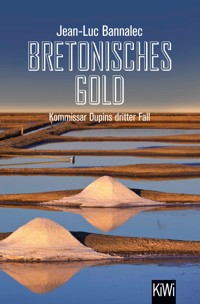10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Mord in der idyllischen Bretagne – Kommissar Dupin ermittelt in seinem ersten Fall voller Geheimnisse und Überraschungen! In Bretonische Verhältnisse, dem ersten Band der Krimi-Reihe von Jean-Luc Bannalec, wird der hochbetagte Inhaber des legendären Hotels Central in Pont Aven brutal erstochen. Kommissar Dupin, der eigensinnige Pinguinliebhaber und Kaffee-Junkie, muss sich in seinem ersten Fall in der Bretagne nicht nur mit verschlossenen Dorfbewohnern und kapriziösen Künstlern herumschlagen, sondern auch einem Geheimnis auf die Spur kommen, das weitreichende Konsequenzen hat. Als kurz darauf eine zweite Leiche an der bretonischen Küste gefunden wird, wird Dupin klar, dass er es mit einem Fall ungeahnten Ausmaßes zu tun hat. Während der Druck von allen Seiten steigt, begibt sich der Kommissar auf die Suche nach dem Motiv hinter den Morden – und stößt dabei auf eine tragische Familiengeschichte und verborgene Geheimnisse in der malerischen Künstlerenklave. Ein Muss für alle Fans von spannenden Cosy Crime und französischem Flair! Jean-Luc Bannalec liefert mit seinen Wohlfühlkrimis um Kommissar Dupin aus der Bretagne die perfekte Urlaubslektüre: Mit feinsinnigem Humor und einem Gespür für das Lokalkolorit entführt Bannalec die Leser in die einzigartige Bretagne, wo man die salzige Atlantikluft förmlich riechen kann. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Verhältnisse
Ein Fall für Kommissar Dupin
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym; der Autor ist in Deutschland und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten acht Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin, »Bretonische Verhältnisse«, »Bretonische Brandung«, »Bretonisches Gold«, »Bretonischer Stolz«, »Bretonische Flut«, »Bretonisches Leuchten«, »Bretonische Geheimnisse« und »Bretonisches Vermächtnis«, wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde Jean-Luc Bannalec von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der erste Fall für Kommissar Dupin, eigensinniger Pinguinliebhaber und koffeinabhängig, gebürtiger Pariser und zwangsversetzt in die Bretagne – ans Ende der Welt. An einem heißen Julimorgen geschieht im pittoresken Künstlerdorf Pont Aven ein mysteriöser Mord: Pierre-Louis Pennec, der hochbetagte Inhaber des legendären Hotels Central, das schon Gauguin und andere große Künstler beherbergte, wird brutal erstochen. Wer ermordet einen 91-Jährigen und warum? Was ist in den letzten Tagen des Hotelbesitzers vorgefallen? Als kurz darauf eine zweite Leiche an der bretonischen Küste aufgefunden wird, realisiert Georges Dupin, dass er es mit einem Fall ungeahnten Ausmaßes zu tun hat. Während sich der Druck von Seiten der Öffentlichkeit verschärft und die kapriziösen Dorfbewohner beharrlich schweigen, kommt Kommissar Dupin im Dickicht der bretonischen Verhältnisse einem spektakulären Geheimnis auf die Spur …
»Und weil ganz dezent das Vorbild des großen Simenon und seines Kommissar Maigret durchscheint, ohne dass dies je aufdringlich würde, liest man das Buch mit doppeltem Vergnügen.« Tilman Spreckelsen, FAZ
»Jean-Luc Bannalec hat mit ›Bretonische Verhältnisse‹ einen wunderbar und leicht zu schmökernden Krimi geschrieben, mit viel Humor und viel regionalem Flair.« Nicole Rodriguez, HR-Online
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2012, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Mathias Bothor/photoselection
Kartografie: Birgit Schroeter, Köln
ISBN978-3-462-30528-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karte-zu-bretonische-verhaeltnisse
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
»Une mer calme n’a jamais fait un bon marin.«
»Eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervorgebracht.«
Bretonisches Sprichwort
à L.
Der erste Tag
Es war ein fabelhafter Sommertag, dieser 7. Juli. Einer dieser großen atlantischen Tage, die Kommissar Dupin für gewöhnlich ganz glücklich machten. Das Blau schien überall zu sein, die Luft war, für bretonische Verhältnisse, sehr warm, schon so früh morgens, und dabei ganz luzid; die Dinge besaßen eine klare, scharfe Gegenwart. Gestern Abend noch hatte es nach Weltuntergang ausgesehen, schwere, tief hängende, drohend schwarze Wolkenungetüme waren den Himmel entlanggerast und hatten es in heftigen Böen wieder und wieder sintflutartig regnen lassen.
Concarneau, die prächtige »Blaue Stadt«, wie sie ob der leuchtend blauen Fischernetze, die im letzten Jahrhundert die Quais gesäumt hatten, noch heute hieß, strahlte. Kommissar Georges Dupin saß im Amiral, ganz am Ende der Bar, wie immer die Zeitung vor sich ausgebreitet. Die runde Uhr über dem schönen alten Gebäude der Markthalle, wo man täglich fangfrisch kaufen konnte, was den hiesigen Fischern in den sehr frühen Morgenstunden ins Netz gegangen war, zeigte 7 Uhr 30. Das traditionsreiche Café und Restaurant, das früher auch ein Hotel gewesen war, lag direkt am Quai, gegenüber der berühmten Altstadt. Die von mächtigen Mauern und Wehrtürmen geschützte ville close war auf einer kleinen, lang gestreckten Insel gebaut worden, die wie gemalt in dem großen Hafenbecken lag, in das der träge Moros mündete. Seit Dupin vor zwei Jahren und sieben Monaten infolge »bestimmter Querelen« – so hatte es in den internen Papieren geheißen – aus Paris in die entlegenste Provinz »versetzt« worden war (und sein ganzes Leben zuvor in der glamourösen Hauptstadt verbracht hatte), trank er jeden Morgen seinen petit café im Amiral; ein ebenso strenges wie lustvolles Ritual.
Charme besaßen die Räume des Amiral keinen mehr, seitdem man sie vor ein paar Jahren mit großem Aufwand von Grund auf renoviert oder, wie Paul Girard, der leutselige Besitzer, stolz formulierte, »vollständig modernisiert« hatte. Wenig erinnerte noch an die großen Zeiten Ende des 19. Jahrhunderts, als weltberühmte Künstler oder später dann Maigret hier logierten. Gauguin hatte sich direkt vor dem Restaurant eine derbe Prügelei geliefert, rüde Seeleute hatten seine blutjunge javanesische Freundin beleidigt. Nur selten verirrten sich Touristen ins Amiral, sie bevorzugten die »idyllischeren« Cafés weiter unten am großen Platz. So war man hier weitgehend unter sich.
»Noch einen café. Und ein Croissant.«
Am Blick und an der knappen Geste des Kommissars erkannte Girard, was sein Gast wollte, der eher gemurmelt hatte, als zu sprechen. Es war Dupins dritter café.
»Siebenunddreißig Millionen – haben Sie gesehen, Monsieur le Commissaire, siebenunddreißig Millionen sind jetzt drin.« Girard stand schon an der Espressomaschine, die Dupin jedes Mal aufs Neue beeindruckte, eine von denen, die noch richtige Geräusche machten.
Der Besitzer des Amiral war vielleicht sechzig, hatte einen beeindruckend länglichen Kopf, der vor allem von einem geprägt war: einem riesigen Schnurrbart, der schon lange so strahlend grau geworden war wie die verbliebenen wenigen Haare auf seinem Kopf. Seine Augen waren immer überall, er sah alles. Dupin mochte ihn gut leiden, auch wenn sie nie viel sprachen. Vielleicht deswegen. Girard hatte den Kommissar vom ersten Tag an akzeptiert – was viel hieß hier, generell, aber vor allem, weil Pariser den Bretonen die einzig wirklichen Ausländer waren.
»Verdammt.«
Dupin fiel ein, dass er unbedingt noch tippen wollte. Der gigantische Lotto-Jackpot, der die ganze Nation in Atem hielt, war auch letzte Woche nicht geknackt worden. Dupin hatte mutig zwölf Reihen getippt und es fertiggebracht, in zwei – unterschiedlichen – Kästen jeweils eine Richtige zu haben.
»Heute ist schon Freitag, Monsieur le Commissaire.«
»Ich weiß. Ich weiß.«
Er würde gleich zum Tabac-Presse nebenan gehen.
»Letzte Woche sind Freitagmorgen überall die Scheine ausgegangen.«
»Ich weiß.«
Dupin hatte – wie die ganzen letzten Wochen – miserabel geschlafen, er versuchte sich auf die Zeitung zu konzentrieren. Im Juni hatte das nördliche Finistère traurige 62 Prozent der Sonnenstunden abbekommen, die ein durchschnittlicher Juni normalerweise bot – 145. Das südliche Finistère hatte es auf 70 Prozent gebracht, das angrenzende Morbihan, lediglich ein paar Kilometer entfernt, auf immerhin 82 Prozent. Der Artikel war der Aufmacher des Ouest-France. Erstaunliche Statistiken über das Wetter waren eine Spezialität der Zeitung – eigentlich aller bretonischen Zeitungen und überhaupt aller Bretonen. »Seit Jahrzehnten«, das war die dramatische Quintessenz, »hat uns kein Juni mit so niederschmetternd wenig Sonnenstunden und Wärme zurückgelassen.« Wieder einmal. Und der Artikel endete, wie er enden musste: »So ist es: In der Bretagne ist das Wetter schön – fünf Mal am Tag«; eine Art patriotisches Mantra. Nur die Bretonen selbst durften indes über das bretonische Wetter schimpfen oder lachen; wenn es andere taten, wurde es als sehr unhöflich empfunden. Das verhielt sich, wie Dupin in den nun fast drei Jahren hier gelernt hatte, mit allem »Bretonischen« so.
Der penetrante Ton seines Mobiltelefons schreckte den Kommissar auf. Er hasste das, jedes Mal. Es war Kadegs Nummer. Einer seiner beiden Inspektoren. Dupins Laune verdüsterte sich. Er ließ es klingeln. Er würde ihn in einer halben Stunde im Kommissariat sehen. Dupin fand Kadeg kleingeistig, unerträglich emsig, devot, dabei von einem hässlichen Ehrgeiz getrieben. Kadeg war Mitte dreißig, eher untersetzt, hatte ein rundes Babygesicht, ein wenig abstehende Ohren, eine Halbglatze, die ihm außerdem nicht stand – und fand sich unwiderstehlich. Er war Dupin gleich am Anfang zugeteilt worden, und der Kommissar hatte einiges unternommen, um ihn loszuwerden. Er war dabei ziemlich weit gegangen, ohne Erfolg.
Das Handy klingelte ein zweites Mal. Immer machte er sich wichtig. Ein drittes Mal. Dupin merkte, dass er doch etwas unruhig wurde.
»Ja?«
»Monsieur le Commissaire? Sind Sie es?«
»Wen erwarten Sie an meinem Telefon?«, blaffte Dupin.
»Präfekt Locmariaquer hat angerufen, gerade eben. Sie müssen ihn vertreten. Heute Abend, das Freundschafts-Komitee aus Staten Stoud in Kanada.«
Der süßliche Tonfall Kadegs war widerlich.
»Wie Sie wissen, ist Präfekt Locmariaquer Ehrenvorsitzender unseres Komitees. Heute Abend wird die offizielle Delegation, die sich für eine Woche in Frankreich aufhält, Ehrengast auf der Bretonnade in Trégunc Plage sein. Der Präfekt hat nun unvorhergesehenerweise in Brest zu tun und bittet Sie, an seiner Stelle die Delegation und ihren ersten Vorsitzenden, Docteur de la Croix, zu begrüßen. Trégunc ist ja unser Terrain.«
»Was?«
Dupin hatte keine Ahnung, wovon Kadeg sprach.
»Staten Stoud ist die Partnerstadt von Concarneau, in der Nähe von Montreal, der Präfekt hat entfernte Verwandte dort, die …«
»Es ist Viertel vor acht, Kadeg. Ich frühstücke.«
»Es ist dem Präfekten sehr wichtig, er hat ausschließlich deswegen angerufen. Und er hat mich gebeten, Sie unverzüglich zu informieren.«
»Zu informieren?«
Dupin legte auf. Er hatte keine Lust, sich auch nur einen Augenblick mit dieser Sache zu beschäftigen. Gott sei Dank war er zu müde, um sich wirklich aufzuregen. Dupin konnte Locmariaquer nicht ausstehen. Und außerdem hatte er bis heute keine rechte Idee davon, wie er diesen Namen auszusprechen hatte, was ihm zugegebenermaßen bei nicht wenigen Bretonen so ging und ihn, der in seinem Beruf nun einmal viel mit Menschen zu tun hatte, nicht selten in peinliche Situationen brachte.
Dupin wendete sich wieder der Zeitung zu. Der Ouest-France und der Télégramme, das waren die beiden großen Lokalzeitungen, die sich auf zuweilen kurios liebevoll-stolze Weise der Bretagne widmeten; nach einer Seite sehr summarischer internationaler und nationaler Nachrichten, die zügig das Weltgeschehen abhandelten, folgten dreißig Seiten regionaler und lokaler, meist sehr lokaler Meldungen. Kommissar Dupin liebte beide Blätter. Nach seiner »Versetzung« hatte er, zunächst widerwillig, dann mit wachsendem Interesse seine Studien der bretonischen Seele begonnen. Neben den Begegnungen mit den Menschen waren es genau diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Geschichten, durch die er am meisten erfahren hatte. Geschichten über das Leben am »Ende der Welt«, dem »finis terra« – wie die Römer den äußersten Teil der weit in den tosenden Atlantik hineingestreckten, wild zerklüfteten Halbinsel genannt hatten und wie das Département bis heute hieß.
Das Telefon klingelte wieder. Wieder Kadeg. Dupin merkte, wie trotz aller Müdigkeit Wut in ihm aufstieg.
»Ich werde heute Abend nicht können, ich habe zu tun, dienstliche Verpflichtungen, richten Sie das Loccarm – richten Sie das dem Präfekten aus.«
»Ein Mord. Es gab einen Mord.«
Kadegs Stimme war dünn und ohne Intonation.
»Was?«
»In Pont Aven, Monsieur le Commissaire. Pierre-Louis Pennec, der Besitzer des Hotel Central, wurde vor wenigen Minuten tot in seinem Restaurant aufgefunden. Man hat die Wache in Pont Aven angerufen.«
»Ist das ein Witz, Kadeg?«
»Die beiden Kollegen aus Pont Aven müssten schon da sein.«
»In Pont Aven? Pierre-Louis Pennec?«
»Wie meinen Sie, Monsieur le Commissaire?«
»Was wissen Sie noch?«
»Nur das, was ich Ihnen gerade gesagt habe.«
»Und es ist sicher ein Mord?«
»Es sieht wohl so aus.«
»Warum?«
Dupin hatte sich über diese Frage fast schon geärgert, bevor sie ihm über die Lippen gekommen war.
»Ich kann Ihnen nur sagen, was der Anrufer, der Koch des Hotels, dem diensthabenden Polizisten gesagt hat, und der wiederum …«
»Ist schon gut. Aber was haben wir mit der Sache zu tun? Pont Aven fällt in den Zuständigkeitsbereich Quimperlés – das ist Dercaps Angelegenheit.«
»Kommissar Dercap ist seit Montag im Urlaub. Bei ernsteren Vorkommnissen sind wir zuständig. Deswegen hat die Wache in Pont Aven …«
»Ja, ja … Ich mache mich auf. Sie auch. Und rufen Sie Riwal an, ich will, dass er umgehend kommt.«
»Riwal ist schon unterwegs.«
»Gut. – Das darf nicht wahr sein. So ein Scheiß.«
»Monsieur le Commissaire?«
Dupin legte auf.
»Ich muss los«, rief er in Girards Richtung, der neugierig guckte. Dupin legte ein paar Münzen auf den Tresen und verließ das Amiral. Sein Wagen stand auf dem großen Parkplatz am Quai, nur ein paar Schritte entfernt.
»Absurd«, dachte Dupin, als er im Wagen saß, »das ist vollkommen absurd.« Ein Mord in Pont Aven. Im Hochsommer, kurz vor der Saison, die den Ort zu einem großen Freilichtmuseum werden ließ, wie man in Concarneau spottete. Pont Aven war die reine Idylle. Der letzte Mord in dem pittoresken – für Dupins Geschmack viel zu pittoresken – Dorf, das Ende des 19. Jahrhunderts durch seine Künstlerkolonie, vor allem natürlich durch Paul Gauguin, ihr prominentestes Mitglied, weltweit berühmt geworden war und sich nun in jedem Reiseführer Frankreichs und jeder Geschichte der modernen Kunst wiederfand, musste Ewigkeiten zurückliegen. Und dazu: der hochbetagte Pierre-Louis Pennec – ein legendärer Hotelier, eine Institution – ganz so wie es sein Vater und vor allem natürlich seine Großmutter gewesen waren, die berühmte Gründerin des Central, Marie-Jeanne Pennec.
Dupin fingerte an den aberwitzig winzigen Tasten seines Autotelefons herum, er hasste das.
»Wo sind Sie, Nolwenn?«
»Auf dem Weg ins Kommissariat. Kadeg hat gerade angerufen. Ich bin im Bilde. Sie wollen sicher Docteur Lafond.«
»So schnell es geht.«
Seit einem Jahr gab es einen zweiten Gerichtsmediziner in Quimper, den Dupin nicht ertragen konnte, Ewen Savoir, ein linkischer junger Schnösel. Mit beeindruckender technischer und technologischer Ausrüstung, aber dumm. Und furchtbar umständlich. Zwar konnte Dupin nicht gerade behaupten, dass er den alten brummigen Docteur Lafond mochte; auch er und Lafond gerieten sich zuweilen in die Haare, wenn es Dupin nicht schnell genug ging, und dann schimpfte Lafond wie ein Rohrspatz, doch er leistete einfach großartige Arbeit.
»Savoir macht mich vollkommen wahnsinnig.«
»Ich kümmere mich um alles.«
Dupin liebte diesen Satz aus Nolwenns Mund. Sie war schon die Sekretärin seines Vorgängers und Vorvorgängers gewesen. Sie war großartig. Patent. Unendlich patent.
»Gut. Ich bin am letzten Kreisel von Concarneau. In zehn Minuten bin ich da.«
»Monsieur le Commissaire, das klingt nach einer schlimmen Sache. Unfassbar. Ich kannte den alten Pennec. Mein Mann hat einmal ein paar Dinge für ihn gemacht. Vor vielen Jahren.«
Dupin lag es kurz auf der Zunge, zu fragen, was für »ein paar Dinge« dies gewesen waren, aber er ließ es. Es gab Wichtigeres. Er hatte bis heute nicht genau verstanden, was der Beruf von Nolwenns Mann war. Er schien unbestimmt universell zu sein. Für alle möglichen Leute machte er immer wieder »ein paar Dinge«.
»Ja. Das wird einen riesigen Rummel geben. Eine Ikone des Finistère. Der Bretagne. Frankreichs. Mon Dieu … Ich melde mich wieder.«
»Tun Sie das. Ich stehe schon vor dem Kommissariat.«
»Bis gleich.«
Dupin fuhr schnell; viel zu schnell für die schmalen Straßen. Es war nicht zu fassen, zum ersten Mal seit zehn Jahren hatte der alte Dercap Ferien. Zehn Tage war er weg. Seine Tochter heiratete; auf La Réunion – was auch Dercap für eine ganz und gar blödsinnige Idee gehalten hatte, der Bräutigam kam aus demselben verschlafenen Kaff wie sie, drei Kilometer von Pont Aven entfernt.
Dupin nestelte wieder an den Tasten der Telefonanlage herum.
»Riwal?«
»Monsieur le Commissaire.«
»Sind Sie schon da?«
»Ja. Gerade angekommen.«
»Wo liegt der Tote?«
»Unten im Restaurant.«
»Waren Sie schon dort?«
»Nein.«
»Lassen Sie niemanden rein. Niemand geht da rein, bevor ich da bin. Auch Sie nicht. Wer hat Pennec gefunden?«
»Francine Lajoux. Eine Angestellte.«
»Was hat sie gesagt?«
»Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Ich bin wirklich gerade erst angekommen.«
»Gut. Ja. Ich bin sofort da.«
Die Blutlache kam Kommissar Dupin ungeheuer groß vor, sie hatte sich unförmig ausgebreitet, den Unebenheiten des Steinbodens folgend. Pierre-Louis Pennec war ein hochgewachsener Mann, dünn, sehnig. Graue, kurze Haare. Eine stolze Gestalt, noch mit seinen einundneunzig Jahren. Seine Leiche lag merkwürdig verrenkt auf dem Rücken, die linke Hand fasste in die Kniekehle, die Hüfte war stark verschoben, die rechte Hand lag auf dem Herzen, das Gesicht war auf entsetzliche Weise verzerrt. Die offenen Augen starrten zur Decke. Er hatte ganz offensichtlich mehrere Wunden, am Oberkörper, am Hals.
»Jemand hat Pierre-Louis Pennec übel zugerichtet. Einen alten Mann. Wer tut so was?«
Riwal stand zwei Meter hinter Dupin, sie waren allein. In seiner Stimme lag Entsetzen. Dupin schwieg. Es stimmte, was Riwal sagte. Dupin hatte einige Mordopfer gesehen. Das hier war in der Tat ein brutaler Mord.
»So ein Scheiß!« Dupin fuhr sich heftig durch die Haare.
»Vermutlich Messerstiche. Aber von der Tatwaffe ist nichts zu sehen.«
»Immer mit der Ruhe, Riwal.«
»Zwei Kollegen aus Pont Aven sichern das Hotel, Monsieur le Commissaire. Ich kenne einen davon, Albin Bonnec. Der ist schon länger dabei. Ein sehr guter Polizist. Der andere heißt Arzhvaelig. Den Vornamen konnte ich mir nicht merken. Noch ein sehr junger Kollege.«
Dupin musste unwillkürlich lächeln. Riwal war selbst noch jung, Anfang dreißig, erst in seinem zweiten Jahr als Inspektor. Er war genau. Schnell. Klug. Obwohl er immer etwas behäbig wirkte und auch so sprach. Er hatte manchmal einen spitzbübischen Ausdruck im Gesicht, den Dupin mochte. Und er machte nie Aufhebens um sich.
»Es war noch niemand im Raum?«
Dupin hatte die Frage schon drei Mal gestellt, was Riwal indes kein bisschen irritierte.
»Niemand. Aber der Gerichtsmediziner und die Spurensicherung müssen bald hier sein.«
Dupin hatte verstanden. Riwal wusste, dass der Kommissar es mochte, sich in Ruhe umzusehen, bevor die ganze Meute anrückte.
Pennec lag in der hintersten Ecke, direkt vor der Bar. Der Raum war L-förmig, im lang gestreckten, vorderen Teil das Restaurant, im hinteren, abgeknickten Teil die Bar. Vom Restaurant kam man durch einen kleinen Flur in die Küche, die sich in einem Anbau hinter dem Haus befand. Die Tür war verschlossen.
Die Hocker vor dem Tresen der Bar standen ordentlich aufgereiht, nur einer ein Stück nach hinten versetzt. Ein einzelnes Glas stand auf dem Tresen. Und eine Flasche Lambig, der Apfelschnaps der Bretonen, auf den sie sehr stolz waren – wie sie auf alles genuin Bretonische oder das, was sie dafür hielten, auf sehr intensive Weise stolz waren. Dupin trank ihn auch gern. Das Glas war fast leer. Keinerlei Anzeichen eines Kampfes, es war nicht die kleinste Auffälligkeit in diesem Teil des Raums auszumachen, ganz offensichtlich war er noch am Abend von den Hotelangestellten sorgsam aufgeräumt und gereinigt worden. So wie das ganze Restaurant. Die Tische und Stühle standen in penibler Anordnung, es war schon eingedeckt, ländlich-rustikale, bunte Tischdecken, der Boden blitzsauber. Das Restaurant und die Bar mussten vor nicht allzu langer Zeit renoviert worden sein, alles sah neu aus. Und war gut isoliert, nichts war von draußen zu hören, gar nichts. Nicht von der Straße, obgleich es drei Fenster gab, nicht aus dem Vorraum, der gleichzeitig der Eingangsbereich des Hotels war. Die Fenster waren fest verschlossen, Dupin hatte sie sich genau angesehen.
Die gewissenhafte Ordnung und Sauberkeit – die ganze Normalität des Raums bot einen unheimlichen Widerspruch zu dem grausigen Bild, das die Leiche abgab. An den weiß getünchten Wänden hingen wie überall im Ort die obligatorischen Gemäldekopien aus der großen Künstlerkoloniezeit Ende des 19. Jahrhunderts. Noch in den kleinsten Cafés und Geschäften des Ortes konnte man sie bewundern. Pont Aven schien damit tapeziert.
Dupin ging ein paarmal sehr langsam durch den ganzen Raum, ohne etwas Bestimmtes zu suchen. Er fand auch nichts. Ein wenig ungelenk holte er sein kleines rotes Notizheft aus seiner Hosentasche und kritzelte, eher planlos, ein paar Dinge auf die Seiten.
Jemand versuchte unsacht die Tür zu öffnen, die Dupin von innen verschlossen hatte, und klopfte dann lautstark. Dupin hatte Lust, es zu ignorieren, protestierte aber nicht, als Riwal ihn fragend ansah und dann Richtung Tür ging. Mit Lärm schlug die Tür auf. Reglas war mit einem Satz im Raum und Kadegs beflissene Stimme verkündete: »Docteur Lafond ist da. Und die Spurensicherung, René Reglas und seine Leute.«
Dupin seufzte tief. Immer vergaß er Reglas. Die »Tatortarbeit«. René Reglas, der größte Forensiker der Welt. Er war mit drei Leuten angerückt, sie schlichen schweigend neben ihm her. Docteur Lafond trat als Letzter ein und steuerte geradewegs auf die Leiche zu. Kaum vernehmlich brummte er ein »Bonjour M’sieur« in Richtung Dupin. Es klang nicht unfreundlich.
Reglas wandte sich forsch an Kadeg und Riwal.
»Meine Herren, ich darf Sie bitten, den Raum zu verlassen, bis unsere Arbeit hier getan ist. Lediglich der Commissaire, Docteur Lafond, ich und mein Team haben solange Zutritt zum Restaurant. Wenn Sie das sicherstellen würden? Bonjour Monsieur le Commissaire, Bonjour Monsieur le Docteur.«
Dupin hatte große Schwierigkeiten, seinen Affekt in den Griff zu bekommen. Er sagte kein Wort. Die beiden Männer hatten immer schon wenig Sympathie füreinander empfunden.
»Docteur Lafond, wenn auch Sie bitte äußerst umsichtig sein würden und keine neuen Spuren setzen. Danke.«
Reglas hatte seine dicke Kamera gezückt.
»Meine Kollegen beginnen sofort mit den daktyloskopischen Arbeiten. Lagrange – hier, ich will zunächst mögliche Fingerabdrücke von der Bar, dem Glas, der Flasche, von allem nahe der Leiche. Systematisch.«
Lafond stellte in aller Seelenruhe seine Tasche auf einem der Tische nahe der Bar ab, ihm war nicht anzumerken, ob er Reglas’ Sätze überhaupt gehört hatte.
Dupin ging zur Tür. Er musste hier raus. Er verließ den Raum, ohne ein Wort zu sagen.
Mittlerweile ging es etwas lauter zu im Eingangsbereich des Hotels, wo sich auch die kleine Rezeption befand. Ohne Zweifel hatte sich die Nachricht herumzusprechen begonnen, im Hotel, im ganzen Dorf. An der Rezeption standen einige Gäste, und es wurde heftig durcheinandergeredet, hinter dem gedrängten Tresen stand eine kurzhaarige, etwas hagere kleine Frau mit einer verhältnismäßig großen, scharfkantigen Nase, die mit fester Stimme sprach. Sie war sehr bemüht, Ruhe zu demonstrieren.
»Nein, nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden das alles regeln.«
Ein Mord in dem Hotel, in dem man die schönsten Wochen des Jahres verbringen wollte; Dupin verstand die Unruhe der Gäste, aber die Frau tat ihm auch leid. Sie befanden sich kurz vor der Hochsaison, das Hotel war zur Hälfte ausgebucht, hatte Riwal gesagt. Sechsundzwanzig Gäste waren schon da, vier davon Kinder, die meisten Ausländer; zu dieser Zeit reisten noch wenige Franzosen. Erst in einer Woche würde der Rummel richtig losgehen. Dennoch, auch wenn das Hotel nicht ganz belegt war – die Gäste, die da waren, gingen ein und aus, auch abends und nachts. Wer unter diesen Umständen einen Mord beging, musste damit rechnen, dass jemand etwas mitbekommen würde – dass er gesehen würde, wenn er zum Beispiel durch den Vorraum das Hotel verließ. Oder dass jemand etwas von dem Gerangel hören würde, einen Hilferuf, den Schrei des um sein Leben ringenden Pennec. Auch hatte sich in der Nacht bestimmt noch Personal im Hotel aufgehalten. Hier einen Mord zu begehen war riskant.
Riwal kam die Treppe herunter. Er sah den Kommissar fragend an.
»So ist es, Riwal. Jetzt gehört der Tatort den Profis.«
Riwal setzte an, etwas zu sagen, ließ es aber. Dupin hatte ihm das Fragen nach seinem Vorgehen und seinen Plänen abgewöhnt. Das war das Einzige, das ihn gestört hatte an Riwal, und manchmal kam es noch durch. Riwal wollte immer Dupins Methode verstehen.
»Wo sind die Polizisten von hier? Die Rezeption muss verlegt werden. Ich will den Raum leer haben.«
»Kadeg hat sie mit hochgenommen. Er wollte die Befragung der Gäste zur letzten Nacht beginnen.«
»Ich möchte, dass nur noch Gäste und Personal das Hotel betreten und verlassen können. Jemand soll den Eingangsbereich regeln. Nicht Sie. Jemand von der örtlichen Polizei. Sie sagten, eine Angestellte hat Pennec gefunden?«
»Ja, Francine Lajoux. Sie ist schon über vierzig Jahre hier. Sie sitzt oben im Frühstücksraum, ein Zimmermädchen ist bei ihr. Sie steht unter Schock. Wir haben einen Arzt gerufen.«
»Ich will mit ihr sprechen.« Dupin zögerte kurz, ganz unbestimmt, und holte sein Notizheft heraus.
»Es ist jetzt 9 Uhr 05. Um 7 Uhr 47 hat Kadeg angerufen. Da war er gerade informiert worden von den Kollegen in Pont Aven. Die hatten einen Anruf von hier aus dem Hotel bekommen. Madame Lajoux wird Pierre-Louis Pennec gegen 7 Uhr 30 gefunden haben. Das ist nicht einmal zwei Stunden her. Bisher wissen wir gar nichts.«
Riwal konnte sich nicht vorstellen, dass der Kommissar dies so notierte, auch wenn allgemein bekannt war, dass Dupin eine, wie sollte man sagen – sehr eigenwillige Art des Sich-Notizen-Machens hatte.
»Pierre-Louis Pennec hat einen Sohn, Loic. Es gibt auch einen Bruder, einen Halbbruder. Er lebt in Toulon. Die Angehörigen sollten bald benachrichtigt werden, Monsieur le Commissaire.«
»Ein Sohn? Wo lebt er?«
»Hier in Pont Aven, unten am Hafen, mit seiner Frau Catherine. Keine Kinder.«
»Ich gehe sofort zu ihm. Aber davor werde ich mit Madame Lajoux sprechen.«
Riwal wusste, dass es keinen Sinn machte, zu widersprechen; er kannte den Kommissar, wenn er in einem »echten Fall« war. Und das hier war ein echter Fall.
»Ich besorge Ihnen die genaue Adresse von Loic Pennec. Und die Rufnummer von seinem Halbbruder. Er ist ein bekannter Politiker im Süden, André Pennec, seit zwei Jahrzehnten im Parlament für die Konservativen.«
»Ist er zurzeit hier? Ich meine, hier in der Region?«
»Nein. Nicht soweit wir wissen.«
»Gut. Ich rufe ihn später an. Sonst keine Familie?«
»Nein.«
»Lassen Sie sich von Reglas alles erzählen, wenn er fertig ist. Und Lafond soll mich anrufen. Auch wenn er sagt, dass er sich zu nichts äußern wird vor Abschluss seines Berichts.«
»Gut.«
»Und ich will Dercap sprechen. Jemand soll sofort versuchen, ihn zu erreichen.«
Dercap kannte Pont Aven sicher in- und auswendig. Sein Wissen wäre hilfreich. Und eigentlich war es ja auch sein Fall.
»Ich glaube, Bonnec ist schon dabei.«
»Was macht der Sohn? Arbeitet er auch im Hotel?«
»Nein, wohl nicht. Kadeg wusste nur, dass er eine kleine Firma hat.«
»Was für eine Firma?«
»Honig.«
»Honig?«
»Ja, miel de mer. Die Bienenstöcke dürfen höchstens fünfundzwanzig Meter vom Meer entfernt stehen. Der beste Honig der Welt, sagt …«
»Gut. Was Priorität hat, Riwal: Ich will wissen, was Monsieur Pennec in den letzten Tagen und Wochen gemacht hat, so genau es geht. Tag für Tag. Ich möchte, dass alles genauestens festgehalten wird. Alles, auch das Alltägliche. Seine Rituale, seine Gewohnheiten.«
Einer der Gäste an der Rezeption wurde plötzlich laut.
»Wir werden unser gesamtes Geld zurückerhalten. Wir werden das nicht hinnehmen.« Ein unangenehmer Wicht, untersetzt, schmierig. Seine Frau schaute ihn ergeben an.
»Wir werden jetzt auf der Stelle abreisen – genau das werden wir tun.«
»Ich denke, Sie werden jetzt nicht abreisen, Monsieur. Niemand wird abreisen.«
Wutschnaubend drehte sich der Mann zu Dupin um. Im nächsten Moment würde er losbrüllen.
»Commissaire Dupin. Commissariat de Police Concarneau. Sie werden sich wie alle Gäste zunächst einer polizeilichen Befragung unterziehen.«
Dupin hatte seinen Satz sehr leise gesprochen. Zischend. Dies und sein imposanter Körperbau taten ihre Wirkung. Umgehend trat der kleine Mann einige Schritte zurück.
»Inspektor Riwal«, Dupin sprach jetzt laut und formal, »die Polizisten werden Monsieur«, er stoppte und blickte den Mann auffordernd an, der kleinlaut »Galvani« stammelte, »die Polizisten werden Monsieur Galvani und seine Frau zu letzter Nacht befragen. Eingehend. Die Personalien aufnehmen, eine Identifikation vornehmen.«
Dupin war hochgewachsen, kräftig, massig, mit Schultern, die einen mächtigen Schatten warfen. Er machte einen, sagten böse Zungen, eher grobschlächtigen Eindruck; so rechnete auch niemand mit der geschickten Schnelligkeit und feinen Präzision, zu der er ansatzlos fähig war. Sicher, wie ein Kommissar sah er nicht aus, noch weniger in seinen Jeans und Poloshirts, die er fast immer trug – und auch diese Irritation machte sich Dupin gerne zunutze.
Monsieur Galvani stammelte etwas, das aber nicht mehr zu verstehen war, und suchte Schutz bei seiner Frau, die bestimmt einen Kopf größer war als er. Dupin drehte sich zur Seite und sah, wie die Hotelangestellte ihn verstohlen anlächelte. Er lächelte zurück. Dann wandte er sich wieder Riwal zu, der etwas verlegen dreinblickte.
»Rekonstruieren Sie mit Kadeg vor allem den gestrigen Tag und Abend so genau wie möglich. Was hat Pennec gemacht? Wo war er wann? Wer hat ihn zuletzt gesehen?«
»Wir sind dabei. Der Koch hat ihn wohl zuletzt gesehen.«
»Gut. Welche Angestellten sind heute Morgen im Hotel?«
Riwal zog ein sehr kleines, schwarzes Notizbüchlein hervor. »Mademoiselle Kann und Mademoiselle Denoelalig, beide sehr jung, Zimmermädchen, und Madame Mendu, die, wenn ich es richtig verstehe, eine Art Nachfolgerin von Madame Lajoux werden soll. Sie ist auch für das Frühstück zuständig. Madame Mendu steht hier vorne.«
Riwal deutete mit dem Kopf dezent Richtung Rezeption.
»Dann Madame Lajoux und der Koch, Edouard Glavinec. Und ein Gehilfe von ihm.«
Dupin notierte sich alles.
»Der Koch? Um diese Uhrzeit der Koch?«
»Sie holen jeden Morgen sehr früh die Sachen vom Großmarkt in Quimper.«
»Wie heißt der Küchenjunge?«
Riwal blätterte in seinem Büchlein.
»Ronan Breton.«
»Breton? Er heißt Breton?«
»Breton.«
Dupin wollte etwas dazu sagen, ließ es aber.
»Und der Koch hat Pennec als Letzter lebend gesehen?«
»Bisher scheint es so.«
»Ich will ihn sprechen, sobald ich mit Madame Lajoux fertig bin. Kurz.« Dupin wandte sich ab und stieg die Treppen hoch. Ohne sich umzudrehen rief er: »Wo im ersten Stock?«
»Direkt rechts, die erste Tür.«
Dupin klopfte sachte an die Tür des Frühstücksraums und trat ein. Francine Lajoux war älter, als Dupin sie sich vorgestellt hatte, über siebzig sicher, die Haare ganz grau, ein spitzes Gesicht mit tiefen Falten. Sie saß in der äußersten Ecke des Raums, neben ihr ein rothaariges, üppiges Zimmermädchen, klein, mit einem etwas feisten, aber hübschen Gesicht – Mademoiselle Kann, die dem Kommissar sehr freundlich und erleichtert zulächelte. Madame Lajoux schien das Eintreten des Kommissars zunächst gar nicht zu bemerken, sie starrte bewegungslos auf den Boden.
Dupin räusperte sich.
»Bonjour Madame, mein Name ist Dupin, ich bin der zuständige Kommissar. Man sagte mir, dass Sie es waren, die die Leiche von Pierre-Louis Pennec heute Morgen im Restaurant gefunden haben.«
Madame Lajoux’ Augen waren verweint, die Wimperntusche verlaufen. Es dauerte einen Augenblick, dann schaute sie den Kommissar an.
»Ein abscheulicher Mord, nicht wahr, Monsieur le Commissaire? Das ist ein abscheulicher Mord. Ein kaltblütiger Mord. Seit siebenunddreißig Jahren bin ich treu in Monsieur Pennecs Diensten. Nicht einen Tag war ich krank. Höchstens zwei Mal … Er sieht schlimm zugerichtet aus, nicht wahr? Der Mörder muss mit einem großen Messer zugestochen haben. Ich hoffe, Sie fassen ihn schnell.«
Sie sprach nicht hastig, aber doch in eindrucksvollem Tempo, ohne Pausen, mit schnell wechselnden Intonationen.
»Der arme Monsieur Pennec. So ein wunderbarer Mann. Wer kann so etwas Grausames getan haben? Alle haben ihn gemocht, Monsieur le Commissaire. Alle. Alle haben ihn geschätzt – geschätzt und bewundert. Und das – das in unserem schönen Pont Aven. Entsetzlich. Einem so friedlichen Ort. Die Blutlache war so groß. Ist das normal, Monsieur le Commissaire?«
Dupin wusste nicht, was er antworten sollte. Und worauf er antworten sollte. Eher schwunglos holte er sein Heft hervor und schrieb etwas auf. Es entstand eine merkwürdige Pause. Mademoiselle Kann lugte verstohlen nach dem Heft.
»Entschuldigen Sie, ich weiß, dass es schrecklich für Sie sein muss, sich das wieder in Erinnerung zu rufen, aber könnten Sie mir davon erzählen, wie Sie die Leiche gefunden haben? War die Tür offen? Waren Sie allein?«
Ihm war klar, dass dies keine besonders mitfühlende Reaktion war.
»Ich war ganz alleine. Ist das wichtig, ja? Die Tür war zu, aber nicht abgeschlossen. Und das ist sie sonst immer. Ja. Monsieur Pennec schließt sie ab, wenn er nachts geht. Da habe ich mir schon gedacht, dass etwas nicht stimmt. Ich glaube, es war Viertel nach sieben. Ungefähr. Wissen Sie, ich mache jeden Morgen das Frühstück. Seit siebenunddreißig Jahren bin ich jeden Morgen um sechs Uhr hier. Seit siebenunddreißig Jahren. Pünktlich um sechs Uhr. Es fehlten die kleinen Löffel. Beim Frühstück hier. Wissen Sie, wenn es noch nicht so viele Gäste sind, machen wir nur hier oben Frühstück, in der Hochsaison dann auch im Restaurant. Ich wollte kleine Löffel aus dem Restaurant holen. Sie fehlen häufig, das muss man ändern. Das sage ich die ganze Zeit! Ich muss noch mal mit Madame Mendu sprechen. – Ich habe nichts Besonderes gesehen, unten im Restaurant, nur die Leiche. Der arme Monsieur Pennec. Wissen Sie, warum niemand etwas gehört hat gestern Nacht? Wegen des großen Festes. Es war überall so laut, im ganzen Ort, das ist immer so, wenn hier gefeiert wird. Es geht sehr ausgelassen zu. Ich habe vor drei Uhr kein Auge zugetan. Ja, ich war alleine. Dann habe ich geschrien. Und Mademoiselle Kann ist gekommen. Sie hat mich hierhin gebracht. Sie ist eine gute Seele, Monsieur le Commissaire. Es ist so schlimm.«
»Sie haben also weder gestern noch in den letzten Tagen irgendetwas Ungewöhnliches wahrgenommen? An Monsieur Pennec, hier im Hotel? Denken Sie darüber nach. Der kleinste Umstand kann von Belang sein. Etwas, das Ihnen vielleicht ganz unbedeutend vorkommt.«
»Es war alles wie immer. In bester Ordnung. Darauf legte Monsieur Pennec großen Wert.«
»Gar nichts also.«
Madame Lajoux machte eine resignierte Armbewegung.
»Nein, gar nichts. Wir haben eben schon alle miteinander gesprochen. Alle Hotelangestellten, die heute da sind, meine ich. Niemandem ist etwas Besonderes aufgefallen.«
»Ganz allgemein – haben Sie eine Idee, was hier vorgefallen sein könnte?«
»Monsieur le Commissaire!«
Sie wirkte tatsächlich empört.
»Sie fragen, als hätte es hier ein kriminelles Geschehen gegeben.«
Dupin lag es auf der Zunge, anzumerken, dass ein Mord ja durchaus als kriminelles Geschehen aufzufassen sei.
»Sie sind es, die von allen Angestellten am längsten in Monsieur Pennecs Diensten standen?«
»Oh ja!«
»Dann kannten Sie Monsieur Pennec am besten von allen hier im Hotel.«
»Natürlich. Ein Haus wie dieses, Monsieur le Commissaire, ist eine Lebensaufgabe. Ein Mandat, wie Pierre-Louis Pennec immer sagte.«
»Ist Ihnen denn im Restaurant und in der Bar etwas aufgefallen? Abgesehen von der Leiche.«
»Nein. Wissen Sie, die Saison beginnt gerade. Es ist immer sehr hektisch in diesen Tagen. Es ist so viel.«
Ihr Gesicht veränderte dramatisch die Züge. Jetzt sprach sie sehr langsam, schleppend, mit gepresster Stimme. »Wissen Sie, es gibt schlimme Gerüchte, man behauptet, wir hätten … wir hätten eine Affäre gehabt, Monsieur Pennec und ich. In den Jahren nach dem tragischen Tod seiner Frau. Ein Unfall auf dem Boot. Ich hoffe, Sie schenken diesen impertinenten Stimmen keinen Glauben, Monsieur le Commissaire. Eine ungeheuerliche Lüge. Nie hätte Monsieur Pennec so etwas getan. Er hat seine Frau über den Tod hinaus geliebt und war ihr treu. Alle Zeit … Nur weil wir uns so nahestanden, freundschaftlich. Menschen haben manchmal eine wüste Fantasie.«
Dupin war ein wenig ratlos.
»Aber natürlich, Madame Lajoux. Aber natürlich.«
Es entstand eine kleine Pause.
»Was war das für ein Unfall?«
Dupin hatte diese Frage ohne eine bestimmte Absicht gestellt.
»Aus heiterem Himmel, eines Tages. Darice Pennec ist bei Sturm über Bord gegangen. In der Dämmerung. Niemand trägt eine Schwimmweste hier, wissen Sie. Sie kamen von den Glénan-Inseln. Kennen Sie das Archipel? Wahrscheinlich nicht, Sie sind ja ganz neu hier, hat man mir gesagt. Es ist wunderschön. Wie im Mittelmeer, manche meinen sogar, wie in der Karibik. Blendend weißer Sand.«
Dupin hätte gerne gesagt, dass er die Glénan natürlich kenne, dass er ja immerhin seit fast drei Jahren hier lebe. Für Bretonen war man, wenn die Familie nicht seit vielen Generationen aus der Bretagne stammte, »ganz neu« hier. Aber er hatte sich irgendwann damit abgefunden und alles Protestieren aufgegeben.
»Wissen Sie, die Stürme kommen so schnell hier. Sie war sofort weg. Das tut das Meer manchmal. Er ist bis zum nächsten Morgen draußen gewesen, um sie zu suchen. Wissen Sie, das ist lange her. Zwanzig Jahre. Sie war achtundfünfzig Jahre alt. Der arme Pennec. Er war fast ohnmächtig vor Erschöpfung, als er im Hafen ankam.«
Dupin beschloss, nicht weiter darauf einzugehen.
»Und Ihnen?« Dupin wandte sich übergangslos an Mademoiselle Kann und kassierte einen entrüsteten Blick von Madame Lajoux. »Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen gestern, heute, in den letzten Tagen? Es geht auch um Kleinigkeiten.«
Das Zimmermädchen war überrascht über die unvermittelte Anrede. Sie blickte etwas ängstlich.
»Mir? Nein. Ich habe sehr viel zu tun gehabt.«
»Wissen Sie, ob heute Morgen nach Madame Lajoux und Ihnen noch jemand ins Restaurant gegangen ist?«
»Nein. Ich habe die Tür abgeschlossen.«
Dupin machte sich eine Notiz.
»Sehr gut. Wann haben Sie beide Monsieur Pennec das letzte Mal gesehen?« Dupin hielt kurz inne. »Ich meine, lebend gesehen?«
»Ich bin gestern um halb acht gegangen. Ich gehe immer um halb acht. Ich meine, seit zehn Jahren. Davor war ich auch die Abende hier, aber das schaffe ich nicht mehr. Nicht mehr wie früher. Bevor ich gegangen bin, haben wir noch kurz gesprochen, Monsieur Pennec und ich. Über die Hotelangelegenheiten, wissen Sie. Es war wie immer.«
»Und Sie, Mademoiselle Kann?«
»Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gegen drei Uhr gestern Nachmittag. Ich habe ihn zuvor am Morgen gesehen, als er aus seinem Zimmer kam. So um sieben. Er hatte mich gebeten, sein Zimmer sofort zu machen.«
»Er hat hier ein Zimmer? Monsieur Pennec wohnte im Hotel?« Mademoiselle Kann schaute mit einem schwer zu deutenden Blick zu Madame Lajoux, die das Antworten übernahm.
»Er hat ein Haus in der Rue des Meunières, nicht weit vom Hotel. Und er hat ein Zimmer hier. Im zweiten Stock. In den letzten Jahren hat er immer öfter hier geschlafen. Es war ihm zu beschwerlich, nachts noch nach Hause zu gehen. Er war immer bis zum Schluss da, verstehen Sie, jeden Abend. Er ist nie vor Mitternacht gegangen. Nie. Er schaute nach dem Rechten. Wissen Sie, er war ein großartiger Hotelier. Wie sein Vater. Und seine Großmutter. Eine große Tradition.«
»Warum sollte sein Zimmer sofort gemacht werden?«
Mademoiselle Kann schien einen Augenblick zu überlegen.
»Ich weiß es nicht.«
»War das ungewöhnlich?«
Wieder schien sie ganz genau nachdenken zu wollen.
»Er hat das nicht oft gesagt.«
»Was hat Pierre-Louis Pennec noch selbst gemacht hier im Hotel? Gibt es einen Geschäftsführer oder so etwas?«
»Monsieur le Commissaire!« Im Ton und Blick Francine Lajoux’ lag Entsetzen.
»Alles hat Monsieur Pennec selbst gemacht. Natürlich alles. Seit 1947 hat er das Hotel geleitet. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte des Central kennen. Sie sind ja ganz neu hier. Sie sollten sie kennen! Hier wurde die moderne Kunst erfunden. Gauguin hat hier seine berühmte Schule gehabt, die Schule von Pont Aven …«
»Madame Lajoux, ich …«
»Pierre-Louis Pennecs Großmutter hat das alles hier begründet, sie war es. Sie war mit den Künstlern eng befreundet. Und hat sie gefördert, wie sie nur konnte. Sie hat ihnen sogar Ateliers gebaut. Sie müssen das alles wissen, Monsieur le Commissaire. Marie-Jeanne steht in den Geschichtsbüchern und Kunstbüchern. Ohne die Pension von Marie-Jeanne Pennec und das Hotel von Julia Guillou hier gleich nebenan hätte es das alles nicht gegeben. Manchmal haben die Künstler hier gewohnt und gegessen, ohne zahlen zu müssen, die meisten besaßen ja ohnehin nichts. Und …«
Sie musste eine Pause machen, in ihrem Blick lag nun offene Empörung.
»Und es ist bis heute eine kolossale Ungerechtigkeit, dass man um Mademoiselle Julia mehr Aufhebens macht als um Marie-Jeanne Pennec. Wissen Sie davon, Monsieur le Commissaire?«
»Ich – nein. Davon wusste ich nichts.«
»Sie müssen sich ein Buch kaufen. Unbedingt. Direkt an der Brücke liegt der Presseladen. Und alles nachlesen. Das alles ist sehr berühmt hier.«
»Madame Lajoux, ich …«
»Ich verstehe, es geht jetzt um die polizeilichen Ermittlungen, ja. Sie hatten gefragt, ob Pierre-Louis Pennec das Hotel alleine geleitet hat? Das war Ihre Frage. Oh ja! Dreiundsechzig Jahre hat er es geleitet, das muss man sich vorstellen. Er war achtundzwanzig, als sein Vater starb, der wunderbare Charles Pennec, er ist nicht sehr alt geworden. Er hatte das Hotel von seiner Mutter geerbt. Sie …«
Madame Lajoux unterbrach sich und schien sich selbst zur Konzentration zu ermahnen.
»Der achtundzwanzigjährige Pierre-Louis hatte, als es dann so weit war, keine Angst vor der Bürde der Tradition. Er hat das Hotel übernommen und alleine geleitet, bis zum heutigen Tag.«
Francine Lajoux seufzte tief.
»Und ich, ich bin für das Frühstück und die Zimmer verantwortlich, für die Zimmermädchen. Auch für die Rezeption, Reservierungen und all diese Dinge. Ich meine, eigentlich macht Madame Mendu das jetzt. Seit ein paar Jahren. Sie macht das gut.« Madame Lajoux hielt kurz inne, holte Luft und sprach dann fast unhörbar leise, wie erschöpft, »aber ich bin noch da«.
Mademoiselle Kann kam ihr zu Hilfe.
»Madame Mendu hat die Arbeit der Hausdame von Madame Lajoux übernommen. Sie haben sie draußen sicher gesehen, an der Rezeption. Sie hat eine Assistentin, Mademoiselle Denoelalig. Die arbeitet nachmittags an der Rezeption und abends als Bedienung im Restaurant. Dann ist Madame Mendu wieder an der Rezeption, morgens auch.«
Als das Zimmermädchen den Satz beendet hatte, äugte sie etwas unsicher zu Madame Lajoux. Zu Recht, wie sich im nächsten Augenblick herausstellte.
»Aber all das sind niedere Arbeiten. Die Leitung lag alleine bei Monsieur Pennec. Ich …« Ihr Tonfall war schneidend gewesen. Sie brach den Satz abrupt ab, offensichtlich selbst erschrocken.
»Ist alles in Ordnung, Madame Lajoux?«
Dupin wusste, dass es nun bald genug war.
»Ja, ja. Meine Nerven sind etwas angegriffen.«
»Nur ein paar Dinge noch, Madame Lajoux. Wie beendete Monsieur Pennec den Tag für gewöhnlich?«
»Wenn es im Restaurant losging, schaute er überall nach dem Rechten, besprach die wichtigen Dinge mit Madame Leray und mit dem Koch. Corinne Leray kommt erst am späten Nachmittag, sie führt das Restaurant. Mit dem Hotel hat sie weiter nichts zu tun. Ist es das, was Sie wissen wollten, Monsieur le Commissaire?«
Dupin stellte fest, dass sein kleines Diagramm mit den Namen der Hotelangestellten, ihren Tätigkeiten, Hierarchien und Arbeitszeiten unübersichtlich geworden war.
»Und dann, später meine ich? Am Ende des Tages?«
»Am Ende, wenn er mit allem fertig und das Restaurant schon wieder für den nächsten Tag eingedeckt war, stand er immer noch an der Bar. Manchmal war Fragan Delon dabei. Oder ein Stammgast. Oder auch jemand aus dem Ort. Meistens war er aber alleine.«
Mademoiselle Kann hatte anscheinend das Gefühl, dies präzisieren zu müssen.
»Monsieur Delon war Monsieur Pennecs bester Freund. Er kam regelmäßig ins Hotel, manchmal zum Mittagessen oder nachmittags, manchmal auch abends.«
»Mademoiselle Kann! Es ist für andere schwer zu beurteilen, wer beste Freunde sind. Das ist eine sehr private Sache.« Francine Lajoux blickte das Zimmermädchen strafend an, wie eine Lehrerin eine vorlaute Schülerin, die sich ungebührend hervorgetan hat.
»Sie waren befreundet. Mehr können wir dazu nicht sagen. Sie waren auch nicht immer einer Meinung.«
»War Monsieur Delon gestern Abend da?«
»Ich denke nein. Aber Sie müssen Madame Mendu fragen. Mademoiselle Kann und ich sind abends ja nicht da.«
»Um wie viel Uhr beendete Monsieur Pennec den Tag an der Bar gewöhnlich? Trank er dann immer einen Lambig?«
»Das hat Ihnen also schon jemand verraten. Ja, einen Lambig. Das ist unser Apfelschnaps! So gut wie ein Calvados, glauben Sie mir, die machen nur mehr Reklame! Pierre-Louis Pennec trank den Lambig von Menez Brug, immer nur den. Er ging so um elf in die Bar, jeden Abend. Und er blieb immer eine halbe Stunde. Nie länger. Hilft Ihnen das weiter?«
Es klopfte und im nächsten Moment stand Riwal in der Tür, er sprach hektisch.
»Monsieur le Commissaire. Loic Pennec ist am Telefon. Er und seine Frau wissen es bereits.«
Dupin wollte zuerst fragen, wie sie die Nachricht erreicht hatte, wusste aber, dass diese Frage lächerlich war. Natürlich wusste der ganze Ort zu diesem Zeitpunkt bereits Bescheid. Und er hätte daran denken müssen.
»Sagen Sie ihm, ich komme sofort. Ich bin gleich da.«
Riwal verschwand wieder im Flur.
»Ich danke Ihnen sehr. Ihnen beiden. Das waren wichtige Informationen. Sie haben mir sehr geholfen. Ich möchte Sie bitten, uns alles, was Ihnen noch einfallen sollte, sofort mitzuteilen. Ich habe Sie ungebührlich lange strapaziert, das tut mir leid.«
»Ich will, dass Sie den Mörder finden, Monsieur le Commissaire.« Madame Lajoux’ Gesicht war versteinert.
»Sie erreichen mich jederzeit, Madame Lajoux, Mademoiselle Kann. Ich werde sicherlich wieder auf Sie zukommen. Sehr bald wahrscheinlich.«
»Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Monsieur le Commissaire«, antworteten beide wie aus einem Munde.
Riwal stand direkt neben der Tür, als der Kommissar hinaustrat.
»Monsieur und Madame Pennec erwarten Sie in …«
»Riwal, wenn die Spurensicherung durch ist, gehen Sie mit Madame Lajoux ins Restaurant. Madame Lajoux soll noch einmal schauen, ob irgendetwas fehlt oder verändert ist – im ganzen Hotel am besten. Und fragen Sie Madame Mendu, ob Pennecs Freund Fragan Delon oder jemand anderes gestern später am Abend da war. Ob jemand mit Pennec an der Bar war gestern, wie kurz auch immer. Ach ja, und sprechen Sie mit Madame Leray!«
»Gut. Ich habe eine vollständige Aufstellung aller Hotelangestellten.«
»Gibt es einen zweiten Eingang zum Hotel?«
»Ja, durch die Küche. Er ist im Hof, in den man auch über die schmale Gasse hinter dem Hotel gelangt. Dort befindet sich eine schwere gusseiserne Tür, die wohl nie benutzt wird und immer abgeschlossen ist. Der Schlüssel hängt an der Rezeption.«
»Was für ein Fest war das hier in Pont Aven letzte Nacht?«
»Oh, nur das örtliche Fest-Noz, wissen Sie, das ist …«
»Ich weiß, was das ist.«
Den ganzen Sommer über fanden sie statt, die »traditionellen bretonischen Tanzfeste« mit der traditionellen Volksmusik, die nicht so Dupins Sache war, jeden Abend in einem anderen Dorf, egal, wie klein es auch sein mochte – ein endloser Reigen.
»Monsieur le Commissaire, Sie sollten jetzt wirklich …«
»Der Koch, kurz.«
Riwal hatte es sich offenbar schon gedacht. Mit nur ein klein wenig resigniertem Gestus deutete er den Flur entlang.
»Wir haben eines der unbelegten Zimmer genommen.«
Er unternahm noch einen Versuch: »Wenn Sie wollen, spreche ich mit dem Koch.«
»Wir machen es ganz kurz.«
»Es heißt, Edouard Glavinec rede ohnehin nicht gerne, Monsieur le Commissaire.«
Dupin schaute Riwal ein wenig irritiert an.
»Was?«
Das Zimmer war für ein so altes Haus erstaunlich großzügig und hell, mit schlichten, aber hübschen weißen Holzmöbeln eingerichtet, altes Eichenparkett, helle Stoffe. An einem kleinen Tisch nahe der Tür saß ein junger, schlaksiger Kerl, der irgendwie vollständig unbeteiligt wirkte. Er nahm fast keine Notiz von ihnen, als sie eintraten.
»Bonjour Monsieur. Commissaire Dupin, Commissariat de Police Concarneau. Es heißt, Sie haben Pierre-Louis Pennec gestern Abend noch gesehen.«
Glavinec nickte kurz. Er machte ein freundliches Gesicht dabei.
»Wann war das?«
»Viertel vor elf.«
»Sind Sie sich sicher mit der Uhrzeit?«
Glavinec nickte wieder.
»Warum sind Sie sich so sicher?«
»Ich war mit allem fertig, die Küche wurde nur noch aufgeräumt. Dann ist es immer so Viertel vor elf.«
»Wo genau haben Sie ihn gesehen?«
»Unten.«
»Genauer?«
»An der Treppe.«
»Wohin ist er gegangen?«
»Er kam von oben runter.«
»Und Sie?«
»Ich wollte eine rauchen. Draußen.«
»Und wohin wollte er?«
»Keine Ahnung. An die Bar, denke ich. Er ging später immer an die Bar.«
»Und haben Sie miteinander gesprochen?«
»Ja.«
Es war wirklich ein wortkarges Gespräch. Dupin war vollkommen unklar, woher dieser Mensch die Leidenschaft nahm, die er beim Kochen offensichtlich auslebte. Er war kein Spitzenkoch, aber das Restaurant, wusste Dupin, wurde ernst genommen. Sogar Nolwenn empfahl es. Er musste gut sein.
»Worum ging es?«
»Um nichts Großes.«
Dupins leicht fassungsloser Blick bewegte Glavinec, doch noch etwas hinzuzufügen.
»Was wir heute machen wollten.«
»Was meinen Sie?«
»Was wir heute kochen würden, das Tagesgericht und so. Wir haben immer ein besonderes Tagesgericht. Das war Monsieur Pennec wichtig.«
Ein erstaunlich ausführlicher Satz.
»Es ging nur darum, um nichts anderes?«
»Nein.«
»Und ist Ihnen nichts aufgefallen an Monsieur Pennec? War er auf irgendeine Art anders als sonst?«
»Nein«, antwortete Glavinec erwartungsgemäß. »Nichts.«
Dupin seufzte.
»Er wirkte auf Sie also wie immer?«
»Ja.«
»War er alleine? Kam jemand hinzu?«
»Ich habe niemanden gesehen.«
»Und ansonsten, im Hotel, an anderen Personen? Ist Ihnen da etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
Dupin wusste, dass es eine überflüssige Frage war. Bevor Glavinec etwas antwortete, fügte er hinzu:
»Ich bitte Sie, sich umgehend an uns zu wenden, wenn Ihnen doch noch etwas einfällt, das Ihnen bemerkenswert scheint. Sie sind eine wichtige Person für uns. Pierre-Louis Pennec ging nach Ihrem Gespräch vermutlich an die Bar und wurde dort wahrscheinlich nur wenig später ermordet. Verstehen Sie, warum Ihre Aussagen von größter Bedeutung sein könnten?«
Auch jetzt veränderten sich Glavinecs Blick und Mimik nicht. Dupin hatte es auch nicht erwartet.
»Ich muss gehen. Wir werden uns sicher in den nächsten Tagen sehen.«
Glavinec stand auf, streckte dem Kommissar wortlos die Hand entgegen und ging. Riwal und Dupin blieben allein im Zimmer zurück.
»Tja.« Dupin stand ebenfalls auf und wandte sich zum Gehen. Er musste schmunzeln. Es war in gewisser Weise eine sehr bretonische Konversation gewesen. Insgeheim mochte er den Koch. Und hatte beschlossen, irgendwann einmal zum Essen hierhin zu kommen. Er hatte viel erfahren.
»Was denken Sie, Monsieur le Commissaire, es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht irgendjemand irgendetwas gesehen oder gehört hätte gestern Abend?«
Dupin wollte sagen, dass er es schon häufig mit dem Teufel hatte zugehen sehen, verkniff es sich aber.
»Das wird sich zeigen. Niemand betritt die Räume unten, Riwal. Wenn die Kollegen fertig sind, sperren wir alles ab. Ich werde jetzt die Pennecs aufsuchen.«
Dupin ging.
Riwal kannte das. Die Manie des Kommissars, den Tatort, selbst wenn es sich um öffentliche Orte handelte, auf unbestimmte Zeit absperren zu lassen, weit über die Notwendigkeiten der Forensiker hinaus. So lange, bis er dachte, es sei nun nichts Neues mehr zu erfahren. Das führte jedes Mal zu faustdickem Ärger. Diese Praxis war durch keinerlei polizeiliche Bestimmungen gedeckt. Der Kommissar hatte, prinzipiell, seine eigenen Vorstellungen. Riwal wusste, Diskussionen waren sinnlos. Außerdem hatte er gelernt, dass Dupins unorthodoxes Vorgehen unter Umständen zu Erstaunlichem führte. Im Zuge von Dupins ersten Ermittlungen in der Bretagne hatte es ruppige Auseinandersetzungen mit allen möglichen Leuten gegeben, nicht nur mit Locmariaquer, und nicht immer war Dupin als Sieger hervorgegangen. Doch nach ersten Erfolgen als Kommissar, vor allem nach der Aufklärung der spektakulären Morde an zwei Thunfischfischern in seinem zweiten Jahr, die die Bretonen nachhaltig bewegt und Dupin zu einer durchaus prominenten Person in der Region gemacht hatte, war es seltener zu Auseinandersetzungen gekommen.
Das Central lag am Place Paul Gauguin, dem kleinen hübschen Hauptplatz des Ortes, es war ein schönes, strahlend weiß gestrichenes Gebäude, vom Ende des 19. Jahrhunderts. Man sah ihm in allem an, dass es die ganzen Jahrzehnte über liebevoll und sorgfältig gepflegt worden war. Es lag direkt neben dem deutlich größeren Hotel Julia,