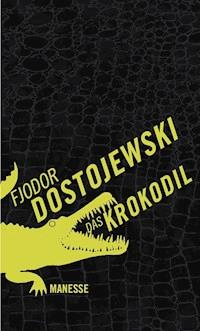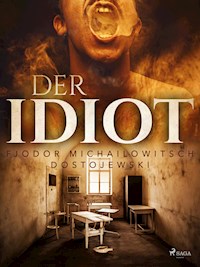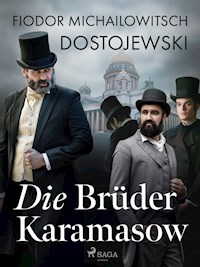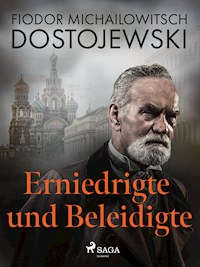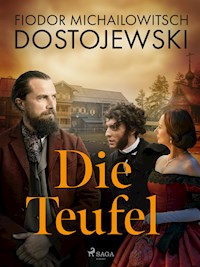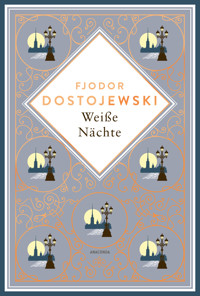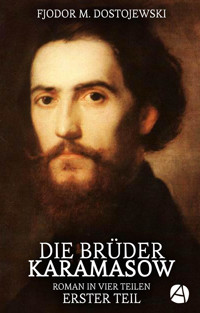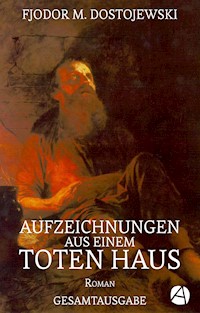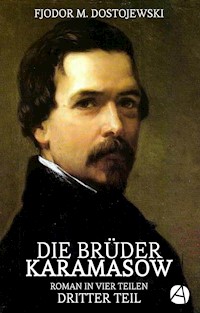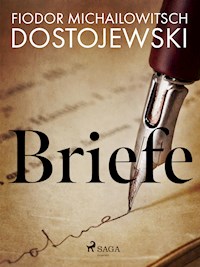
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreise aus der Feder Dostojewskis – was einen der wichtigsten und herausragendsten Schriftsteller Russlands beschäftigte, lässt sich in Form seiner Briefe nachvollziehen. Von Dostojewski gibt Hunderte von Briefen, die in Büchern veröffentlicht wurden. Dieser Sammelband stellt eine Mischung aus geschäftlicher und privater Korrespondenz dar, die der berühmte Autor unter anderem an seinen Bruder Michail Michailowitsch Dostojewski und seine Ehefrau Anna Grigorjewna Dostojewskaja gerichtet hat. Sie gibt Einblick in das private Leben, das Denken und Fühlen von Dostojewski.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor M Dostojewski
Briefe
Übersezt von Alexander Eliasberg
Saga
Briefe
Übersezt von Alexander Eliasberg
Titel der Originalausgabe: Bukvy
Originalsprache: Russischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726981483
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Vorwort
Eine vollständige Sammlung von Briefen Dostojewskijs existiert heute noch nicht. Der erste Band der ersten Gesamtausgabe von Dostojewskijs Werken (St. Petersburg, 1883) enthält nur eine Auswahl, die in den späteren Auflagen überhaupt fehlt. Eine Reihe von Briefen, die in diese Sammlung aufgenommen werden sollten, wurde im letzten Augenblick von der Witwe des Dichters zurückbehalten; die Korrekturabzüge werden in einer versiegelten Mappe im Moskauer Dostojewskij-Museum verwahrt.
Vorliegender Ausgabe liegt das Buch von W. Tscheschichin: »Dostojewskij in der Erinnerung der Zeitgenossen, in seinen Briefen und Notizen« (Moskau, 1912), zugrunde. Die Briefe XXXVIII, XLIV, L, LVI und LVIII unseres Bandes, die in dieser Sammlung fehlen, habe ich der historischen Monatsschrift »Rußkaja Starina« entnommen; die bei Tscheschichin unvollständig wiedergegebenen Briefe XXXIX, XLVI, XLVIII und LIX habe ich ergänzt.
Dem Werke Tscheschichins wurden auch eine Anzahl der Anmerkungen sowie die Erinnerungen der Zeitgenossen im »Anhang« entnommen. Weitere Erinnerungen an Dostojewskij – von seinem Bruder Andrej und Nikolaj Strachow – finden sich in Bd. 11 und 12 der im gleichen Verlag erscheinenden Gesamtausgabe von Dostojewskijs Werken.
A. E.
I. An den Vater, den 10. Mai 1838
Mein lieber guter Vater! Können Sie denn wirklich denken, daß Ihr Sohn zu viel verlangt, wenn er Sie um eine Unterstützung angeht? Gott sei mein Zeuge, daß ich Sie weder aus Eigennutz, noch aus wirklicher äußersten Not irgendwie schädigen will. Wie bitter ist es mir, wenn ich meine Blutsverwandten um eine Gefälligkeit bitten muß, die sie so schwer bedrückt! Ich habe meinen eigenen Kopf und eigene Hände. Wäre ich frei und selbständig, so hätte ich von Ihnen auch nicht eine Kopeke verlangt; ich hätte mich selbst an die bitterste Not gewohnt. Ich würde mich schämen, auch nur ein Sterbenswörtchen von einer Unterstützung zu schreiben. Jetzt kann ich Sie nur mit Versprechungen für die Zukunft vertrösten; doch diese Zukunft ist nicht mehr fern, und Sie werden sich mit der Zeit selbst davon überzeugen.
Jetzt bitte ich Sie, lieber Papa, zu berücksichtigen, daß ich im wahren Sinne des Wortes diene. Ich muß mich, ob ich will oder nicht, nach den Gepflogenheiten meiner jetzigen Umgebung richten. Warum sollte ich auch eine Ausnahme bilden? Solche Ausnahmestellungen sind oft mit den größten Unannehmlichkeiten verbunden. Das werden Sie auch selbst verstehen, lieber Papa. Sie haben ja genug unter Menschen gelebt. Beachten Sie also bitte folgendes: das Lagerleben eines jeden Zöglings der Militärlehranstalten erfordert mindestens vierzig Rubel. (Ich schreibe dies, weil ich zu meinem Vater spreche.) In dieser Summe sind solche Bedürfnisse, wie Tee, Zucker usw., nicht inbegriffen. Denn dies alles muß ich auch ohnehin haben, und zwar nicht nur des Anstandes wegen, sondern aus wirklicher Not. Wenn man bei feuchter Witterung und Regen in einem leinenen Zelte liegen muß, oder bei solchem Wetter müde und durchfroren von einer Übung heimkommt, so kann man ohne Tee leicht krank werden, wie ich es schon im vorigen Jahre beim Manöver erlebt habe. Ich will aber Ihre Notlage berücksichtigen und gänzlich auf Tee verzichten; ich will Sie daher nur um das Allernotwendigste bitten: um sechzehn Rubel für zwei Paar einfacher Stiefel. Ferner: ich muß ja meine Sachen, wie Bücher, Schuhwerk, Schreibzeug und Papier usw., irgendwo verwahren. Ich brauche für diesen Zweck einen Koffer, denn im Lager gibt es keine anderen Bauten als Zelte. Unsere Betten sind mit Leintüchern bedeckte Strohbündel. Nun frage ich Sie, wie ich ohne Koffer alle meine Sachen verwahren soll? Sie müssen wissen, daß der Fiskus sich gar nicht darum kümmert, ob ich einen Koffer habe oder nicht. Denn die Examina sind bald zu Ende, und dann brauche ich ja keine Bücher; der Fiskus sorgt für meine Equipierung, folglich brauche ich auch keine Stiefel usw. Wie soll ich mir aber ohne Bücher die Zeit vertreiben? Die Stiefel, mit denen uns der Fiskus versorgt, sind so schlecht, daß drei Paar davon in der Stadt für kaum ein halbes Jahr reichen.
[Es folgt eine weitere Aufzählung der notwendigen Anschaffungen.]
Von Ihrer letzten Sendung habe ich mir fünfzehn Rubel zurückgelegt. Sie sehen also selbst, lieber Papa, daß ich unbedingt noch fünfundzwanzig Rubel brauche. Anfang Juni verlassen wir das Lager. Wenn Sie also Ihrem Sohne in seiner bitteren Not beistehen wollen, so schicken Sie ihm dieses Geld zum 1. Juni. Ich wage nicht, auf meiner Bitte zu bestehen; ich verlange nicht zu viel, doch mein Dank wird grenzenlos sein.
II. An den Bruder Michail, Petersburg, den 9. August 1838
[Der Brief beginnt mit Erklärungen, warum D. seinem Bruder so lange nicht geschrieben hat: er hat keine Kopeke Geld gehabt.]
Es ist wahr, ich bin faul, sehr faul. Was soll ich aber tun, wenn das ewige Faulenzen meine einzige Bestimmung im Leben ist? Ich weiß nicht, ob meine trüben Gedanken mich je verlassen werden. Dem Menschen ist ja nur dieser einzige Seelenzustand beschieden: die Atmosphäre seiner Seele besteht aus einer Vermengung des Himmlischen mit dem Irdischen: welch ein unnatürliches Kind ist also der Mensch; denn das Gesetz der geistigen Natur ist in ihm verletzt ... Unsere Erde erscheint mir als ein Fegefeuer für himmlische Geister, die von sündigen Gedanken getrübt worden sind. Mir scheint, daß unsere Welt eine negative Größe geworden ist und daß alles Erhabene, Schöne und Geistige sich in eine Satire verwandelt hat. Wenn nun in dieses Bild eine Person gerät, die weder in der Idee noch im Effekt mit dem Ganzen übereinstimmt, mit einem Worte eine ganz unbeteiligte Person, was kann da aus dem Bilde werden? Das Bild ist verdorben und kann nicht weiter bestehen.
Wie schrecklich ist es aber, nur die rauhe Hülle, unter der das Weltall verschmachtet, zu sehen! Zu wissen, daß eine einzige Anspannung des Willens genügt, um diese Hülle zu sprengen, um mit der Ewigkeit eins zu werden; dies alles zu wissen und dabei wie die letzte der Kreaturen zu leben ... Wie schrecklich! Wie kleinmütig ist der Mensch! Hamlet! Hamlet! Wenn ich an seine aufrührerische wilde Rede denke, in der das Stöhnen der ganzen erstarrten Welt wiederklingt, so entringt sich meiner Brust kein einziger Vorwurf, kein einziger Seufzer ... Die Seele ist dann so sehr von Gram bedrückt, daß sie sich scheut, diesen Gram ganz zu erfassen, um sich selbst nicht zu zerfleischen. Pascal hat einmal gesagt: Wer gegen die Philosophie protestiert, der ist selbst Philosoph. Eine armselige Philosophie!
Ich habe mich aber verplaudert. Von allen deinen Briefen habe ich außer dem allerletzten nur zwei bekommen. Nun, Bruder, du klagst über deine Armut. Auch ich bin nicht reich. Du wirst mir wohl gar nicht glauben wollen, daß ich beim Auszug aus dem Lager nicht eine Kopeke hatte; unterwegs habe ich mich erkältet (es regnete den ganzen Tag und wir waren ohne Obdach), bin auch vor Hunger erkrankt, und hatte dabei kein Geld, um mir die Kehle mit einem Schluck Tee anzufeuchten. Ich habe mich später erholt, litt aber im Lager die bitterste Not, bis endlich das Geld von Papa kam. Ich bezahlte meine Schulden und verbrauchte den Rest.
[D. ergeht sich noch weiter über die Lage des Bruders und seine eigenen Geldschwierigkeiten.]
Es ist aber Zeit, von etwas anderem zu sprechen. Du rühmst dich, daß du so viel Bücher gelesen hast ... Bilde dir aber bitte nicht ein, daß ich dich darum beneide. Auch ich habe in Peterhof mindestens ebensoviel gelesen wie du. Den ganzen Hoffmann russisch und deutsch (d. h. den noch nicht übersetzten Kater Murr), und fast den ganzen Balzac. (Balzac ist groß! Seine Charaktere sind Schöpfungen eines weltumfassenden Geistes! Nicht der Zeitgeist, sondern ganze Jahrtausende haben in ihrem Ringen in der Seele des Menschen eine solche Entwicklung und Lösung gezeitigt!) Ferner Goethes Faust, seine kleineren Gedichte, Polewojs Geschichte, Ugolino und Undine (über Ugolino will ich dir ein anderes Mal ausführlicher schreiben); schließlich Victor Hugo (außer Cromwell und Hernani).
Lebe wohl. Schreibe mir bitte möglichst oft, denn deine Briefe sind mir eine Freude und ein Trost. Beantworte diesen Brief sofort. Ich erwarte deine Antwort in zwölf Tagen. Spätestens. Schreibe mir, damit ich nicht verschmachte.
Dein Bruder F. Dostojewskij.
Ich habe ein neues Projekt: verrückt zu werden. Mögen sich nur die Leute wie wild gebärden, mögen sie mich kurieren, mögen sie versuchen, mich vernünftig zu machen! Wenn du den ganzen Hoffmann gelesen hast, so kannst du dich gewiß an Alban erinnern. Wie gefällt er dir? Es ist schrecklich, einen Menschen zu sehen, der das Unfaßbare in seiner Macht hat, der nicht weiß, was damit anzufangen, und mit einem Spielzeug spielt, welches Gott heißt!
III. An den Bruder Michail, Petersburg, den 31. Oktober 1838
Wie lange habe ich dir nicht geschrieben, lieber Bruder. Das böse Examen! Es hinderte mich, dir und Papa zu schreiben und I. N. Schidlowskij (Anmerkung des Übersetzers: Nikolai Schidlowskij, Beamter im Finanzministerium, schrieb hochtrabende Gedichte abstrakt-idealistischen Inhalts. Kam später infolge Trunksucht ganz herunter). aufzusuchen. Und was kam dabei heraus? Ich bin doch nicht versetzt worden. O Grauen! Noch ein Jahr, ein ganzes Jahr in diesem Jammer zu leben! Ich hätte nicht so sehr gewütet, wenn ich nicht wüßte, daß ich einer Gemeinheit, einer puren Gemeinheit unterlegen bin! Der Mißerfolg hätte mich nicht so sehr betrübt, wenn nicht die Tränen des armen Vaters in meiner Seele brennten. Ich habe bisher nicht gewußt, was beleidigter Ehrgeiz bedeutet. Wenn sich dieses Gefühl meiner bemächtigt hätte, müßte ich wohl erröten ... Doch weißt du: nun habe ich wirklich Lust, die ganze Welt auf einmal zu zermalmen ... Ich habe so viel Zeit vor dem Examen verloren, bin dabei krank und elend geworden, habe das Examen im wahren und vollen Sinne des Wortes bestanden und bin doch sitzengeblieben ... So wollte es der Lehrer für Algebra, dem ich einmal im Laufe des Lehrjahres einige Grobheiten gesagt habe, und der jetzt so gemein war, es mir zu vergelten, indem er mir damit den Grund meiner Nichtversetzung erklärte ... Bei zehn ganzen Punkten hatte ich im Mittel neuneinhalb und bin trotzdem sitzengeblieben ... Zum Kuckuck! Wenn ich leiden muß, so werde ich eben leiden ... Ich will für diese Erörterungen kein Papier verschwenden, denn ich habe auch so selten Gelegenheit, mit dir zu sprechen.
Mein Freund! Du philosophierst wie ein Dichter. Ebenso wie die Seele nicht gleichmäßig im Zustande der Begeisterung bleiben kann, so ist auch deine Philosophie nicht richtig und nicht gleichmäßig. Um mehr zu wissen, muß man weniger fühlen und umgekehrt; dein Urteil ist voreilig, es ist ein Delirium des Herzens. Was willst du mit dem Wort wissen sagen? Natur, Seele, Liebe und Gott erkennt man mit dem Herzen und nicht mit der Vernunft. Wären wir Geister, so wohnten wir in der Sphäre jener Idee, über der unsere Seele schwebt, wenn sie sie erraten will. Wir sind aber erdgeborene Menschen und müssen die Idee erraten, können sie aber nicht von allen Seiten zugleich erfassen. Der Leiter des Gedankens durch die vergängliche Hülle ins Innere der Seele heißt Vernunft. Die Vernunft ist eine materielle Fähigkeit; doch die Seele oder der Geist leben von den Gedanken, die ihnen das Herz zuflüstert. Der Gedanke wird in der Seele geboren. Die Vernunft ist ein Werkzeug, eine Maschine, die vom seelischen Feuer angetrieben wird. Wenn die Vernunft des Menschen (das ist wieder ein Kapitel für sich) in das Gebiet des Wissens eindringt, so wirkt sie unabhängig vom Gefühl und folglich auch vom Herzen. Wenn aber das Ziel der Erkenntnis die Liebe oder die Natur ist, so beginnt hier das ureigenste Gebiet des Herzens. Ich will nicht mit dir streiten, will aber bemerken, daß ich deine Ansichten über Poesie und Philosophie nicht teile. Die Philosophie darf nicht als eine gewöhnliche mathematische Gleichung, in der die Natur die Unbekannte ist, betrachtet werden! Merke dir, daß der Dichter im Augenblicke der Begeisterung Gott erfaßt, folglich die Aufgabe eines Philosophen erfüllt. Folglich ist die poetische Begeisterung nichts anderes als philosophische Begeisterung. Folglich ist die Philosophie nichts anderes als Poesie, als eine höhere Stufe von Poesie! Es ist sonderbar, daß du im Sinne der heutigen Philosophie urteilst. Wieviel sinnlose philosophische Systeme sind letztens in den gescheitesten und feurigsten Köpfen geboren! Um aus diesem bunten Haufen ein richtiges Resultat zu gewinnen, muß man alles einer mathematischen Formel unterordnen. Das sind eben die Gesetze der heutigen Philosophie. Ich habe mich aber verplaudert. Wenn ich auch deine schlappe Philosophie für unmöglich halte, halte ich es doch für möglich, daß meine Einwendungen nicht minder schlapp sind; ich will dich also damit nicht weiter plagen.
Bruder, es ist so traurig, ohne Hoffnung zu leben! Wenn ich vorwärts schaue, so graut es mir vor der Zukunft. Ich schwebe in einer kalten arktischen Atmosphäre, in die kein einziger Sonnenstrahl dringt. Ich habe seit langer Zeit keinen einzigen Ausbruch von Begeisterung erlebt ... Dafür befinde ich mich im gleichen Zustand wie der Gefangene von Chillon nach dem Tode seiner Brüder. Der Paradiesvogel der Poesie wird mich wohl nie wieder besuchen, wird nie wieder meine erfrorene Seele erwärmen. Du sagst, ich sei verschlossen; alle meine früheren Träume haben mich aber schon längst verlassen, und von jenen herrlichen Arabesken, die ich einst geschaffen, ist die ganze Vergoldung abgefallen. Alle Gedanken, die früher mit ihrem Strahl meine Seele und mein Herz entzündeten, haben nun ihr Feuer und ihre Wärme eingebüßt, oder mein Herz ist erstarrt, oder ... Es graut mir, diesen Satz fortzusetzen. Ich will nicht gestehen, daß alles Vergangene nur ein Traum, ein goldener bunter Traum gewesen ist.
Bruder, ich habe dein Gedicht gelesen. Es hat einige Tränen aus meiner Seele herausgepreßt und sie für eine Zeitlang im Banne der Erinnerungen eingelullt. Du sagst, daß du eine Idee für ein Drama hast. Ich freue mich darüber. Schreibe doch dein Drama. Wenn du nicht diese letzten Krumen vom paradiesischen Mahle hättest, was bliebe dir dann noch vom Leben übrig? Es tut mir leid, daß ich in der vorigen Woche Iwan Nikolajewitsch [Schidlowskij] nicht aufsuchen konnte; ich war krank. Hör einmal. Mir scheint, daß die Begeisterung des Dichters auch vom Ruhm begünstigt wird. Byron war ein Egoist; sein Streben nach Ruhm war kleinlich. Doch der bloße Gedanke, daß deiner Begeisterung dereinst irgendeine schöne, erhabene Menschenseele aus dem Staube zur Himmelshöhe folgen wird; der Gedanke, daß jene Zeilen, über denen du geweint hast, von deiner Begeisterung wie von einem himmlischen Sakrament geheiligt sind und daß über den gleichen Zeilen auch die späteren Geschlechter weinen werden, dieser Gedanke ist – davon bin ich überzeugt – manchem Dichter sicher auch in Augenblicken höchster schöpferischer Begeisterung gekommen. Das Geschrei des Pöbels ist aber hohl und nichtig. Mir fallen gerade die Verse Puschkins ein, in denen er den Pöbel und den Dichter beschreibt:
So laß das blöde Volk, dein Werk verlästernd, schrein, Und den Altar, darauf dein Feuer loht, bespein, Und kindischen Übermuts den Dreifuß dir erschüttern ...
Wundervoll, nicht wahr? Lebe wohl.
Dein Freund und Bruder F. Dostojewskij.
Ja! Teile mir bitte mit, worin die Hauptidee des Werkes von Chateaubriand »Génie du Christianisme« besteht. Ich las neulich im »Ssyn Otetschestwa« einen Aufsatz des Kritikers Nisard über Victor Hugo. Wie wenig halten doch von ihm die Franzosen! Wie niedrig schätzt Nisard seine Dramen und Romane ein! Sie sind ungerecht gegen ihn, und Nisard (wenn er auch sonst gescheit ist) redet Unsinn. Teile mir auch noch den Hauptgedanken deines Dramas mit: ich bin überzeugt, daß er herrlich ist.
Der arme Vater tut mir leid! Er hat einen so merkwürdigen Charakter. Wieviel Kummer hat er schon erlebt. Es ist so bitter, daß ich ihn mit nichts trösten kann! Weißt du übrigens: Papa steht der Welt ganz fremd gegenüber. Er hat schon fünfzig Jahre in der Welt gelebt und hat dabei die gleiche Meinung von den Menschen bewahrt, die er vor dreißig Jahren hatte. Diese selige Unwissenheit! Doch die Welt hat ihn enttäuscht, und ich glaube, daß es unser aller Schicksal ist. Lebe wohl.
IV. An den Bruder Michail, Petersburg, den 1. Januar 1840
Ich danke dir von Herzen, mein guter Bruder, für deinen lieben Brief. Ich bin doch ein ganz anderer Mensch als du; du kannst dir gar nicht vorstellen, wie angenehm mir das Herz bebt, wenn man mir einen Brief von dir bringt; ich habe mir eine neue Art von Genuß erfunden: ich spanne mich auf die Folter. Ich nehme deinen Brief in die Hand, wende ihn einige Minuten lang hin und her, betaste ihn, ob er umfangreich ist, und nachdem ich mich am versiegelten Briefumschlag satt gesehen, stecke ich ihn in die Tasche. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welch einen angenehmen Zustand von Herz und Seele ich mir damit verschaffe. Ich warte oft eine Viertelstunde; schließlich falle ich gierig über das Paket her, entsiegele es und verschlinge deine Zeilen, deine lieben Zeilen. Zahllose Gefühle werden in meinem Herzen wach, während ich deinen Brief lese! So viele zärtliche und unangenehme, süße und bittere Empfindungen drängen sich in meiner Seele; ja, lieber Bruder, es sind auch bittere und unangenehme darunter; du kannst dir gar nicht vorstellen, wie bitter es mir ist, wenn man mich nicht begreift, wenn man das, was ich sagen wollte, mißversteht und in ein schiefes Licht stellt. Nachdem ich deinen letzten Brief gelesen, war ich ganz enragé, weil ich dich nicht in meiner Nähe hatte: ich sah meine besten Herzensträume und meine heiligsten Grundsätze, die ich aus schweren Erfahrungen gewonnen habe, gänzlich verdreht, verstümmelt und verzerrt. Du schreibst mir ja selbst: »Schreibe mir doch, widersprich mir, streite mit mir!«; du erwartest davon irgendeinen Nutzen. Lieber Bruder, es bringt auch nicht den geringsten Gewinn! Das einzige, was du damit erreichst, ist, daß du dir mit deinem Egoismus (der Egoismus ist übrigens uns allen eigen) eine solche Meinung von mir, meinen Ansichten, Ideen und Eigenschaften bildest, wie sie dir gerade paßt. Das ist doch höchst beleidigend! Nein! Polemik in freundschaftlichen Briefen ist ein süßes Gift. Wie wird es nun sein, wenn wir uns einmal wiedersehen? Ich glaube, dies wird den Stoff zu ewigen Streitigkeiten liefern. Doch genug davon.
Nun von deinen Versen: höre einmal, lieber Bruder! Ich glaube: im Menschenleben gibt es unendlich viel Leid und unendlich viel Freude. Im Leben des Dichters gibt es Dornen und Rosen. Die Lyrik ist der ständige Begleiter des Dichters, denn er ist ein sprachbegabtes Geschöpf. Deine lyrischen Gedichte sind reizend: »Der Spaziergang«, »Der Morgen«, »Die Vision der Mutter«, »Die Rose«, »Die Rosse des Phoebus« und viele andere sind wunderschön. Alle diese Gedichte sind ein lebender Bericht von dir, mein Lieber! Und dieser Bericht geht mir so nahe. Ich konnte dich damals so gut verstehen, denn jene Monate haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Wieviele seltsame und wunderbare Dinge habe ich damals erlebt! Es ist eine lange Geschichte, und ich werde sie niemand erzählen.
Bei meiner letzten Begegnung mit Schidlowskij bin ich mit ihm in Jekaterinhof spazierengegangen. Wie wunderbar haben wir doch diesen Abend verbracht! Wir gedachten des vergangenen Winters, als wir so viel von Homer, Shakespeare, Schiller und Hoffmann gesprochen haben; besonders von Hoffmann. Wir sprachen auch von uns selbst, von der Zukunft und von dir, mein Lieber. Nun ist er längst fort, und ich habe keine Nachrichten von ihm. Ob er überhaupt noch am Leben ist? Mit seiner Gesundheit stand es sehr schlecht; schreibe ihm doch!
Im vergangenen Winter war ich ununterbrochen in einer seltsam gehobenen Stimmung. Der Verkehr mit Schidlowskij hat mir viele Stunden eines besseren Lebens verschafft; doch dies war nicht die einzige Ursache meiner begeisterten Stimmung. Du hast mir vielleicht übel genommen und nimmst es mir noch jetzt übel, daß ich dir damals nicht geschrieben habe. Dumme Dienstangelegenheiten waren schuld daran. Ich muß dir gestehen, mein Lieber, daß ich dich immer geliebt habe; ich liebte dich um deiner Gedichte, der Poesie deines Lebens und deiner Leiden willen; das war alles; es war aber keine Bruderliebe, keine Freundesliebe. Ich hatte damals an meiner Seite einen Freund, einen Menschen, den ich so liebte. Du schriebst mir, Bruder, ich hätte Schiller nicht gelesen. Du irrst. Ich habe ihn auswendig gelernt, habe in seiner Sprache gesprochen und in seinen Bildern geträumt; ich glaube, es war wohl ein besonders gütiges Geschick, das mir die Bekanntschaft mit diesem großen Dichter gerade in jenem Zeitpunkt meines Lebens verschaffte; nie hätte ich Schiller besser kennen lernen können als gerade in jenen Tagen. Während ich mit ihm Schiller las, sah ich in ihm den edlen und feurigen Don Carlos, den Marquis Posa und Mortimer. Diese Freundschaft hat mir viel genützt und viel Leid verschafft. Doch ich will davon ewig schweigen; der Name Schiller ist mir ein liebes vertrautes Zauberwort, das in mir zahllose Erinnerungen und Träume erweckt. Diese Erinnerungen sind bitter, und aus diesem Grunde vermied ich es immer, mit dir über Schiller und über die Eindrücke, die ich ihm verdanke, zu sprechen! Schon wenn ich den Namen Schiller höre, tut mir das Herz weh.
Ich wollte noch verschiedenes gegen deine Vorwürfe einwenden, und dir zeigen, daß du mich mißverstanden hast. Auch von anderen Dingen wollte ich mit dir sprechen; doch während ich diesen Brief schreibe, überkommen mich so viele süße Erinnerungen und Träume, daß ich von nichts anderem sprechen kann. Nur einen Vorwurf will ich zurückweisen: nämlich, daß ich die großen Dichter, die ich angeblich gar nicht kenne, nach ihrer Güte sortiert hätte. Ich habe nie solche Parallelen gezogen wie zwischen Puschkin und Schiller. Ich weiß gar nicht, wie du zu dieser Behauptung kommst; zitiere mir bitte die betreffende Stelle aus meinem Brief; an eine solche Sortierung habe ich nie gedacht; es ist ja möglich, daß ich irgendwie zufällig die Namen Puschkin und Schiller nebeneinander erwähnt habe, doch ich glaube, daß zwischen diesen Worten ein Komma steht. Sie haben beide nicht die geringste Ähnlichkeit miteinander. Bei Puschkin und Byron kann man ja noch von einer Ähnlichkeit sprechen. Was aber Homer und Victor Hugo betrifft, so glaube ich, daß du mich absichtlich mißverstanden hast. Ich meinte es so: Homer (ein sagenhafter Mensch, der uns vielleicht wie Christus von Gott gesandt war) kann nur neben Christus und keineswegs neben Hugo gestellt werden. Versuche doch, Bruder, in seine »Ilias« einzudringen, lies sie aufmerksam (gestehe doch, daß du sie nie gelesen hast). Homer hat ja mit seiner »Ilias« der Welt der Antike die gleiche Organisation des geistigen und irdischen Lebens gegeben, wie sie die moderne Welt Christus zu verdanken hat. Verstehst du mich nun? Victor Hugo ist ein Lyriker, lauter wie ein Engel, und seine Poesie ist durch und durch keusch und christlich; niemand ist ihm in dieser Beziehung gleich; weder Schiller (wenn Schiller auch ein durchaus christlicher Dichter ist), noch Shakespeare, noch Byron, noch Puschkin. Ich habe seine Sonette französisch gelesen. Homer allein hat den gleichen unerschütterlichen Glauben an seinen Dichterberuf und an den Gott der Poesie, dem er dient; nur in dieser Beziehung gleicht seine Poesie der von Victor Hugo; doch nicht in der ihm von der Natur eingegebenen und von ihm ausgedrückten Idee; ich habe ja gar nicht die Idee gemeint. Mir scheint sogar Derschawin als Lyriker höher zu stehen als diese beiden. Lebe wohl, mein Lieber!
Dein Freund und Bruder F. Dostojewskij.
Ich muß dir noch eine Rüge erteilen: wenn du von der Form in der Dichtung sprichst, scheinst du mir ganz verrückt; in allem Ernst: ich habe schon längst bemerkt, daß du in dieser Beziehung nicht ganz normal bist. Neulich hast du auch über Puschkin eine ähnliche Bemerkung fallen lassen. Ich bin absichtlich darauf nicht eingegangen. Von deinen Formen will ich im nächsten Brief ausführlicher sprechen. Jetzt fehlt mir Raum und Zeit. Sage mir aber bitte, wie konntest du, als du von den Formen sprachst, die Behauptung aufstellen, weder Racine noch Corneille könnten uns gefallen, denn ihre Form sei schlecht. Du Unglücksmensch! Und dabei sagst du noch mit solcher Überlegenheit: »Glaubst du denn, daß die beiden keine echten Dichter waren?« Ob Racine kein Dichter war? Ob Racine, der feurige, leidenschaftliche, in seine Ideale verliebte Racine kein Dichter war? Das wagst du zu fragen? Hast du seine » Andromaque« gelesen? He? Hast du die » Iphigénie« gelesen? Wirst du vielleicht behaupten, daß sie nicht herrlich ist? Ist denn Racines Achilles dem des Homer nicht ebenbürtig? Racine hat ja allerdings Homer bestohlen, doch wie! Wie wundervoll sind seine Frauengestalten! Begreife es doch! Du sagst: »Racine war kein Genie; konnte er denn überhaupt (?) ein Drama schaffen? Er konnte nur Corneille nachahmen.« Und » Phèdre«? Bruder! Wenn du mir nicht beistimmen wirst, daß dies die höchste und reinste Poesie ist, so weiß ich gar nicht, was ich von dir noch halten soll. Es steckt ja die Kraft eines Shakespeare darin, wenn das Bildwerk auch aus Gips und nicht aus Marmor ist.
Nun von Corneille. Höre einmal, Bruder! Ich weiß gar nicht, wie ich mit dir sprechen soll; vielleicht muß ich vorher wie Iwan Nikiforowitsch (Anmerkung des Übersetzers: Held einer Novelle von Gogol.) eine tüchtige Portion Erbsen fressen. Ich kann es nicht glauben, Bruder, daß du ihn überhaupt gelesen hast; daher redest du auch solchen Unsinn. Weißt du denn überhaupt, daß Corneille mit seinen riesenhaften Gestalten und seinem romantischen Geist beinahe an Shakespeare heranreicht? Du Armer! Weißt du denn, daß Corneille erst fünfzig Jahre nach dem talentlosen elenden Jodel, dem Autor der ekelhaften »Kleopatra«, und nach dem an unseren Tredjakowskij gemahnenden Ronsard ausgetreten ist; und daß er beinahe ein Zeitgenosse des gefühllosen Dichterlings Malherbe war? Wie kannst du von ihm Formen verlangen? Es ist noch gut, daß er die Form von Seneca entlehnt hat. Hast du seinen » Cinna« gelesen? Was sind vor der göttlichen Gestalt des Octavius – Karl Moor, Fiesco, Tell und Don Carlos! Dieses Werk würde selbst Shakespeare zur Ehre gereichen. Du Armer! Wenn du es noch nicht gelesen hast, so lies doch wenigstens den Dialog zwischen August und Cinna, wo er ihm den Verrat vergibt (doch wie!). Du wirst sehen, daß nur gekränkte Engel so sprechen können. Besonders die Stelle, wo August sagt: » Soyons amis, Cinna«. Hast du seinen » Horace« gelesen? Höchstens noch bei Homer kannst du solche Gestalten finden! Der alte Horace ist ein Diomedes. Der junge Horace ist ein Ajax, Sohn des Telamon, doch mit dem Geiste eines Achilles; Curias ist Patrocles und Achilles in einer Person, er ist der Inbegriff der Liebessehnsucht und der Pflicht. Wie erhaben ist doch dies alles! Hast du » Le Cid« gelesen? Lies ihn, du Unglücksmensch, und falle in den Staub vor Corneille. Du hast ihn gelästert. Lies ihn unbedingt. Was ist überhaupt noch Romantik, wenn ihre höchsten Ideen nicht schon im Cid entwickelt sind? Wie wunderbar sind die Gestalten des Don Rodrigo, seines Sohnes und dessen Geliebten! Und erst der Schluß!
Nimm mir bitte meine verletzenden Äußerungen nicht übel, grolle mir nicht wie Iwan Iwanowitsch Pererepenko bei Gogol.
V. An den Bruder Michail, den 30. September 1844
[Anfangs ist die Rede von der Schillerübersetzung, die die beiden Brüder Dostojewskis herausgeben wollten.]
Ja, Bruder, ich weiß es selbst, daß meine Lage verzweifelt ist; ich will dir nun alles genau erklären.
Ich nehme den Abschied, weil ich nicht länger dienen kann. Das Leben freut mich nicht, wenn ich meine beste Zeit so sinnlos verschwenden muß. Im übrigen hatte ich nie die Absicht, lange im Dienst zu bleiben; warum soll ich meine besten Jahre verlieren? Die Hauptsache aber ist, daß man mich in die Provinz abkommandieren wollte; sage mir bitte selbst, was könnte ich ohne Petersburg anfangen? Wozu würde ich noch taugen? Du wirst mich sicher begreifen.
Wegen meines ferneren Lebens brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Ich werde immer meinen Lebensunterhalt finden können. Ich werde furchtbar viel arbeiten. Ich bin ja jetzt frei. Es fragt sich nur, was ich jetzt gleich anfangen soll. Denke dir nur, Bruder, ich habe achthundert Rubel Schulden; fünfhundertfünfundzwanzig Rubel schulde ich für die Miete (ich habe nach Hause geschrieben, daß ich eintausendfünfhundert Rubel Schulden habe, denn ich kenne die Leute: sie schicken mir immer ein Drittel von dem, was ich verlange). Niemand weiß noch, daß ich den Abschied nehme. Was soll ich nun anfangen, wenn ich nicht mehr im Dienste bin? Ich habe sogar kein Geld, um mir Zivilkleider zu kaufen. Ich quittiere den Dienst am 14. Oktober. Wenn ich nicht sofort Geld aus Moskau bekomme, bin ich verloren. Man wird mich in allem Ernst ins Gefängnis sperren (dies ist klar). Eine komische Lage.
[Weiter ist die Rede davon, wie sich D. Geld von seinen Angehörigen verschaffen will.]
Du sagst, meine Rettung sei das Drama. Bis es aufgeführt wird, vergeht viel Zeit. Und bis ich erst das Honorar bekomme, vergeht noch mehr Zeit. Ich habe aber den Abschied vor der Nase (mein Lieber, wenn ich das Abschiedsgesuch noch nicht eingereicht hätte, so hätte ich es jetzt getan; ich bereue gar nicht, daß ich es schon eingereicht habe). Ich habe noch eine Hoffnung. Ich vollende gerade einen Roman (»Arme Leute«) im Umfange von »Eugénie Grandet«. Der Roman ist recht originell. Ich schreibe ihn bereits ins Reine; am 14. werde ich wohl schon eine Antwort von der Redaktion haben. Ich will ihn in den »Vaterländischen Annalen« unterbringen. (Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden.) Ich werde dafür vielleicht vierhundert Rubel bekommen; dies ist meine ganze Hoffnung. Ich hätte dir gern ausführlicher über meinen Roman geschrieben, doch mir fehlt die Zeit. (Das Drama werde ich unbedingt unterbringen. Denn ich will davon leben.)
Die Moskauer sind unglaublich dumm, eingebildet und klugschwatzend. K. rät mir in seinem letzten Brief, ohne jeden ersichtlichen Grund, ich möchte mich nicht so sehr von Shakespeare hinreißen lassen. Er sagt, Shakespeare sei nur eine Seifenblase. Ich möchte, daß du diese lächerliche Gehässigkeit gegen Shakespeare begreifst. Warum bringt er plötzlich Shakespeare aufs Tapet? Den Brief hättest du sehen sollen, den ich ihm darauf geschrieben habe! Es ist ein Muster von polemischem Stil. Ich habe ihn wirklich gut abgefertigt. Meine Briefe sind Meisterwerke der »Lettristik«.
Bruder, schreib doch um Gottes willen sofort nach Hause. Meine Lage ist verzweifelt; der 14. Oktober ist der alleräußerste Termin; ich habe mein Gesuch vor eineinhalb Monaten eingereicht. Um Himmels willen! Schreibe ihnen, sie möchten mir das Geld sofort schicken. Es ist dringend, denn sonst werde ich keine Kleidung haben. Chlestakow (in Gogols Revisor) wollte gern ins Gefängnis gehen, doch nur »in allen Ehren«. Wie kann ich aber ohne Hose »in allen Ehren« ins Gefängnis gehen?
Meine Adresse: Neben der Wladimirkirche, Haus Prjanischnikow, Grafengasse. Dostojewskij.
Ich bin mit meinem Roman außerordentlich zufrieden. Ich bin außer mir vor Freude. Für den Roman werde ich sicher Geld bekommen; was aber weiter kommt ...
Verzeihe mir, daß dieser Brief so zusammenhanglos ist.
VI. An den Bruder Michail, den 24. März 1845
Du brennst wohl schon lange vor Ungeduld, liebster Bruder. Die Ungewißheit meiner Lage hinderte mich am Schreiben. Ich kann mich keiner Beschäftigung hingeben, wenn ich nichts als Ungewißheit vor Augen habe. Es ist mir noch immer nicht gelungen, meine Angelegenheiten irgendwie zu ordnen; ich will dir aber trotz dieser Ungewißheit schreiben; denn ich habe dir schon so lange nicht geschrieben.
Ich habe von den Moskauern fünfhundert Rubel bekommen. Ich hatte aber so viel alte und neue Schulden, daß das Geld mir für den Druck nicht langte. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Ich könnte ja das Geld der Druckerei schuldig bleiben, oder die Schulden zu Hause nur zum Teil bezahlen; der Roman war aber noch nicht fertig. Ich hatte ihn ja noch im November fertig geschrieben, im Dezember beschloß ich aber, ihn gänzlich umzuarbeiten; ich habe ihn umgearbeitet und ins Reine geschrieben; doch im Februar begann ich wieder zu feilen, zu polieren, einzelne Stellen zu streichen und andere neu einzufügen. Gegen Mitte März war ich damit fertig und mit meiner Arbeit zufrieden. Nun kam etwas Neues dazwischen: die Zensur braucht einen ganzen Monat zum Lesen. Schneller geht es nicht. Die Zensurbeamten sind angeblich mit Arbeit überladen. Ich wußte nicht, was ich anfangen sollte und habe mir das Manuskript zurückgeben lassen. Denn außer den vier Wochen für die Zensur mußte ich noch weitere drei Wochen für den Druck rechnen. Das Buch könnte also frühestens im Mai erscheinen. Das wäre zu spät! Da begann man, mich von allen Seiten zu bestürmen, ich möchte den Roman an die »Vaterländischen Annalen« schicken. Das wäre Unsinn. Ich müßte es sicher bereuen. Erstens würden sie das Manuskript gar nicht lesen, und wenn sie es auch lesen würden, so doch nicht vor einem halben Jahre. Sie haben auch ohnehin genug Manuskripte liegen. Und wenn sie das Werk auch drucken, so bekomme ich dafür keinen Heller. Denn bei dieser Zeitschrift herrscht eine wahre Oligarchie. Was brauche ich den Ruhm, wenn ich des täglichen Brotes wegen schreibe? Ich habe einen verzweifelten Entschluß gefaßt: noch weiter warten und unter Umständen neue Schulden machen; gegen den 1. September, wenn alle nach Petersburg umgezogen sind und wie die Spürhunde nach Neuem suchen, will ich versuchen, für die letzten Kopeken, die möglicherweise gar nicht reichen werden, den Roman drucken zu lassen. Wenn ich das Werk in eine Zeitschrift gebe, so komme ich unter das Joch nicht nur des ersten Maître d'hôtel, sondern auch aller Küchenmägde und Küchenjungen, die überall, wo die Kultur gemacht wird, nisten. Es gibt dort mehr als einen Diktator: es sind ihrer zwanzig. Wenn ich aber das Werk auf eigene Kosten drucke, so kann ich mir mit meiner eigenen Kraft den Weg bahnen; und wenn das Werk gut ist, so wird es nicht verloren gehen; es wird mich sogar vor den Schulden und Nahrungssorgen retten.
Und nun von den Nahrungssorgen! Du weißt ja, Bruder, daß ich in dieser Beziehung auf meine eigenen Kräfte angewiesen bin. Ich habe mir aber geschworen, wie schlecht es mir auch gehen möge, mich zusammenzunehmen und unter keinen Umständen auf Bestellung zu schreiben. Bestellte Arbeit wird mich erdrücken und verderben. Ich will, daß jedes meiner Werke unzweifelhaft gut sei. Sieh dir nur Puschkin und Gogol an. Beide haben sehr wenig geschrieben, sich aber Denkmäler verdient. Gogol bekommt schon jetzt für den Druckbogen tausend Rubel, Puschkin hat aber, wie du wohl weißt, für jede Verszeile einen Dukaten bekommen. Beide, besonders aber Gogol, haben ihren Ruhm mit Jahren bitterer Not erkauft. Die alte Schule geht zugrunde; die neue Schule schreibt aber nicht: sie schmiert. Das ganze Talent wird für einen breiten Schwung verschwendet, in dem man nur eine unfertige ungeheuerliche Idee und kolossale Muskelkraft entdecken kann; es steckt aber fast gar keine ernsthafte Arbeit darin. Béranger sagte von den modernen französischen Feuilletonisten, ihre Arbeit sei wie eine Flasche Chambertin in einem Eimer Wasser. Bei uns ahmt man sie nach. Raffael arbeitete an jedem Bild viele Jahre und feilte an jedem Detail lange herum; so schuf er Wunderwerke. Unter seinem Pinsel entstanden Götter! Heute malt Vernet in einem Monat ein Bild fertig, das einen eigens dazu erbauten riesengroßen Saal erfordert; die Perspektive ist großartig, der Schwung kolossal; ernsten Wert hat aber das Bild für keinen Heller. Sie alle sind nichts als Dekorationsmaler.
Mit meinem Roman bin ich wirklich zufrieden. Es ist ein ernstes und gut ausgebautes Werk. Es hat aber auch entsetzliche Mängel. Der Druck wird mich für alles belohnen. Jetzt, solange ich keine neuen Ideen habe, möchte ich gern irgend etwas schreiben, um mich beim Publikum einzuführen, oder auch nur des Geldes wegen; ich habe aber wirklich keine Lust, etwas Wertloses zu schreiben; zu Ernstem brauche ich aber viel Zeit.
Es naht die Zeit, die ich mit euch, meine lieben Freunde, verleben wollte. Ich werde aber keine Mittel, d. h. kein Geld haben. Ich habe beschlossen, in der alten Wohnung zu bleiben. Hier habe ich wenigstens einen Vertrag mit dem Vermieter und brauche mich sechs Monate lang um nichts zu bekümmern. Die Sache ist eben die, daß mein Roman alles decken soll. Wenn mir dies nicht gelingt, werde ich mich aufhängen.
Ich möchte mir bis zum August wenigstens dreihundert Rubel sparen. Ich kann das Buch auch für dreihundert Rubel drucken. Die Rubel laufen aber wie die Krebse nach allen Richtungen auseinander. Ich hatte gegen vierhundert Rubel Schulden (die neuen Ausgaben und Kosten der Kleidung inbegriffen); nun bin ich für mindestens zwei Jahre anständig gekleidet. Ich werde übrigens unbedingt zu euch kommen. Schreibe mir möglichst gleich, was du dir über meine Wohnung denkst. Es ist ein entscheidender Schritt. Was soll ich aber tun?
Du schreibst, es graue dir vor der Zukunft ohne Geld. Schiller wird aber alles decken, außerdem kann ja auch mein Roman etwas einbringen. Schreibe mir bald. Mit der nächsten Post werde ich dir alle meine Entschlüsse mitteilen.
Dein Bruder Dostojewskij.
Küsse von mir die Kinder und grüße Emilie Fjodorowna (Frau des Michail Dostojewskij.). Ich denke oft an euch. Es interessiert dich vielleicht, was ich treibe, wenn ich nicht schreibe: ich lese. Ich lese sehr viel, und die Lektüre hat auf mich eine seltsame Wirkung. Wenn ich irgend etwas, was ich schon vor Jahren einmal gelesen habe, wieder lese, so spüre ich in mir neue Kräfte; ich dringe in das Buch tief ein, begreife alles und schöpfe daraus auch Schaffenskraft für mich.
Vom Dramenschreiben will ich nichts wissen. Dazu brauche ich jahrelange Ruhe und Mühe. Es ist ja heute so leicht, Dramen zu schreiben. Das Drama neigt jetzt zum Melodrama. Shakespeare verschwindet im Nebel und erscheint im Dunste des elenden modernen Dramas wie ein Gott, wie ein Brockengespenst. Im Sommer werde ich vielleicht doch noch versuchen, etwas zu schreiben. Wollen wir noch zwei oder drei Jahre abwarten! Bruder, in literarischer Beziehung bin ich nicht mehr derselbe, der ich vor zwei Jahren war. Damals war alles Kinderei und Unsinn. Die zwei Jahre ernsten Studiums haben mir vieles genommen und vieles eingebracht.
Im »Invalid« las ich soeben im Feuilleton von den deutschen Dichtern, die an Hunger, Kälte oder in Irrenhäusern gestorben sind. Es sind im ganzen an die zwanzig; und was für Namen sind darunter! Mir ist auch jetzt noch unheimlich zumute. Man sollte wirklich ein Scharlatan sein ...
VII. An den Bruder Michail, den 4. Mai 1845
Liebster Bruder! Verzeihe, daß ich dir wieder so lange nicht geschrieben habe. Ich habe noch immer verdammt viel zu tun. Mein Roman, den ich unmöglich loswerden kann, macht mir unendlich viel zu schaffen; wenn ich es vorher gewußt hätte, so hätte ich ihn wohl gar nicht angefangen. Ich habe mich entschlossen, ihn wieder umzuarbeiten; er hat dadurch, bei Gott, sehr viel gewonnen. Jetzt bin ich auch damit fertig, und diese Neubearbeitung ist wirklich die allerletzte. Ich habe mir das Wort gegeben, ihn nicht wieder anzurühren. Es ist schon einmal das Schicksal aller Erstlingswerke, daß man sie unzähligemal abändert. Ich weiß nicht, ob Chateaubriands »Atala« sein Erstlingswerk war, ich weiß aber, daß er dieses Werk siebzehnmal umgearbeitet hat. Puschkin verfuhr so auch mit ganz kurzen Gedichten. Gogol pflegte seine wundervollen Werke zwei Jahre lang zu feilen; und wenn du die »Empfindsame Reise«, ein winziges Buch, von Sterne gelesen hast, so wirst du dich wohl erinnern können, was Walter Scott in seiner Notiz über Sterne, mit Berufung aus Sternes Diener La Fleur sagt. La Fleur behauptet, sein Herr hätte etwa hundert Buch Papier mit der Schilderung seiner Reise durch Frankreich vollgeschrieben. Nun fragt es sich, was aus dieser Menge Papier geworden ist. Das Ganze ergab ein Büchlein, zu dem ein sparsamer Schreiber, wie z. B. Pljuschkin (Anmerkung des Überestzers: Gestalt aus Gogols »Toten Seelen«; personifizierter Geiz.), ein halbes Buch Papier verwendet hätte. Ich begreife gar nicht, wieso dieser selbe Walter Scott in wenigen Wochen so vollendete Werke wie »Mannering« fertigstellen konnte. Vielleicht nur, weil er um jene Zeit vierzig Jahre alt war.
Ich weiß gar nicht, Bruder, was aus mir werden soll! Du urteilst falsch, wenn du behauptest, daß mich meine Lage gar nicht bedrückt. Sie peinigt mich entsetzlich, und ich kann oft nächtelang vor den quälenden Gedanken nicht einschlafen. Verständige Leute sagen mir, daß ich zugrunde gehe, wenn ich den Roman als Buch herausgebe. Sie sagen zwar, das Buch werde sehr gut sein, ich sei aber kein Kaufmann ... Die Buchhändler seien Wucherer; sie würden mich selbstverständlich ausbeuten, und ich würde totsicher hereinfallen.
Aus diesem Grunde habe ich doch den Entschluß gefaßt, den Roman in einer Zeitschrift, z. B. in den »Vaterländischen Annalen« unterzubringen. Die »Vaterländischen Annalen« haben eine Auflage von zweitausendfünfhundert Exemplaren, folglich werden sie von mindestens hunderttausend Leuten gelesen. Wenn ich den Roman in dieser Zeitschrift erscheinen lasse, so ist meine literarische Zukunft und mein ganzes Leben gesichert. Ich kann dabei leicht mein Glück machen. Ich bekomme dann ständigen Zutritt in die »Vaterländischen Annalen«, und habe immer Geld; wenn mein Roman im August- oder im Septemberheft erscheint, kann ich ihn im Oktober noch als Buch auf eigene Rechnung herausgeben, und zwar mit der sicheren Aussicht, daß alle, die überhaupt Romane kaufen, ihn sich anschaffen werden. Außerdem werden mich auch die Anzeigen nichts kosten. Ja, so stehen die Sachen!
Ehe ich den Roman untergebracht habe, kann ich nicht nach Reval kommen; ich will nicht die Zeit umsonst vergeuden. Ich darf keine Mühe scheuen. Ich habe noch eine Reihe neuer Ideen, die mir einen literarischen Namen verschaffen werden, sobald mein erster Roman untergebracht ist. Dies sind alle meine Aussichten für die Zukunft.
Was aber das Geld betrifft, so habe ich leider keines. Der Teufel weiß, wo es hingekommen ist. Dafür habe ich wenig Schulden ...
Wenn ich den Roman einmal untergebracht habe, wird es mir auch ein leichtes sein, deine Schillerübersetzung unterzubringen, so wahr ich lebe! Der »Ewige Jude« ist nicht übel. Sue scheint mir übrigens recht beschränkt zu sein.
Ich spreche nicht gern davon, lieber Bruder, doch deine Lage und das Schicksal deines Schiller quälen mich so sehr, daß ich oft meine eigene Lage vergesse. Und ich habe es wirklich nicht leicht.
Wenn ich den Roman nicht unterbringe, so gehe ich vielleicht in die Newa. Was soll ich denn tun? Ich habe mir schon alles überlegt! Ich werde den Tod meiner fixen Idee nicht überleben können!
Schreibe mir bald, denn ich langweile mich.
VIII. An den Bruder Michail, den 8. Oktober 1845
Liebster Bruder! Ich hatte bisher weder Zeit noch die nötige Stimmung, um dir irgend etwas von meinen eigenen Angelegenheiten zu schreiben. Alles war ekelhaft und häßlich und die ganze Welt ödete mich an. Erstens hatte ich während der ganzen Zeit kein Geld und lebte auf Kredit, was höchst unangenehm ist, mein lieber und einziger Freund. Zweitens war ich auch sonst in jener schlechten Stimmung, bei der man jeden Mut verliert, doch nicht in stumpfe Gleichgültigkeit verfällt, sondern, was viel schlimmer ist, viel zu viel an sich selbst denkt und unbändig wütet. Anfangs dieses Monats besuchte mich Nekrassow (Anmerkung des Übersetzers: Nikolai Alexejewitsch Nekrassow (1821-77), namhafter Dichter liberaler Tendenz, leitete 1846-66 die von Puschkin begründete Monatsschrift »Ssowremennik« (= Der Zeitgenosse)). und zahlte mir einen Teil seiner Schuld zurück; den Rest bekomme ich in einigen Tagen. Ich muß dir sagen, daß Bjelinskij (Anmerkung des Übersetzers: Wissarion Grigorjewitsch Bjelinskij (1810-48), hervorragendster russischer Kritiker extrem-liberaler Richtung.) mir vor vierzehn Tagen eine umfassende Belehrung erteilt hat, wie man sich in unserer literarischen Welt einleben kann; schließlich erklärte er mir, daß ich um meines Seelenheiles willen nicht weniger als zweihundert Rubel für den Druckbogen verlangen darf. Mein Goljädkin (»Der Doppelgänger.«) würde mir in diesem Falle mindestens fünfzehnhundert Rubel einbringen. Nekrassow, den offenbar Gewissensbisse peinigten, kam ihm zuvor und versprach mir zum 15. Januar hundert Rubel für meinen Roman »Arme Leute«, den er von mir erworben hat. Er mußte mir selbst gestehen, daß ein Honorar von hundertfünfzig Rubel durchaus unchristlich sei; er hat es mir auch um hundert Rubel erhöht. Dies alles ist ja recht schön. Sehr unangenehm ist mir aber, daß ich noch immer keine Nachricht von der Zensur wegen der »Armen Leute« habe. Sie verschleppen diesen unschuldigen Roman, und ich weiß gar nicht, womit das enden wird. Und wenn sie ihn verbieten? Oder gänzlich zusammenstreichen? Es ist ein wahres Unglück; Nekrassow sagt mir aber, daß der Almanach nicht rechtzeitig wird erscheinen können und daß ihn dieses Unternehmen bereits viertausend Rubel kostet.
Jakow Petrowitsch Goljädkin ist ein Charakter. Er ist durch und durch gemein, und ich kann mit ihm wahrlich nicht fertig werden. Er will nicht vorwärts kommen, denn er behauptet, er sei noch immer nicht fertig; er sei noch nichts, könne aber, wenn es notwendig ist, auch seinen wahren Charakter zeigen; warum denn nicht? Im übrigen sei er nicht ärger als die andern. Was geht ihn meine Arbeit an! Ein furchtbar gemeiner Kerl! Vor Mitte November will er unter keinen Umständen seine Karriere abschließen. Er hat bereits eine Unterredung mit Seiner Exzellenz gehabt und ist nicht abgeneigt, den Abschied zu nehmen; warum auch nicht? Doch mich, seinen Autor, versetzt er in eine peinliche Lage.
Ich komme oft zu Bjelinskij. Er ist mir über alle Maßen gewogen und sieht in mir eine Rechtfertigung seiner Ansichten vor dem Publikum. Ich habe neulich Kroneberg, den Übersetzer Shakespeares (er ist ein Sohn des alten Professors aus Charkow) kennen gelernt. Meine Zukunft (und zwar die nächste Zukunft) kann sich im allgemeinen recht günstig gestalten, kann aber auch entsetzlich schlecht werden. Bjelinskij treibt mich an, meinen Goljädkin fertig zu schreiben. Er hat schon in der ganzen literarischen Welt Gerüchte über diesen Roman verbreitet und ihn beinahe an Krajewskij (Anmerkung des Übersetzers: Herausgeber der »Vaterländischen Annalen«.) verkauft. Von den »Armen Leuten« spricht bereits das halbe Petersburg. Großartig ist ein Ausspruch von Grigorowitsch (Anmerkung des Übersetzers: Dmitrij Wassiljewitsch Grigorowitsch (1822-99), beliebter Schriftsteller, Verfasser zahlreicher Romane und Novellen. Kollege Dostojewskijs in der Ingenieurschule.). Er hat mir selbst gesagt Je suis votre claqueur-chauffeur!«
Nekrassow ist ein echter Schwindler; anders würde er gar nicht existieren können; es ist ihm schon so angeboren. Gleich nach seiner Ankunft kam er abends zu mir und entwickelte das Projekt eines kleinen fliegenden Almanachs, an dem die ganze literarische Gemeinde nach Kräften mitarbeiten soll; an der Spitze der Redaktion sollen aber ich, Grigorowitsch und Nekrassow stehen. Der letztere will die Kosten tragen. Der Almanach soll zwei Druckbogen stark sein und alle vierzehn Tage erscheinen: am 7. und 21. jeden Monats. Er soll »Suboskal« (Der Spötter) heißen. Wir wollen alles schonungslos verspotten und auslachen, Theater, Zeitschriften, Gesellschaft, Literatur, Tagesereignisse, Ausstellungen, Zeitungsmeldungen, Nachrichten aus dem Auslande, mit einem Worte alles; das Ganze soll in einer Richtung und einem Geiste geschrieben werden. Das erste Heft soll am 7. November erscheinen. Dieses Heft ist wunderbar zusammengestellt. Erstens wird es auch Illustrationen bringen. Als Motto nehmen wir die berühmten Worte Bulgarins (Anmerkung des Übersetzers: Faddej Bulgarin (1789-1859), Journalist, stand im Solde der Polizei und war als Denunziant und Lockspitzel gehaßt und gefürchtet.) aus seinem Feuilleton in der »Nordischen Biene«: »Wir sind bereit, für die Wahrheit zu sterben, denn wir können nicht ohne Wahrheit leben usw.« Darunter setzen wir die Unterschrift Faddej Bulgarin. Mit dem gleichen Motto wird auch die Anzeige versehen sein, die am 1. November erscheinen wird. Das erste Heft wird folgende Beiträge enthalten: einen Aufsatz Nekrassows »Über gewisse Petersburger Gemeinheiten« (die selbstverständlich erst in diesen Tagen geschehen sind). Den zukünftigen Roman von Eugène Sue: »Die sieben Todsünden« (der ganze Roman umfaßt drei Seiten). Eine Übersicht aller Zeitschriften. Einen Vortrag Schewyrjows über Puschkins Verse: sie sind so harmonisch, daß, als Schewyrjow einmal im Coliseum zu Rom in Damengesellschaft einige Strophen Puschkins rezitierte, alle Frösche und Eidechsen, die im Coliseum hausen, hervorgekrochen waren, um die wunderbaren Verse zu hören. (Schewyrjow hat eine solche Vorlesung in der Moskauer Universität gehalten.) Dann kommt ein Bericht über die letzte Sitzung der Gesellschaft der Slawophilen, in der feierlich bewiesen wurde, daß Adam ein Slawe war und in Rußland gelebt hatte; bei dieser Gelegenheit wird auf die Bedeutung und den Nutzen der Lösung dieser großen sozialen Frage für das Wohlergehen der ganzen russischen Nation hingewiesen werden. In der Kunstchronik wird sich unser »Suboskal« mit der »Illustration« Kukolniks solidarisch erklären und sich dabei ganz besonders auf folgende Stelle in dieser Zeitschrift berufen: (es ist bekannt, daß die »Illustration« so schlecht redigiert und korrigiert wird, daß auf dem Kopf stehende Buchstaben und durcheinandergekommene Worte eine ganz normale Erscheinung sind). Grigorowitsch wird eine »Wochenchronik« schreiben und darin einige seiner Wahrnehmungen zum besten geben. Ich werde »Notizen eines Lakaien über seinen Herrn« schreiben. Die Zeitschrift wird, wie du siehst, recht lustig werden; etwas in der Art der »Guèpes« von Alphonse Carre. Das Unternehmen ist glänzend, denn auf mich allein werden monatlich im ungünstigsten Falle hundert bis hundertfünfzig Rubel kommen. Das Buch wird Erfolg haben. Nekrassow will sich auch mit Versen beteiligen.
... Lies unbedingt »Teverino« (von George Sand in den »Vaterländischen Annalen«, Oktober). Dergleichen hat es in unserem Jahrhundert noch nicht gegeben. Es kommen darin wahre Urbilder von Menschen vor ...
IX. An den Bruder Michail, den 16. November 1845
Liebster Bruder! Ich schreibe dir in aller Eile, da meine Zeit sehr knapp ist. Goljädkin ist noch immer nicht fertig; ich muß ihn aber unbedingt zum 25. fertig schreiben. Du hast mir so lange nicht geschrieben, daß ich bereits um dich besorgt war. Schreibe mir doch öfter; was du über Zeitmangel schreibst, ist Unsinn. Braucht man denn wirklich viel Zeit, um einen Brief zu schreiben? Das Provinzleben mit dem ewigen Nichtstun richtet dich einfach zugrunde, mein Liebster; das ist alles.
Ja, Bruder, ich glaube, mein Ruhm steht jetzt in seiner höchsten Blüte. Man bringt mir überall unglaubliche Achtung und kolossales Interesse entgegen. Ich habe eine Menge höchst anständiger Menschen kennen gelernt. Fürst Odojewskij bittet mich um die Ehre meines Besuches, und Graf Ssollogub rauft sich vor Verzweiflung die Haare aus. Panajew hat ihm erklärt, es gäbe ein neues Talent, vor dem sie alle verschwänden. S. lief lange herum, besuchte u. a. Krajewskij und fragte ihn ganz unvermittelt: »Wer ist Dostojewskij? Wo kann ich Dostojewskij erwischen?« Krajewskij, der vor niemand Respekt hat und alle schneidet, gab ihm zur Antwort: »Dostojewskij wird wohl nicht geneigt sein, Ihnen das Glück und die Ehre seines Besuches zu schenken.« Es stimmt ja wirklich: der Junker steigt nun aufs hohe Roß und glaubt, mich mit seiner Huld vernichten zu können. Alle betrachten mich als ein Weltwunder. Wenn ich nur den Mund aufmache, so hallt es gleich in allen Ohren nach, was Dostojewskij gesagt hat, was Dostojewskij zu tun beabsichtigt. Bjelinskij liebt mich über alle Maßen. Der Dichter Turgenjew, der soeben aus Paris zurückgekehrt ist, hat sich mir gleich am ersten Tage in inniger Freundschaft angeschlossen, und Bjelinskij behauptet, Turgenjew hätte sich in mich verliebt. T. ist ein wirklich herrlicher Mensch! Auch ich bin in ihn beinahe verliebt. Ein hochbegabter Dichter, Aristokrat, schön, reich, klug, gebildet und erst fünfundzwanzig Jahre alt; ich weiß wirklich nicht, was er sich vom Schicksal noch wünschen könnte. Außerdem hat er einen ungemein aufrichtigen, schönen, wohl beherrschten Charakter. Lies doch seine Novelle »Andrej Kolossow« in den »Vaterländischen Annalen«. Der Held dieser Novelle ist er selbst, obwohl er gar nicht die Absicht hatte, sich selbst zu schildern.
Ich bin noch immer nicht reich, obwohl ich auch nicht über Not klagen kann. Neulich saß ich ganz ohne Geld. Nekrassow hat inzwischen den Plan gefaßt, einen reizenden humoristischen Almanach »Suboskal« herauszugeben; die Anzeige habe ich geschrieben. Diese Anzeige hat großes Aufsehen erregt; denn es ist der erste Versuch, ähnliche Erzeugnisse in einem leichten und humoristischen Stil zu schreiben. Diese Anzeige erinnert mich an das erste Feuilleton des Lucien de Rubempré (Anmerkung des Übersetzers: In den » Illusions perdues« von Balzac.). Meine Anzeige ist bereits in den »Vaterländischen Annalen« und in den »Vermischten Nachrichten« erschienen. Ich habe für diese Arbeit zwanzig Rubel bekommen. Als ich neulich so ganz ohne Geld war, besuchte ich Nekrassow. Während ich bei ihm saß, kam mir die Idee, einen Roman in neun Briefen zu schreiben. Nach Hause zurückgekehrt, schrieb ich den Roman in einer Nacht fertig; sein Umfang beträgt einen halben Bogen. Am Morgen brachte ich das Manuskript zu Nekrassow und bekam dafür hundertfünfundzwanzig Rubel; der »Suboskal« zahlt mir also für den Bogen zweihundertfünfzig Rubel. Am Abend wurde mein Roman in unserem Kreise, d. h. vor zwanzig Anwesenden vorgelesen und hatte einen kolossalen Erfolg. Er wird im ersten Heft des »Suboskal« erscheinen. Ich werde dir das Heft am 1. Dezember schicken. Bjelinskij sagte mir, er sei jetzt meiner sicher, denn ich hätte die Fähigkeit, die verschiedenartigsten Elemente in Angriff zu nehmen. Als Krajewskij neulich hörte, daß ich kein Geld habe, bat er mich ganz ergebenst, von ihm ein Darlehen von fünfhundert Rubel anzunehmen. Ich glaube, daß ich von ihm zweihundert Rubel für den Bogen bekommen werde.
Ich habe eine Menge neuer Ideen; wenn ich aber auch nur etwas irgend jemand, z. B. Turgenjew anvertraue, wird es schon morgen in allen Ecken und Enden von Petersburg heißen, daß Dostojewskij dies und das schreibt. Ja, Bruder, wenn ich dir alle meine Erfolge aufzählen wollte, so würde mir das Papier dazu nicht ausreichen. Ich glaube, daß ich bald viel Geld haben werde. Goljädkin gerät mir großartig; es wird mein Meisterwerk werden. Gestern war ich zum ersten Male bei P. und habe mich, wie mir scheint, in seine Frau verliebt. Sie ist klug und schön, dabei liebenswürdig und ungewöhnlich aufrichtig. Ich vertreibe mir die Zeit gut. Unser Kreis ist sehr groß. Ich schreibe aber nur über mich selbst, verzeihe es mir, Liebster; ich will dir aufrichtig sagen, daß ich jetzt von meinem Ruhm gänzlich berauscht bin. Mit meinem nächsten Brief werde ich dir den »Suboskal« schicken. Bjelinskij sagt, ich profanierte mich, wenn ich am »Suboskal« mitarbeitete.
Leb wohl, Freund. Ich wünsche dir Glück. Ich gratuliere dir zu der Beförderung. Ich küsse deiner Emilie Fjodorowna die Hände und umarme deine Kinder. Wie geht es ihnen?
Dein Dostojewskij.
Bjelinskij hält mir die Verleger vom Leibe. Ich habe diesen Brief durchgelesen und festgestellt, daß ich erstens fürchterlich schreibe und zweitens ein Prahlhans bin.
Leb wohl und schreibe mir um Gottes willen.
Unser Schiller wird sicher zustande kommen. Bjelinskij lobt unsere Absicht, das gesamte Werk Schillers herauszugeben. Ich glaube, daß ich die Arbeit mit der Zeit günstig unterbringen werde; vielleicht bei Nekrassow.
Lebe wohl.
Alle die Minnchen, Klärchen, Mariannchen usw. sind unglaublich hübsch geworden, doch kosten sie eine Menge Geld. Turgenjew und Bjelinskij haben mich neulich wegen meines unordentlichen Lebenswandels ausgeschimpft. Diese Herren wissen gar nicht, wie sie mir ihre Liebe bezeugen können; sie sind alle in mich verliebt.