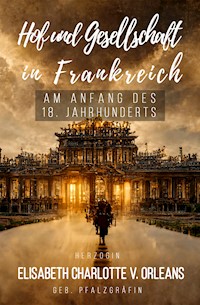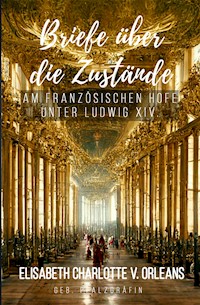
Briefe über die Zustände am französischen Hofe unter Ludwig XIV. E-Book
Elisabeth Charlotte v. Orleans
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herzogin von Orléans und Schwägerin von König Ludwig XIV. fiel kurz nach ihrer Ankunft am französischen Hofe in königliche Ungnade. Trotz Intrigen und der Gefahr einer völligen Verbannung erlangte Prinzessin von der Pfalz allmählich die Gunst des Königs zurück. Die Schreiblust der Prinzessin spiegelt sich in etwa 3.900 Briefen wider, in denen sie unverblümt und humorvoll über das Leben am königlichen Hofe berichtet. 236 ausgewählte Briefe sind in diesem Buch zu finden. Neben Intrigen, Komplotten und Verwicklungen findet auch der adelige Alltag genügend Erwähnung. Die Mode der Zeit. Am französischen Hof turmhohe Frisuren. Die Fahrzeuge wuchsen in die Höhe, um den Damen den ungehinderten Einstieg zu gewähren. Anderenorts, am Zarenhof putzte man sich modern die Nase mit den Fingern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Briefe über die Zustände
am französischen Hofe
unter Ludwig XIV.
Ausgewählt aus den Jahren 1672-1720
und herausgegeben von Rudolf Friedemann
von
Elisabeth Charlotte v. Orleans
______
Erstmals erschienen im:
Franck’sche Verlagshandlung,
Stuttgart, 1913
_______
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2019 Klarwelt Verlag
ISBN: 978-3-96559-193-6
www.klarweltverlag.de
Elisabeth Charlotte von Orleans.
Nach dem Gemälde von H. Rigaud, gestochen von Ch. Simmoneau.
Inhalt
Titel
Vorwort
Briefe
Vorwort
ie wird man den Charakter einer Zeit leichter und richtiger erkennen können als aus Briefen und unmittelbaren Mitteilungen urteilsfähiger Menschen. Keine wissenschaftliche Untersuchung, keine langatmige Schilderung vermag so lebendige Bilder aus vergangenen Jahrhunderten so schnell und anschaulich zu entrollen wie ein Scherz, ein lachend Wort, der kurze Bericht selbsterlebter, oft auch beweinter Ereignisse. Dem Vorzuge ihrer lebhaften Sprache, in der die als deutsche Pfalzgräfin geborene und erzogene Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans über die Sitten und ihre Beobachtungen und Erlebnisse am Hofe des Sonnenkönigs plaudert, verdanken es ihre Briefe ganz besonders, daß sie immer wieder von den Geschichtsschreibern, wie Ranke, Schütz, Menzel u. a. m. um Rat befragt wurden und auch heute noch als unversiegbare Quelle historischer Wahrheit in Anspruch genommen werden. Wohl melden sich hier und da Zweifler, die manches Urteil von Antipathie beeinflußt wähnen oder es auf leichtfertige Zuträgereien und Hofklatsch zurückführen möchten, besonders wo es sich um Frau von Maintenon handelt. An der subjektiven Wahrheit der Briefe aber zweifelt niemand, und ihre Reichhaltigkeit und frische, natürliche Sprache ließ schon oft den Wunsch erstehen, sie im Auszuge auch dem großen Publikum in allgemeinverständlicher Form zugänglich zu machen. Diesem Gedanken entsprang die Anregung zu dem vorliegenden Auszuge der Briefe, deren chronologische Anordnung nur durch die Einschaltung wichtiger Dokumente späterer mitteilsamerer Jahre aus den bisher nur einmal gedruckten Briefen an die Prinzessin von Wales, Gemahlin des nachmaligen Königs Georg II. von England, unterbrochen wurde. Bei möglichster Wahrung der ursprünglichen Orthographie wurden, jedoch meist in Klammer [ ], einige Modernisierungen und Übersetzungen eingestreuter französischer Worte vorgenommen; das Verständnis erleichternde Zusätze erschienen ebenfalls häufig geboten.
Bei der Auswahl der Briefstellen, die inhaltlich bis zum Beginn der Witwenschaft der Briefschreiberin (1701) reichen, war die Absicht maßgebend, nicht so eigentlich ein Lebensbild Elisabeth Charlottes als gleichsam in Tagebuchblättern der an der Quelle politischer und kulturhistorisch wichtiger Zeitströmungen lebenden klugen und hochgebildeten Frau einen Beitrag zur Sittengeschichte des französischen Hofes zu geben, dessen tiefe, häßliche Schatten und schaudervolle Nachtseiten sich in dem tugendklaren, fleckenlosen, treuen, wahrhaften und reinen Charakter der deutschen Fürstin deutlich abspiegeln. Ein zu inniger Teilnahme zwingendes Lebensbild der Herzogin entwickelt sich daneben ganz von selbst.
Um die in den Briefen berührten Beziehungen leichter verständlich zu machen und die Person der Briefschreiberin wie die Persönlichkeit der Adressaten überhaupt dem Leser näher zu bringen, scheint eine kurze Einführung wohl angebracht.
* *
*
„Habt Acht, Lisette, daß Ihr es nicht wie gewöhnlich macht und Euch so verlauft, daß man Euch nicht finden kann! — Liselott! Ihr müßt nicht so wild sein!“ Wie oft mögen wohl diese und gleichartige Ermahnungen dem übermütigen, am 27. Mai 1652 geborenen Töchterchen Elisabeth Charlotte des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz zu teil geworden sein. Eine „wilde Hummel“ war die kleine schmächtige, nicht gar schöne Prinzessin, wenn sie im Heidelberger Schloß herumtollte, so recht wie ein wilder Junge. „Ich bin mein Lebtag lieber mit Degen und Flinten umgegangen als mit Puppen; wäre gar zu gern ein Junge gewesen“ und „In meiner Jugend bin ich sehr lustig gewesen. Davon ist mir der Name: Rauschenplattenknecht überkommen“ schreibt sie noch in ihrem Alter und denkt mit Wehmut an ihre schöne, goldige Jugend.
Von größerer Wichtigkeit für ihre Erziehung und Charakterbildung als die Spiele in Heidelberg wurde für Liselotte der Aufenthalt am Hofe ihrer Tante Sophie, der Fürstin von Hannover, wo sie bis zu ihrem 9. Lebensjahre blieb, und der Einfluß des strengen, aber liebevollen Fräuleins von Uffeln, der späteren Frau von Harling. Herbeigeführt wurde diese Übersiedelung durch die nicht glücklichen Verhältnisse, die am Heidelberger Hofe herrschten, seit der Kurfürst dort neben seiner Gemahlin Charlotte, einer gebotenen Prinzessin von Hessen-Kassel, sich die Baronesse Marie Luise von Degenfeld zur linken Hand hatte antrauen lassen. Die Raugräfinnen Luise und Amalie Elisabeth und der Raugraf Karl Ludwig, an die viele von den nachfolgenden Briefen gerichtet waren, sind die Halbgeschwister Liselottes aus dieser zweiten Ehe ihres Vaters, der im ganzen 13 Kinder entsprangen.
Was für eine wichtige Rolle Frau von Harling und ihre Tante Sophie in dem Leben Liselottes spielten, wird aus den Briefen selbst deutlich hervorgehen. Ihr Herzblut gäbe sie gern für ihre Tante, und von ihrer „herzlieben Jungfer Uffeln“ schreibt sie wiederholt: „Was ich Gutes und Rühmliches besitze, das verdanke ich ihr und meiner guten Tante.“
Ein goldiges Gemüt hatte die junge Pfalzgräfin und einen lauteren, festen Charakter, dessen Stärke sich auch bis zu ihrem Tode darin zeigte, daß sie allzeit, unter allen Umständen und in allen Lebenslagen wahrheitsliebend und natürlich war, alle Heuchelei und Künstelei vom Grunde ihrer Seele haßte; und dieser Haß der Lüge erstreckte sich auch, soweit sie am Hofe Ludwigs XIV. über sich selbst verfügen konnte, auf die vielleicht in jener Zeit noch mehr als sonst mächtigen kleinen weiblichen Eitelkeiten in der Kleidung, der Frisur und dem Schmuck. Nie wollte sie etwas anderes scheinen, als was sie war.
Tiefe Wahrhaftigkeit ließ die kaum 18jährige Liselotte auch an zwei Freier, den Herzog von Kurland, um dessen Liebe zu der Prinzessin Maria von Württemberg sie wußte, und den Markgrafen von Durlach, vor der offiziellen Werbung, aber in wünschenswertester Deutlichkeit Körbe austeilen. Ein unglückseliges Geschick zwang sie kurz darauf, im Jahre 1671, ohne Liebe, die sie unter diesen Umständen überhaupt wohl nie in ihrem Leben gefühlt hat, den Bruder Ludwigs XIV., den Herzog Philipp von Orléans, zu heiraten — in höherem politischem Interesse. Ohne Murren und ohne den Versuch eines Widerspruchs gehorchte sie mutig ihrem geliebten Vater, der durch diese Verbindung mit dem mächtigen Herrscher Frankreichs die Zukunft seines Landes sichern wollte. Ludwig XIV. aber wollte sich gerade mit dieser Heirat die rechtliche Grundlage zu dehnbaren Ansprüchen auf deutsche Länder schaffen.
„Hätte mich mein Herr Vater so sehr geliebt, als ich Ihro Gnaden, hätten sie mich nicht in ein so gefährliches Land geschickt, wie dieses, und wohin ich wider Willen aus purem Gehorsam gegangen bin.“ Aus purem Gehorsam, ohne Liebe, ja ohne Sympathie zu empfinden für den ihrem schlichten, deutschen Wesen so ganz und gar nicht ähnlichen Gatten, ohne auch bei ihm Freundschaft zu erwecken, lebte sie nur wenige Jahre mit ihm in ehelicher Gemeinschaft, trotz allen Beleidigungen und trüben Erlebnissen stets bemüht, durch Freundlichkeit ein erträgliches Zusammenleben zu ermöglichen. Drei Kinder gebar sie ihrem Gatten in diesen ersten Jahren der etwa 30 Jahre währenden Ehe. Was sie aber in dieser an Bitternissen und Gelegenheiten zur Selbstüberwindung und Verzweiflung reichen Zeit gelitten hat, selbst ihren vertrautesten Freundinnen, denen sie sonst in langen Briefen ihr Herz auszuschütten pflegte, teilte sie es erst später mit und verhehlte es in opferfreudigem Zartgefühl mit Fleiß, solange ihr Vater lebte, um ihm den Schmerz und die Reue darüber zu sparen, daß er die Tochter seinen Plänen geopfert habe.
Mit der Aussicht, jemals glücklich werden zu können — an dem ausschweifenden Hofe von Versailles war ein glückliches Leben für die keusche, edle, wahrhaft vornehm denkende deutsche Fürstin an der Seite eines Sodomiten und Spielers von vornherein ausgeschlossen — hatte Liselotte bei dem Betreten französischen Bodens auch ihr Vaterland, das sie nie wiedersehen sollte, und, durch den Übertritt zur katholischen Kirche, ihre Religion verloren; freilich nur äußerlich. In ihrem Herzen blieb sie ihrem calvinistischen Glauben ebenso treu, wie sie bis zu ihrem letzten Atemzuge deutsch gedacht, deutsch gefühlt und, wenn immer möglich, (in jedem Sinne) gut deutsch geredet hat. „Ich habe nie französische Manieren gehabt, noch annehmen können, denn ich habe es jederzeit für eine Ehre gehalten, eine Deutsche zu sein und die deutschen Manieren zu behalten, welche hier selten gefallen“, bekennt sie einmal. Ihre Ehrlichkeit und derbe, deutsche Aufrichtigkeit, ihr Standesbewußtsein, das sie zu jeder Zeit und jedermann gegenüber ihre Gedanken aussprechen ließ, machten sie beim auch bald zum enfant terrible des Hofes, bis sie die schlimmen Erfahrungen, namentlich mit den schamlosen Günstlingen ihres rückgratlosen Gatten und der von ihr ehrlich gehaßten Madame de Maintenon, der allmächtigen Beherrscherin Frankreichs, des Hofes und des Königs, veranlaßten, soweit es die Hofetikette irgend gestattete, das Leben einer Einsiedlerin zu führen.
Daß sie an diesem aller Ehrbarkeit baren Hofe allein stand, gereicht der deutschen Fürstentochter zu höchster Ehre. Sie wußte im übrigen, daß sie die Sympathien der Hofgesellschaft nicht hatte. „Ich tue mein Bestes, wie einer, der allein geigt“, schreibt sie einmal. Nur dem König selbst war sie zugetan, und Ludwig XIV schätzte die kluge und humorvolle Liselotte sehr hoch, wenn er es auch nicht gleichmäßig und immer zu erkennen gab oder zeigen durfte. Auf seinem Sterbebette bat er sie noch um Verzeihung für alles, was er ihr angetan hatte.
Langeweile aber kannte Elisabeth Charlotte trotz des Mangels an willkommenem Verkehr nie; dazu war sie zu geistvoll. Sie hätte mit Recht sagen können — insbesondere in dem damaligen Paris —, daß sie sich, wenn sie allein sei, in der denkbar besten Gesellschaft befinde. Sie lernte in der ihrem Herzen immer fremden Umgebung die Einsamkeit liebgewinnen, und ihre Sammlungen von Münzen und Kupferstichen, ihre Bibliothek und ihre Hunde gaben ihr immer angenehme Beschäftigung.
Briefe
l.
St. Clou[d] den 27. aprill 1676.
Herzlieb Carllutzgen weillen ich glaube daß ihr Nun wieder Im lande seht undt derentwegen meine amme Euch wirdt zu sehen bekommen, so hab ich sie nicht weg wollen lassen, ohne ihr ein Zettelgen ahn Euch mittzugeben, worinen ich Euch Erinere, daß ihr mich alß lieb behalten solt, den ich hab Euch Schwartzköpffel recht lieb undt verbleibe allzeit Ewer affectionierte freündin.
Elisabeth Charlotte.
2.
Paris den 2. may 1677.
Hertz lieb Carllutz ich hab im Anfang alß ich Ewere trauerigkeit Erfahren ober Ewer mama todt Eüch nicht gleich schreiben wollen, weillen ich woll weiß daß man Im ahnfangs, undt In den Ersten mouvementen von Einer rechtmäßigen betrübnuß, unmöglich brieffe lesen Kan, jetzt aber hoffe ich, daß ihr Ein wenig wider bey Eüch selbsten sein Könnet, derowegen wo fern, Eüch meine freündtschafft lieb, undt die versicherung, daß sie allezeit werden wirdt In Etwas trösten Kan, so wünsche ich daß dießer brieff Eüch zu Einigem trost gereichen möge, den glaubt lieb Carllutz, daß ich Euch noch alß so lieb habe, alß wie vor dießem, undt daß ich mitt freüden hir im lande die gelegenheit suchen mögte Eüch zu persuadiren daß ich Ewere affectionirte freündin bin
Elisabeth Charlotte.
P. S. Monsieur [ihr Gemahl Herzog Philipp von Orleans] kombt morgen wider von der armée drumb ist es mir unmöglich ahn Carolin zu schreiben. Drumb bitt ich Euch grüst sie von meinetwegen undt Ewee andere schwesterger auch undt macht ihnen mein compliment!
3. An [ihre frühere Hofmeisterin]
Frau v. Harling geb. v. Uffeln.
St. Germain, 14. januari 1672.
Hertzlib fraw Harling. Ich kan euch dißmahl nicht viel schreiben, dan dißer briff nun der 6te ist, so ich heütte schreibe und deßwegen so müde bin, daß ich baldt die Handt nicht mehr fortführen kan; hab• doch noch ahn mein hertzlieb jungfer Uffel schreiben wollen, damit sie sicht, daß ich ihr nicht vergeßen, sondern noch als lieb hab undt lieb behalten werde. Adieu auf ein andermahl will ich anstatt dießen kleinen einen großen mächtigen brieff schreiben.
4. An die Kurfürstin Sophie von Hannover.
St. Germain: den 5. Febr. 1672.
Mein hertzliebste ma tante — —
Es ist nicht, daß ich hier mehr spaziere oder stärker, als ich bei uns pflegte; aber die Leute hier sein so lahm wie die Gänse und ohne [außer] den König, mad. de Chevreuse und ich ist keine Seele, so 20 Schritt thun kann ohne Schwitzen und Schnaufen. — — Den duc Mazarin sehe ich schier niemals und habe noch niemals mit ihm geredet. — Was mad. de Wartenberg ahn Donndorf gesagt, daß ich so geschreitt [geweint], daß meine Seite dick war, ist wahr; denn ich [habe auf der Reise zur Vermählung 1671] von Straßburg bis Chalons nichts gethan die ganze Nacht als Schreien. Denn ich nicht verschmerzen konnt den Abschied, so ich da genommen. Ich hab mich zu Straßburg härter gestellt als mir’s um’s Herz war. — —
[Am 1. Dezember 1719 schreibt Liselotte über ihren Empfang:]
Wie [ich] das erste Mal zu St. Germain an den Hof gekommen, kam unser König gleich zu mir au château neuf, wo Monsieur und ich logierten, und führten Monsieur le Dauphin zu mir, so damals ein Kind von 10 Jahren war. Sobald man mich angezogen hatte, fuhr der König wieder ins alte Schloß, empfing mich dans la Sale des Gardes und führte mich zur Königin [und] sagte mir ins Ohr: „Keine Furcht, Madame! Sie wird mehr Furcht vor Euch haben als Ihr von der Königin.“ Der König war so barmherzig, wollte mich nicht verlassen. Er setzte sieh zu mir und allemal, wenn ich aufstehen mußte, nämlich wenn ein Herzog oder Prinz in die Kammer kam, stieß er mir unvermerkt in die Seite.
5. An Frau v. Harling.
St. Germain den 12. Febr. 1672.
Allhier spielt man ebensowohl Lanterlüe [Landsknecht] als zu Mannheim, denn ich [hab]’s viel Leuten gelernt; und jetzt spielen bald alle Menschen. Wie ich heute nachmittag durch des Königs Kammer von der Königin [Maria Theresia, Tochter Philipps IV. von Spanien] bin kommen, sind mir 2 nachgelaufen, welchen ich hab versprechen müssen, daß ich heute vor 8 wiederkommen wolle, um in der Königin Kammer Lanterlüe zu spielen. Der eine ist der Herzog d’Engien [Prince de Condé] und der andere ist monsieur de Noyers. Sie wollen’s aber hier nicht Lanterlüe heißen, sondern sie heißen’s Pamphile — —
Was der Calvinisten Gebete anbelangt, muß ich wohl glauben, daß sie gut sind, weil ich mein Morgen- und Abendgebet noch nicht verändert, sondern als1 noch dasselbige, so Sie mir gelernt hat, bete.
6. An Frau v. Harling geb. v. Uffeln.
Versailles den 23. Nov. 1672.
O meine liebe Jungfer Uffel! Wie kommt das einem rauschenplattenknechtgen2 so spanisch vor, wann man nicht mehr laufen und springen darf, auch garnicht einmal in der Kutsche fahren, sondern als in einer chaise [Sänfte] muß getragen werden. Und wenn es bald getan wäre, so wäre es noch eine Sache; aber daß es so 9 ganze Monate fortwähren muß, das ist ein trübseliger Zustand. — Ach wollt Ihr mir wohl patience [= Geduld] geben, denn das ist, was ich jetzt am meisten nötig habe. Wann aber dieses Ei einmal ausgebrütet wird sein, so wollt ich, daß ich’s Euch auf der Post nach Osnabrück schicken könnte, denn Ihr versteht Euch besser auf das Handwerk [der Kindererziehung] als alles, was hier im ganzen Land ist; und bin ich versichert mit meiner eigenen experientz [= Erfahrung], daß es wohl versorgt sein würde. Aber hier ist kein Kind sicher, denn die Dokter hier haben der Königin schon 5 [Kinder] in die andere Welt geholfen. Das letzte ist vor 3 Wochen gestorben und 3 von Monsieur,3 wie er selber sagt, sind auch so [durch den Unverstand der Ärzte] fortgeschickt worden [d. h. gestorben] — —
7. An Frau v. Harling.
St. Clou[d] den 30. Mai 1673.
— — Ich bedanke mich für das gute Vertrauen, so Mons. Harling und Ihr zu mir tragt, mir Euern kleinen Vetter [den 6jährigen Neffen Eberhard Ernst Franz v. Harling] zu schicken. Seid versichert, daß ich alle Sorge für ihn tragen werde, soviel ich kann. Es ist wohl ein artlich Kind. Nicht allein Monsieur und ich, sondern alle Menschen haben ihn lieb. Er dient schon wie einer von den andern [Pagen] und fängt ahn,4 frantzösch zu reden und zu verstehen. Ich habe ihn apart von den andern in ein Haus logiren lassen — — er ißt ahn meiner Jungfern Tafel, daß ihm also, wie ich hoffe, nichts mangelt — — Sein erster Dienst ist gewesen, daß er einer von den hübschesten Jungfern hier im Lande hat ahn Tafel aufwarten müssen, welches ihm dann nicht übel gefallen. Denn sobald man von Tafel aufgestanden, hat ihn die Jungfer ein paarmal geküst. Dieses hätte er gern in eine Gewohnheit gebracht; und als sie einmal nicht daran dachte, stellte das kleine Männchen sich vor sie und hielt ihr den …. dar. Sie sagte zu ihm, er wäre garzu artlich, sie könne es ihm nicht abschlagen, und küßte ihn. — — Ich rede oft lange mit ihm, denn er ist gar zu artlich. Wann er was verzählt, dann macht er so ein ernstlich Gesichtchen dazu; das macht mich allemal lachen. Ich wollte, daß ich so geschickt wäre und könnte so ein artlich Männchen, wie Klein-Darling ist, ahn den Tag bringen; so würde ich ganz stolz mit sein. Es wird nun wohl bald ahn ein Krachen geben, denn ich bin alle 3 Wochen im … monat. — —
8. An die Kurfürstin Sophie.
St. Clou[d] den 5. August 1673.
— —Was aber meinen Kleinen [Alexander Louis, Herzog von Valois, geb. 2. Juni 1673] ahnbelangt, so ist er so schrecklich groß und stark, daß [er] met verlöss met verlöss5 eher einem Deutschen und Westfällinger gleich sieht als einem Franzosen, wie E[w]. L[iebden]. aus seinem Konterfei ersehen werden, sobald er gemalt wird werden, denn ich’s E. L. alsdann schicken werde. Unterdessen bringt mon maistre [ihr Hofmeister Jeme] E. L. mein Bären-Katzen-Affengesicht mit. Alle Leute hier sagen, daß mein kleiner Bub mir gleicht; also können E. L. wohl denken, daß es eben nicht so ein gar schön Bürschchen ist. Jedoch wenn er nur mein Patchen, E. L. Prinzeß [Sophie Charlotte, nachmalige Gemahlin des ersten Königs von Preußen] gefällt, dann ist alles gut, weil sie doch, wie E. L. mir schreiben, mit der Zeit ein Paar geben sollen. — — Was Chargen anbelangt, so sind keine bei Monsieur zu vergeben und beim König sind ihrer ohnehin so viel, die lange in des Königs eigene Dienste gewesen und mit Schmerzen daraus lauern, daß der König also ohne Zweifel wohl keine von Monsieur Leuten dazu befördern wird. — — — wie froh ich bin, nun reiten zu lernen, denn es schickt sich trefflich wohl zu Liselotts rauschenbeüttelichen Kopf, wie ma tante wohl weiß: denn um die Wahrheit recht zu bekennen, so bin ich eben noch nicht gar sehr verändert — —
9. An die Kurfürstin Sophie.
St. Cloud den 22. August 1674.
Wann meine Wünsche wahr könnten werden, so möchte ich E. L. Prinzeßchen, mein Patchen, lieber mons. le dauphin [Louis, ältester Sohn Louis XIV., geb. 1. Nov. 1661] als meinem Sohn wünschen, denn das ist ein besser Bissen und wäre es eben recht im Alter und E. L. müßten jetzunder noch eine Tochter bekommen und die dann ahn meinen ältesten Sohn geben. — — zuvörderst aber ist zu wünschen, daß uns Gott den guten Frieden wieder verleihen wollte, denn sonsten würde der Pap [Kinderbrei, Speise] in der guten Pfalz gar teuer werden, wenn mons. De Turenne noch mehr Kühe wegnehmen sollte, was aber, wie ich verhoffe, Pate6 nun wohl wehren wird.
In diesem Augenblick ruft man mir, um ‘nunder zu geben, denn der König, Königin und mon. le dauphin wollen mich im Durchfahren besuchen. Sie kommen von Paris, allwo man heute das Te Deum gesungen wegen der Schlacht [bei Senef, 11. Aug. 1674], so mons. Le prince de Condé] gewonnen, denn er hat des Prinzen von Oranien [späteren König Wilhelm III. von England] Arrieregarde geschlagen und alle die Bagage und viele Gefangene bekommen. — —
10. An die Kurfürstin Sophie.
St. Germain. den 16. November 1674.
Ich muß E. L. sagen, daß ein horoscop, so man von meinem jüngsten Sohn [Philipp (II)] gemacht hat, sagt, daß er Papst werden solle. Ich fürchte sehr, daß dieser kleine der Anschrift7 ist, wie die Herren Pfarrer die Offenbarung Johannis auslegen. Wenn dem aber so wäre, so glaub ich schier, daß E. L. sein Prinzchen [Ernst August], so jetzt [18. Sept. 1674] geboren, der Gog [Offenbarung Johannes 20. 8 und Hesekiel 38] sein wird, weil der Antichrist und Obgemel[de]ter gleiches Alter [haben] und Vettern sein sollen. — — Aber genug hiervon. Es ist ein absichtlich Gerase hier in dieser Kammer, daß ich nicht weiß, was ich schreib, denn Monsieur8 sitzt da und spielt à la bassette [Glücksspiel mit Karten] mit 10 oder 12 Personen, also daß ich anstatt, was ich sonst schreiben will, schier nichts anderes setzen kann als albin, va und la face, denn sonst höre ich nichts; hingegen aber diese 3 Worte rufen gottlob 10 Personen alle auf einmal mit solcher Stärke, daß es nicht weniger Gerase macht als (ohne Vergleichung) alle die Parforcehunde, womit ich heute mit dem König den Hasen forciert [= gejagt] habe. —— —— ——
11. An Frau v. Harling.
St. Germain den 18. November 1674.
— — ich möchte garnicht gern mich oder die Meinigen in die hiesigen Doktorenhände geben, denn ich bin überzeugt, daß sie gar ignorant [d. i. unwissend] sind und nichts wissen als Aderlassen und purgiren, womit sie manche in die andere Welt schicken. Gott behüte uns alle von ihren Händen. Und daß man ihrer nicht bedarf, ist noch ein besserer Wunsch. ——
12. An die Kurfürstin Sophie.
Paris den 22. Mai 1675.
—— dabei steht man hier erstlich um halb 11 auf, gegen 12 geht man in die Meß. Nach der Meß schwätzt man mit denen, so sich bei der Meß einsanden. Gegen 2 geht man zur Tafel; nach der Tafel kommen Damen; dieses währet bis um halb 6. Hernach kommen alle Mannsleute von Qualität, so hier sind. Dann spielet Monsieur à la bassette und ich muß ahn einer anderen Tafel auch spielen, damit alle, die da sind, hin und her gehen können. Oder ich muß die übrigen in die Oper führen, welche bis 9 währt. Wenn ich von der Oper komme, dann muß ich wieder spielen bis um 10 oder halb 11. Dann zu Bett. — —
13. An die Kurfürstin Sophie.
Versailles den 22. August 1675.
— — Ich muß bekennen, daß ich (dieses aber sei unter uns gesagt) mich eben nicht hab betrüben können über die Schlacht, so der Marschall de Crequi gegen Onkel und Pate [die Herzöge Ernst August und Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg] verloren hat [am 11. Aug. 1675 an der Lanzerbrücke]. — — Wir spielen alle Tage ein Spiel, so man boca nennt. — Und wie mein Beutel nicht gar wohl versehen war, so hat mir F. M. der König 2000 Pistolen zu spielen [ge]geben. Allein ich bin so unglücklich und habe schon seit 14 Tagen 1700 verloren. Also wird mein Spiel bald ein Ende haben. Zukünftigen Montag gehen wir nach Fontainebleau, allwo mich der König hinführt, weil ich noch nie dort gewesen. Ich hoffe, daß wir uns dort ein wenig lustig machen werden, denn alles Jagdzeug gebt hin und die Komödianten. — —
14. An die Kurfürstin Sophie.
St. Cloud den 14. September 1675.
Ich bezeuge E. L meine Freude, das Gott, der Allmächtige, Onkel [Gemahl der Kurfürstin, damals noch Herzogl. Pate [Georg Wilhelm von Zelle] und unfern Prinzen Georg Ludwig, ältester Sohn der Adressatin] so gnädiglich von vor Trier vor Unfall behütet hat. Als ich diese Rettung erführ, dürfte ich nicht so springen, wie ich bei der gewonnen Schlacht gethan hatte, weil ich die Einnehmung von Trier vom König selber erfahren, welcher Onkel und Pate unerhört lobte; und [er] sagte auch, daß die Gefangenen nicht genug rühmen könnten, in was genereusse [großmütige] und auch zugleich tapfere Hände sie gefangen wären. Hernach auch hab ich ihnen erzählt, wie genereus unser Prinz in der Schlacht sich verhalten, daß er nicht allein gegen den Feind gegangen sei, sondern daß er auch so vielen das Leben errettet hat, worüber sich der König und Monsieur, als ich ihnen gesagt, daß er kaum das 15. Jahr erreicht hätte, über die Maßen verwundert. Ich weiß, daß es E. L. auch nicht würde übel gefallen haben, wenn Sie hätten hören können, wie er von männiglich ist admirirt [d. i. bewundert] worden — —
15. An Frau v. Harling.
St. Cloud. den 30. Mai 1676.
— Ihr habt wohl recht, mein lieb Frau von Harling, daß Ihr sagt, daß je älter man wird, je mehr lernt man die Welt kennen und verspüret alle Verdrießlichkeiten, so man unterworfen ist. Denn auch jetzt, da ich noch nicht von diesem Unglück [Tod ihres ältesten Sohnes, 16. März 1676] zurecht [ge]kommen, ist Monsieur nach der Armee, allwo er mir schon tausend Ängste eingejagt hat, indem er sich, wie man mir von allen Orten herschreibt, so unerhört in den zwei Belagerungen von Condé und hernach von Bouchain gewaget, welch‘ letztere er selber ahngefangen und Gott sei Dank in kurzer Zeit eingenommen und glücklich vollzogen hat. Und nun hab ich wieder eine andere Sorg. Man schreibt uns, daß viel Leute in der Armee krank werden, und wie Monsieur nicht weniger als die Anderen fatigirt [angestrengt] und oft über 24 Stunden nicht vom Pferde kommt und nicht schläft, so ist mir Angst, daß er endlich auch krank wird werden; denn, wie man sagt, so soll die Campagne noch lange währen, und der König denkt noch ahn keine Zurückkunft. O das ist ja gar ein langwierig, verdrießliches Wesen, welches einem wohl, wie ich schon einmal geschrieben, das Rauschen9 vertreibt und die Milzkrankheit vor dem Alter herbeibringt. Ich wünsche wohl von Grund meiner Seelen, daß wir bald einen guten Frieden haben möchten, denn ich bin des Krieges so müde, als wenn ich ihn mit Löffeln gefressen hätte, wie man als pflegt zu sagen.