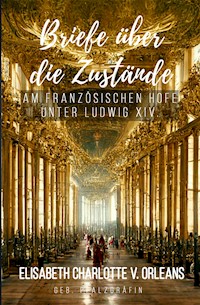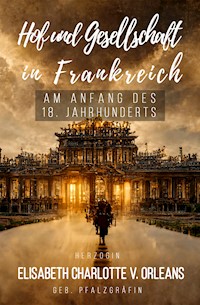
Hof und Gesellschaft in Frankreich am Anfang des 18. Jahrhunderts E-Book
Elisabeth Charlotte v. Orleans
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ganz Paris ist niemand in "grand habit", nur hier bei Hof trägt man's. Alle Weiber zu Paris sind debrailliert [an Hals und Brust entblößt], daß mir's recht ekelt, man sucht ihnen schier den Nabel; toller, als sie nun daher gehen, hat man's nie gesehen; sie sehen alle aus, als wenn sie aus dem Tollhaus kämen. Wenn sie es mit Fleiß täten, um sich abscheulich zu machen, könnte es nicht ärger sein. Mich wundert nicht mehr, daß die Mannsleute die Weiber verachten und sich untereinander lieben; die Weiber sind gar zu verachtliche Kreaturen itzunder mit ihrer Tracht, mit ihrem Saufen und mit ihrem Tabak, welches sie gräßlich stinkend macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hof und Gesellschaft
in Frankreich
am Anfang des 18. Jahrhunderts
Neue Folge der Briefe über dieZustände am französischen Hofe
von
Elisabeth Charlotte v. Orleans
______
Erstmals erschienen in:
Franck’sche Verlagshandlung,
Stuttgart, 1913
_______
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
Buchbearbeitung: Nadja Mondy
© 2019 Klarwelt Verlag
ISBN: 978-3-96559-195-0
www.klarweltverlag.de
Inhalt
Titel
Vorwort
Briefe
Vorwort
Das lebhafte Interesse, das der von Rudolf Friedemann besorgten Sammlung von Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte aus den Jahren 1672—17001 entgegengebracht wurde, sowie der vielfach geäußerte Wunsch nach einer Fortsetzung über 1700 hinaus und für die Zeit der vielberufenen Regentschaft ihres Sohnes, des Herzogs Philipp II. von Orleans, veranlaßten die Verlagshandlung, vorliegenden Band als weiteres Glied in der Kette ihrer die Kulturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts betreffenden Publikationen den Liebhabern der französischen Sittengeschichte darzubieten. Und sie glaubt, für diesen Band eine gleiche Teilnahme wie für den ersten erwarten zu dürfen. Bilden doch die beiden Jahrzehnte nach 1700, um die es sich hier handelt, kulturgeschichtlich wie überhaupthistorisch den ersten Brückenbogen, der über Sumpf und Moder zu einer terra nova führt. Der Grundton der beiden Jahrzehnte ist der der Zersetzung und Fäulnis. Selbst die zierliche Form, die den Erscheinungen der ersten und mittleren Epoche Ludwigs XIV. eigen war, verliert sich mehr und mehr und geht in dem Taumel der Regentschaft in Verzerrung über. Wie starr und halb bewußtlos sieht die große Masse, die der Großkönig der gloire zu liebe sich an Menschenkraft und materiellen Mitteln fast verbluten läßt, dem wüsten Treiben zu, aber schon ballt sie die Faust und reckt sie plump drohend in die Höhe, und schon wird hin und wieder der frenetische Jubel der unter Leitung des Regenten den Cancantanzenden hohen Gesellschaft übertönt von dem unterirdischen Grollen des Vulkans, auf dem sie tanzt. Fast der einzige Lichtpunkt auf diesem dunklen Hintergrunde ist Elisabeth Charlotte selbst.
Für die Auswahl und Wiedergabe der Briefe sind dieselben Grundsätze wie für den ersten Band maßgebend gewesen, nur sind, um ihre originelle Persönlichkeit noch besser hervortreten zu lassen, weniger, aber dafür längere Stellen ausgewählt.
Die ursprüngliche Orthographie ist so weit beibehalten, als sie nicht ein schnelles Verständnis des Lesers erschwert. Zur Erläuterung und zur leichteren Orientierung sind in eckigen Klammern [] hin und wieder Übersetzungen, Erklärungen oder Deutungen ungewöhnlicher Ausdrücke hinzugefügt. Andere zur Gedankenverbindung oder Charakterisierung der jeweiligen Zeitlage vom Herausgeber eingeschalteten Bemerkungen sind durch kleineren Druck kenntlich gemacht oder als Noten unter den Textverwiesen. Wie im ersten Bande liegen auch in diesem den Briefauszügen in der Hauptsache die verdienstvollen Ausgaben von Bodemann und Holland zu Grunde.
— — — — — — — — — — — — — —
In betreff der Lage, in der sich die Briefschreiberin im Sommer 1701 befand, sei mit Hinweis auf die Einleitung zum ersten Bande dieser Briefauszüge nur kurz das folgende bemerkt:
Elisabeth Charlotte, Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, war — ein Opferlamm auf dem Altar der Politik ihres Vaters, der durch eine verwandtschaftliche Verbindung mit dem gefährlichen und begehrlichen französischen Nachbar die bedrohte Pfalz zu sichern wähnte —im Jahre 1671 als Braut von Ludwigs XIV. Bruder nach Paris gekommen. Das von sprudelnder Lebenslust erfüllte, echte Pfälzer Kind, dem aller Zwang und alle Verstellung in der Seele zuwider war, fühlte sich inmitten des Intrigenspiels der zuchtlosen Versailler Hofgesellschaft und in den lähmenden Fesseln eines bis ins kleinste ausgebildeten Zeremoniells bald über die Maßen elend und vereinsamt. Sie hätte wohl trotz ihres kräftigen, widerstandsfähigen Geistes in dem schweren Kampfe fast gegenihre gesamte Umgebung und unter der Todfeindschaft der allmächtigen Mätresse Ludwigs XIV., der Frau v. Maintenon, erliegen müssen, hätte sie nicht aus dem Muttergefühl neue Kraft gesogen und sich durch eine ausführliche, mit ihrem Herzblut geschriebene Korrespondenz einigen Ersatz verschafft.
Ihre unbeugsame Rechtlichkeit, ihr gesunder Verstand, ihr gutes Herz, ihre beispiellose Enthaltung von selbstischen Machenschaften errangen ihr schließlich die Achtung des Königs und der besseren Elemente des Hofes, aber damit war am Ende für ihre Person an der Seite des erbärmlichen Philipp von Orleans, der selbst gegen sie intrigierte, wenig gewonnen. Trotz allem hatte sie ihre Pflichten als Gattin treu und gewissenhaft erfüllt und weinte nun dem Herzog, als ihn ins Jahre 1701 der Tod ereilte, aufrichtige Witwentränen nach. Die Briefe L.’s stellen somit den ungehemmten Erguß eines sonst allenthalben eingedämmten und gedrückten und darum um so ungestümer pulsierenden Menschenherzens dar. Hier wenigstens streift sie den lästigen Zwang ab, und ohne Schminke porträtiert sie Menschen und Dinge ihrer Umgebung. Daß dabei manches Unsaubere in Erscheinung tritt, erklärt sich aus der Beschaffenheit der Zeit, der Sitten und des Ortes, zum geringsten Teile aus der derben, aller Verschleierung abholden Natur der Briefschreiberin. Der Freund der Sittengeschichte wird auch dies ohne Anstoß und mit Interesse als jener Kulturepoche eigenentgegennehmen, und für andere Leser ist diese Sammlung nicht verfaßt.
_______
1 von Rudolf Elisabeth Charlotte von Orleans (geb. Pfalzgräfin), Briefe über die Zustände am französischen Hofe unter Ludwig XIV, herausg. Friedemann. 80 (160 S. mit Porträt). Stuttgart. Franck’sche Verlagshandlung.
Briefe
l. An die Kurfürstin Sophie.
Versailles, 30. Juni —7. Juli 1701.
E. L. [Euer Liebden] wissen nun schon, daß der König [Ludwig XIV.] Sorg vor mir will haben; monsieur [Elisabeths Gatte, Herzog Philipp v. Orleans] hat 7 Millionen und eine halbe Schulden hinterlassen; reich werde ich wohl nie sein, Gott gebe nur, daß ich auskommen kann . . . Wenn man in jener Welt wissen könnte, was in dieser vorgeht, glaube ich, daß J. L. monsieur s. [selig] sehr kontent von mir sein würden, denn in den Kistenhabe ich alle Briefe, so die Buben ihm geschrieben, aufgesucht und ungelesen verbrannt, damit es nicht in andere Hand kommen möchte . . . Daß monsieur meiner nicht in seinem Testament gedacht, ist kein Wunder, es kann nicht sein; in diesem Land kann der Mann der Frauen nichts vermachen, noch die Frau dem Mann; was er ihr aber bei Leben gibt, ist ihr eigen, aber monsieur hat’s lieber an die geben wollen, die ihn divertiert haben, denn man findt, daß drei junge Bursch allein des Jahres jeder hunderttausend Taler eingezogen haben. Ins Königs Gnade hätte mich monsieur wohl nicht rekommandiert, denn sie wünschten nicht, daß ich drinnen sein möchte. E. L. können wohl gedenken, daß ich meinen möglichsten Fleiß tun werde, mich ins Königs Gnaden und mad. de Maintenon Freundschaft zu erhalten; allein wer kann versichern, daß dieses Bestand haben mag, denn E. L. können wohl denken, daß mein Sohn und ich je mehr werden beneidt werden, je mehr der König uns Gnade tut, und daß man an großen Höfen, wie dieses ist, die Kunst zu brouillieren nur gar zu wohl weiß. Dieses alles wohl überwogen macht gar keine gute Hoffnung vor mein zukünftiges Leben . . .Ich gestehe wohl, daß mich monsieur oft geplagt und chagriniert [bekümmert] hat, aber das war nur aus Schwachheit und zu sehr sich denen zu ergeben, so zu seine Späß und Freuden halfen. Der König hat mir selber gestanden, daß J. L. mir in den letzten Zeiten nicht mehr so viel böse Offizien [Dienste] geleistet haben als vor ein paar Jahren . . . denn wie ich E. L. oft geschrieben und gesagt, so habe ich den armen Herrn nie gehaßt, sondern lieb gehabt, so ungerecht J. L. oft vor mich gewesen sein.1
Über ihre Lage nach dem Tode ihres Gemahls schreibt L. unterm 23. Dezember 1718 an die Prinzessin von Wales:
Nach Mons. Tode ließ mich der König fragen, wo ich hin wollte, ob ich in ein Kloster zu Paris oder nach Maubouisson wollte, oder anders wohin? Ich antwortete, daß, weil ich die Ehre hätte, vom Königl. Hause zu sein, könnte ich keine andere Wohnung haben, als wo der König wäre, wollte also gerade nach Versailles. Das gefiel dem König, kam zu mir, stachelte doch ein wenig, sagte, er hätte mich fragen lassen, wo ich hin wollte, weil er nichtgedacht hätte, daß ich am selbigen Ort bleiben wollte, wo er wäre. Ich sagte, ich wüßte nicht, wer Ihr. Maj.so fälschlich von mir berichtet hätte; daß ich mehr Respekt u. Attachement für Ihr. Maj. hätte, als alle, so mich fälschlich angeklagt hätten. Darauf hieß der König alle Menschen hinausgehen, und wir hatten ein groß éclaircissement [Aussprache], in welchem mir der König vorwarf, daß ich die Mde de Maintenon haßte. Ich sagte, es wäre wahr, daß ich sie haßte, aber nur aus Liebe für ihn, und weil sie mir böse Offizien bei ihm leistete, aber wenn es Ihr. Maj. angenehm sein könnte, daß ichmichmit ihr rekonziliierte, wäre ich bereit, es zu tun. Die gute Dame hatte das nicht vorgesehen gehabt, sonst hätte sie den König nicht zu mir gelassen; dem König aber verdroß die Sache so wenig, daß sie mir bis an mein Ende gnädig geblieben sein. Er ließ die alte Zott holen und sagte zu ihr: Madame se veutbien raccomoder avec Vous [Madame will sich gern mit Ihnen versöhnen], machte uns embrassieren, damit war es getan.
2. An die Raugräfin Amalie.
Fontainebleau, 12. Oktober 1701.
Alles, was hier ist, geht alle Tag auf die Jagd und zweimal die Woch in die Komödie außer ich, wie Ihr leicht denken könnt. Ich muß gestehen, unter uns geredt, daß es mir nicht eine kleine Mortifikation [Qual] ist, dieser beider Divertissementen zu entbehren müssen.2 Zu Fuß gehe ich gar oft spazieren und jedesmal eine gute französische Meil durch den Wald durch; das vertreibt die Melancholie, welche sonsten hart nachsetzt, insonderheit wenn ich von Affären reden höre, da ich mein Leben vor diesem nichts von gehört. Es wäre mir hoch von nöten, daß ich die Sachen so wohl als Luise verstehen könnte. Wenn ich dann von Sachen höre, so ich nicht recht begreifen kann (den im 50ten Jahr zu lernen ist was spat) denn werde ich blutsläunisch und gritlich wie eine Wandlaus. Apropos von Wandlausen: sie hätten schier die Königin von Spanien, die junge, in den spanischen Galléen [Galeeren] gefressen; man hat sie ganze Nächte bewachen müssen. Sie ist vor etlich Tagen zu Toulon ankommen, wird von da zu Land nach Barcelona. J. M. können nicht länger auf der See dauern, wie sie mir geschrieben haben. Ich möchte nicht in dieser Königin Platzsein. Königin sein ist überall beschwerlich, aber Königin in Spanien ist noch ärger als alles . . .
Von dieser Königin, Marie Luise von Savoyen, die durch ihre Mutter, Anna Marie, Tochter des Herzogs Philipp von Orleans auserster Ehe, L. nahestand, berichtet diese in einem Briefe vom 17. November 1701 des weiteren:
Vergangenen Samstag abends ist mons. de Louville ahnkommen, der ein Edelmann vom König in Spanien[Philipp V., Ludwig XIV. Enkel] ist, war hier son gentilhomme de la manche [Flügeladjutant]. Man hatte das gute Kind, die Königin, nicht gewarnt, daß man alle ihre Leute wegschicken wolle. Wie das arme Kind morgens aufstund, funde sie lauter abscheuliche häßliche und alte Weiber ahnstatt ihre Leute; da fing sie ahn zu schreien und wollte mit ihre Leute wieder weg.
Der gute König, der sie herzlich lieb schon hat, meinte, das könnte geschehen, und wie er auch noch ein wenig kindisch ist [Philipp V. war damals 18 Jahre alt], weinte er auch und meinte, seine Gemahlin würde weg. Man hat ihn aber getröstet und gesagt, wie es nicht sein könnte, weilen der Heurat konsumiert wäre. ..
Die dames du palais, so diese Königin bei sich hat, sind böse Stücker. Die Königin bat, man möchte ihr doch auf französisch zu essen geben, sie könnte die spanisch Manieren von Zurichten nicht essen; so befahle der König, man sollte der Königin durch seine französischen Offizierer [Angestellten] zu richten lassen.
Wie das die Damen sahen, nahmen sie die Suppen, gossen alle Brühe davon, sagten, das könnte ihre Kleider verderben, und brachten der Königin die Suppe ohne Brühe, desgleichen taten sie mit dem Ragout... Bösere Menschen, als die sein, solle man nichtfinden können und abscheulich häßlich darbei.
L. unterhielt sowohl mit der jungen Königin von Spanien, ihrer Stiefenkelin, wie mit deren Mutter, der Herzogin von Savoyen, fortdauernd den regsten Briefwechsel.
3. An die Raugräfin Amalie.
Fontainebleau, 4. November 1701.
Meint Ihr, liebe Amelise, daß ich die Bibel nicht mehr lese, weilen ich hier bin? Ich lese alle Morgen 3 Kapitel. Ihr müßt nicht meinen, daß die französischen Katholiken so alber sein wie die deutschen Katholischen; es ist ganz eine andere Sach mit, schier als wenns eine andere Religion wäre. Es liest hier die heilige Schrift, wer will; man ist auch nicht obligiert, an Bagatellen und abgeschmackte Mirakel zu glauben. Man hält hier den Papst nicht vor unfehlbar; wie er monsieur de Lavardin zu Rom exkommunizierte, hat man hier nur darüber gelacht. Man betet ihn nicht an, man hält nichts auf Wallfahrten und hundert dergleichen, worinnen man im Land ganz different von den deutschen Katholischen ist, wie auch von den Spaniern und Italienern . . . Ich versichere Euch, liebe Amelise, daß ich ganz und gar keine Ambition und nichts weniger wünschte als Königin zu sein. Je höher man ist, je gezwungener muß man leben, und wäre die Stelle von madame eine Charge, so man verkaufen könnte, so hätte ich es längst gar wohlfeil weggeben, will geschweigen denn, daß ich eine Königin zu sein wünschen sollte . . Man sagt hier, König Wilhelm [von England] hätte die Wassersucht und sei todkrank; ich werde es aber nicht glauben, bis ich’s anderwärts her erfahre. Es wäre schade, daß so ein verständiger König so wenig leben sollte. Was man ihn aber beschuldigt, ist nur gar zu wahr. Alle junge Engelländer, so mit Mylord Portlands Ambassade herkamen, als sie sahen, daß es zu Paris eben zugeht wie bei ihrem Hof, haben sie keine Scheu gehabt, alles ganz natürlich zu verzählen, wie es hergeht. Solle [der König solle] von dem Albemarle verliebt gewest sein wie von einer Damen und ihm die Händ vor alle Menschen geküßt haben. Das große Zeichen noch, daß dieser König verliebt von jungen Männern ist, ist, daß er nichts nach Weiber fragt; denn glaubt mir, liebe Amelise, die Männer sind so, sie müssen eines oder das andere lieben. König Karl s. hat allein die Weiber geliebt. Es sind aber noch viele, die beide lieben; deren findt man hier gar viel und mehr als von denen, so nur von eine Inklination sein . . . Die Männer glauben, die Weiber können nicht sein, ohne was zu lieben, weilen sie selber so sein; drum muß man ihnen diese Fragen zu gut halten. Ich glaube, daß lieben und nichtlieben nicht allerdings bei uns stehet, aber die haben Gott zu danken, denen er hierinnen einen ruhigen Sinn gibt und vor solch Unglück bewahrt, so tausend andere Unglücknach sich zieht. Drum muß man Mitleiden mit denen haben, welche Gott in solch Unglück fallen läßt, und ihn fleißig bitten, uns davor gnädig zu bewahren.
4. An die Raugräfin Luise.
Versailles, 10. Dezember 1701.
Mein Heuratskontrakt hat man so elend aufgesetzt, als wenn ich ein Burgerstochter wäre; kann nicht begreifen wie J. G. der Kurfürst s. mich selbigen hat unterschreiben machen. Aber mein Haus [Haushalt] ist so groß, daß, ob der König mir zwar 250 tausend Franken Pension gibt, so fehlt es ahn noch einmal so viel, als der König mir gibt, um mich nach meinem Stand gemäß zu unterhalten, und daß, weilen auf alle Chargen Gerechtigkeiten sind, alle erkauft sein und ich also nicht retranchieren kann, auch hier im Land so teuer und außer Preis ist. Es ist also gar weit gefehlt, daß ich die pfälzische Gelder frei und zu Spielgeld, so zu sagen, haben sollte; ich muß sie haben, meinen Stand zu erhalten, und werde nichts davon apart legen können . . .
5. An die Kurfürstin Sophie.
Fontainebleau, 9. November 1701.
Der Pfalzgraf von Zweibrücken ist nun zu Straßburg. Dort stellt er sich an oder ist es in der Tat, als wenn er verliebt von der Prinzeß von Veldentz wäre, gibt aber vor, er könne sie nicht heiraten, weilen er katholisch und sie lutherisch ist, also ist es gar eine unglückselige Liebe. Sie sitzen als gegeneinander über, reden alle halben Stand nur ein Wort, seufzen aber so unerhört stark, daß man sie der andern Kammer hören kann. Der gute Pfalzgraf, welcher so wohl als andere vom Geschlecht sehr mit Winden geplagt ist, wollte den Seufzer gar tief holen, der Wind aber, anstatt über sich zu gehen, ging unter sich und formierte einen von den abscheulichsten F....., so man in langer Zeit gehört hatte. Der Prinz erschrak, fuhr auf vom Stuhl und sagte zur Prinzeß: Ich bitte E. L. um Verzeihung; dieser ist mir unversehens entfahren. Die Prinzeß aber sagte, sie wolle keinen f. . . . . den Liebhaber haben, er solle sich wegpacken und nicht wiederkommen. Der gute Prinz in großen Ängsten ließ die Frau von Rathsamshausen bitten, seinen Frieden zu machen. Die Frau von R. fuhr zu der Prinzeß von Veldentz, machte einen eloquenten Diskurs von den menschlichen Schwachheiten und wie einer mit des andern Schwachheiten als gute Christen Geduld müßten haben. Man übergab ihr die Artikel vom Frieden aufzusetzen, welche waren, daß die Prinzeß dem Prinzen seinen F.... vergeben solle, damit solch Unglück ihm nicht mehr geschehen möchte; der Prinzeß aber sollte es erlaubt sein, sich nicht zu zwingen und im Fall ihr etliche Winde unter sich kämen, sie getrost, mit welchem Ton es auch sein möge, herauszulassen. Nach diesem schönen Friedensschluß haben sich die Verliebten wiedergesehen. Die Rotzenheuserin [Leonore von Rathsamshausen, Liselottes vertraute Kammerfrau und von dieser familiär häufig die Rotzenheuserin genannt]schwört, es sei keine inventierte Historie, sondern die pure Wahrheit. Ich wünsche, daß es E. L. einen Augenblickmöge lachen machen. [Die Liebesseufzer des so ergötzlich geschilderten Paares verdichteten sich erst im Jahre 1707zu einem Ehebunde, der 1723 wieder gelöst wurde, worauf sich der Pfalzgraf im gleichen Jahre mit einem Frl. v. Hofmann ehelich verband.]
6. An die Kurfürstin Sophie.
Marly, 15. Dezember 1701.
Ich fragte einmal an jemandes Räsonables [eine verständige Person], warum man in allen Schriften unsern König [Ludwig XIV.] immer lobte; man antwortete mir, man hätte den Buchdruckern expreß ahnbefohlen, kein Buch zu drucken, wo des Königs Lob nicht in stunde; man täte es wegen des Königs Untertanen, denn wie die Franzosen ordinarie viel lesen, und in den Provinzen lesen sie alles, was von Paris kommt, und des Königs Lob gibt ihnen Veneration und Respekt vor dem König, wie sie haben sollen, deswegen geschieht’s und nicht des Königs wegen, welcher es nie sieht noch hört, seiderdem J. M. in kein Opera mehr geht.
7. An die Raugräfin Amalie.
Versailles, 21. Dezember 1701.
Ihr embroulliert [verwechselt] die Markise de Richelieumit der Duchesse; die Duchesse ist längst tot, aber die Markise ist aus allerhand Weis abscheulich debauchiert [ausschweifend], legte sich einstmals hier in monsieur de dauphins Bett, ohne daß er sie drum gebeten, um bei ihm zu schlafen. Wie er in sein Kammer kam, sagten die Kammerdiener: „Monsiegneur, eine Dame ist in Ihrem Bett und erwartet Sie; sie weigert sich, ihren Namen anzugeben.“ Er ging hin, sah, wer es war; wie er sah, daß es die marquise de Richelieu war, schlief er bei ihr, sagte es aber andern Tags an alle Menschen . . . Wir haben wenig Neues hier itzunder bei Hof, aber von Paris hört man gar wunderliche Geschichten. Ein Burgersmädchen, so ziemlich reich war und von vierzehn Jahren, wurde von einem Menschen angeführt und wurde schwanger. Sie war schlau genug, die Sach zuverhehlen und heimlich niederzukommen, bekam einen Sohn; den trug sie gleich aux enfants trouvés [ins Findlingshaus], als wenn’s ihr Kind nicht wär, zeichnete es aber, um es mit der Zeit wieder zu kennen können.
Ein paar Jahr hatte sie große Sorg vor das Kind und gab ihm alles, was ihm nötig war. In der Zeit wird ein reicher Kaufmann von Paris verliebt von das Mensch und heuratt sie. Sie, die, wie schon gesagt, schlau war, dachte, daß, wenn sie aux enfants trouvés gehen sollte, daß es ihrem Mann einen Argwohn geben möchte, insonderheit wenn sie Geld hintrüge, resolviert sich aus einen Stutz, nicht mehr hinzugehn. Sie lebt so 20 Jahr mit ihrem Mann, welcher ihr all sein Geld gibt und stirbt.
Sie hatte eine große Inklination vor ihres Manns erster Ladenknecht; er hatte sie auch lieb; sie heuratt ihn diesen Sommer.
Wie ihr Mann ausgezogen bei ihr war, wird sie auf einmal gewahr, daß er das Zeichen am Leib hat, so sie ihrem Sohn gemacht. Sie erschrickt, läßt ihn aber nichts merken, läuft aux enfants trouvés und fragt, wo der Jung hinkommen sei, so sie zu ihnen getan.
Sie sagen, er hätte Inklination gehabt, wie er ahnfangen, großzu werden, um ein Kaufmann zu werden; er hätte das Wesen gelernt und wäre in dem Laden von einem reichen Kaufmann gangen, nannten ihr darauf ihren ersten Mann.
Da konnte die Frau nicht mehr zweiflen, daß ihr zweiter Mann nicht ihr Sohn wäre. Sie lief gleich zu ihrem Beichtvater und gest und ihm den ganzen Handel.
Der Beichtvater sagte, sie sollte die Sach heimlich halten, nichtmehr bei ihrem Mann schlafen, bis die Sach in der Sorbonne [theologische Fakultät zu Paris] vorgetragen würdesein. Man weiß noch eigentlich nicht, was die Sorbonne darüber ordonniert hat; erfahre ich es, so werde ich’s Euch schreiben.
8. An die Raugräfin Luise.
Versailles, 28. Dezember 1701.
Ich höre alle Tage: Heute ist ein neu Opera, morgenwird eine neue Komödie sein. Dies Jahr, welches noch nie geschehen, hat man 6 neue Komödien und 3 neue Operäen. Ich glaube, der Teufel tut’s mit Fleiß, um mich in meiner Einsamkeit [als trauernde Witwe] rechtungeduldig zu machen, aber ich bin der Sach zu gewohnt, uns recht ungeduldig zu werden.
L. war stets eine große Freundin des Theaters, das sie übermanche trübe Stunde hinwegtäuschte. Zahlreich sind die Stellen in ihren Briefen, wo sie sich mit gutem Verständnis über Ausführungen, denen sie beiwohnte, äußerst oder zur Erläuterung des eben besprochenen Gegenstandes Verse aus den Stücken jener klassischen Epoche des französischen Schauspiels aus dem Stegreif zitiert. Es seien hier noch einige Stellen aus ihren Briefen mit charakteristischen Äußerungen über das damalige Theater angefügt. So schreibt sie am 1. Juni an Herrn von Harling:
. . . ich liebe alle Tier, und alles was Landzeug ist, gefällt mir besser, als die schönste Paläst und alles, was man in Städten hat, außer wenn Baron [der beste Charakterdarsteller jener Zeit] Komödie spielt, das ist, was mir am besten an Paris gefällt.
Er hat uns am vergangenen Mittwoch le misanthrope [Molières berühmtes Schauspiel] gespielt. In der Welt kann man nicht besser spielen, als er tat, ist auch sehr approbieret worden.
Unterm 5 . August schreibt sie:
Ich bin gar nicht verwundert, daß die neue Komödianten sich nicht gut gefunden haben; man findt gar keine gute Komödianten mehr, ins Königs Truppe sind nur 2 gute Weiber und zwei gute Männer pour le sérieux und einen pour le comique, alle andern taugen nichts, sind doch 20 in allem, 10 Männer und 10 Weiber.
In einem Briefe vom 4. Januar 1720 heißt es:
Ich habe hier [in Paris] nur Qual und Zwang und nie nichts Angenehmes bis auf die Komödien, so die einzige Lust ist, so mir in meinem Alter geblieben.
Die können mir hier nicht gefallen, denn die Leute sind so abgeschmackt hier, daß sie sich haufenweis auf das Theater [d. h. die Bühne] stellen und setzen, daß die Komödianten kein Platz zu spielen haben; das ist recht unangenehm. Gestern hatten wir eine neue Tragödie, so nicht uneben ist, aber die Komödianten konnten nicht durchkommen wegen der Menge Leute.
Ebenso klagt sie am 10. April 1721 aus Paris
Die Komödien waren auch hübscher bei Hof [in Versailles, zu Ludwigs XIV. Zeiten] als hier; denn da durfte niemand sich aufs Theater setzen; hier sind 4 Rang Bänke, also wenn man ein komisches Stück spielt, weiß man nicht, ob, die da sitzen, von der Komödie sein oder nicht.
Vergl. auch Brief 107 und 110 im Band 1 und insbesondere weiter unten Brief 14.
8a. An die Kurfürstin Sophie.
Versailles, 1. Januar 1702.
Es ist leicht zu glauben, daß es keiner Eloquenz bedarf, um mad. de Montez Päan über ihren Mann zu trösten. [Frau von Montez Päan, Mätresse Ludwigs XIV. bis 1683, wo sie von der Frau von Maintenon in dieser Funktion abgelöst wurde, lebte noch 1707 in Zurückgezogenheit. Ihre Kinder von Ludwig XIV. wurden sämtlich vom Königanerkannt zum großen Leide L.’s, für welche die Vermählung ihres Sohnes mit einer Tochter der Montespan eines der schmerzlichsten Ereignisse ihres Lebens war. Vergl. Brief 72. Ende 1701 war der Marquis von Montespan gestorben.] Man tut ihr unrecht, zu sagen, daß sie jetzt säuft, das hat sie ihren Frau Döchtern überlassen, die es brav können. Sie führt ein trauriges Leben, wollte gern devot sein und kann nicht; reist immer von einem Ort zum andern. Sie ist nun eine Witwe, aber keine glatte Witwe, indem sie sowohl als ich sehr verrunzelt ist. Es ist wohl wahr, daß die Jahren, so mad. de Montespan mit dem König genossen, sehr verschieden von diese waren.
Über Frau von Montespan schreibt L. am 10. Dezember 1717 an die Prinzessin von Wales:
Mad. de Montespan und ihre älteste Tochter haben brav schöppeln können, ohne einen Augenblick voll zu werden. Ich habe sie, ohne was sie sonst getrunken, 6 Rasaden (volle Humpen) vom stärksten Rosolis [Rosoli-Likör] trinken sehen; ich meinte, sie würde unter die Tafel fallen, aber es war ihr wie ein Trunk Wasser.
Am 2. September 1718 schreibt L. an dieselbe:
Wenn Mad. de Montespan ausfuhr, hatte sie auch Garden, aus Frucht, daß ihr Mann ihr einen Affront tun möchte, denn er hat ihr allzeit gedräuet.
Vergl. im übrigen Brief 97 unten, sowie Brief 70 im. I. Bande.
9. An die Raugräfin Luise.
Versailles, 22. April 1702.