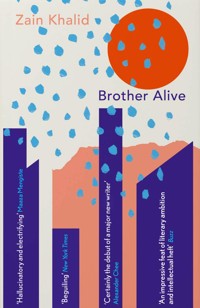TEIL 1
SPIRIT OF AMERICA
1
Was soll ich dir antworten, wenn du fragst? Soll ich dir sagen, dass du deinen Schmarotzer, deinen Quälgeist, deine Plage von deinem Großvater geerbt hast? Das wäre nicht wahr. Es wäre zu romantisch, dein Leiden ein Erbe zu nennen, schließlich seid ihr nicht blutsverwandt. Man könnte eher sagen, dass dein Großvater dich mit dem Parasiten angesteckt hat, als er, vorzeitig alternd, mit einer List dazu verleitet wurde zu glauben, er wäre nicht infiziert. Ihr wart gerade mal ein paar Minuten auf dieser Welt, deine Schwester und du, da strich er euch übers Engelshaar und rief euch zum Gebet. Nach jeder Zeile wechselte er vom Ohr der einen zum Ohr der anderen, damit jede von euch nur den halben Adhan erhielt und ihr eure zweite Hälfte immer brauchen würdet. Aber zusammen mit seiner Liebe gab er euch etwas Wahnwitziges, nicht Fassbares, Giftiges weiter. Ohne es zu wissen, bot er seinem Fluch in diesem Moment die Gelegenheit, sich fortzupflanzen. Inzwischen wissen wir, dass dieses fremde Etwas in mehr als einer Hinsicht amerikanisch ist.
Wollte man Imam Salim vorwerfen, dass er nach Markab zurückgekehrt ist, könnte man ebenso gut ein Pendel dafür verantwortlich machen, an welcher Stelle es stehen bleibt. Man könnte natürlich glauben, er habe nach einem Heilmittel für dich, für mich, vielleicht sogar für sich selbst suchen wollen. Aber das hieße, seinen Egoismus außer Acht zu lassen. In Wirklichkeit ist er dorthin zurückgekehrt, wo er sterben möchte, und wir sind jetzt hier, um davon Zeugnis abzulegen. Während ich dies schreibe, betet dein Vater im Tal hinter dem Brij-Campus, vermutlich um eine Antwort und um dein Wohlergehen.
Es war eine lange Reise, so lang wie eine Blutfehde, lang genug, dass ich von unserer Familie Rechenschaft ablegen kann. Wenn die Menschen einst von uns erzählen, gelingt es ihnen hoffentlich besser als mir. Aber was ich dir jetzt schreibe, kann nur ich berichten. Wenn es zu Ende ist, falls wir tatsächlich an unser Ende gelangen, dann hast du vielleicht eines Tages die Chance zu erkennen, wer wir gewesen sind. Und doch wird die Qual mich immer begleiten, und ich werde mich ewig fragen: Hätte ich dir noch mehr erzählen müssen?
2
Ya Ruhi, ich sage dir, mit der Geburt anzufangen, ist erbärmlich einfallslos. Und ich sage dir, was auch immer wir tun, die Zeit zerstört alles. Also nur der Vollständigkeit halber: Dayo, Iseul und ich wurden 1990 geboren, und zwar in dieser Reihenfolge. Das ist wahr. Was danach kam, entspricht weniger der Wahrheit als vielmehr der Geschichte, die uns erzählt wurde. Wie dein Großvater weiß, sind Erinnerungen oft genug Lügen, versiegelt mit dem heißen Wachs der Wiederholung. Dass er seine Lügen mit dem Selbstbewusstsein von Gottes persönlichem Pressesprecher vortrug, tat ein Übriges.
In unseren ersten drei Lebensjahren, so hieß es, wanderten wir von einem New Yorker Kinderheim zum nächsten. Dann trat Imam Salim auf den Plan, der nach der Rückkehr von einem Aufbaustudium in Saudi-Arabien angeblich von tiefer Einsamkeit und dem Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, ergriffen wurde und uns bei sich einquartierte. Wie und warum wir drei als Kleinkind-Kleeblatt zusammengehörten, blieb lange ein Geheimnis, das uns nicht weiter interessierte. Warum sollten wir unserem geschenkten Vater ins Maul schauen? Wir besaßen eben keine Vergangenheit. Selbst unsere Geburtsurkunden verdankten wir, wie wir später lernen sollten, nur einem Akt rückwirkender Kontinuität. Irgendwie hatte man uns den Nachnamen Smith verpasst. »Youssef Smith. Freut mich, Sie zweifellos verwirrt kennenzulernen.« Damals konnten wir uns gut vorstellen, dass wir in den USA geboren waren, und deshalb taten wir es auch. Was wir hingegen sicher wussten, weil es uns ins Gesicht geschrieben stand und dein Großvater es uns bestätigte, war, dass wir anders waren als die amerikanischen Bürger, die dieses Land in fester Überzeugung ihr Eigen nennen konnten. Dein Onkel Dayo stammt aus Nigeria. Iseul, dein Vater, aus Korea. Mir ließ Imam Salim nie dasselbe zuteilwerden wie ihnen, nicht einmal, was das Herkunftsland anging; ich galt und sah mich auch selbst als jemand, der einfach irgendwo aus Nahost stammte. Mein Hautton, eher rinden- als olivbraun, eher arabisch als jüdisch, ließ mich vermuten, dass meine Wurzeln sogar zwei bis drei Landkartenzentimeter östlich davon lagen.
Imam Salim war von seinem Studium in Saudi-Arabien nach New York zurückgekehrt, um die Moschee seines verstorbenen Onkels auf Staten Island zu neuem Leben zu erwecken. In der Wohnung über dem Gotteshaus war er selbst von seinem achten bis achtzehnten Lebensjahr aufgewachsen, nachdem seine Eltern in New Karachi unter einem umgekippten Lastwagen begraben worden waren. Unsere Moschee, ein niedriger Backsteinbau in der Occident Street, duckte sich ans Ende eines brach liegenden Betonstreifens, der in unregelmäßigen Abständen von Linden und in regelmäßigen von den schimmernden Gezeitentümpeln der Straßenlaternen gesäumt wurde. Bevor Imam Salim die Moschee wiedereröffnen konnte, musste er im Gebetsraum eine Seite für unsere muslimischen Schwestern abteilen. Er renovierte die kahle Küche im ersten Stock, später erhielt das Wohnzimmer noch einen hässlichen Teppich, einen Couch- und einen Esstisch sowie einen korpulenten Fernseher. In der Etage darüber, die man über eine schon halb zersplitterte Treppe erreichte, wurden aus zwei Schlafzimmern kurzerhand drei gemacht. Das erste Zimmer gehörte ihm, das zweite uns, und das dritte, der größte Raum mit den breitesten Fenstern, blieb frei für den Fall, dass mal jemand in Not war und ein Dach überm Kopf brauchte. Von Imam Salims Zimmer aus gelangte man außerdem in ein Arbeitszimmer, das er jedoch immer verschlossen hielt.
Im Hinterhof pflanzte Imam Salim ein Grüppchen Akazien. Ansonsten suchte er Pflanzen aus, die ins New Yorker Klima passten, Phlox, Glanzgras, Weiderich, Korkspindel, aber sein Ein und Alles waren die Akazien. Die Erde im Beet war immer voller Mulden von seinen Knien. Einmal hörte ich ihn zu den Sträuchern sagen: »Ich hoffe, ihr könnt das verstehen.« Er verhielt sich häufig skurril, nicht nur, was die Pflanzen anging. Wenn wir ihn auf seine emotional aufwühlende Gartenarbeit ansprachen, bombardierte er uns als Antwort mit einem Haufen religiöser Fakten. Ob wir eigentlich wüssten, fragte er dann, dass die ersten Götter von Heliopolis unter dem schützenden Blätterdach einer Akazie geboren worden waren? Ob wir etwas über Osiris wüssten, über den phönizischen Gott Tammuz, über Marduk oder den weniger bekannten, aber ebenso grausamen Gott Vitzliputzli, den die Azteken in Mexiko verehrt hatten? Wussten wir, dass Jahwe Moses auftrug, die Bundeslade aus Akazienholz zu bauen? Nein? Wir wussten wohl gar nichts, was? Anscheinend nicht, dachten wir; wir waren gerade mal vier Jahre alt. Heute kommt es mir nicht mehr so skurril vor, dass er auf unsere Fragen mit diesen merkwürdigen Gegenfragen antwortete, aber damals hielten wir ihn für einigermaßen gestört.
An der Mündung der Occident Street lag Coolidge. Unser Viertel. Die Coolidge-Siedlung. Soziales Insel-Wohnbauprojekt, das mit der Zeit … na, du weißt ja, wie es ist, Ruhi. Armut heiligt. Fromme hispanische Ladenbesitzer mit der ganzen Familienbande und so weiter. Wenn wir hier tatsächlich geheiligt wurden, dann verdankten wir das sicher nicht dem Desinteresse der Politik, den unterfinanzierten Schulen, arbeitslosen Eltern, Suchtproblemen oder dem Leben am Rand der Gesellschaft. Wie flexibel die wird, wenn es darum geht, unsere Erniedrigung auszunutzen – man stählt unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Schmutz und weiß, dass man uns damit auch gleich die Menschlichkeit nimmt. Coolidge war nicht von einem Mythos oder Zauber umgeben, sondern einfach nur auf andere Weise nackt. In den Hinterhöfen wuchsen unsere Schatten, in den verdreckten Fenstern von Crown Fried Chicken und trübseligen sri-lankischen Restaurants wurden unsere Spiegelbilder allmählich älter. Wir waren Seiltänzer auf den Bordsteinkanten der schmalen Straßen.
Ich glaube, das Leben an der zerfurchten Spitze von New Yorks unscheinbarstem Stadtbezirk putscht die Bewohner auf, als hätten sie die Erlaubnis, sich gehen zu lassen. Hier ist den Menschen schon früh klar, dass das andere Ende ihrer Leine um den Hals des Nachbarn liegt. Man kann nicht einfach in die U-Bahn-Linie 5 springen und verschwinden; wenn man aus Coolidge entkommen will, muss man ein Stück Ozean überwinden. Diese Fährfahrt hält die meisten davon ab, die Insel wirklich zu verlassen. Denn bei all den Geschichten über die lieblichen Geheimnisse des Meeres löst es bei manchen doch gewaltige Angst aus. Nicht weil sie nicht schwimmen können oder weil man sogar über alle möglichen kosmischen Nebel mehr weiß als über die Ebenen der Tiefsee. Nein, Ruhi, beim Anblick des glänzendglatten Meeres steigt in einem Immigranten oft die Erinnerung auf, sei es die eigene oder die seiner Eltern, wie er einst am Bug eines Schiffes das Glitzern durchschnitt oder in der Höhe nervös das weite Blau überquerte. Wir aber hatten niemanden, durch den wir uns erinnern konnten, und so fiel uns, als die Zeit gekommen war, der Abschied leichter als den meisten anderen.
3
Anfangs vollzog dein Großvater noch eine Menge Rituale, als stammte er aus einem alten Reich. Als Erstes rief er wenige Minuten vor Sonnenaufgang die Dschinn zum Gebet. Nach Fadschr genoss er einen dampfenden Kaffee, eine Dattel und eine halbe Grapefruit und las dazu den internationalen Teil der New York Times oder, später, den Daily Star. Wenn der Kaffee seine Verdauung in Gang gebracht hatte, machte er im Gebetsraum seine Übungen. Er beugte, verdrehte und streckte sich, ließ die Muskeln gegen die Schwerkraft und sein eigenes Körpergewicht arbeiten und hielt in verschiedenen Positionen inne wie ein Fassadenkletterer beim Ausdauertraining. Gedehnt und ermattet ging er dann duschen. Anschließend trimmte er sich den Bart auf die immer gleichen sechs Zentimeter, eine tägliche Korrektur, ein verlässlicher Akt der Kontrolle.
Wenn um acht Uhr fünfzehn die roten Punkte auf unserem Wecker vibrierten, standen schon Schüsseln mit Müsli und Cornflakes, Toast und Obst auf dem Küchentisch. Manchmal fütterte Salim Leviathan, eine freilaufende Katze aus der Nachbarschaft, die er nur Levi rief. Wenn wir nach unten kamen, fragte er uns, ob es uns gut ging und wie wir geschlafen hatten, dann brachte er uns zu Fuß zur Schule. Zwischen den nächsten beiden Gebetsrufen zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, wo er sich einer weiteren sonderbaren Angewohnheit widmete: Er schrieb Briefe. Um die Mittagszeit trat er mit verschiedenen großen und kleinen Umschlägen vor die Tür und marschierte damit zum Briefkasten am Ende unseres Blocks. Imam Salim schien der Einzige zu sein, der diesen Briefkasten benutzte, und wir fragten uns, ob die Post ihn vielleicht schon vor langer Zeit aufgegeben hatte. Wir rissen Witze über die Briefe, die eines Tages, wenn der Stapel im Kasten hoch genug wäre, von ganz allein zum Absender zurückkommen würden, wenn er die Klappe aufmachte. Im Sommer oder wenn wir krank waren, beobachteten wir diese Marotte und löcherten ihn mit Fragen, an wen er da immer schrieb – was für telefonscheue Freunde waren so wichtig, dass man sich dermaßen hingebungsvoll um sie kümmern musste? Wir bedrängten ihn so lange, bis er schließlich sagte: »Vielleicht unterstütze ich ja mit diesen Niederschriften eine Widerstandsbewegung, eine Intifada?«
»Tust du nicht«, erwiderten wir, obwohl wir nicht wussten, was eine Niederschrift, eine Widerstandsbewegung oder eine Intifada war.
Nach dem Gang zum Briefkasten verrichtete er die Waschung, rief einen weiteren Adhan, diesmal lauter, und begann mit dem Zuhrgebet. Selbst wenn außer ihm niemand in der Moschee war, führte er diese Dinge beharrlich aus. Das ist die Aufgabe eines Imams, sagte er. Uns zwang er nie zu beten, und außerhalb der Occident missionierte er auch nicht. Als wir alt genug waren, um ihn zu fragen, warum er nicht für seinen Gott warb, obwohl das doch auch zu den Aufgaben eines Imams gehörte, antwortete er: »Ich habe mehr Menschen bekehrt, als ich vertragen kann.« Wir reihten uns natürlich trotzdem hinter ihm auf und warfen uns nieder wie er. Was soll ich sagen? Schuldgefühle entstehen früh. Beim Glauben dagegen, den ich nie hatte, gibt es nur eine simple Zweiteilung, und die ist schon vor der Geburt festgelegt. So sehe ich das jedenfalls.
*
In Wahrheit war Imam Salim Sufi, aber das gab er nur ein einziges Mal zu. Er betrachtete die Religion nicht als Balsam für die Gesellschaft, für ihn konnte sie immer nur ein Hilfsmittel sein, um das eigene verworrene Innenleben zu sortieren. Mit diesem Standpunkt machte er sich nicht sonderlich beliebt. Für die jenseitigen Aspekte des Gemeinwesens waren in Coolidge von jeher die Pfarrer zuständig, die mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie aus den Korintherbriefen zitierten, verkündeten, wen Jesus im Rathaus haben wollte. Imam Salim dagegen brachte es kaum fertig, seiner Gemeinde ein anständiges Leben nach dem Tod zu versprechen. »Ist ein Wolkenkratzer himmelstürmend oder dystopisch?«, fragte er in seinen Predigten – und erntete Totenstille. »Das kommt auf die Perspektive an. So ist es mit allen Dingen, selbst mit Gottes Gnade.«
Außerdem stellte er klar, dass man sich durch die Mitwirkung am politischen Prozess in Amerika an den zahlreichen Gräueltaten dieses Landes, von denen er einige selbst miterlebt hatte, mitschuldig machte. Damit war er ganz und gar nicht auf der Wellenlänge seiner Gemeinde und hatte einen ziemlich schweren Stand. Erst 1995 sollte sich diese trostlose Lage ändern. Aus bislang unbekannten Gründen fanden in jenem Jahr sämtliche frisch getrennten, halbseidenen Nymphomaninnen in unserer Umgebung zu Allah. Sie schlangen sich irgendeinen Fetzen als Hidschab um den Kopf, zogen sich Kleider an, in denen sie keine Haut, aber möglichst viel Figur zeigten, und erschienen zum nächstbesten Gebet. Man munkelte, eine der Schwestern habe Imam Salims Gesicht erblickt und die Botschaft verbreitet. Er besaß ein beeindruckendes Gesicht. Die braunen Augen lagen tief in den Höhlen und hatten einen gelblichen Schimmer, als würde in ihnen eine Kerze flackern. Selbst die Leichen, die er im Keller hatte, wirkten verrucht. Ob es nun an seinem Aussehen, seiner Kleidung oder seiner mysteriösen Vergangenheit lag, die bildschönen Schwestern rannten ihm jedenfalls die Moschee ein. Pflichtbewusst hörten sie sich seine Freitagspredigten an, und danach fand unweigerlich die eine oder andere einen Grund, ihn an der Seite der Moschee vor der Tür zu unserer Wohnung abzupassen, meist unter dem Vorwand dringend benötigten seelischen Beistands. Er ging gern auf sie ein – befriedigte das doch seinen Narzissmus –, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Niemand verstand, warum er ihren Avancen auswich wie ein Matador, schließlich ist es Imamen nicht verboten zu heiraten. Oft benutzte er uns als Ausrede. »Vielleicht, wenn die Kinder größer sind.« Mit dem Spruch kam er meistens durch. Aber ein paar Schwestern gaben selbst nach den ersten Abfuhren nicht auf und versuchten, ihn und uns mit Essen zu ködern. Begriffsstutzig wie eh und je nutzte er ihre Bemühungen, um eine Suppenküche zu eröffnen. Das kam bei den Köchinnen nicht gut an. Eine seiner Verehrerinnen regte sich dermaßen auf, dass wir sie aus dem Gebetsraum brüllen hörten. Ihre Frage, die auch die ganze Nachbarschaft beschäftigte, waberte mit dem Duft ihres nur locker abgedeckten Currys zu uns hoch ins Wohnzimmer. »Was denn – bist du schwul oder was?« Ehrlich gesagt, wenn er nicht mit seiner tiefen Frömmigkeit so glaubwürdig im Mihrab gestanden hätte, wäre dieser Verdacht vielleicht an ihm hängen geblieben. Stattdessen blieben die Schwestern an ihm hängen, weil sie spürten, dass sich die Bekanntschaft mit diesem gutaussehenden, hakennasigen Imam lohnte, auch wenn er nicht in der Lage war, ihre Zuneigung zu erwidern.
Nach und nach folgten den Schwestern immer mehr Brüder, und ein Jahr später war die Moschee auf beiden Seiten gerammelt voll. Endlich konnte der polyglotte und wortgewaltige Imam Salim sich der Aufgabe widmen, die Gemeinschaft zu einem geeinten Willen zu führen. Weißt du, er hatte so eine Aura, als hätte die Luft um ihn herum ihm soeben ein Geheimnis verraten. Dass er von Konversionen genug hatte, hielt ihn nicht davon ab, radikale Ideen zu verbreiten. Auf seine Anregung hin gingen im Jahr 2000 in Coolidge weniger Menschen als je zuvor zur Wahl, stattdessen arbeiteten an diesem Tag viele mit ihm als freiwillige Helfer in den Obdachlosenunterkünften der Umgebung. 2008 hatten die Stimmenwerber beider Parteien unsere Nachbarschaft komplett aufgegeben. Nur siebzehn Leute gingen wählen, und für diese Ausübung ihrer Bürgerpflicht wurden sie prompt zum Gespött von Verwandten und Freunden jeglicher Glaubensrichtung. Vielleicht ist das noch am ehesten Imam Salims bleibendes Vermächtnis, sein ganzer Stolz.
*
Jeden Abend nach Sonnenuntergang kochte Salim für uns. Zu seinen Collegezeiten hatte er als Koch in einem Diner in Midtown gejobbt, aber bei uns zu Hause gab es nie Burger oder sonstige amerikanische Kost. Stattdessen, so verkündete er, hätten wir »die ganze Welt zu Gast an unserem Tisch«. (Zumindest was seine aufgesetzte Kultiviertheit anging, war er ein guter Vater.) Bamia, Kabsa, Tandooris oder Halim waren bei seiner Herkunft keine Überraschung, aber er kochte genauso oft Samgyetang, Kilishi oder Ofe Akwu. Es schienen weniger Spezialitäten aus aller Welt zu sein als vielmehr die Gerichte unserer Eltern.
Nach dem Abendessen leitete Imam Salim das Ischagebet. Dann spielte er mit uns am Esstisch eine Runde Go, wobei er uns jahrelang gewinnen ließ, oder wir setzten uns alle zusammen aufs Sofa und sahen uns eine oder zwei Folgen Twilight Zone an. Wir hätten lieber die Sendungen gesehen, von denen unsere Klassenkameraden erzählten, aber selbst als wir älter waren, verzichteten wir darauf, es uns zu ertrotzen, weil wir einfach froh waren, mit ihm zusammen zu sein. Während wir uns die Zähne putzten, goss er sich einen Becher frischen Kaffee ein, gekrönt mit einem Schuss Whiskey. Dann setzte er sich auf einen Stuhl neben unserer Zimmertür – er hielt sich immer in der Nähe irgendeiner Tür auf – und schlug Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus auf oder ein Buch von Khoury oder Munif oder vielleicht einen der Russen, Väter und Söhne von Turgenjew. Nicht um uns vorzulesen, falls du das denkst, sondern um sich wach zu halten. Wir beobachteten ihn, wie er beim Lesen mit seinen langen, hageren Fingern die Zeilen entlangfuhr. Immer zwei Finger, wie ein Magier. Wenn unser Atem ruhig geworden war, zog dein Großvater sich in sein Arbeitszimmer zurück.
Ich vermute, in manchen Nächten schaffte er es. Dass er wach blieb bis zum Morgen. Meistens jedoch musste er um vier oder fünf die Segel streichen und stand dann ganz kurz vor dem ersten Gebetsruf wieder auf. Die Nacht, in der ich das herausfand, ist eine meiner frühesten Erinnerungen, ich war nicht älter als fünf. Ich lag im Bett, jede Faser meines Körpers durchdrungen von der übersteigerten Empfindsamkeit eines Schlaflosen, und betrachtete den messingfarbenen Schimmer, den die kaputten Weckerziffern auf die Ecke eines leeren, vergoldeten Bilderrahmens warfen. Um elf nach vier schloss Imam Salim fluchend die Tür seines Arbeitszimmers ab. »Connard!« Er fluchte immer nur in europäischen Sprachen. Wahrscheinlich wünschte ich mir in diesem Moment nichts sehnlicher als etwas Wärme zum Ankuscheln – anders kann ich mir nicht erklären, warum ich ohne zu klopfen seine Zimmertür öffnete. Ich glaube schon, dass ich ein höfliches Kind war und nicht ohne Grund einfach so hineingeplatzt wäre.
Imam Salim saß mit gespreizten Beinen auf dem Bett, direkt unter einem billigen Druck von Gauguins Stuhl, und ich hätte am liebsten seine Fußsohlen gepackt und wäre zu ihm hochgeklettert. Als er mich sah, entfuhr ihm ein betrunkenes Lachen. In diesem Moment hätte ich gehen sollen. »Du machst wirklich alles noch schlimmer.« Wieder lachte er. Ich war verwirrt, und er ahmte meine Miene mit höhnisch verzogenem Gesicht nach.
»Youssef, sieh mich an, wenn ich dir das sage.« Ich sah ihn an. »Du bist nicht zu retten.«
Du hättest sehen müssen, wie er mich anstarrte – als würde mein Anblick in ihm eine uralte Feindschaft nähren. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutete, nicht zu retten zu sein. Aber das war auch nicht nötig. »Ich spare mir die Erklärung. Du weißt schon um dein Erbe, nicht wahr?« Ich nickte. »Gut.« Er setzte Kopfhörer auf, die mit seinem Wecker verbunden waren. Auch er hielt sich für höflich. »Dann geh jetzt wieder ins Bett und versuch zu schlafen.« Er schloss die Augen und war im Handumdrehen eingenickt. Nach kurzer Zeit fing er an zu schnarchen.
So offen wie in dieser Nacht sprach Imam Salim nie wieder darüber, was er von mir hielt, selbst unter vier Augen nicht. Doch wir wussten es alle, Ruhi. Er bemühte sich so sehr, die Nähe, die er den anderen bereitwillig schenkte, mir gegenüber nicht zuzulassen, dass seine Abneigung offensichtlich war. Wir führten keine Gespräche zu zweit; zu den Entscheidungen, die ich traf, sagte er mir nie offen seine Meinung. Er vermied es sogar, wirklich mal mit mir alleine zu sein, bis ganz zum Schluss, als sein maroder Verstand mich mit meinem Vater verwechselte.
In jener Nacht kehrte ich trotz Salims Anweisung nicht in mein Zimmer zurück. Ich blieb am Fuß seines Bettes stehen und grübelte, grübelte, warum er mich hasste und wie lange sein Hass andauern würde. Ich blieb dort stehen, bis die Morgendämmerung in grapefruitfarbenen Flecken durchs Fenster drang wie ein leuchtender Hautausschlag.
4
Manchmal wurde es in dieser Zeit schummrig um mich, und in meinem Augenwinkel tauchte wie eine Frage ein nervöser Schatten auf. Damals jagte Bruder mir noch keine Angst ein. Bald schon nahm er erkennbare Formen an: Käfer, Vogel, Fuchs, Hirsch, Katze, manchmal ein Mischmasch aus zwei oder mehr Arten. Obwohl seine Gefühle in meinen eigenen lebten, waren sie doch klar von mir getrennt, und in ihrem Kern hauste ein alles durchdringender Hunger. Dieser Hunger war es auch, der ihn eines Tages dazu trieb, sich mir zum ersten Mal zu nähern. An jenem Morgen, ich saß allein am Tisch und aß einen geviertelten Apfel, hatte er den Körper eines Hundes mit einem Fell wie geschmolzene Sonne angenommen, er sah aus wie der Mischling, der immer in den Mülltonnen an der Moschee nach Futter suchte. Ich spürte aber, dass ich nicht diesen Hund vor mir hatte – Bruder sah irgendwie, wie soll ich sagen, nicht real aus. Er flackerte wie eine schlecht verkabelte Lampe; sein Körper war eher Quecksilber als Fleisch und Blut. Das Sonnenlicht, das durch die Streifen der Jalousien sickerte, zerschnitt ihn in Stücke. Als er mich ansah, wurde sein Gesicht schärfer, wie vor Aufregung und Freude beim Anblick eines guten alten Freundes. Aber dahinter harrte immer noch der Hunger. Ich hielt ihm mein letztes Apfelviertel vor die Nase. Er schnupperte kurz daran, und dann begann alles zu pulsieren. Ich spürte einen sirrenden Druckschmerz, ein gleichbleibendes Summen, und presste die Augen zu. Als ich sie wieder aufmachte, war das Esszimmer unverändert, aber Bruder hatte sich verdichtet. Sein Fell war übersät mit Dreck und Blättern. Er bellte dreimal als Zeichen der Zufriedenheit. Ich hielt immer noch etwas in der Hand, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, um was es sich handelte. Ich roch daran. Es duftete herb und sauer und süß. Ich biss hinein, und es schmeckte so, wie es roch, aber das dazugehörige Wort war mir verloren gegangen.
Bruder behandelte mich mit Nachsicht und Geduld. Nie nahm er sich etwas, ohne zu fragen, immer wartete er, bis ich ihn fütterte. Anfangs tauchte er nur ein- oder zweimal im Monat auf. Ich gab ihm von mir, was ich entbehren konnte, kleine Ideen, die ich bereit war, ihm zu überlassen, Kuriositäten, nutzlose historische Fakten, die die Lehrer mir beigebracht hatten und an denen mir nichts lag, religiösen Kram von Imam Salim, die neunundneunzig Namen Allahs, nichts Bedeutendes. Bruder war nicht wählerisch und ernährte sich gern von meinem Schnickschnack. Früher oder später konnte ich ein paar Dinge, die ich an Bruder verfüttert hatte, wiederentdecken, zum Beispiel den Geschmack und die Bezeichnung eines Apfels, aber vieles habe ich für immer verloren.
Manchmal hatte Bruder so großen Hunger, dass mein Ramsch ihm nicht reichte. Aber weil ich ihn als Bruchstück meines zweigeteilten Bewusstseins ansah, war er besonders anfällig für den Virus der Literatur. Wenn ich ihn mit Innerlichkeit oder struktureller Exteriorität zwangsernährte, konnte ich ihn eine Zeit lang infizieren, beherrschen, sein Ich durch andere Ichs oder andere Geisteszustände ersetzen, durch Stimmen, die sich ausbreiteten und vermehrten. Aber auf lange Sicht ging diese Strategie natürlich nicht auf. Literatur ist keine Antwort, nur ein Fenster. Allerdings entwickelte er Geschmack. Er löste sich von dem Müll, den Kinder ohne goldenen Löffel im Mund an staatlichen Schulen lernen, von den beschissenen Büchern über Menschen, die in nach Blumen benannten Straßen wohnen, von den behördlich subventionierten Geschichten voller Opfer, Unterdrücker und Kontrastfiguren, und machte Platz für all das, was der echten, ätzenden Grausamkeit des Lebens ins Gesicht sah. Eine Grausamkeit, die seine Kontrolle über den eigenen Körper einschränkte – er konnte mich nicht stärker steuern als ein Geist eine Planchette. Als ich älter wurde, waren Kavan, Gass, Thiong’o, Jelinek und Mahfouz fast mehr ein Teil von ihm als von mir. Der Virus der Literatur veränderte ihn, uns, immer weiter, sodass die Schweigsamkeit des Anfangs sich später manchmal in ironische Distanz oder Selbstverleugnung verwandelte. Es gab aber auch Tage, an denen wir durch die Worte wie vor einem gewaltigen Abgrund klar hervortraten, und wir sahen uns an und spürten unser Blut wie ein Wunder in Schläfen und Fingerspitzen pulsieren. Und wenn gar nichts mehr funktionierte, konnte ich interessanterweise auch stellvertretend für ihn eine Zigarette rauchen.
Jahre später, als Bruders Existenz schon fest verankert war, fing er an umherzustreunen. Ich konnte mich im Gebetsraum der Occident befinden, und er hockte vielleicht als Kapuzineraffe in einer der hinteren Reihen des Village Vanguard oder sah sich im Cinépolis in Chelsea Andrej Rubljow an. Heute zum Beispiel springt er als sechsbeinige Antilope durch die engen Gassen von Old Markab, während ich im Lesesaal der Brij-Bibliothek sitze. Gestern war er der Duft von Nachtjasmin. Es macht mir nichts aus, wenn er weggeht, denn er ist niemals wirklich fort. Mittlerweile braucht er nicht einmal mehr Nahrung. Er ist immer bei mir, an meiner Seite. Inzwischen liebt er sogar die Menschen, die ich liebe, und hält damit die Resignation im Zaum.
5
Ich habe keine erste Erinnerung an Adolphina; es ist eher ein Gewirr aus Ereignissen und Empfindungen. Sie erschien einfach in unserem Leben und war dann immer mal da, mal wieder fort; dieses Durcheinander zu einer Chronologie zu ordnen, würde wenig nützen und ist aus diesem Abstand auch gar nicht mehr möglich. Oder kannst du dich daran erinnern, wann du deine Mutter zum ersten Mal gesehen hast? Und wäre das überhaupt wichtig?
Angeblich lernte Imam Salim Adolphina, ihres Zeichens Stadträtin und deine spätere Patin, auf der Straße vor der einzigen Justizvollzugsanstalt von Staten Island kennen. Salim, der mit dem Gefängnisgeistlichen befreundet war, besuchte die Einrichtung einmal im Monat, um den gläubigen Strafgefangenen beizustehen. An jenem Tag saßen sie auf einem Dutzend graubrauner Stühle in einem kahlen, weiß getünchten Raum, und Salim schwärmte ihnen vor, dass selbst noch ein spiritueller Schlussakt einen Menschen sowohl im Angesicht Gottes als auch der Justiz auf den rechten Weg führen kann. Adolphina hielt sich währenddessen ein paar Räume weiter im Besucherzentrum auf, um zwei kurz vor der Entlassung stehende Männer aus Coolidge für ihr politisches Aktionskomitee einzustellen, das sie ganz ohne ironischen Unterton »Zentrum für amerikanische Rückentwicklung« genannt hatte. Adolphina war zwar gewählte Amtsträgerin, aber nichtsdestotrotz eine Art Anarcho-Syndikalistin, eine geistige Erbin von Lagardelle und Dolgoff und Bastiat. Das Zentrum war für sie der Grundstein für einen Neuentwurf des amerikanischen Traums. Den beiden Männern gegenüber ließ sie das Ganze aber weitaus weniger kompliziert klingen. Der Job würde die Bewährungshelfer zufriedenstellen, den Männern mehr Geld einbringen, als sie sich anderswo erhoffen konnten, Sozialleistungen inbegriffen, und ihnen die Freiheit sichern. Adolphinas Anwältin und langjährige Geliebte Naomi DePeña würde dafür sorgen, dass sie nie wieder ins Gefängnis mussten, wie sie das auch für alle anderen zweihundert Angestellten des Zentrums getan hatte. Worin genau der Job bestand und worauf das Zentrum eigentlich hinarbeitete – nun ja, Adolphina ging da erst mal nicht ins Detail. War auch gar nicht nötig. Zwar verdiente sie inzwischen neunzig Prozent ihres Geldes auf legale Weise. Aber die Leute erinnerten sich noch sehr gut an die Zeit vor ihrer Wahl, als es umgekehrt gewesen war und ihre Gegner ihren Namen voller Furcht nur in der Kurzform in den Mund nahmen. Damit diese Vergangenheit auch ja niemand vergaß, trug Adolphina bei jedem ihrer Besuche in der Justizvollzugsanstalt als kleine Gedächtnisstütze einen goldenen, mit schwarzen Diamanten verzierten Grill auf der oberen Zahnreihe. Ein Mund voller Killerbienen, eine funkelnde Erinnerung, die sie selbst und alle, die sie sahen, an ihr früheres Leben gemahnte. Vielleicht war es Schicksal, dass genau dieses Schmuckstück zu ihrer Bekanntschaft mit Imam Salim führte.
Beide warteten am Gefängnisausgang auf die Kontrolle mit den Metalldetektoren, und ich stelle mir vor, wie sie mit den Füßen kontrapunktische Rhythmen klopften, passend zu ihren unterschiedlichen Charakteren. Adolphina kam zuerst dran, und der Scanner des Wärters piepste an ihrem Mund und dann noch einmal in der Nähe ihres Beckens. Die beiden tauschten einen kurzen Blick, dann wies er sie zum Ausgang. Als Imam Salim an der Reihe war, forderte der Wärter ihn unwirsch auf, Gürtel und Armbanduhr abzulegen. Der Mann war nicht begeistert von Imam Salim, und Imam Salim hatte schon so eine Vermutung, warum die Frau vor ihm eine bevorzugte Behandlung bekommen hatte. Als er zur Bushaltestelle kam, bleckte Adolphina ihren Bienenschwarm. (Es schien fast, als würden sie sich schon seit Jahren kennen und in einer Art Geheimsprache kommunizieren.) Ihre Protzerei ärgerte ihn. »Wie putzen Sie die Dinger?«, fragte er und entblößte die Zähne.
Sie wies mit dem Daumen auf seinen Koran. »Jedenfalls nicht mit solchem Bullshit.«
Trotz ihrer Lebensgeschichte und trotz seines Glaubens betrachteten Adolphina und Imam Salim Zufälle nicht als Zeichen des Himmels. Deshalb gab auch keiner von ihnen etwas darauf, dass im Bus nur noch zwei benachbarte Plätze am Gang frei waren. Als der Bus losruckelte, waren unsere zwei unerschütterlichen Realisten von der zufällig erzwungenen Nähe einfach nur genervt.
Die Justizvollzugsanstalt befindet sich an der Spitze des Apostrophs Staten Island, und die Rückfahrt nach Coolidge dauert lang. Auf der Reise entlang der Ränder verschiedener Stadtviertel verzog Adolphina nach jeder Bodenwelle das Gesicht und setzte sich anders hin. Imam Salim seufzte extra laut, und Adolphina tat ihm den Gefallen und bemerkte es.
»Ja?«
»Ich glaube, es wäre angenehmer, wenn Sie sich ein Holster kaufen würden.«
Sie warf ihrem Sitznachbarn am Fenster einen kurzen Blick zu – seine Wange klebte mit ausgehustetem Schleim an der Scheibe fest –, zog eine Five-SeveN aus dem Hosenbund und legte sie sich in den Schoß. »Oh, Sie meinen für die hier?«
»Ja, genau das meine ich.«
»Danke, ich nehme Ihre Anregung zur Kenntnis.« Damit hob sie den Hintern, um die Knarre wieder wegzustecken.
Warum sie die Unterhaltung fortgesetzt haben? Vielleicht waren sie einfach hoffnungslos gelangweilt von der Fahrt, Haus an Haus und Bauplatz an Bauplatz, ein ganzer Horizont in der Farbe von Wintergras. Worüber sie sprachen, erfuhren wir nicht. Sie erzählten uns später nur, sie hätten eine lange Diskussion über das Leben geführt. Aber hier auf meinem Stuhl hinter der Rezeption, hoch über den künstlich gekühlten Straßen von HADITH, stelle ich mir vor, dass Adolphina sich mit ihren raspelkurzen Haaren über den Gang lehnte und Imam Salim fragte, wer und was er war, und dass er ihr die ganze Wahrheit sagte. Als sie irgendwann feststellten, dass sie nur zehn Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnten, wusste sie vermutlich schon alles über die Umstände seiner Flucht aus Markab, die Plage, die sich bis in seine Lunge gefressen hatte, die drei Söhne, die er mit gekauften Papieren ins Land geschmuggelt hatte, und die Ursache seiner Schlaflosigkeit. Sicher aber ist nur, dass sie nach dem Aussteigen eine Flasche miesen Whiskey kauften und im Gebetsraum der Occident einen Absacker nahmen.
Als Adolphina sich eine durchzechte Stunde später krumm und schief wie ein Ellbogen erhob, um nach Hause zu gehen, schoss ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. »Woher weißt du’s?«, fragte sie, hielt sich an der Wand fest und deutete mit dem Zeigefinger nach oben, über den ersten und zweiten Stock und die Wolken hinaus. »Ich meine, wie kannst du sicher sein?« Sie fragte nach einem Beweis, den nur ein Imam geben kann. Er holte eine Taschenlampe aus dem Schrank. Dann machte er das Licht aus, knipste die Lampe an und hielt die Hand in den Lichtstrahl, sodass seine Finger einen Schatten an die Wand warfen. Er schaltete die Lampe an und aus und wieder an.
»Siehst du?«, sagte er und deutete auf den Lichtstrahl, seine Hand und den Schatten. »Das ist Tauhid. Das ist Gott.«
Sie nickte und tat so, als würde sie verstehen, und sie versprach ihm wiederzukommen.
6
Obwohl Imam Salim liebevoll und warmherzig war, nahm er uns, seine Söhne, nur dann in den Arm, wenn es wirklich nötig war. Es gab kein aufmunterndes Durch-die-Haare-Wuscheln, kein Schulterklopfen. Eine gute Schulnote wurde mit einem anerkennenden Blick gewürdigt. Wenn er um eine Umarmung trotz allem nicht umhinkam, hielt er dabei die Luft an. Und weil der fehlende Körperkontakt durch Imam Salims Gesichtsausdrücke und Eigenheiten ersetzt werden musste, liebten wir sie ganz besonders. Sein Lächeln beispielsweise, das man allerdings selten zu sehen bekam, genossen wir wie eine Opernaufführung. Zuerst wölbten sich seine Wangen, und die Augen, schimmernd wie warmer Honig, verengten sich, dann trat eine Furche auf seine Stirn, als wäre er in Gedanken versunken, und zuletzt erschienen seine für einen Immigranten erstaunlich geraden Zähne, ganz langsam und zart, wie Klaviermusik in der Dunkelheit. Trotzdem dauerte es nicht lange, bis Dayo, Iseul und ich die mangelnde Nähe durch reflexartige, rabiate Prügeleien kompensierten. Ständig gingen wir wegen nichts und wieder nichts aufeinander los. Es fing im Sommer an, als wir in klebriger Langeweile herumhingen. Augenbrauen zogen sich zusammen, und schon rumorte ein vertrauter Jähzorn in unseren Eingeweiden. Wir zofften uns ums Essen, um Spiele, um die Frage, wer wo am Esstisch oder auf dem Sofa sitzen durfte. Äußerungen wurden absichtlich falsch verstanden und als Beleidigungen interpretiert. Blaue Flecken blühten auf unserer Haut wie Länder auf einer Landkarte, meistens Australien. Als ich acht war, setzte Iseul mich zum ersten Mal mit einem Fausthieb außer Gefecht. Diese Kämpfe waren absolut notwendig für uns und wurden nur selten wirklich boshaft.
Imam Salim, schlecht gerüstet fürs Vatersein, versuchte durchzugreifen, indem er eine kratzige Wolldecke über uns warf. Wenn das nicht funktionierte, wurde er so wütend über unsere Ungezogenheit, dass sein kojotengraues Gesicht rot anlief und seine Stimme sich überschlug. Seine Sprache für Wut war Italienisch. Porco cane! Damals war mir das nicht klar, aber er machte sich nicht wegen eines Faustschlags oder einer gebrochenen Nase Sorgen. Er hatte nur Angst, er könnte uns in einer Stresssituation zu nahe kommen. Er machte sich Gedanken um die Gefahr, die von ihm ausging, und deshalb besorgte er sich verschiedene Hilfsmittel.
Eines Tages, als Dayo und ich uns beim Frühstück anschickten, einen Kampf auf Leben und Tod um die letzte Dattel auszutragen, zischte plötzlich etwas an meinem Ohr entlang. Ich spürte einen Schlag im Nacken, gefolgt von einem heftigen, stechenden Schmerz. Keine Sekunde später wurde Dayo an derselben Stelle getroffen, direkt über dem Hemdkragen. Imam Salim, der sich heimlich ins Zimmer geschlichen hatte, stand mit einem Stock in der Hand hinter uns und kicherte. Ein stinknormaler Stock, der aber mächtig wehtat. Ein dorniger Akazienzweig, einen knappen Meter lang, mit feinsten Verästelungen an der Spitze. In den folgenden Wochen sauste der harte, stachelige Stock immer wieder auf uns herab, um unsere Keilereien zu beenden. Wir rauften trotzdem, was Imam Salim überraschte. Er drohte uns an, noch heftiger zuzuschlagen, brachte es aber letzten Endes nicht übers Herz. »Wer hätte gedacht, dass Barbarei vererbt wird?«, fragte er verzweifelt die Wand. Dabei hätte einem so intelligenten Mann wie ihm eigentlich klar sein müssen, dass der Stock für uns eine Verlängerung seiner Hände war.
Mittlerweile kam Adolphina recht regelmäßig in der Occident vorbei. Sie war uns mit nicht mehr als ihrem Namen vorgestellt worden, aber sie schien Imam Salim auf dieselbe Art zu mögen wie wir, und deshalb waren wir bereit, sie zu akzeptieren. Im Sommer neunundneunzig war es bereits sie, die auf uns aufpasste, wenn Imam Salim mal rauskommen wollte. Sie erschien gegen Abend, während wir uns gerade bettfertig machten, und Imam Salim konnte zu einem seiner Nachtspaziergänge aufbrechen, von denen er immer erst kurz vor Fadschr zurückkehrte. (Jetzt, da ich weiß, was ihm bevorstand und wie ihm schon damals die Zeit durch die Finger rann und sein Zustand sich konstant verschlimmerte, überrascht es mich, dass er sich nicht schon früher an sie gewandt hatte.)
Adolphina war groß und hatte ein zerfurchtes, aber schönes Gesicht. Gewöhnlich strahlte sie Ruhe aus, doch ihre Augen waren immer in Bewegung, so, wie man es sich vielleicht bei einem Großwesir vorstellt. Sie bemühte sich sehr um unsere Freundschaft, als wollte sie eine versäumte Zeit wettmachen – sie fragte uns nach der Schule, nach Mädchen, nach Jungen, nach unseren Lieblingsbüchern, Filmen und Videospielen. Unsere Antworten blieben einsilbig. Wir beobachteten sie, wie man vielleicht einen Luchs beobachten würde, der gerade zufälligerweise im Wohnzimmer herumschleicht. Wenn sie bei uns war, hielten wir meistens die Klappe und versuchten unsere Raufereien auf ein Minimum zu reduzieren, aber je mehr wir uns an sie gewöhnten, desto öfter konnte sie einen Blick auf unser wahres Ich erhaschen. Wie sollten wir auch verhindern, dass der Deckenventilator die Spannung zwischen uns aufpeitschte? Quer durchs Zimmer starrten wir einander wütend an, und es dauerte nicht lange, bis Adolphina merkte, was los war. »Wer provoziert hier gerade wen?«, fragte sie wissend. In ihrer Stimme lag stets ein beunruhigendes Selbstvertrauen. Wir weigerten uns, ihre Vermutungen zu bestätigen oder zu bestreiten, was sie wiederum gut fand. »Das ist anständig von euch«, sagte sie. »Ehrenwert.«
Ihr Gleichmut führte schließlich doch dazu, dass wir überkochten. Eines Abends formte Dayo in Iseuls Richtung mit den Lippen ein lautloses »Arschloch«, woraufhin Iseul mit einem Glas nach Dayo warf, sich auf ihn stürzte und einen cartoonesken Trommelwirbel von Fausthieben auf ihn losließ. Adolphina stieß einen hörbaren Seufzer der Erleichterung aus. »Na endlich.« Sie kniete sich neben die beiden wie eine Ringrichterin, die einen Wrestler anzählt. Dayo hatte deinen Vater schon fast von sich runtergeschoben, aber Iseul war zu schwer und hatte einen zu großen Hebel. Er war wütender als jemals zuvor, einfach weil er sich so lange zusammengerissen hatte. Zwischen den Schlägen stachelte Adolphina Dayo an: »Das ist ja peinlich, was du da machst.« Schließlich zuckte sie die Achseln, nahm die Hände auf den Rücken und sagte zu Iseul: »Na dann, bitte sehr.« Sie reichte ihm ihre Gabe mit dem Lauf in der Hand.
Jahre später würde uns jemand erklären, dass der Griff nach einer Waffe eine sichere Erkenntnis bringt: Er offenbart, was man wirklich will. Genau das war es, was wir an jenem Abend von Adolphina lernten; sie verlangte Ehrlichkeit von uns. Einen Atemzug lang, weniger noch, richtete Iseul die Five-SeveN zitternd auf Dayo, dann zielte er entschlossen auf ihre Besitzerin. Adolphina grinste. Natürlich grinste sie. Die Zeit stockte. Iseul schloss die Augen und drückte ab, aber der gewaltige Knall, den er erwartet hatte, blieb aus. Als er die Augen wieder aufmachte, sah sie ihn mit zärtlichem Mitleid an. Das hohle Ding rutschte vom langen Zeigefinger deines Vaters und schlug fest auf dem Boden auf. Er krümmte die Schultern, und dann weinte er, und Dayo weinte auch. Und ich auch. Ich kann dir nicht sagen warum. Adolphina zog Dayo hoch und drückte sein Gesicht an ihre Brust. Iseul presste sie an die andere Seite. »Komm schon, Youssef.« Ich schob mich direkt in die Mitte des Knäuels, mit der Wange an ihren Bauch. Sie versuchte, uns alle gleichzeitig in die Arme zu schließen, kam aber nicht ganz rum. Ich spürte die anderen atmen, und alles schmeckte nach Salz.
7
Adolphina kittete unsere Kindheit, indem sie Imam Salims nicht unbeträchtliche Mankos ausglich. Sie berührte uns gern und viel, auch wenn sie selten sanft war. Meistens bekamen wir Schläge gegen den Hinterkopf. Während Imam Salim sich in Bezug auf seine und unsere Vergangenheit sehr zugeknöpft gab, erfuhren wir über Adolphinas umso mehr. Ihr Vater stammte aus St. Lucia, ihre Mutter aus der Dominikanischen Republik. Sie war in einem Waisenhaus von einem katholischen Drachen aufgezogen worden, und sie dankte Gott, dass diese Frau tot war, eine Aussage, die uns zuerst schockierte und dann elektrisierte. Wenige Tage nach der Beerdigung hatte Adolphina wegen Drogenbesitzes vor Gericht gestanden und sich in ihre Pflichtverteidigerin verliebt. Gemeinsam mit ihrer Liebsten arbeitete sie sich aus der Kleinkriminalität hoch. Wie die beiden dann auf die Erfolgsspur gelangten und Adolphinas Wahl in den Stadtrat einfädelten, blieb für uns ein Geheimnis. Sie sagten nicht mehr, als dass sie es glücklicherweise geschafft hatten, bevor Amerika vollends zum Überwachungsstaat geworden war.
Gegen Ende des Jahres schleifte sie uns schon durch die Nachbarschaft, die zum Teil auch ihr Werk war. Wir waren dabei für sie natürlich nicht mehr als ein Alibi, um noch einmal in eine alte Rolle schlüpfen zu können, die sie in Wirklichkeit aber nie innegehabt hatte. Uns war das egal. Wenn Salim zu einem seiner Ausflüge aufbrach, machten wir uns nur Minuten später dick eingemummelt selbst auf den Weg, schlichen durch trostlose Gassen am Park und am Pfandleiher vorbei, an den frisch von wucherndem Unkraut befreiten Baulücken und den glänzenden Skeletten neuer Gebäude, für die Adolphina angeblich verantwortlich zeichnete. Sie nutzte diese Ausflüge, um uns Lektionen über das Leben zu lehren. Sie erklärte uns, dass man die Reue als das einzig Unvermeidliche im Leben akzeptieren muss, woran man erkennt, dass man reingelegt wird, wie man sich Deine-Mutter-Beleidigungen ausdenkt, einen Tageshändler beurteilt oder eine Immobilie in einem Stadtviertel ohne Supermärkte bewertet, wie man ein Stück Pizza zusammenklappt, ohne dass es sich durchbiegt, wie man mit der Kommunalverwaltung feilscht, wie man merkt, dass man beobachtet wird. Für das meiste waren wir zu jung, und die Saat ihres Wissens fiel auf Zement. Wir fanden es trotzdem toll, denn ihre Ratschläge waren ganz anders als die von Imam Salim. Er hielt hochtrabende professorale Predigten, egal, ob jemand zuhörte oder nicht. Didaktische Monologe für ein Publikum aus Luft. Wenn er sich auf ein Thema eingeschossen hatte, hob er in höchste argumentative Höhen ab, bis er mit seinem Gedankengang irgendwann notlanden musste, was meistens spätabends nach einigen Drinks passierte. »Ihr weigert euch doch einfach nur, die Perspektive derer einzunehmen, die außerhalb eurer angeblich unveränderlichen Geschichte stehen. Der Zusammenhang von materiellem Wissen und Macht ist natürlich offenkundig, aber es gibt auch andere Kategorien des Wissens – seid ihr nicht ganz klar im Kopf? Ahistorischer Materialismus ist überhaupt kein Materialismus!« Was zum Geier redete er da nur? Und mit wem? Mit Bruno Latour? Mit Žižek? Der einzige Kontext, den er lieferte, waren seine Trinkgeräusche und sein lautes Räuspern. Adolphinas Unterweisungen waren wenigstens nützlich. Heul nicht, tu nicht so beleidigt, denk nach. Mach dir klar, dass Intellekt und Wille dasselbe sind. Gib die Jobs bei den Telefonhotlines den Dicken und Hässlichen. Und als Gegenleistung für ihre Lehren ließen wir zu, dass sie auch uns kennenlernte. Wir beantworteten ihre Fragen. Wir beteten Fakten nach, die wir Flaschendeckeln und Eisstielen entnahmen. Ob sie zum Beispiel wusste, dass die Verrazano-Brücke die längste Hängebrücke Amerikas war, noch vor der Golden Gate? Wusste sie, schließlich war sie auf Staten Island aufgewachsen, aber sie spielte mit. Wir beschwerten uns auch bei ihr über Imam Salim. Wieso interessierte er sich nur für seine Moschee und seine Briefe und nicht für uns? Wieso vergaß er immer so viel? Und wieso ging er so oft weg, vor allem nachts? »Werdet ihr erst mal älter«, war alles, was sie dazu zu sagen hatte.
Als die Nächte wärmer wurden und die Luft die Temperatur unserer Haut bekam und die Sonne erst unterging, wenn der Mond schon die Hälfte seiner Runde hinter sich hatte, erwachten die Straßen von Coolidge zum Leben. Wu-Tang, Dipset und früher Drill schallten aus geparkten Autos und echoten vom dicken Beton. Auf unseren Ausflügen mit Adolphina besuchten wir jetzt auch die Hinterhof-Barbecues, bei denen sie ihre »Wählerschaft« aus den Sozialwohnungen wiedertraf und wir lernten, dass alle Teile vom Schwein schmecken, inklusive der Füße. (Dein Vater hat genauso zugeschlagen wie Dayo und ich, selbst wenn er das jetzt, wo er so gottesfürchtig geworden ist, nicht mehr zugeben würde.) Während wir Maiskolben, Kohl und köstliche Currys von Styroportellern futterten, wurden wir von allen möglichen Leuten beschwatzt, die sich bei unserer einflussreichen Freundin einschmeicheln wollten. Wir nutzten dieses bisschen Ruhm schamlos aus und nahmen Huldigungen in Form von großen Mengen No-Name-Cola und Flan entgegen. An einem dieser Abende, wir hatten gerade zum ersten Mal Wassermelone gegessen und waren eigentlich nur darauf aus, uns weiter bestechen zu lassen, löste sich aus der Menge eine Frau mit feinen Haaren und einem Rücken so gerade wie der Pfad der Tugend. Lächelnd kam sie auf uns zu. »Da sind sie ja – die drei Bodyguards.«
Dayo, dem der rosa Saft das Kinn hinunterlief, antwortete für uns. »Wenn Sie Adolph meinen, ist es eher andersrum. Wir sind erst neun.«
Die Frau sah hübsch aus und ihr Outfit, eine weiße Bluse zu einem steifen Bleistiftrock, harmonierte perfekt mit ihrem jugendlichen, unverbrauchten Gesicht. Die kam aus einer anderen Gegend als wir.
»Aha, ihr gebt also zu, dass ihr die jungen Männer seid, die seit Monaten ihre Aufmerksamkeit stehlen?«
Hinter ihr tauchte mit zusammengepressten Lippen und schuldbewusster Miene Adolphina auf. »Mi amor.« Sie umarmte die Frau. »Jungs, das ist Naomi.«
»Oh, wir haben schon viel von Ihnen gehört«, sagte ich, um besonders erwachsen zu klingen.
»Dito«, erwiderte Naomi und brachte mich mit diesem merkwürdigen Wort vollkommen aus dem Konzept. Dann nahm sie Adolphina zur Seite und begann halblaut auf sie einzureden. »Dir ist hoffentlich klar, dass wir jetzt gleich diese Spendensache haben … Ich weiß, du willst dir den Scheiß von früher hier noch mal ansehen … die Leute kennen dich nicht mal … Geschichten sind sowieso alle ausgedacht.«
»Du hast ja recht, tut mir leid.« Adolphina küsste ihr die Hand. »Geh doch schon mal nach Hause, und ich komme in ein paar Stunden nach, okay? Du kannst ja alle, die wir brauchen, auf einen Schlummertrunk zu uns einladen. In der Öffentlichkeit erreicht man sowieso kein vernünftiges Ergebnis. Und nüchtern schon gar nicht.« Sie grinste und küsste Naomi noch einmal, diesmal auf die Wange.
»Einverstanden«, sagte Naomi und wandte sich an uns. »Ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, Jungs – sie ist selbst schuld.«
Ich mochte Naomi, denn sie war nett, und außerdem sah sie, kurz bevor sie in der Menge verschwand, einen Moment lang so aus, als könnte sie meine Mutter sein. Das war das einzig Gute daran, dass ich absolut gar nichts über meine Mutter wusste – ich konnte sie mir so vorstellen, wie es mir gefiel.
Adolphina besorgte uns einen Nachschlag und lotste uns auf eine Treppenstufe an der Rückseite des Gebäudes. Wir aßen, bis wir satt und zufrieden waren. Deine Patin lehnte sich zurück und zündete sich einen Joint an. Sie schob ihr T-Shirt hoch und rieb sich in großen Kreisen den Bauch. Fasziniert starrte ich auf ihren Rumpf, an dem sich tektonische Muskelplatten im Laufe von Jahrzehnten langsam zu Wällen aus vernarbter Haut übereinandergeschoben hatten. Krater und Furchen, eine Mondlandschaft.
»Ich sag euch jetzt mal was.« Sie zupfte das T-Shirt zurecht und verschränkte die kurzen Finger, die sonst oft im ungeduldigen Rhythmus einer Kriegstrommel klopften, entspannt hinter dem Kopf. »Egal, was wir machen, Leute wie wir, wie Salim – Waisen, meine ich …« Ich zuckte zusammen, obwohl mir klar war, dass der Ausdruck zutraf. »Wir haben so ein Gespür – nein, es ist eigentlich kein Gespür, es ist das Bewusstsein, dass das Wesentliche, dem die normalen Leute hinterherjagen, gar nicht existiert. Vielleicht ist es der Sinn? Oder eher so was wie Moral?« Sie schwieg eine Weile. »Wir suchen trotzdem noch danach, ich zum Beispiel mit all dem hier, indem ich Coolidge in das verwandle, was es jetzt ist. Aber man kann sich ein Zuhause nicht einfach ›bauen‹. Man kann aus einem Ich nicht einfach ein Wir machen. Verdammt, seht euch doch nur Salim und seinen Gott an!« Fast hätte sie sich über ihn lustig gemacht, aber dann besann sie sich eines Besseren. »Seht euch doch an, was es mit ihm macht. Sogar er weiß, dass der ›Sinn‹, das ganze Konzept von Sinn, überhaupt nur erfunden wurde, um unsere angeborene Panik in Schach zu halten. Waisen ist das von vornherein klar; wir können sowieso nur auf uns selbst vertrauen. Uns wird von keiner biologischen Autorität irgendeine Ordnung aufgezwungen. Wir haben einen weiteren Blick als andere. Wir leben nicht, wir schweben. ›Hier‹ wird sowieso immer wieder ›woanders‹, und wir befinden uns genau dazwischen, versteht ihr?« Sie bemerkte unsere Verwirrung und bildete mit den Händen ein großes T. »Sorry. Ich bin ein bisschen high. Lassen wir die komplizierten Themen.« Sie stieß uns nacheinander leicht mit dem Fuß an. »Ich würde gern mal wissen, was ihr so vorhabt, wenn ihr groß seid. Wenn ihr nicht mehr hier seid, meine ich. Würde mich interessieren, was euch da so durch den Kopf geht, auch wenn sich das später vielleicht noch mal ändert.« Sie warf einen Blick auf die Uhr. »Aber nicht zusammen antworten wie sonst immer. Denkt mal selbst nach.«
Dayo, der Älteste, antwortete als Erster. »Ich will Geld verdienen. Aber nicht so wie du – nicht böse gemeint! –, eher wie Lex Luthor oder Smaug oder Mr Burns. Ich will Monopolist werden.«
»Geld ist Wasser, aber gut, ehrliche Antwort. Und du?« Sie sah mich an.
»Ich weiß nicht.«
»Also kein Geld verdienen«, witzelte Dayo.
Adolphina beugte sich vor und tippte mir mit dem Finger leicht an die Stirn. »Wenn du es dir überlegt hast, schreib es auf.« Iseul rutschte mit seinem breiten Hintern auf der Stufe hin und her in der Hoffnung, sie würde ihn vergessen. Aber Adolphina sagte: »Du kommst mir nicht davon, Großer.«
Er biss sich auf die Lippen.
»Na los. Raus damit.«
»Ich glaube …« Er biss so fest zu, dass ich dachte, gleich würde ihm die Lippe aufplatzen. »Ich glaube … ich will … dass was von mir bleibt. Ich will was machen, was weiterlebt.« Das überraschte uns alle. Auch die Art, wie er es sagte, wie er die Worte hervorstieß, als wären sie eine riesige Offenbarung.
»Was auch immer wir tun, die Zeit zerstört alles. Aber trotzdem viel Glück«, sagte Adolphina mit liebevoller Herablassung. Sie stand auf, und ein Luftzug strich uns durch die Haare. »Okay, rührt euch nicht von der Stelle.« Dann huschte sie durch den Lichtkegel der Straßenlaterne und trabte davon.
Keine dreißig Sekunden später dröhnte etwas die Straße herauf. Adolphina mit Helm auf einem gelb lackierten Motorrad, das Vorderrad in der Luft. Direkt vor uns kam sie zum Stehen und ließ den Reifen mit theatralischem Federn auf den Boden knallen.
»Wer will zuerst?«
Als Ältester wollte Dayo den Platz wie selbstverständlich für sich beanspruchen, aber Iseul drängelte sich an ihm vorbei und schlang aufgeregt die Arme um Adolphinas Taille. Er war damals schon der Größte von uns dreien und hatte Mühe, seine langen Beine zwischen all den Metallröhren unterzubringen. »Sag Bescheid, wenn es losgehen kann.« Iseul umklammerte Adolphinas Bauch, so fest er konnte, und presste die Hände auf die Ellbogen. »Kann los–«, und schon sausten sie davon. Fünfzehn Minuten später war Adolphina ohne deinen Vater wieder da. Jetzt sprang Dayo auf, noch mal wollte er nicht das Nachsehen haben – aber ich hatte auch gar kein Interesse daran, mich vorzudrängeln. Ich war nicht besonders scharf darauf, irgendwelche streunenden Katzen auf den Asphalt zu bügeln, aber was blieb mir anderes übrig? Als Adolphina das zweite Mal zurückkam, stieg ich auf.
Und dann ging es los. Die atemberaubende Geschwindigkeit verwandelte den schwülen Sommerabend augenblicklich in Herbstluft, und zwischen meiner Brust und Adolphinas Rücken wurde es frostig kalt. Die Lichter der Straßenlaternen über unseren Köpfen waren nur noch zwei dünne Striche, die niedrigen Wolken schrumpften zu einer schwarzgrauen Welle zusammen. Auf Adolphinas Schulter erschien Bruder als windzerzaustes Frettchen, durchsichtig wie ein Mond aus Papier. Hunger hatte er nicht. Er wollte das erleben, genau wie ich. Bis zu diesem Moment hatte die Welt sich uns im Tempo unserer eigenen Schritte erschlossen. Wir waren nur ein paarmal in einem Auto gefahren und einmal mit dem Bus. Das hier war eine andere Dimension, unmittelbar und überwältigend. Ich hatte Angst, dass sich normales Gehen nach diesem Erlebnis anfühlen würde wie die Arbeit mit einer Axt, nachdem man Präzisionswerkzeuge benutzt hat. Wir bretterten so scharf wie möglich um die Kurven – deine Patin war eine unverbesserliche Angeberin – und mir kam ein bisschen Wassermelonen-Galle hoch. Letzten Endes war die Fahrt aber schnell vorbei. Bevor ich wieder zu Atem kommen konnte, glitt der Scheinwerfer schon über die nüchterne Rückseite unseres Hauses. Bruder sprang ab und verschwand unter den Akazien. Ich wollte ihm hinterher, aber als ich wieder auf festem Boden stand, zitterten mir plötzlich die Knie, und ich wäre fast ins dornige Dickicht gefallen. »Wo willst du denn hin?«, fragte Adolphina eher belustigt als besorgt.
Ich zuckte die Achseln.
»Was siehst du da?«
»Will ich nicht sagen.«
»Einen imaginären Freund oder so?«
»Kann sein.«
»Was macht ihr denn so zusammen?«
»Ich füttere ihn.«
»Und womit hast du ihn zuletzt gefüttert?«
»Mit dem Schlächterburschen, das ist so ein Buch.«
»Ein ziemlich sadistisches, wenn ich mich … Dafür bist du noch viel zu jung …«
Ich zuckte wieder die Achseln.
»Und womit noch?«
»Mit der Form meiner Nase, die hasse ich nämlich. Aber als ich in den Spiegel geguckt habe, war sie wieder da.«
»Was?« Sie sah auf die Uhr. »Da reden wir später noch mal drüber, okay?«
Taten wir dann zwar nicht, aber das war auch nicht weiter schlimm. Sie winkte mich zu sich, tippte mir zum zweiten Mal auf die Stirn und sagte: »Tisbah ala khair.« Ich mochte es, wenn sie Arabisch sprach, auch wenn ihre Aussprache noch fürchterlicher war als meine. Beim Wegfahren ließ sie extra für mich den Motor aufheulen.
Oben hatte Iseul Dayo huckepack genommen, und zusammen rannten sie Motorengeheul ausstoßend in einer großen Acht um den Couchtisch. Dieser Abend hatte uns Strom durch die Adern gejagt und jegliche Vernunft ausgetrieben. Als Dayo und Iseul nicht mehr konnten, aßen wir Bananen und Datteln und kicherten bis nachts um halb zwei. Schließlich schoben wir irgendein Twilight-Zone-Video rein, in der festen Überzeugung, zum Schlafen noch viel zu aufgeregt zu sein. Aber mit dieser Überzeugung lagen wir natürlich daneben. Noch bevor Rod Serling mit seiner Einleitung fertig war, schliefen wir tief und fest.
Ein paar Stunden später wurde ich vom rostigen Klappern des Vorhängeschlosses im Erdgeschoss geweckt. Ich rüttelte Iseul und Dayo wach, und blitzschnell räumten wir auf. Dann knipsten wir das Licht aus und stürzten uns mit Klamotten ins Bett. Nur Sekunden später schlurften Salims müde Schritte die Treppe herauf, kurz danach klickte fast unhörbar seine Zimmertür. Ich malte mir aus, wie er den Türknauf gedreht und am Anschlag gehalten hatte, um möglichst kein Geräusch zu machen. (Meine Vorstellung von ihm war immer viel zu wohlwollend.) Kurze Zeit später drang sein Schnarchen durch die Wände, und wir unterdrückten ein freudiges Jauchzen. Dir ist bestimmt klar, warum wir so jubelten. Zum allerersten Mal waren wir wach auf dieser Welt, während er schlief. Was für andere Kinder normal war, hatten wir bis zu diesem Moment noch nie erleben dürfen. Es war wie ein Sieg über den Tod. Aber dann wussten wir mit dem ganzen Hochgefühl doch nichts anzufangen und schliefen wieder ein.
Minuten vergingen, mehr als eine Stunde. Plötzlich ertönte von unten ein schrilles Wimmern, und zum zweiten Mal in dieser Nacht wurde das Fundament meines Schlafs erschüttert. Der Fernseher war wieder angegangen. »Habt ihr das gehört?«, fragte ich in die Dunkelheit. Hatten sie nicht, sie lagen in tiefen Träumen. Auch Imam Salims Schnarchen dauerte unvermindert an. Wer sah da fern? Bruder war es nicht, er lehnte als Spazierstock in der Ecke des Zimmers und schlief. Unvermittelt begann Mr Serling seine Erzählung von vorn, mit geisterhaftem Echo wie eine Stimme aus einem tiefen Schacht.
»Clown, Landstreicher, Balletttänzerin, Dudelsackpfeifer und ein Major – eine Ansammlung von Fragezeichen. Fünf mehr oder weniger unwahrscheinliche Wesen, hinabgestoßen in die Finsternis. Keine Erklärung, keine Logik, keine Vernunft; nur ein ewiger Albtraum, in dem Angst, Einsamkeit und Unbegreifliches Hand in Hand durch die Schattenwelt wandern …«
8
Die schmallippige Sprechstundenhilfe in der Arztpraxis konnte sich nie an meinen Namen erinnern, obwohl sie mich mindestens einmal im Monat zu Gesicht bekam. Ich war nicht im eigentlichen Sinn kränklich, aber alle paar Wochen hatte ich Fieber, bekam einen Husten oder litt unter überwältigender Erschöpfung. Mein Immunsystem glich eher einer Mullbinde als einem Kettenhemd. Die Ärztin, eine Russin namens Ksenia, untersuchte mich, verschrieb, was nötig war, und dann durfte ich wieder nach Hause, glücklich über einen Tag schulfrei, an dem ich am neuen Computer im Esszimmer Spades spielen konnte. Imam Salim dagegen war genervt von meinen häufigen Erkrankungen. Er mochte es nicht, wenn sein Tagesablauf durcheinandergeriet, zumindest behauptete er das, aber ich glaube, in Wirklichkeit gefiel es ihm nicht, dass ich ihn an seine eigenen Leiden erinnerte, an die Aphthen, den Durchfall und die eigenartigen Flecken auf der Haut, die er mit Make-up abdeckte.
Im Sommer vor meinem Wechsel auf die weiterführende Schule hatte ich mit einem Infekt alle im Haus angesteckt. Schweißnass hatten wir im Wohnzimmer vor uns hingeschmort, als überraschend ein Bote mit einer Lieferung klingelte. Er ließ Imam Salim unterschreiben, dann half er ihm, die große Kiste nach oben zu tragen, und stellte sie verkehrt herum vor unserer Tür ab. »Von wem ist das?«, fragte Dayo. »Von einem Freund aus Saudi-Arabien«, sagte Salim, »aber das muss euch nicht interessieren.« Als wir die Kiste umdrehten, riss das Klebeband, und eine Seite platzte auf. Ein Schwung dicker, kugelrunder Orangen kullerte die Treppe hinunter. Dayo, Iseul und ich flitzten hinterher und brachten so viele zurück, wie wir tragen konnten. Dann stellte Imam Salim sich in die Küche und schnitt die geäderten Früchte in eine Schüssel. Auf dem Tisch lag ein Brief. »Ich übersetze ihn euch.«
Salim,
hast du mir nicht mal erzählt, manche Menschen würden glauben, dass die Seelen der Toten auf Bäumen leben? Dass man die Bäume schütteln muss, damit die Seelen herunterfallen und in ihren Gräbern Frieden finden? Nein, jetzt erinnere ich mich – das war jemand anders. Ich glaube, es war ein Schriftsteller, den ich in Beirut kennengelernt habe. Er hat gesagt, eine Orange aus Palästina zu essen, hieße deshalb, das Land selbst zu schmecken. Er war hin- und hergerissen, was das für ihn bedeutete. War es pietätlos, die Orangen zu essen? Oder war es besser, sein Heimatland zu verzehren, damit man nicht selbst von ihm aufgezehrt wurde? Ich antwortete ihm, dass das gute Fragen seien, aber dass wir uns um solche Dinge gar nicht erst sorgen müssten, wenn es mit unseren Ländern so weitergehe wie zur Zeit.
Die Orangen in dieser Kiste sind nicht aus Palästina. Sie stammen aus unterseeischen hydroponischen Biosphären im Golf von Akaba. Diese Biosphären gehören dem Mann, dessen Küche ich leite. Vielleicht gehört ihm auch das ganze Rote Meer, wer weiß das schon? Schließlich ist alles käuflich. Na ja, diese Unterwasserorangen sind jedenfalls die besten, die ich je gegessen habe. Wallah. Lass sie dir und den Jungs schmecken.
Aber stell keine Fragen, mein Freund.
Bleib am Leben.
Kashif