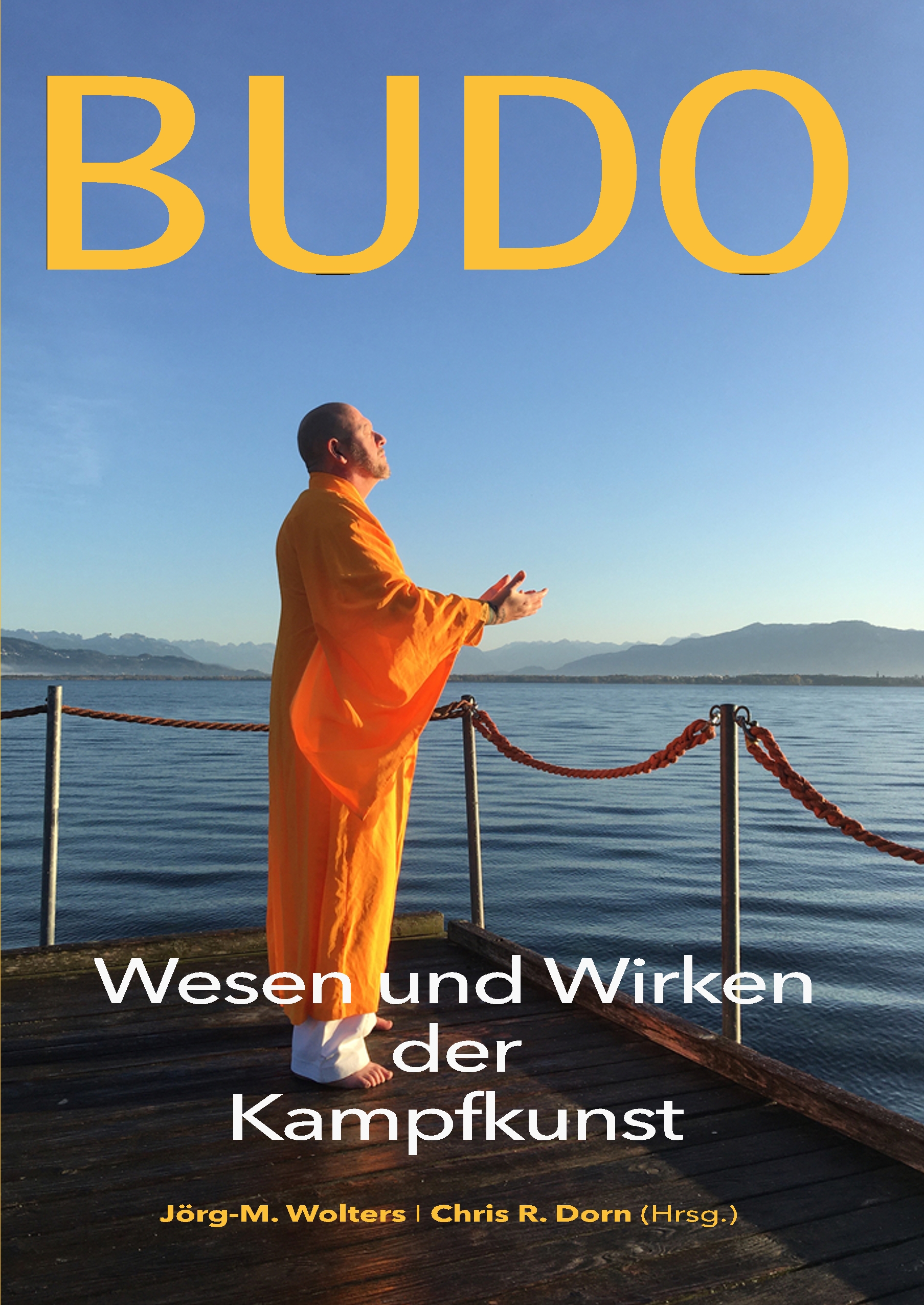
Budo E-Book
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Budo als Oberbegriff für die traditionellen Kampfkünste, eigentlich namentlich Japans, aber hier im weiteren Sinne alle Kampf- und Bewegungskünste Asiens, die sich als Weg und nicht Sport begreifen, ist in den letzten Jahren vermehrt Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Jüngere Veröffentlichungen zum Thema nehmen das historisch, philosophisch, psychologisch und pädagogisch Besondere und sich vom modernen Kampfsport gänzlich Unterscheidende in den Blick, ohne dass allerdings weiterhin begrifflich und inhaltlich falsche Vorstellungen durch die absurde Vereinnahmung der allein dem Budo zugeschrieben Wesenszüge und Wirkweisen in sog. "Budo-Sport"-Verbänden immer mehr verbreiten. Gerade so, als könne man dem modernen Kampfsport durch den Zusatz "Budo" (der suggerieren soll, man beziehe sich auf dessen Wesentliche, "Geistige") etwa einen ehrwürdig-traditionellen Charakter verleihen und den Wettkampfsport bereichern, gar ethisch aufwerten. Insofern bedarf es immer noch oder immer mehr der Aufklärung darüber, was denn das eigentliche Wesen und Wirken von Budo überhaupt ausmacht, um dem Ganzen gerecht zu werden. Dabei soll sich dieses Buch nun weniger auf die historische, seit der Edo-Periode (1600-1868) vor allem vom Zen-Buddhismus (neben Konfuzianismus und Taoismus sowie Shaolin) geprägte Entwicklung von Budo aus den alten Kriegskünsten (Bugei und Bujutsu) eingehen, als auf das nunmehr auch heute noch Wesentliche und "Spezielle". Budo als spirituelle wie praktisch-philosophische Weg-Lehre und dadurch Kampf-"Kunst" kann, recht verstanden, ein einzigartiger Schatz in der Theorie und Praxis des Studiums von "Kampf" und "Kämpfen-Können" sowie des Selbst sein, und am Ende auch des eigenen Lebens. Budo wirkt! Es ist ein auf Bewegung, Begegnung und Besinnung angelegtes bewährtes ganzheitliches Instrument der Selbsterziehung, Charakterschulung und Persönlichkeitsentwicklung und als originärer Weg ("Do") zum "Friedvollen Krieger" eine konkrete Anleitung zu körperlicher, seelischer, geistiger, d.h. psycho-physischer wie psycho-emotionaler Selbstbeherrschung, die auf der Grundlage von stetig geübter Achtsamkeit und Wertschätzung in der Meisterschaft zu Einsicht und Gewaltverzicht führt. In diesem Buch wird das Thema Budo, sein Wesen und Wirken, aus Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis heraus analysiert, um ein ebenso weitergehendes wie tieferes Verständnis von der Sache zu fördern. Die Autoren (Vorstellung im entsprechenden Kapitel hinten), allesamt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
O Mi To Fo
Wir grüßen den Buddha in dir - und in uns!
"Glaubt nicht an irgendwelche Überlieferungen, nur, weil sie für lange Zeit in vielen Ländern Gültigkeit besessen haben.
Glaubt nicht an etwas, nur, weil es viele andauernd wiederholen. Akzeptiert nichts, nur, weil es ein anderer gesagt hat, weil es auf der Autorität eines Weisen beruht oder weil es in einer heiligen Schrift geschrieben steht.
Glaubt nicht an Einbildungen und Visionen, die ihr für gottgegeben haltet. Glaubt nichts, nur, weil die Autorität eines Lehrers oder Priesters dahintersteht.
Glaubt an das, was ihr durch lange eigene Prüfung als richtig erkannt habt, was sich mit eurem Wohlergehen und dem anderer vereinbaren lässt." (Buddha)
Inhaltsverzeichnis.
Einleitung
Budo
- Grundlegendes und Allgemeines zur Wortbedeutung
Die 6 Wesenselemente
Die 6 Prinzipien
…und mehr
Der Dualismus von Kampfkunst und Kampfsport
Charakteristika als Abgrenzungsmerkmale
Budoka und das Ethos des Athleten
Selbstverteidigung, Kampfsport, Kampfkunst und Budo
Zwischenreflexion
Paradigmenwechsel:
Die Subjektzentrierung im Budo
Budoide Wesenselemente
Bu und Do
Schüler – Lehrer – Weg
Das Dojo
Reigi – Das moralische Gerüst
Zen – Das geistige Gerüst
Shu Ha Ri – Die Etappen des Weges
Reflexion
Budopädagogik
Budo-Projekte. Professionelle Budo-Angebote
Budotherapie
Budotherapie bei seelischen Erkrankungen
Das heilsame Wesen und Wirken buddhistischer Kampfkunst, oder:
Mein Weg nach „Shaolin“...
Stell dir vor...
Konsequenzen für das zentrale Qi
Letzter Ausweg – „Shaolin“
Dein erster Schritt als „Shaolin“
Dein zweiter Schritt als „Shaolin“
Dein dritter Schritt als „Shaolin“
Zurück auf Anfang: Stell dir vor...
buddhAID...
Zum Schluss, oder:
Budo – Beruf und Berufung
Schlusswort der Herausgeber...
Über die Autoren...
Grusswort der Herausgeber
Univ. Doz. Dr. Jörg-M. Wolters I Prof. Dr. Chris R. Dorn
Was uns verbindet, ist ein gemeinsames Grundverständnis des Budo. Was für uns beide m Zentrum steht, ist nicht die äußere Leistung, sondern die innere Reifung und Menschwerdung. Sie steht von jeher im Mittelpunkt der Weg-Lehre der Kampfkünste – diesem Weg fühlen wir uns verpflichtet. Aufgrund dieser originär erzieherischen, selbsterzieherischen aber auch therapeutischen Anteile der Auseinandersetzung mit sich selbst, gewinnt Budo heute als neues Medium sowohl in der Pädagogik als auch im Rahmen therapeutischer Settings immer mehr an Gewicht. Mit anderen Worten: Budo wirkt in jedem Bereich unseres Lebens gedeihlich, indem es den Körper kräftigt, den Geist stärkt und sowohl unsere Achtsamkeit als auch unser Mitgefühl ausbildet, was uns deutlich sozialer macht. Wir forschen und arbeiten an verschiedenen gemeinsamen Projekten, um möglichst vielen Menschen diesen bereichernden Weg zu vermitteln.
Wir bieten Vorträge, Coachings, Seminare und Weiterbildungen an, die sie vielleicht interessieren und/oder inspirieren könnten. Außerdem finden sie umfassendes Material zum Thema auf unseren Heimseiten. Wir würden uns freuen, wenn sie uns besuchen... Und wenn sie Fragen haben – Mail genügt!
www.shoto-kempo-kai.de
www.budopaedagogik.de
www.buddha-aid.org
www.professordorn.de
Unsere Vision: Shorinji-Bubutsu-Do
(jap.: Shaolin buddhistisches Budo)
Einleitung
Jörg-M. Wolters
Budo als Oberbegriff für die traditionellen Kampfkünste, eigentlich namentlich Japans, aber hier im weiteren Sinne alle Kampf- und Bewegungskünste Asiens, die sich als „Weg“ und nicht Sport begreifen, ist in den letzten Jahren vermehrt Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Jüngere Veröffentlichungen zum Thema nehmen das historisch, philosophisch, psychologisch und pädagogisch Besondere und sich vom modernen Kampfsport gänzlich Unterscheidende in den Blick, obwohl sich allerdings weiterhin begrifflich und inhaltlich falsche Vorstellungen durch die absurde Vereinnahmung der allein dem Budo zugeschrieben Wesenszüge und Wirkweisen in sog. „Budo-Sport“-Verbänden immer mehr verbreiten. Gerade so, als könne man dem modernen Kampfsport durch den Zusatz „Budo“ (der suggerieren soll, man beziehe sich auf dessen Wesentliche, „Geistige“) etwa einen ehrwürdigtraditionellen Charakter verleihen und den Wettkampfsport bereichern, gar ethisch aufwerten.
Insofern bedarf es immer noch oder immer mehr der Aufklärung darüber, was denn das eigentliche Wesen und Wirken von Budo überhaupt ausmacht, um dem Ganzen gerecht zu werden. Dabei soll sich dieses Buch nun weniger auf die historische, seit der Edo-Periode (1600–1868) vor allem vom Zen-Buddhismus (neben Konfuzianismus und Taoismus sowie Shaolin) geprägte Entwicklung von Budo aus den alten Kriegskünsten (Bugei und Bujutsu) eingehen, als auf das nunmehr auch heute noch Wesentliche und „Spezielle“.
Budo als spirituelle wie praktisch-philosophische Weg-Lehre und dadurch Kampf-„Kunst“ kann, recht verstanden, ein einzigartiger Schatz in der Theorie und Praxis des Studiums von „Kampf“ und „Kämpfen-Können“ sowie des Selbst sein, und am Ende auch des eigenen Lebens. Budo wirkt!
Es ist ein auf Bewegung, Begegnung und Besinnung angelegtes bewährtes ganzheitliches „Instrument“ der Selbsterziehung, Charakterschulung und Persönlichkeitsentwicklung und als originärer Weg („Do“) zum „Friedvollen Krieger“ eine konkrete Anleitung zu körperlicher, seelischer, geistiger, d.h. psycho-physischer wie psycho-emotionaler Selbstbeherrschung, die auf der Grundlage von stetig geübter Achtsamkeit und Wertschätzung in der „Meisterschaft“ zu Einsicht und Gewaltverzicht führt.
In diesem Buch wird das Thema Budo, sein Wesen und Wirken, aus Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis heraus analysiert, um ein ebenso weitergehendes wie tieferes Verständnis von der Sache zu fördern.
Die Autoren (Vorstellung im entsprechenden Kapitel hinten), allesamt langjährige Kampfkünstler, Praktiker, „Meister“, Budo-
Lehrer und akademische Forscher, versuchen mit ihren jeweils verschieden gearteten Beiträgen und unterschiedlichen Schreibstilen den „wahren“ Kern und Sinn von Budo herauszuarbeiten.
Dies ist Mal in einem streng wissenschaftlichen und „nüchternen“ Stil, Mal sehr persönlich (fast intim), Mal als Übersichtsarbeit eher populärwissenschaftlich, was den Bezug der Autoren zum Thema und der Lektüre der geneigten Leserschaft gerecht werden soll.
Insgesamt ist dieses Werk aber ein Plädoyer für die Rückbesinnung auf das Wesentliche und Anerkennung des Wesentlichen von Budo, und ebenfalls ein Einblick in und Ausblick auf die Chancen, die Budo in heutiger Zeit für die Ausübenden, Schüler wie Lehrer, aber auch Adressaten professioneller Budo-Methoden wie Budopädagogik oder Budotherapie hat oder haben kann. Das tiefere Wissen und Verständnis vom Wesen und Wirken des Budo wird jedem Interessierten jedenfalls dienlich sein, seinen eigenen Weg der Kampfkunst als „ewiger Schüler“ intensiver zu studieren oder als Lehrer gehaltvoller zu vermitteln.
Fragen, Kritik und Anregungen nehmen wir sehr gerne entgegen und freuen uns, liebe Leser, auf Ihr Feedback. Wir wollen das Thema ja bewegen, also auch diskutieren, darüber und dafür streiten, in die Welt tragen…
1. Budo - Grundlegendes und Allgemeines zur Wortbedeutung
Jörg-M. Wolters
Befassen wir uns zunächst einmal mit der Wortbedeutung. Das Wort Budo und seine eigentliche Bedeutung erschließt sich nämlich schon aus der Schreibweise. Sie definiert den gemeinten Sinn, der sich im heutigen westlichen Sprachgebrauch allerdings in offensichtlicher Unkenntnis des originär mit „Bu - Do“ Ausgesagten so verwässert hat, dass der Begriff in falscher Verwendung oft für alle möglichen Kampfsportarten herhalten muss. Dabei erklärt sich Sinn und Bedeutung durch die Schreibweise der Worte „Bu“ und „Do“ selbst:
Die japanischen (auch chinesischen) Schriftzeichen für Budo bestehen aus 2 Kanji, Bu und Do, gemalten Bildwörtern. Das linke Zeichen „Bu“ wiederum besteht aus 2 einzelnen Bildern:
Zeichen für Hellebarde, Schwert
Zeichen für „Ende, Stopp“ oder „Beenden, Anhalten“.
Damit meint „Bu“ erstmal grundlegend also: „Schwert-Stoppen“ und im weiteren Sinne „Kampf beenden“.
„Bu“ begegnet uns im Wort „Bushi“, „Bu“ und „Shi“, also: „derjenige (Mensch), der das Schwert führt“, steht somit für „Krieger“ und das konkret kriegerische Element, für „Militär“ und die „Kriegskunst“, „Kunst des Krieges“ oder „Technik des Krieges“, „Bujutsu“ („Jutsu“ als „Kunst“ im Sinne von Kunstfertigkeit oder auch „handwerkliche Technik“). Der Begriff bezieht sich im Allgemeinen auf die Kriegs- und Kampftechniken des japanischen Altertums.
Damit steht das Kanji „Bu“ allein erstmal nur für die rein technische Fähigkeit und Fertigkeit, die „Handwerkskunst“, Kämpfen zu können, um das „Schwert zu stoppen“. Wie das aber nun genau zu geschehen hat, wird mit dem nachfolgenden Wort und Kanji erklärt. Im „Bu“-„jutsu“ durch das „Beherrschen des Handwerks“, durch technisches „Können“ und Erfolg – also durch das Besiegen des Gegners.
Uns interessiert hier aber im Unterschied (und Gegensatz) zum Bu-jutsu vielmehr Bu-do, also das 2. Schriftzeichen „Do“. Es ist ebenfalls ein gemaltes Bild-Wort, dessen Sinn sich in der Analyse der beiden Ideogramme, aus denen sich das Zeichen „Do“ zusammengesetzt, erschließt:
Hier sehen wir den Menschen (vertikale Linie mit Punkt als Kopf) und einen Weg (horizontale Linie).
Dieser Bildteil bezeichnet somit recht „einen Menschen auf dem Weg“.
Das weitere Ideogramm im Kanji „Do“ soll das Ziel dieses Weges näher bezeichnen und definieren:
Dieses Zeichen „Kopf, Haupt“, auch „Führer“, „Führen“ symbolisiert den Helm des Shogun (Anführer des Kriegeradels der Samurai). Es steht für die Herrscherklasse oder deren mächtigen Einfluss und das „Würdevolle“ und „Besondere“, somit, und das ist nun ganz wesentlich, allgemein für ein sich lohnendes, zu erstrebendes „höheres Ziel“.
„Do“ heißt also im gemalten Wortsinne: „der Mensch auf dem Weg zu einem höheren Ideal“. Zwar wird „Do“ meist wörtlich übersetzt als „Weg“, „Straße“ oder „Pfad“, bedeutet aber im entsprechenden Kontext auch „Methode“ oder „Prinzip“, und in Bezug auf das besagte „Höhere Ziel“ hin eben auch „der rechte Weg“, auch die „Lehre“.
„Do“ gewinnt im Sinne der rechten „Lehre“ somit philosophische Bedeutung (auch wenn sie an den abstrakten Gehalt des gleichgeschriebenen chinesischen Wortes „Dao“ und Laotzes Daoismus, eine der 3 großen esoterischen Lehren Chinas neben Konfuzianismus und Buddhismus, herankommt).
„Do“ als der „rechte Weg“ und die „rechte Lehre“, um Höheres, ein „Ideal“ anzustreben und zu erreichen, ist daher ein eindeutig „geistiges“ Prinzip (im Unterschied zum technischen des „Jutsu“), ein „Sich-auf-dem-Weg-befinden“ im Streben nach dem „Besseren“, „Guten“.
„Do“ in der Betonung des „Weges“, also im Sinne der rechten „Weisheits“-Lehre, hebt somit originär ab auf das philosophisch „Esoterische“, auf Glaubens- und beinahe Religionswert erhaltende Ethik und Moral, auf einen Verhaltenskodex tugendhaften Strebens, Bemühens und Studierens des rechten Weges und ist dem praktischen, ehrenhaften „geistigen“ Übens und Tuns verpflichtet.
„Budo“ (auch chin. „Wudao“) besagt also schon im gemalten Wortsinn, dass das „Schwert-Stoppen“, den „Kampf-Beenden“, auf geistig-philosophischer Ebene – und eben nicht im körperlich-technischen Sinne wie in „Jutsu“-Systemen – zu bewerkstelligen ist. Nicht durch „Sieg“, das kriegerisch-kämpferische Besiegen der Gegner (wie im auf das bloße Handwerk dazu beschränkte „Jutsu“), sondern durch Einsicht, d.h. letztlich konkret die Ideologie („Do“) des „Nicht-Kampfes“.
Es wird quasi dank eigener moralisch-ethischer Grundeinstellung, dem Streben nach dem, übrigens buddhistisch inspiriertem höheren Ideal1 des Nichtkämpfen-Wollens, des Friedens also, nunmehr das eigene Schwert gestoppt, nicht das des Feindes. Im richtigen Verständnis meint also Budo, den Kampf in dem Sinne zu beenden, dass er gar nicht erst entsteht, d.h. ihn also aus der Philosophie (und Psychologie) des erstrebten Gewaltverzichts heraus „zu vermeiden“, gar, ihn „zu verhindern“.
Dies ist mit dem „Sieg über sich selbst“ gemeint, der Sieg, der entsteht, wenn es gelingt, seine eigene Wut und Aggression, seine unkontrollierten Emotionen, sich selbst zu beherrschen, die volle Kontrolle seiner selbst.
Grundmann lässt dies in der provokativen These „Die Niederlage ist ein Sieg“2 gipfeln.
Nun darf allerdings nicht verkannt werden, dass dieser „Do“ sich konkret auf „Bu“ bezieht. Das bedeutet, dass die Erlangung kämpferischer Fähigkeiten sehr wohl die zu erlernenden Inhalte von Kampfkunst und damit natürlich die konkrete Übungspraxis im Budo bestimmt. Das darf nicht übersehen oder verharmlost werden. Es geht darum, zu lernen, so gut kämpfen zu können, dass man den „Nicht-Kampf“ durch Überwindung des Kämpfen-Wollens oder „Meinen-zu müssens“ verwirklicht, und als Souverän (Meister) schließlich jeder vermeintlichen Provokation in der Gewissheit von Überlegenheit (nicht ängstlichen Unterlegenheit) trotzen kann. Der Meister weiß um sich, seine Fähigkeiten, und muss es niemandem mehr beweisen, schon gar nicht unter Verletzung eigener („Do“)-Prinzipien des Gewaltverzichts und Wertschätzung allen Lebens3.
Das ist der – in der Tat buddhistische – „Weg des Friedvollen Kriegers“4 – nicht der ausschließlich spirituell-meditative der Mönche. Ein nur auf den ersten Blick paradoxer Weg…
Das breite Spektrum der „Wege“ in der japanischen Kultur, das von der Teezeremonie (Sado) über Kalligraphie (Shodo), Duftzeremonie (Kodo) bis zur Blumensteckkunst (Kado) oder, wie hier betrachtet, eben Kampfkunst reicht, setzt die jeweilige Kunst (das praktizierte Handwerk), mit der man sich in steter Übung im Trachten nach Erfüllung des Ideals auseinandersetzt, ins Zentrum von systematischer Selbstschulung und Selbstentwicklung. Im Budo lernt man, wie im Jutsu und seiner Idee folgendem Kampfsport auch, Kämpfen, nur eben in ganz unterschiedlicher Theorie und Praxis, Haltung und Zielvorstellung.
Wer permanent (auch in konkreten Zweikampfsituationen wie Kumite oder Randori) unter Anleitung eines echten Weg-Lehrers (Sensei) übt, sich bei Alledem (dem psycho-emotionalen Stress von Angriff und Verteidigung) zuvörderst selbst zu beherrschen, statt nur andere zu besiegen, den „Kontrahenten“ als Partner und Freund, gar Lehrer und nicht etwa Gegner sieht, geht einen (selbst-)erzieherischen Weg, den Tiwald als „Psychotraining“5 und Lind als „geistigen Weg“6 der Kampfkünste beschrieben haben.
Im Verstehen des Sinns des Begriffs „Budo“ wird offensichtlich, dass Budo weder Sport noch Selbstverteidigung sein kann. Judo, Karatedo und andere nunmehr Pseudo-„Do“ sind längst olympische Wettkampfsportarten und nutzen nur noch den falschen Namen. Die hartnäckige und grassierende Verwendung des Worts „Budo-Sport“, der das Ganze noch schlimmer macht, als zu wenig zwischen Kampfkunst (Budo) und
Kampfsport (Bujutsu) zu unterscheiden, ist wahrlich falsch und kompletter Unsinn.
Ohne hier davon sprechen zu wollen, was besser oder schlechter sei, ergebnisorientierter Kampfsport oder prozessorientierte Kampfkunst, geht es darum, durch Versachlichung dazu beizutragen, korrekt von dem zu sprechen, was man denn meint. Beide Arten, sich mit „Kämpfen-Können“ auseinanderzusetzen, haben ihre Berechtigung – nur könnten sie verschiedener und widersprüchlicher nicht sein; sie sind als komplementäre Gegensätze absolut unvereinbar. Jede Vermischung, sprachlich wie praktisch im Training versucht, muss daher scheitern.
Die Budo-Leitidee „Ken Zen Ichi“7, „Faust und Schwert sind Eins“, im weiteren Sinne die Einheit von „Pinsel und Schwert“8, also buddhistischer Zen-Lehre und Kampfkunst, verdeutlicht ebenso wie die Budo-Philosophie „Bun Bu Ryo Do“9, „Die Schönen Künste und die Kampfkünste gehören zusammen“, dass Budo als Weg-Lehre untrennbar mit der japanischen Kultur der „schöngeistig“-spirituellen Kultivierung des Menschen verbunden ist. Erst die moderne Sportiesierung hat das originäre Wesen des Budo beinahe vollständig korrumpiert – wären nicht immer noch einige Wenige, die gegen den Mainstream an dem Schatz des Originären und der Tradition festhalten und ihren Schülern weiterzutragen versuchen.
1.1 Die 6 Wesenselemente
Das Wesen, also die allgemeine und bleibende Bestimmtheit, die Essenz des Budo, seine im Kern ganz spezifische Eigenart lässt sich durch genaue Analyse des prägend Entscheidenden definieren. Nur wenn die das Wesen bestimmenden Elemente deutlich existenzieller Bestandteil der Theorie und Praxis sind, und zwar alle insgesamt 6 zusammen (da sie miteinander in synergetischer Verbindung und Abhängigkeit stehen), kann von „Budo“ im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Diese, wie weiter hinten (besonders von Nevermann) ausführlich dargelegt und diskutiert, sind die unabdingbaren 6:
BU – Kampf und Nicht-Kampf
DO – Weg und Fortschritt
DOJO – Tempel und Gemeinschaft
REIGI – Etikette und Rituale
SHITEI – Lehrer und Schüler
ZEN – Esoterik und Spiritualität
„Bu“ und „Do“ ergeben sich durch den Begriff und seine Schreibweise schon von selbst; trägt doch der Name durch seine Kanji seinen Bedeutungsgehalt bereits in sich: Es geht um den speziellen Weg, die konkrete Lehre (Do) des Erlernens von Kampfkunst (Bu), und zwar wie im vorangegangenen bereits erläuterten Sinne.
Im Einzelnen und der Reihe nach:
BU
Bu, das eigentliche Thema dieses Do, die „Kunst“, in der die handwerkliche Meisterschaft und geistige Meisterung (des Ich) erlangt werden soll, bezieht sich auf das Erlernen, Können und wissende Verstehen um die Kunst des rechten Kampfes.
Das meint nun zweierlei: Nämlich, selbstverständlich, erstens die „äußere“, physische Ebene der technischen Kunstfertigkeit, reale Kämpfe erfolgreich zu meistern, was mit Übung der Techniken (Waza) und Formen (Kata) der jeweiligen Kampfsysteme oder -stile (Ryu) ausgebildet werden soll. Man lernt zu Kämpfen und, wie auch immer, systemtypisch darin erfolgreich zu sein. Das beinhaltet also die Fertigkeit, das Schwert bzw. den Angriff des Gegners zu stoppen. Damit ist dieser Teil des Bu quasi, rein äußerlich, identisch oder zumindest ähnlich mit dem Bu in ursprünglichen Jutsu- oder Kampfsport-Arten, in denen es um den Sieg über Feinde geht.
Zweitens aber bedeutet das darüber hinaus nun gerade auch, die „innere“, geistige Kunstfertigkeit zu beherrschen, mittels mentaler, psychologischer Souveränität und „Philosophie-Treue“ (Do) den realen Kampf als Mittel der Auseinandersetzung abzulehnen, zu vermeiden und durch Selbstbeherrschung, psychoemotionale Gelassenheit auf Aggressivität und Gewalt zu verzichten. In diesem „esoterischen“ (vordergründig sich nicht gleich offenbarenden) Sinne wird das Schwert auf eine in „Psychotraining“ und Spiritualität entwickelte ethisch-moralische innere Haltung des „Friedvollen Kriegers“ gestoppt. Budoka sind durch Übung am eigenen Leib geschulte und in Praxis erfahrene Fachleute für Wut und Angst, und die Bearbeitung (Kontrolle) dieser gewaltauslösenden Gefühle.
Bu ist also beides, Kämpfen und Nicht-Kämpfen können!
Für beide Fähigkeiten braucht es in jedem Falle die intensive Technikschulung, aus der heraus man nur die erforderliche physische und psychische Stärke des ja immerhin „Kriegers“ entwickeln kann, aus der vermeintlichen Niederlage (des Gewaltverzichts z.B. aus der Sicht des Gegenübers oder Dritter) einen Sieg zu machen, einen Sieg über sich selbst. Budo ist kein „mönchischer“ Weg, sondern einer, der aus Kämpfern und Söldnern gerade über den Weg des rechten Übens und Lernens, wie Kämpfe entstehen und „gemeistert“ werden, tugendhafte „Friedvolle Krieger“ macht, Experten für Gewaltprävention und Konfliktlösung.
Das Wesenselement Bu im Budo meint also, „mit der Hand des Teufels“ „das Herz des Buddha“ zu entwickeln10.
Oder: Nur wer Töten kann, kann auch Leben schenken!11 Bu kultiviert den Friedvollen Krieger.
DO
Do, der Weg, ist das Ziel. Und dieser Weg ist ein Kreis.
Zu den obigen Ausführungen zur Bedeutung des Do-Begriffs ist hier ergänzend zu betonen, dass es vor allem um das Gehen und die Weiterentwicklung auf dem Weg geht, nicht darum, irgendwo anzukommen. Es geht um das Üben der Übung willen12, das Lernen an sich, nicht das Können, um den Prozess, nicht das Ergebnis, um das Bemühen, nicht die Leistung.
Dieses Verständnis ist dem westlichen Gedanken fremd, aber kennzeichnend für die Idee des Do. Es geht um das Gehen, nicht ums Ankommen.13 „Höher, schneller, weiter“, die olympische Sportmaxime, also auch die des Kampfsports, widerspricht der traditionellen Budo-Auffassung extrem. Hier soll der wohl renommierteste Budo-Experte Roland Habesetzer zu Wort kommen, um die absurde Vereinnahmung des „Do“-Gedankens durch den Sport noch einmal zu kritisieren:
„Schon traurig angesichts dessen, was mir heute unterkommt. Wir sprechen wohl, um meine Position denen klarzumachen, die sie noch nicht kennen sollten, von „Kampfkünsten“, nicht von „Kampfsportarten“, die etwas ganz anderes sind (was auf eine widerrechtliche Aneignung hinausläuft und eine totale Verwirrung nährt). Aber ich stehe dazu: Was die Kampfkunst heute geworden ist, für die allergrößte Zahl derer, die sie zu praktizieren glauben, (die wahren Puristen sind verstreut und isoliert, gewissermaßen auf dem Weg des Aussterbens) ‒ auf diesem Jahrmarkt der Spektakel, der Ranggrade, des Rennens um Unterscheidungen, um Superlative in allen Genres, deshalb der Lügen, der Parade der Egos, der nach Belieben hingebogenen Mythen in chronologischen Überblicken, die nicht verifizierbar sind ‒ ist niederschmetternd, bedauerungswürdig. Unerträglich.14
Wer also z.B. Sportkarate betreibt, betreibt kein Karate-Do15, weil im Do kein Erreichen eines Zieles, etwa ein Titel, Pokal, eine Urkunde o.ä., nicht mal das Können und dann Lernen der nächsten Kata, etwas gilt, sondern allein das intensive Studium seiner selbst im Studium der Technik, und dies eben auch im komplizierten Bewegungs- oder Kampfgeschehen.
Wo der Weg das Ziel ist, kann es keinen Wettkampf, keinen Vergleich in Konkurrenz mit Anderen, keine objektiv messbare Leistungskontrolle geben, da der Fortschritts- und Wachstumsprozess des Ausübenden eine höchst individuelle, persönliche, intime, „innere“ Angelegenheit ist, die außer dem „ewigen Schüler“ selbst bestenfalls nur der eigene Lehrmeister (Sensei) auf der Grundlage der engen und intensiven Lehrer-Schüler-Beziehung (Shitei) „von-Herz/Geist-zu Herz/Geist“ (Ishin-Denshin) erkennen kann.
Do hat somit zentralen Einfluss auf die Theorie und Praxis der Kampfkunst16, bestimmt im Unterricht das zu Übende und die übergeordnete Idee des Bemühens um Fortschritt, durch das Studium des BU zu wachsen und zu reifen, besser zu werden als gestern, der Beste, der man heute sein kann – nicht besser als irgendwelche unwichtige Andere.
Do kultiviert den stets erforderlichen Anfängergeist eines jeden Budoka.
DOJO
Das Dojo (jap. „Ort der Erleuchtung“ in buddhistischen Klöstern oder, weltlicher, „Ort, wo Do gelehrt und geübt wird“), ist den Budoka ein „Tempel“, ein geheiligter, zumindest besonders wertgeschätzter, von allen verehrter und rituell gepflegter Ort des Weges. Er ist den Weg-Übenden und der Realisierung der Lehre und der Budo-Spiritualität17 gewidmeter Raum, und damit besonders. Es ist keine Turnhalle, allgemein von Vielen für unterschiedliche Sportarten und -ziele genutzter, öffentlicher Trainingsraum, wo u.a. zwischen Basketballern und Turnern auch Kampfsportler trainieren.
Ein Dojo ist den Budoka die „Kirche“, ein spiritueller Ort, der Versammlungsort der um ihren Do-Bemühten, speziell auf sie, ihre Bedürfnisse und Erfordernisse der Konzentration auf die Übung und die Lehre zuggeschnittener, speziell dekorierter „intimer“ Gruppen-Raum. Er ist frei, ungeteilt mit profanen Ansprüchen bloßer Leistungsoptimierung trainierenden Leistungs- oder „nur“ Breitensportlern und deren verschiedenen technischen Gerätschaften aller möglicher Schulsport- und Sportvereins-Disziplinen.
Für den in Deutschland berühmt gewordenen Budo-Verfechter Werner Lind ist das Dojo ebenfalls vor allem „ein Ort der Selbstperfektion. Der wichtigste Kampf, der in ihm stattfindet, ist der gegen sich selbst“, „eine Stätte der Mediation und Konzentration, ein geehrter Ort des Lernens, der Brüderlichkeit, der Freundschaft und des gegenseitigen Respektes“ 18, keine Sportarena. Ein Dojo ist der Ort regelmäßiger Zusammenkunft einer „verschworenen Gemeinde“, die dort ihre eigenen Budo-typischen („subkulturellen“) Rituale praktiziert – weshalb ihr auch hin und wieder (vordergründig auch nicht ganz unpassend, genau genommen aber im positiven Sinne richtig) der „Sekten“-Vorwurf gemacht wird.
Neben dem Aspekt des eigenen Budo-„Tempels“ bezeichnet Dojo aber noch Weiteres: Als Zweites kommt hinzu, das mit dem Begriff immer auch die „Gemeinschaft Gleichgesinnter“ gemeint ist, jene Schülergruppe eines Ryu, die zusammen den Weg unter ihrem Lehrmeister gehen, zusammen als „Brüder im Geiste“ als Partner und nicht Gegner mit- und aneinander üben, sich gegenseitig im Fortschritt als „Co-Trainer“ helfen, einander in Wertschätzung und Zuneigung „bekämpfen“ und versöhnen, und in der Freizeit19 als Freunde oder gar „Familie“ miteinander in Vertrautheit und Nähe lachen und weinen, schwitzen und philosophieren. Es ist der Ort für ganz Besonderes und ganz Besondere…
Als dritten Aspekt beinhaltet das Phänomen Dojo die einzigartige Funktion, für alle Budoka einen „Schutzraum“ bereitzustellen. Ein Schutzraum, der sie bei der Ausübung ihrer Übungen vor äußeren Störungen, öffentlicher und fremder Beobachtung und Beurteilung Dritter bewahrt. Immerhin praktizieren hier die Budoka neben ihren kämpferischen und hochemotionalen Übungen, die nicht für Laien oder die Allgemeinheit bestimmt sind, auch ihre eigenen Traditionen und Rituale (Reigi). Die „Abgeschiedenheit“ des geschlossenen und erst recht eigenen Raumes ermöglicht jene Kontemplation, Achtsamkeit und Stille, die bei der Ausübung vonnöten ist.
Jedes Mitglied eines Dojo kann sich „frei“, konzentriert, in meditativem Gewahrwerden und -sein sicher seiner „Arbeit“, der also Übungspraxis von Bu hingeben. Ohne Scham vor Missverstanden-Sein durch Außenbeurteilung, ohne Bühne für Selbstdarstellung, ohne Angst vor eigenem Versagen, vollkommen geschützt in der Gemeinschaft von Mitschülern und Weg-Lehrern. Dojo kultiviert Verbundenheit.
REIGI
Reigi (jap. „die rechte Form des Grußes“, auch Reiho, Reishiki) beschreibt den Kanon der Regeln, Rollen und Rituale der Budo-Etikette. Die Etikette als Systematik budotypischer Manieren besteht aus Formen besonderer Ehrerbietung, d.h. Höflichkeitsformen und Verhaltensanweisungen, die ursprünglich auf kulturell in Japan tief verwurzelten geistigen Traditionen und Zeremonien, die vor allem aus Konfuzianismus, Shintoismus und Buddhismus hervorgegangen sind20.
Die Budo-Etikette sieht außer Regeln bzw. Ge- und Verbote (z.B. sauberer Körper, saubere Kleidung, Ordnung-halten, keine Gespräche im Dojo führen, Höflichkeit gegenüber Mitschülern, Meistern und Gästen, Putzen des Dojo vor und nach dem Unterricht) und Rollen (z.B. Fortgeschrittene als Tutoren für Neue, graduierungsentsprechende Privilegien und Pflichten der Schüler, Aufgaben im Lehr-Team der Übungsleiter, Trainer, Lehrer, Lehrmeister) v.a. spezielle Rituale vor, die regelmäßig bei bestimmten Anlässen zelebriert werden.
Sie dienen der Veranschaulichung der entscheidenden Werte und Normen des Budo und des konkreten Dojo, der Ausbildungsinhalte und -ziele und der Förderung der Identifikation der Ausübenden damit. Und sie dienen der Weg-Orientierung zum „Höheren Ideal“ (Wertschätzung, Nächstenliebe, Achtsamkeit, Bewusst-Sein) und Erarbeitung von „Meisterschaft“.21 Die rituellen Übungen, insbesondere die Formen des rechten Grußes (Gassho) helfen bei der Entwicklung zur rechten Hingabe an die gemeinsame Sache: Kultivierung des Geistes. Im Praktizieren von Wertschätzungsritualen wächst die innere Verbindung zu den Idealen, das Erfassen des eigentlichen Sinns – und am Ende auch die eigene Zustimmung und Identifikation, die Übernahme der „Kunst“, in der rechten äußeren und inneren Haltung seine Gefühle, sich selbst angemessen und (durch Übereinkunft der Bedeutungsinhalte) verständlich ausdrücken zu können.
Budotypische Rituale vermitteln durch Übung eigene Inhalte. Im Wesentlichen beziehen sie sich zunächst auf Achtsamkeit (bei der Durchführung) und im eigentlichen Sinne auf die Vermittlung von Wertschätzung und Würdigung und am Ende die Übernahme besonderer Werte (Friedfertigkeit)i. Diese Selbsterziehung durch kontinuierliche, immerwährende Praxis disziplinierter Selbstbeherrschung eröffnet – wie eine eigene Sprache – eine neue Ausdrucksmöglichkeit, v.a. der Mitteilung „innerer“ Bedeutungsinhalte, also innerer Haltung durch äußere Haltung (Shisei)22. Äußerlich aufrecht – innerlich aufrecht. Das ist die „Kriegerhaltung“: Würdevoll, stolz, stark, „bereit“ – ehrlich, prinzipientreu, großzügig. Ganz und gar, in voller Größe und „Offenheit“, für sich und die Sache stehend, verwundbar23.
Reigi kultiviert Demut und Bescheidenheit in der Größe.
SHITEI
Shitei bedeutet „Lehrer und Schüler“ und hebt ab auf das besondere Lehrer-Schüler-Verhältnis im Budo. Auf diesem basiert die Vermittlung der Lehre und konkrete Unterweisung jedes Einzelnen auf dem Weg.
Die Definition von Schüler und Lehrer im Budo ist entscheidend: Schüler ist, wer Giri, das Versprechen, sich beständig um die rechte Haltung zu kümmern, Nesshin, den ununterbrochenen Eifer und Fleiß, mit dem der Schüler durch die Verwirklichung der Haltung auf dem Weg fortschreitet, und Jitoku, die Einsicht, nicht nur nachzuahmen, sondern der Kampfkunst durch seine eigene Persönlichkeit Sinn und Inhalt zu geben24, dokumentiert. Vertrauensvolle Loyalität gegenüber dem Lehrer, Sensei, der Gemeinschaft, Dojo und Stil, Ryu, gegenüber ist tragende Voraussetzung.
Lehrer (i.w.S. „Guru“25) ist, wer „Meister“ seines Fachs und gelehrter Weg-„Bereiter“ des Budo ist, eine vorbildliche Autorität – aber vor allem auch persönlicher „väterlicher Freund“ und Berater, ein „Scout“, der seinen Schüler durch die Irrungen und Wirrungen, typischen Stolperfallen und Hürden zu führen versteht. Ein solcher Lehrmeister kennt aus eigener Erfahrung als (jap. wörtlich „Zuvorgeborener“) lange Zeit vorher diesen Weg erfolgreich Gehender alle Bu- und alle Do-Etappen und deren (sehr vielen) Tücken, ebenso aber auch die Strategien der Bewältigung der physischen und seelischen Herausforderungen. Er weiß um das Wann, Warum und Wie der nötigen Fortschritte auf dem Weg.
Dieser fördernde Einfluss kann nur auf der Grundlage einer menschlichen Nähe und „intimer“ Kenntnis der Persönlichkeit realisiert werden, die sich in der Lehrmethodik Ishin-Denshin, „Von-Herz/Geist-zu-Herz/Geist“ zwischen Schüler und Lehrer verwirklicht.
Nur ein darauf basierendes Lehren und Lernen ermöglicht echtes Vorankommen im Budo, d.h. wachsendes Können, Wissen und Verstehen des Wesens, Wirkens und Sinns der Lehre. Nur so wird aus einem bloß „Äußeren Schüler“ (Soto-Deshi) ein „Innerer Schüler“ (Uchi-Deshi), der die wahre Lehre jenseits bloßer Körperlichkeit als nämlich praktischen spirituellen Weg begreifen kann. Ohne Shitei wird der „innere Meister“ vom äußeren Meister nicht geweckt werden können…
Aber, so gibt Lind zu bedenken: „Die Persönlichkeit des Meisters ist streng (…) und hart gegen jede Imagepflege. Erst dahinter liegt die menschliche Wärme. Der Meister zwingt zur Wahrheit, zur Aufgabe jeder Fassade, zum Verzicht auf die Selbstdarstellung. Er will den Menschen, nicht die Maske.“26





























