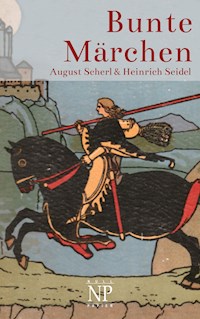
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchen bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
30 Märchen mit wunderschönen Illustrationen Gesammelt und aufgeschrieben von August Scherl und Heinrich Seidel. Ein Schelmenmärchen, Die Prinzessin mit den Entenfüßen, Der Frosch mit dem Edelstein im Kopf, Die Wunderbrille, Naschkätzchen, Die Geschichte von: "Das - und weiß nicht was", Trippstrille, Schattendorf, Vom einfältigen Büblein, Wirbelchens Windfahrt, Vom treuen Schwesterchen, Der Wetterbusch, Kaspar Knirps, Von der Freude, Die Wassernixe, Potthennerken, Königin Mitleide, Das gläserne Häuschen, Die beiden Jungfern, Das Bettel-Ei, Krauskopf und Blondhärchen, Der kleine Junge und sein Pferd, Aber nicht weiter sagen, Inge, die Möwe, Die verlorenen Flügelchen, Die Schlafkönigin, Die weiße Eule Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Seidel
Bunte Märchen
mit 32 farbigen Illustrationen
Heinrich Seidel
Bunte Märchen
mit 32 farbigen Illustrationen
(Neuer deutscher Märchenschatz)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: August Scherl EV: Scherl, Berlin, 1905 5. Auflage, ISBN 978-3-943466-62-1
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Ein Märchen als Einleitung
Ein Schelmenmärchen
Die Prinzessin mit den Entenfüßen
Der Frosch mit dem Edelstein im Kopf
Die Wunderbrille
Naschkätzchen
Die Geschichte von: »Das – und weiß nicht was«
Trippstrille
Schattendorf
Vom einfältigen Büblein
Wirbelchens Windfahrt
Vom treuen Schwesterchen
Der Wetterbusch
Kaspar Knirps
Von der Freude
Die Wassernixe
Potthennerken
Königin Mitleide
Das gläserne Häuschen
Die beiden Jungfern
Das Bettel-Ei
Krauskopf und Blondhärchen
Der kleine Junge und sein Pferd
Aber nicht weiter sagen
Inge, die Möwe
Die verlorenen Flügelchen
Die Schlafkönigin
Die weiße Eule
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Märchen bei Null Papier
Andersens Märchen
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Weihnachten
Grimms Märchen
Tausendundeine Nacht - 4 Bände - Erwachsene Märchen aus 1001 Nacht
Grimms Sagen
Bunte Märchen
Sagen des klassischen Altertums
Grimms Märchen – Illustriertes Märchenbuch
Alice hinter den Spiegeln
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Ein Märchen als Einleitung
Meine lieben Kinder und sehr verehrten großen Leute, ich will euch zu Beginn dieses Märchenbuches auch ein Märchen erzählen, aber ein ganz besonderes, das vollkommen wahr ist und sich erst vor Kurzem zugetragen hat. Und nun passt auf, wie es geht:
Es war einmal ein König von Papierland, der hatte viele Millionen Soldaten, die waren alle aus Blei und gingen auf den Köpfen. Man schmierte ihnen diese mit schwarzer Farbe ein, und dann marschierten sie Tag und Nacht über endloses Papier hin und hinterließen gar seltsame Spuren. Kluge Leute, die lesen gelernt hatten, konnten daraus vieles erfahren; wie es mit Krieg und Frieden und Handel und Wandel stand, und wie die Welt von ihren Königen mithilfe der Blauen, der Gelben, der Schwarzen, der Roten und der Goldenen gar weise regiert wurde. Schöne Geschichten gab es dort zu lesen, in denen die Tugend belohnt und das Laster bestraft wurde, und wunderschöne Gedichte, die sich hinten und vorn und in der Mitte ganz anmutig reimten, und wenn einer wissen wollte, was sich in der ganzen Welt von Honolulu bis Nimmersatt oder von Sydney in Australien bis Winsen an der Aller ereignet hatte, so stand es da schwarz auf weiß. Hatte jemand das Bedürfnis zu erfahren, wo es die längsten Giraffen, die dicksten Kartoffeln, die elegantesten Bartbinden, die süßesten Pfefferkuchenherzen gibt, so wurde auch diesem geholfen. Und dann die Bilder! Wo in der Welt auch nur etwas geschah, gleich waren die großen Guckmaschinen mit den Glasaugen dahinterher, und – schnapp! – gab es ein Bild, sodass der Vesuv bei seinem neuesten Ausbruch noch nicht ausgespien hatte, als er schon vor aller Welt auf dem Papier stand. Als nun aber der König eines Tages die Arbeiten seiner fleißigen Bleisoldaten und der großen Guckmaschinen musterte, da vermisste er etwas. Das, was heute neu und morgen schon wieder alt ist, war in Fülle vorhanden; aber an dem, was sich nie und nimmer begeben hat und darum auch nicht veralten kann, mangelte es. Das sollte anders werden; er drückte auf einen Knopf, und nach einer kurzen Weile steckte sein erster Minister den Kopf in die Tür. »Märchen!«, sagte der König. »Sehr wohl!«, antwortete der Minister und verschwand.
Nun ging also ein großes Schreiben aus in alle Welt an alle Schriftgelehrten und Märchenmacher und es wurden für das beste Märchen drei Beutel, für das zweitbeste zwei Beutel und für das drittbeste ein Beutel mit Goldstücken ausgesetzt. Die dreißig besten aber sollten abgedruckt werden in einem Buche mit schönen Bildern – gleichsam wie in einem Ehrensaal.
Ha! Da bekam die Post zu tun, und alle Tage brachte sie Märchen und Märchen und wieder Märchen. Manche Leute hatten schon welche fertig, die waren natürlich die Ersten auf dem Plan, und die anderen saßen und schrieben und packten ein und schickten weg; niemals wohl, seit die Welt steht, sind so viele Märchen auf Reisen gegangen wie in dieser Zeit. Zentnerweise kamen sie denn alle, alt und jung, hoch und niedrig, reich und arm, waren dabei; der Türmer auf dem Turm und der Schuster in seinem Keller, von Fürsten bis herunter zum Arbeiter, von der vornehmen Dame bis zum Mädchen für alles. Alle vier Fakultäten waren an der Arbeit, und selbst die Blüte der Nation, die Herren Leutnants und die Herren Referendare, schätzten es nicht zu gering. Und manche, die sonst nie dergleichen empfunden hatten, fühlten, dass plötzlich eine Märchenader in ihnen aufsprang und geheimnisvoll zu rieseln begann. So ging das Schicksal seinen Lauf, und als die Zeit erfüllet war, da zählte man 4025 Märchen.
Ihr lieben Kinder und ihr sehr verehrten großen Leute, wisst ihr auch, was das bedeutet: 4025 Märchen? Seht, in diesem schönen Buche, das nun vor euch liegt, sind nur dreißig davon abgedruckt, und es ist doch schon ein stattlicher Band. Wollte man nun alle 4025 eingesandten Märchen abdrucken, so wären dazu 134 solcher Bände wie dieser hier notwendig. Wisst ihr aber auch, was man in solche 134 Bände mit der selben Schrift wie diese, alles hineindrucken könnte? Ich glaube ihr ahnt es nicht; denn ich bilde mir ein, dass ich zurzeit der Einzige bin, der das weiß. Diese 134 Bände würden aufnehmen können: zweimal Goethes sämtliche Werke – und der hat doch am Ende nicht wenig geschrieben; damit aber wären sie noch lange nicht bis zur Hälfte gefüllt. Wieland war auch sehr fleißig und hat ebenso viel geschrieben wie Goethe; aber auch seine sämtlichen Werke würden noch immer nicht genügen, und man müsste noch Jean Pauls, E. T. H. Hoffmanns und Fritz Reuters sämtliche Schriften zu Hilfe nehmen, um diesen Schlund zu stopfen. Aber auch dann bliebe noch immer ein Loch offen, und erst Schillers sämtliche Werke würden das Gefäß zum Überlaufen bringen. Ist das nicht märchenhaft? Darum ist der Heldenmut, die Tatkraft und der Feuereifer, mit denen sich die tapferen Männer der Vorprüfung, die sich mit rauchenden Köpfen durch diese tausende von Prinzessinnen mit goldenen Haaren, diese Scharen von Königen und Königinnen, diese Heere von Riesen, Zwergen, Gnomen, Elfen und Wassernixen durchgearbeitet haben, nicht genug zu preisen. Am meisten aber ist es zu bewundern, dass sie nicht in den Zauberwäldern stecken geblieben sind, denn in diesen Märchen kamen so viele gräuliche, furchtbare und der menschlichen Gesundheit unzuträgliche Zauberwälder vor, dass man das ganze Festland unseres Erdballs hätte damit bedecken können. Aber diese heldischen Männer haben es geschafft und sind, wie ich hoffe, auch jetzt noch alle am Leben. Sie konnten schließlich den sieben Preisrichtern hundert ausgewählte Märchen zur Schlussprüfung übergeben.
Fast in jedem richtigen Märchen kommt nun auch eine Königin vor, und also fehlt sie auch in diesem wahren Märchen nicht; denn unter den Preisrichtern saß sie, eine ganz wirkliche Königin. Aber noch viel märchenhafter war es, was nun geschah; unter all den klugen und gelehrten Herren und vornehmen und gebildeten Damen, die ihre duftenden oder prunkenden Märchensträuße zur Schau trugen, kam mit schweren Schritt ein einfacher Arbeiter daher, der trug in seiner schwieligen Faust einen Busch aus blühendem Heidekraut, auf dem mit Perlenschimmer und Diamantenglanz der Tau funkelte. Und siehe da – es war keine Frage: Ihm gebührte der Preis!
Und so geschah es, dass das Märchen vom Aschenbrödel, vom Allerleirauh oder vom dummen Hans hier wieder lebendig wurde und der Arme, Unscheinbare und Übersehene glänzend den Sieg gewann. Die alten guten Märchen bleiben ewig neu.
Heinrich Seidel
Ein Schelmenmärchen
Von Eugen Bergmann
Vor Zeiten lebte einmal ein junger, derber Bauer, der keinen größeren Herzenswunsch hatte, als ein Kavalier zu werden und eine Prinzessin zur Frau zu bekommen. Wenn er seine Schweine zum Verkauf in die Stadt trieb und dabei in Samt und Seide gekleidete Herren sah, wie sie hoch zu Ross oder in prächtigen Fuhrwerken stolz an ihm vorüberritten und vorüberfuhren, fraß ihm der Neid fast das Herz ab, und er dachte hin und her, auf welche Weise er es ihnen wohl gleichtun könne. Aber er war arm, hatte nur ein kleines Häuschen mit wenig Ackerland, und zur Ausführung seiner törichten Wünsche war nicht die geringste Aussicht vorhanden. Bis in seine Träume hinein verfolgte ihn dieses Verlangen, und oft sah er sich selber mit Federhut und Spitzenkragen am Hofe des Königs einherstolzieren, und da gab es morgens ein übles Erwachen, wenn solch schöne Bilder in eitel Nebel und Dunst zerflossen. Dann ging er tagsüber einher wie einer, dem der Hagel sein Weizenfeld zerschlagen, schnauzte jeden an, der ihm in den Weg kam, und zermarterte sein armes Hirn mit Gedanken, wie er wohl zu dem nötigen Gelde kommen könne. War dies doch das Einzige, was ihm, seiner Ansicht nach, dazu fehlte, der feinsten Kavaliere einer zu werden. Seine Nachbarn, denen er manchmal sein Herz auszuschütten pflegte, wollten sich totlachen über sein närrisches Sehnen, spotteten über ihn, wo sie konnten, und sagten mit Lachen: »Wenn der Esel die Laute schlägt, ist er noch lange kein Künstler.«
Aber das half alles nichts.
Als er nun eines Tages wieder mürrisch und verdrossen hinter seinem Pfluge einherging und der schönen Gotteswelt auch nicht den geringsten Blick schenkte, hörte er plötzlich, wie die Pflugschar mit Klirren an einen Gegenstand stieß, und da er sich fluchend bückte, um den vermaledeiten Stein aus dem Wege zu räumen, gewahrte er einen angerosteten, großen, eisernen Topf im Erdreich. Der war so schwer, dass er ihn kaum heben konnte; und als er den Deckel lüftete, da – wer beschreibt seinen freudigen Schreck! – fiel ihm die Pfeife aus dem Munde, und die Beine begannen ihm zu zittern: Bis an den Rand war der Topf mit Dukaten gefüllt, die so neu und blank aussahen, als kämen sie eben aus des Kaisers Schatzkammer.
Bald jedoch erholte sich das Bäuerlein, dass sich so unvermutet vor das Ziel seiner Herzenswünsche gestellt sah, schlug einen Purzelbaum vor Vergnügen und brachte dann seinen Schatz in sicheren Gewahrsam.
Anderen Tages füllte er sich die Taschen mit den blinkenden Goldfüchsen und ging in die Stadt, wo er sich gleich den vornehmsten Laden aussuchte.
»Hallo, Herr Kaufmann«, schrie er, »nun rückt mal heraus mit dem Feinsten, was Ihr habt und was zum Anzug eines vornehmen Kavaliers gehört! Nichts soll mir zu teuer sein, und das Beste werde ich gerade gut genug finden.« Dabei warf er eine Handvoll Dukaten auf den Tisch, damit der Kaufmann gleich wisse, woran er sei, und nicht am Ende denke, es mit einem Aufschneider und Hungerleider zu tun zu haben.
Und nun ward herbeigeschleppt, was es nur Kostbares gab: Seidenzeug aus Lyon, Spitzen aus Brabant, Samtgewebe aus Persien und tausenderlei andere Dinge, wie sie sich nur ein vollendeter Galan wünschen kann. Der Kaufmann, der sich auf seine Leute verstand, merkte bald, was die Glocke geschlagen hatte, war mit seinem Rat hilfreich zur Hand, und bald waren Anzüge ausgewählt, deren sich kein König zu schämen brauchte. Wie sich unser Bauer nun in dem großen Pfeilerspiegel neu ausstaffiert betrachtete, wollte er kaum glauben, es blicke ihm aus dem Glase der selbe Mensch entgegen, der gestern noch hinter dem Pfluge hergegangen war: So stattlich präsentierte er sich in dem violetten Samtwams mit den Goldstickereien und dem Hut mit dem wallenden Federbusch.
»Bei allen Heiligen«, sagte der schlaue Kaufmann voll erheuchelter Bewunderung, »wenn ihr nicht einem Prinzen von Geblüt gleich seht, will ich mich hängen lassen. Eine Fürstin muss zumindesten Eure Frau werden.«
Der Bauer blinzelte ihn wohlgelaunt von der Seite an und entgegnete mit überlegenen Lächeln: »Ein bisschen höher hinauf, guter Freund, würde mir besser zu Gesicht stehen.«
»Freilich, freilich«, beeilte sich der Handelsmann zu antworten, »unsere Königstochter wäre Euer gerade würdig. Aber« –
»Aber? Was soll es mit dem Aber?«, forschte der neugebackene Kavalier misstrauisch. »Einen feineren und reicheren Gemahl findet sie eben nicht. Habt Ihr mir nicht selbst vor wenigen Minuten versichert, ein solch kostbarer Zobel, wie er meinen Mantel ziert, sei nicht einmal im Besitz des Königs?«
»Das stimmt schon werter Herr, und doch« – hier kraulte sich der Kaufmann vor Verlegenheit hinter den Ohren – »ich weiß nicht, wie ich es gleich sagen soll … seht … nun, Ihr wisst doch: mit den Kavalieren ist es wie mit den Blumen, je kostbarer, je seltener einer ist, desto feiner ist der Duft, der ihn umgibt. Nun hat unsere Prinzessin eine so feine Nase, dass sie es sofort herausriecht, mit wem sie es zu tun hat, und einem Herzog von einem Grafen auf zehn Schritt unterscheidet. Der Bauerngeruch aber sei ihr ganz besonders zuwider, erzählt man, sie wittere ihn schon aus der Ferne und sei hochmütig wie eine echte Prinzessin.«
»Was Ihr sagt!«, hub das Bäuerlein etwas kleinlaut an. »Lässt sich dagegen nichts tun? Gibt es kein Mittel, keine Arznei, sich von diesem bösen Duft zu befreien?«
»O gewiss«, und der Kaufmann lächelte geheimnisvoll, »man braucht nur Doktor Artabatus in der Stadt Mellesund aufzusuchen. Der repariert es!«
Da verließ ihn mit einem Dank für die gütige Auskunft der Bauer, kaufte sich einen starkknochigen Gaul, füllte sich abermals alle Taschen mit Dukaten, erfragte sich die Lage der Stadt Mellesund und machte sich auf den Weg zu Doktor Artabatus.
Nachdem er drei Tage und drei Nächte geritten war, erreichte er die gesuchte Stadt, deren Türme und Zinnen ihm schon von Weitem in der aufgehenden Sonne entgegenfunkelten. Er lies sich von einem Knaben bis an das Haus des Doktors Artabatus führen, denn dessen Name war bekannt bei Alt und Jung, und bat um Einlass.
Vor einem Herdfeuer stehend, auf dem soeben ein neues Lebenselixier brodelte, empfing ihn der berühmte Mann. Mit seinen düsteren Augen sah er ihn eine Weile forschend an, als wollte er bis auf den Grund seiner Seele lesen, und da das Bäuerlein sein Anliegen in schön klingenden Redensarten vorzubringen suchte, unterbrach er ihn barsch und sagte ohne Federlesen:
»Spar deine Worte. Nur ein Stümper hört die Leidensgeschichte seines Patienten. Ich weiß, was dir fehlt. Du möchtest aus einem Bauern ein Kavalier werden. Versteh es auch, denn so taugst du freilich noch nicht dazu. Gemacht kann es werden, aber die Sache kostet Geld.«
Der Bauer schüttete, ohne ein Wort zu sagen, den Inhalt seiner Taschen auf den Tisch, und als der gelahrte Herr das gleißende Häuflein vor sich sah, nickte er befriedigt, strich es ein und sprach:
»Das langt, und merke nun auf, was ich Dir sage. Ihr Bauern habt ein dickflüssig, ungesund Blut, das träge seines Weges rollt und deshalb zu allen feinen Gedanken, zierlichen Redensarten, liebenswürdigen Manieren, wie sie in Schlössern und auf Edelhöfen zu Hause sind, gänzlich ungeeignet ist. Auch fehlt die Würze, die Süße, der Duft. Du musst deshalb in einer süßen Tunke umgekocht werden; die wohl zubereitete Flüssigkeit muss durch die Poren deiner Haut dringen und eine völlige Änderung deiner Säfte herbeiführen. Die Kur ist, von der Hand eines Meisters geleitet, ohne Gefahr. Halte dich bereit, ich rüste dir sogleich das Nötige.«
Er rief nach seinen Handlangern, ließ einen riesengroßen Kessel über den Kochherd seiner Studierstube stellen, und wohlgesiegelte Flaschen, Töpfe, Kruken mit Inschriften in chinesischen Lettern sowie seltsam verschnürte Packen, von denen einzelne mit einem Totenkopf beklebt waren, wurden hereingebracht.
Dann entließ er seine Heilgehilfen und ging an die Zubereitung des wunderkräftigen Wassers.
»Dies hier ist Honig vom Berge Hymettos in Griechenland«, sagte er und schüttete den Inhalt eines großen Topfes in den Kessel. »Das gibt die Süße und ist das Fundament, auf dem sich alles gründet und aufbaut. Dies hier sind Lakritzstängelein; dies Süßholz, geraspelt, so der Zunge eine liebliche Gelenkigkeit zu anmutiger Rede verleihen; hier Fenchel, Anis und Ambra, die dem Geist Kraft und Zartheit mitteilen; hier Gewürznägel, Zimt und Rohrzucker, die den Gelenken zierliche Bewegungen geben, und die Büchse dort, gestempelt mit dem Siegel des Kaisers von China, enthält das Köstlichste, die Krone des Ganzen: Zibet, Moschus und Lavendel. Das, in der richtigen Mischung, erteilt dir den Duft des Kavaliers und vertreibt jeglichen Bauerngeruch auf ewige Zeiten.«
Dem Bäuerlein wirbelte bei all den fremden Namen der Kopf, und staunend schaute er den Hantierungen des Weisen zu, während ein bläulicher Dampf dem Kessel entstieg und das Gemach mit allen Wohlgerüchen Arabiens erfüllte.
Endlich war alles bereitet, wie es sich gehörte, und Doktor Artabatus befahl dem Bauern, die Gewänder abzulegen und in den Kessel zu steigen. Ins Feuer aber warf er noch ein paar mächtige Scheite, dass die Funken wie kleine Sterne in die Höhe stoben.
»So«, sagte er, »jetzt bleibst du so lange darin sitzen, bis du es merkst, wie dich die Süße langsam durchdringt, wie sie die Blutbahn hinaufsteigt, und solange du die Hitze vertragen kannst. Merk auf: je länger, je besser; denn bleibt auch nur etwas der alten, bösen Bauernsäfte zurück, so gerät die Süße in Gärung, wird herb und ranzig, und die Kur bleibt ohne gewünschten Erfolg.«
Pustend und schwitzend saß der angehende Kavalier in der Flüssigkeit, die mit jeder Sekunde heißer und heißer wurde; er japste nach Luft, wenn ihn die Dämpfe umqualmten, ihm beißend in Auge und Nase fuhren, ihm den Atem raubten, und wähnte nicht anders, als dass sein letztes Stündlein geschlagen habe.
»Halte aus«, tröstete der Arzt, »halte aus. Es kämpfen jetzt die Geister der Heilskräfte mit den unreinen Geistern, so dir im Geblüt sitzen; es kämpft die Süße mit dem Sauren; jetzt rückt Zibet vor, jetzt schwingt Ambra das Schwert, und dort naht Lavendel und bringt uns den Sieg.« …
Endlich, da es dem Bauern schien, er habe seinen letzten Atemzug getan, winkte Artabatus mit feierlicher Miene: »Es ist genug.«
Und halb tot entstieg er der süßen Wundertunke und schwur bei sich, diese Kur zum zweiten Male nie mehr über sich ergehen zulassen. Doch schon in Bälde erholte er sich, die Kräfte kehrten schnell zurück, und schmunzelnd schaute der Meister auf sein gelungenes Werk.
»Kehre heim, mein Sohn. Artabatus hat sich ein neues Lorbeerreis in seinen Ehrenkranz geflochten; seit Langem ist kein vollendeterer Kavalier aus seiner Werkstatt hervorgegangen!«
Fröhlich verließ der Bauer das Haus, erstand sich gleich ein edles arabisches Ross, rüstete es stattlich aus mit purpurnen Schabracken und goldenen Steigbügeln und ritt aus den Toren der Stadt Mellesund den kürzesten Weg in raschem Trabe der Königsburg zu.
Als er nun vor dem Portale des herrlichen Schlosses hielt, eilten ihm geschäftige Diener entgegen. Der eine hielt ihm die Bügel, der zweite breitete kostbare Teppiche vor seine Füße, und der dritte führte ihn die Treppe hinauf in den Thronsaal, wo soeben der König und seine Tochter Hof hielten; denn man glaubte nicht anders, als das zu den vielen Prinzen und Königssöhnen, die sich um die Hand der Prinzessin Murmula bewarben, ein neuer hinzugekommen sei.
Da saß nun unter rotsamtenen Baldachin auf seinem Thron der König mit Zepter und Reichsapfel in den Händen und neben ihm die Prinzessin Murmula. Ach, war die schön! In ihren schwarzen Haaren glänzten Diamanten und Perlen, und ihr Gewand war mit silbernen Sternlein bestickt, die funkelten wie die Sterne am blauen Nachthimmel. Weil sie aber so gar hochmütig war und das Näschen immer steil in die Luft trug, musste Tag und Nacht ein Mohr einen Schirm über sie halten, damit es ihr nicht in die Nase regne. Nur ein ganz klein wenig zog sie den Schnabel und schnupperte nach rechts und nach links, als der fremde Kavalier vor sie hintrat – doch roch sie nichts, weil Meister Artabatus seine Sache verstanden hatte.
In zierlichen, wohlgesetzten Worten – denn die Lakritzstängel und das geraspelte Süßholz taten ihre Wirkung – trug nun der Bauer sein Anliegen vor: wie er weit her sei, wie er von der Schönheit der Prinzessin gehört und nur noch den einen Wunsch habe, sie als sein ehelich Gemahl in die Arme zu schließen.
Nicht ungern begann die Schöne seiner Rede zu lauschen, denn er sah gar stattlich aus, hatte Saft und Kraft in sich und überragte manch blasses Prinzlein um Haupteslänge. Ja, aber nun geschah etwas Unvorhergesehenes; ein Jucken kam dem Bauernsohn an, und ehe er sich dessen versah, kratzte er sich, kräftig und tüchtig, wie er es daheim gewohnt war.
Da schnellte das Näschen der Prinzessin Murmula wieder blitzschnell in die Luft.
»Päh«, sagte sie, »Bauer bleibt Bauer!«, und hochmütiger denn je schaute sie zur Seite und hatte auch nicht einen Blick mehr für den Erkannten. Dem aber war zumute, als hätte man einen Kübel eiskalten Wassers über ihm ausgeschüttet; denn ihm wäre nie auch im Traum nur der Einfall gekommen, man kratze sich an Königshöfen nicht, wenn man irgendwo ein Jucken oder Stechen verspüre.
Kleinlaut schlich er aus dem Saal, von hundert spöttischen und schadenfrohen Augen begleitet, und still ritt er davon, seinem Pferde dem Weg überlassend, Verzweiflung im Herzen. Wohl tausend Male verwünschte er im Geiste den Doktor Artabatus und wusste nicht aus noch ein; denn das stand fest in ihm, dass er sterben müsse, wenn er Prinzessin Murmula nicht erwerben könne.
Er ritt und ritt fünf Tage und fünf Nächte und kam endlich in die Stadt Berrefast.
Wie er nun so in Gedanken die Hauptstraße hinabtrabte, weder auf die Paläste zur Rechten und Linken, noch auf die Menschen, die die Bürgersteige füllten, ein Auge warf, sah er plötzlich ein Gefährt, mit sechs schneeweißen, rotgezäumten Mauleseln bespannt, ihm entgegenkommen. In dem Wagen saß ein Mann mit langem, weißen Bart, und sein schwarzer Talar war mit seltsam geheimnisvollen Zeichen besetzt. Da die Menge ihn gewahrte, entstand ein großer Auflauf, Mützen flogen in die Höh’, Tücher wurden geschwenkt, und aus tausend Kehlen erscholl der begeisterte Ruf: »Heil dem Magister Perpendiculus, dem Stolz von Berrefast!« Unser Betrübter erwachte aus seinem Geträume und fragte den ersten besten: »Sagt an, guter Freund, was hat es mit diesem Magister Perpendiculus auf sich?« »Ei«, entgegnete der und maß ihn ein wenig verächtlich, »Ihr seid wohl vom Monde gefallen, dass Ihr nichts vom dem wisst, was der ganzen Welt bekannt ist? Meister Perpendiculus ist der weiseste Arzt der Erde, und Berrefast ist stolz darauf, ihn zu besitzen. Es ist keine Krankheit des Leibes und der Seele, die seiner Kunst widerstände. Man erzählt, dass Geister ihm gehorchen, dass er Tote erwecke und schon manchen Strohkopf mit Weisheit gefüllt habe. Seht jenes Haus dort mit den sechs erzenen Säulen und dem Tor aus schwarzem Onyx: das ist der Wohnsitz des Magisters Perpendiculus, und habt Ihr was, so Euch das Herz bedrückt, vertraut es ihm an, er schafft Rat.«
Eine kleine Weile nachher klopfte das Bäuerlein an die Onyxpforte, die einen dumpfen Klang gab, und begehrte von dem Mohren, der ihm öffnete, zu dem Magister geführt zu werden. – In einem fremdartig ausstaffierten Gemach, durch dessen bunte Scheiben das Tageslicht nur spärlich und gedämpft hereinquoll, saß der weise Meister vor einem Pergamentband, auf dessen roten Blättern in Goldschrift Mittel gegen jegliches Gebrechen geschrieben standen, und blickte erst auf, als der, so seines Rates und seiner Hilfe bedurfte, vor ihm stand.
Niedergeschlagen berichtete der verunglückte Kavalier, wie sich alles zugetragen, wie trotz der süßen Abkochung des Doktors Artabatus die Prinzessin den Bauerngeruch gespürt, und wie er sich ein Leid antun müsse, wenn Magister Perpendiculus keinen Ausweg ersinne.
Als der den Namen »Artabatus«, gehört, war ein verächtliches Lächeln über sein Gesicht gegangen, und nun hob er an: »Eure Sache steht so schlimm nicht, zumal Euch Euer guter Stern vor die richtige Schmiede geführt hat. Fern sei es von mir, auch nur ein nachteiliges Wort über die Kunst meines Kollegen zu sagen; denn das ist unter uns Ärzten nicht Brauch; allein das eine kann ich nicht verhehlen: Seine Methode ist gänzlich veraltet. Wer heutzutage noch sein Vertrauen auf die Mischung verschiedener Stoffe setzt, ist ein Esel. Seit den Zeiten meines Lehrers, des großen Paracelsus, hat man für die Heilweise des Hippokratus, der Artabatus blind ergeben ist, nur noch ein mitleidiges Lachen. Sauer müsst Ihr gekocht werden, sauer, lieber Freund! Eine wohltuende Säure muss Eurem übergesunden Bauernblut zugeführt werden ohne jeglichen Zusatz, ohne jegliches Gewürz. Seht: Fürsten, Königen, Kaisern hat diese meine Hand zur Ader gelassen, und es ist mir noch kein Tröpfchen Kavaliersblut vorgekommen, das nicht säuerlich gedunstet hätte. Freilich – die rechte Säure muss es sein, daran liegt es, darin besteht das Geheimnis. Und ein erklecklich Sümmchen werdet Ihr hergeben müssen, aber – für was ist was!«
Der Bauer schüttete ohne Weiteres den Inhalt sämtlicher Taschen in ein Mäßchen, das ihm der Magister vorhielt und in dem er sein Honorar einzuheimsen pflegte. Perpendiculus rüttelte es ordentlich fest, und da es bis an den Rand gefüllt war, sprach er: »Es fehlt wohl noch um eines Strohhalms Breite an dem Üblichen. Ich will es aber auch dafür tun, da mein Herz nicht am Gewinn hängt.«
Dann führte er seinen Patienten in ein kellerartiges Gelass, wo unter einem geräumigen, silbernen Kessel eine blaue Flamme kochte, hieß ihn sich in das darin befindliche Wasser setzen, und zog aus dem faltigen Gewande ein Kristallgläslein, in dem eine helle Flüssigkeit blinkte, und goss nur wenige Tropfen in den Kessel. Alsbald fing das Wasser an sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, und ein saurer Dunst stieg aus ihm auf, während der Magister mit einem Blasebalg das Feuer zu hellerem Glühen anzutreiben begann. »Auf der höchsten Spitze des Himalaja wächst in einer Felsenspalte das Kraut«, sagte er, »mit dem der Vogel Phönix sein Nest auszufüttern pflegt. Aus diesem Kraut wird vermöge kunstreicher Destillation diese Säure, so Euch nottut, gewonnen.«
Der arme Schelm im Wasser aber fing an, ganz entsetzliche Gesichter zu schneiden, denn prickelnd und ätzend fühlte er die Säure in die Adern dringen, der Atem ward ihm fast genommen, und das Wasser erhitzte sich blitzschnell und schäumte fast über den Rand des Behälters.
Je ärger er aber stöhnte und litt, desto vergnüglicher wurde der große Meister.
»Vortrefflich, vortrefflich!«, jubelte er und schlug sich mit der Hand an die Seite. »Die Kur schlägt an! Spürt Ihr es, wie all das böse Gewürz, die lächerliche Süßigkeit meines Genossen Euch in blauen Wolken verlässt und wirbelnd zum Schornstein hinausfährt? Merkt Ihr es, wie die Krallen der Säure sich in die Zibetkatze schlagen und wie sie die letzte Spur des Ambra vernichten?«
»Lasst es genug sein, Perle der Wissenschaft!«, jammerte der im silbernen Kessel. »Ich glaube, es genügt … Ein bös Brausen hab ich in den Ohren, Feuerfunken tanzen mir vor den Augen, und alle Gedanken mischen sich mir zu wirrem Knäuel … ich überstehe die Kur nicht, einen Entseelten fischt Ihr aus Eurer Brühe!«
Doch der Magister drückte ihn mit dem goldenen Schaumlöffel, der ihm wie ein Schwert zur Seite hing, noch tiefer in die Flüssigkeit, häufte ihm den weißen Schaum übers Haupt, alsodass er kein Glied rühren konnte und seine Seele den Heiligen befahl. Dann hob er ihn mit einem Ruck aus der Säure, und es dauerte nicht lange, da kehrten die Lebensgeister des Armen in doppelter Frische wieder; neue Kraft durchglühte ihn, und als Magister Perpendiculus ihm nun einen Silberspiegel vorhielt, musste er zugeben, die Kur habe angeschlagen, das Mittel seinen Zweck erreicht: So vornehm sah er aus, als reichte er mit seinen Ahnen bis in die graueste Zeit zurück!
Da sich das Onyxtor wieder hinter ihm schloss, ritt er spornstreichs heim, füllte sich alle Taschen abermals mit blanken Goldstücken, warb ein stattliches Gefolge, das ihn an den Königshof begleiten sollte, und machte sich von Neuem auf, um die Hand der Prinzessin Murmula zu werben.
Und es war wieder wie das erste Mal. Als er vor dem Portal des Schlosses hielt, eilten ihm die Diener entgegen: der Erste hielt ihm den Bügel, der Zweite breitete Teppiche unter seine Füße, und der Dritte geleitete ihn die marmornen Treppen hinauf. Untereinander aber flüsterten sie: »Das ist sicher der erwartete Prinz aus Mauretanien, dem die sieben goldenen Schlösser gehören und dessen Schatzkammern bis an die Decke mit Kostbarkeiten gefüllt sind.«
Im Thronsaal warteten schon viele Prinzen und Königssöhne aus nah und fern auf das Erscheinen der Prinzessin; die standen zu beiden Seiten des Thrones, auf dass die Königstochter sich den Schönsten erwähle, und zu den stattlichsten gehörte auch der Bauer. Endlich ertönten Fanfaren und Trompeten, die Doppelvorhänge einer Tür wurden zurückgeschlagen, und in glanzvollem Zuge nahte der König und neben ihm die Prinzessin. Die aber war heute noch tausendmal schöner als das erste Mal. In ihren schwarzen Haaren trug sie eine funkelnde Krone, und ihr weißes Kleid war mit Rosen bestickt, aus deren Kelchen die herrlichsten Diamanten blitzten. Nur das Näschen trug sie so hoch wie immer, doch sie schnupperte nicht einmal; denn Magister Perpendiculus hatte selbst das letzte Stäubchen jenes Geruchs, der ihr so zuwider war, in seiner Säure getötet. Der Bauer aber dachte bei sich: »Wenn ich dich heute nicht gewinne, du holdseligste der Sterblichen, so wäre es mir besser, nicht auf der Welt zu sein.« Vor der Prinzessin hüpfte in munteren Sprüngen ihr Windspiel, lief von einem zum anderen, ließ sich von diesem glätten und jenem, und setzte sich endlich dicht vor den Bauer. Wie der aber den Hund sah, fiel ihm seine Jugend ein. Da war es sein liebstes Vergnügen gewesen, den Katzen in den Schwanz zu kneifen, und wenn sie dann miauend und fauchend davongefahren waren, hatte er sich den Magen gehalten vor Lachen; an keinem Hunde aber war er vorübergegangen, ohne ihm auf den Schwanz zu treten, und hatte immer seine helle Freude daran gehabt, wenn sie heulend das Weite suchten. Und wie er so darüber sann und sann, vergaß er Königskind und Hofburg, Glanz und Umgebung, hob langsam den Fuß und trat dem königlichen Hunde nachdrücklich auf den Schwanz. Das Hündchen, so böser Handlung ungewohnt, hub ein Gequiek an, als hätte es sich auf heißes Eisen gesetzt, kniff den Schwanz ein und raste davon wie vor dem Leibhaftigen, fuhr dem Oberhofmeister zwischen die Beine, dass er schier zu Fall kam, und erfüllte den ganzen Saal mit seinem Geheul.
Da richtete sich das Näschen der Prinzessin Murmula fast kerzengerade in die Höhe, und sie sprach, dass es durch den ganzen Raum klang:
»Pä … Bauer bleibt Bauer – Koch ihn süß oder sauer!«
Sie winkte einem Königssohn und reichte ihm die Hand hin, zum Zeichen, dass sie ihn zum Gemahl erwähle.
Wie ein Donnerschlag jedoch traf ihre Rede den zum zweiten Mal erkannten. Ehe noch jemand recht zur Besinnung kam, hatte er den Saal verlassen, riss sein Pferd aus dem Stall, und der Hufschlag seines Rosses klang laut und dröhnend, da er über die Zugbrücke in wildem Rasen fortjagte. Viele Tage ritt er kreuz und quer durch die Welt, ohne selbst zu wissen, wohin. Sein edles Ross, solcher Anstrengung ungewohnt, ward lahm und steif, und endlich, da es nicht weiter konnte, stieg er ab, überließ es auf einer fetten, grünen Wiese seinem Schicksal und ging nun zu Fuß weiter, Bitternis, Groll und Verzweiflung im Herzen. Manchen Tag noch wanderte er auf staubigen Straßen dahin, bis ihn der Zufall in seine eigene Heimat führte. Als er in einen Forst kam, hinter dem nur eine Tagereise entfernt seine Hütte lag, lagerte er sich neben einem Quell, um Gesicht und Hände mit dem kühlenden Nass zu netzen.
Lange Zeit saß er da in trüben Gedenken seines beklagenswerten Geschicks, als ein runzeliges Mütterlein des Weges kam, das im Wald nach Pilzen gesucht hatte.
»Gott zum Gruß schmucker Knabe«, redete sie ihn an, »was schaust du so darein, als stünde keine Sonne am Himmel, als sänge kein Vöglein im Walde? Solch sauertöpfisch Wesen kleidet kein Geschöpf Gottes.« Und das Mütterchen setzte sich zu ihm. Da fasste er sich ein Herz, weil ihm so sterbensübel zumute war und er keine Seele hatte, der er sein unselig Geschick berichten konnte, und er erzählte der Alten haarklein, was sich alles mit ihm zugetragen hatte. Da er geendet, lächelte das Mütterchen und sprach: »Ein Einfaltspinsel bist du, durch deine dicke Schwarte sei all das Süße und Saure gegangen, was dir die klugen Doktors vorgefabelt? Nichts kann aus dem Menschen kommen, so es nicht in ihm ist. Ein freundliches Herz, dazu unmerkliche Leitung, zarte und feine Zurechtweisung in Kindertagen, wie sie eine liebende Mutter dem eigenen Blut zukommen lässt – das verleiht einem jene schöne Farbe herkömmlicher guter Sitte, die den Menschen zum Kavalier macht. Ein Tölpel bleibt ein Tölpel in jedem Stande!« Damit erhob sie sich, nickte ihm zu und humpelte von dannen. Dem Bäuerlein war zumute, als hätte der Himmel selber ihn getröstet; eilends schritt er vorwärts, und froh klopfte ihm das Herz, als er sein heimatlich Dach bei sinkender Sonne erreichte.
Auf dem Boden seines eisernen Kessels fand sich noch gerade eine Handvoll Dukaten, die dazu ausreichten, ein neues Leben zu beginnen. Das geschah, und zufrieden sitzt er noch heutigentags dort, wo er saß, als wir diese Geschichte begannen.
Die Prinzessin mit den Entenfüßen
Von Anna Bethe-Kuhn
Der alte König war gestorben. Die Kammerherren streiften schwarzen Flor über ihre buntseidenen Ärmelpuffen, und die Damen drückten die Spitzentüchlein an die Augen, vor Kummer darüber, dass nun der Hofball nicht stattfinden konnte, der zum kommenden Tag angesagt worden war.
Im Krönungssaal stand der Thronsessel; er war schneeweiß und hatte vergoldete Füße, und über seine Rückenlehne herab hing der Purpurmantel mit dem Hermelinfutter; den sollte der junge Prinz umgelegt bekommen. Der Hofmarschall hielt die Krone zwischen den gespreizten Fingern und fuchtelte mit dem Zepter durch die Luft. Das war ja ein netter Regierungsantritt! Läufer liefen unablässig die Marmortreppen des Schlosses hinauf und herunter; aber der junge Prinz war nirgends zu finden.
Durch den Schlosshof schritt pfeifend der Hüterjunge. »Hier könnt ihr lange suchen«, lachte er. »Drüben hinterm Walde bei den Moorwiesen liegt der Prinz im Grase und sieht die weißen Wölklein fliegen.«
Ja, nun wussten sie es. Am meisten ärgerten sich die Läufer darüber, den jetzt mussten sie in ihren spitzen Schnabelschuhen über den lehmigen Waldboden zu den Moorwiesen laufen. Schon von Weitem sahen sie den Prinzen im Schilfgras liegen. Als der die drei Läufer erblickte, stand er auf, klopfte sich die Schilfhalme vom Wams und ging ihnen entgegen. »Ich weiß bereits alles«, sagte er. »Das Klügste wird sein, ich füge mich in das Unvermeidliche. Aber das dürft ihr mir schon glauben: Ich hätte lieber mein Lebtag an den Moorwiesen Schweine gehütet, als nach meines Vaters Tod den Thron bestiegen.« Wahrhaftig, das sagte er.
Drinnen im Schlosse bekam der junge Prinz vom Hofmarschall die Krone aufgesetzt. »Das Ding wird mir den Verstand zerquetschen«, sprach er und schüttelte seinen Kopf, dass die Locken flogen. Aber der Hofmarschall ließ keine Einwendungen gelten; er hing dem Prinzen den Purpurmantel um die Schultern und drückte ihm das Zepter in die Hand. Hiermit war die Krönung vollbracht. Der junge König beugte das Haupt unter der Last seiner Krone und ließ den Arm sinken. »Jetzt verstehe ich erst, wie schwer das Regieren ist!«, meinte er und seufzte tief.
Allabendlich, wenn die Sonne sich rot im Moorteich spiegelte, warf der junge König Purpurmantel und Zepter beiseite und wanderte einsam durch den grünen Wald zu den Moorwiesen hinaus. Dort legte er sich ins Schilfgras und starrte zum Abendhimmel empor, bis die Sterne glitzerten.
Das ging so eine gute Weile, bis man im Schloss über die sonderbare Gewohnheit des jungen Königs zu reden begann und allerhand schlechtes und Unrechtes dahinter vermutete.
Eines schönen Tages zog der Hofmarschall den jungen König beiseite. »Majestät verzeihen«, flüsterte er ihm ins Ohr, »aber so darf es nicht weitergehen. Das Volk murrt; die Regierungsgeschäfte kriechen einen Krebsgang; in unserer Schatzkammer vermag bald ein Blinder die Dukaten zu zählen. Kurz und gut, ich sehe nur einen Ausweg, wie dem abzuhelfen sei: Majestät müssen heiraten!«
Der junge König runzelte die Brauen. Doch so leicht ließ sich der Hofmarschall nicht aus dem Konzept bringen. »Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte«, fuhr er fort, »so käme da in erster Linie Prinzessin Lilienblatt in Betracht« –
Jetzt wurde es dem jungen König aber zu bunt. »Bleibt mir mit Euren künstlichen Prinzessinnen vom Leibe!«, schrie er und stampfte mit dem Fuß auf. »Wenn ich heirate, will ich mir meine Frau selber aussuchen.«
»Wahrhaftig, das fehlte mir gerade noch, zu heiraten!«, sagte der junge König, als er abends bei den Moorwiesen im Schilfgrase lag. »Lieber spränge ich in den Moorteich, dort, wo er am tiefsten ist. Da weiß man wenigstens, was einem bevorsteht.«
»Hoho, das ist auch eine Ansicht!«, quakte es plötzlich neben ihm. Der junge König hob erstaunt den Kopf und sah einen dicken, grünen Frosch im Schilfe sitzen, der ihn mit runden Augen anglotzte und vergnüglich mit dem Kopfe wackelte. »Ihr scheint schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, guter Freund«, sagte der Frosch, und dann lachte er, dass er ordentlich Wasser prustete.
»Ich habe gar keine Erfahrungen gemacht«, erwiderte der junge König, »aber ich verspüre keine Lust, mit einem jener Reifrockgestelle, die ich auf den Hofbällen herumschwenken musste, eine Ehe einzugehen. Das kann niemand verwundern, der Prinzessinnen kennt.«
»Ich kenne sie zwar nicht«, sagte der Frosch, »aber ich kann mir vorstellen, dass sie alt und vertrocknet sind. Sie müssten einmal in frisches Wasser gesetzt und ordentlich untergetunkt werden.«
»Das ist ein vortrefflicher Gedanke«, meinte der junge König und lachte.
»Ich habe immer vortreffliche Gedanken«, antwortete der Frosch und blies sich auf, »aber meines Äußeren wegen werden sie nicht beachtet; und zwar nur aus dem Grunde, weil ich so grasgrün bin. Das Grün ist doch nun einmal meine Leibfarbe.«
»Wenn du so vortreffliche Gedanken hast«, sagte der junge König, »so kannst du mir gewiss zu einer Frau verhelfen. Es soll aber keine Froschkönigin sein, sondern ein schönes, warmblütiges Menschenkind. Diese Bedingung stelle ich.«
»Nichts leichter als das«, sagte der Frosch. »Komm heute Nacht, wenn der Vollmond scheint an den Moorteich, da kannst du das holdeste Mädchen der Welt die Enten hüten sehen. Sie ist so hübsch, dass ich eine Zeit lang selber daran dachte, sie zu heiraten. Aber sie vermag sich nicht ordentlich aufzublasen und hat eine melodische Stimme. Mit diesen Mängeln könnte sie nie bei uns zu Hof erscheinen, und darauf sehe ich.«
»Das wäre für mich kein Hinderungsgrund«, sprach der junge König. »Gefällt mir die schöne Entenhüterin ebenso gut wie dir, so soll nichts auf Erden mich daran hindern, sie zur Frau zu nehmen.«
Sobald der Vollmond hinterm Waldrand aufzusteigen begann, zog sich der junge König in seine Gemächer zurück, warf einen schwarzen Mantel um, stülpte die Kapuze über den Kopf und schlich unerkannt durch eine Hinterpforte zum Schloss hinaus. Schon von fern sah er die Moorwiesen im Mondschein glänzen. Irrlichter liefen vor seinen Füßen hin und her und wiesen ihm den Weg.
Da war auch sein Freund, der Frosch. Breitspurig saß er mitten auf der Landstraße und erwartete ihn. »Da bist du ja!«, quakte er. »Potz Moorschlamm und Fliegenbein, du scheinst es eilig zu haben!« Und er lachte, bis er sich verschluckte.
»Spare jetzt deine Scherze«, sagte der junge König, dem doch ein wenig ängstlich ums Herz war, »zeige mir lieber diejenige, derentwillen ich durch Nacht und Nebel hierhergekommen bin.«
»Hättest du Augen im Kopfe, hättest du sie längst erblickt«, versetzte der Frosch. »Drüben am Teichrand sitzt sie und lässt die Füße ins Wasser hängen. Aber euch Menschenkindern muss man die Nase auf alles stoßen, sonst merkt ihr es nicht.«
Der junge König blickte zum Teichrand hinüber. Da saß ein Mädchen, das hatte ein Gesicht weißer als die Mondstrahlen, Augen dunkelblauer als der Nachthimmel und Haare goldgelber und weicher als der zarteste Entenflaum.
»Sie ist wirklich wunderschön«, sagte der junge König, der keinen Blick von dem Mädchen wenden konnte. »Ich gäbe mein Königreich darum, wenn sie meine Frau werden wollte.«
»Das Königreich kannst du ruhig behalten«, sagte der Frosch, »das wird sie nicht genieren. Aber zu ihr hinüberhüpfen lass uns, eh’ es zu spät wird; denn Glockenschlag Eins muss die schöne Entenhüterin wieder nach Hause.«
Sie gingen nun zusammen um den Moorteich herum zu dem Platze, wo das Mädchen saß. Das stieß beim Anblick der beiden einen leisen Schrei aus und zog sein aufgeschürztes Gewand so tief hinab, dass der Saum das Wasser berührte.
»Schönen guten Abend mein Fräulein«, quakte der Frosch. »Hier bringe ich Euch einen Freund, der ein waschechter Prinz und König ist und Euch zur Frau haben möchte.«
Das schöne Mädchen betrachtete den jungen König und senkte verwirrt die nachthimmelblauen Augen zu Boden. »Das kann Euer Ernst nicht sein«, sprach es zum Frosch. »Wer sollte künftig bei Vollmond meine Enten hüten?«
»Ausflüchte – Ausflüchte –«, quakte der Frosch.
Aber das Mädchen schüttelte traurig den Kopf. »So leid es mir tut, ich kann Euch nicht heiraten«, sagte es zu dem jungen König. Der wollte gerade zu einer Liebeserklärung den Mund öffnen, als ihm der nasse Frosch auf die Hand sprang und ihm einen gelinden Schauer über den Rücken jagte.
»Immer kalt Blut«, beschwichtigte der Frosch den jungen König, »sie wird schon ihre Gründe haben, weshalb sie dich nicht heiraten will.« Und er drängte zum Aufbruch. Schweren Herzens nahm der junge König von der Schönen Abschied. »Grün ist die Hoffnung«, sprach er seufzend zum Frosch, als sie zusammen um den Moorteich herumgingen. »Grün ist meine Leibfarbe«, quakte der Frosch und lachte, dass es gluckste. Plantsch! da sprang er mit einem Satz in den Moorteich hinein und ließ den armen jungen König am Ufer stehen. Ja, nun wusste er so viel wie vorher.
Von dieser Stunde an wurde es mit seiner Traurigkeit noch schlimmer. Zwar wanderte er nicht mehr allabendlich zu den Moorwiesen hinaus, allein in jeder Vollmondnacht erhob er sich von seinem Lager, kleidete sich an und schlich heimlich zum Moorteich. Der Moorteich aber lag schwarz und reglos, und der Platz, auf dem die Schöne ihre Enten gehütet hatte, war leer. Nicht einmal der Frosch ließ sich mehr sehen. Nur manchmal wollte es dem jungen König scheinen, als höre er aus der schwärzlichen Tiefe heraus ein schadenfrohes Quaken. Doch das konnte auch eine Täuschung sein. Und bleich und verhärmt kehrte er ins Schloss zurück.
Eines Tages zog der Hofmarschall den jungen König wieder beiseite. »Majestät«, sprach er, »Majestät ertragen die Einsamkeit nicht. Ich erlaube mir nochmals zu wiederholen: Majestät sollten heiraten!«
Diesmal stampfte der junge König nicht mit dem Fuß auf; müde und gleichgültig betrachtete er seine Fingerspitzen. »Wenn es sein muss, warum nicht?«, sagte er und zuckte die Achseln. Mochten sie mit ihm anfangen, was sie wollten; ihm war alles einerlei.
Der Hofmarschall rieb sich freudestrahlend die Hände. Und schon am nächsten Tag begann in dem stillen Schlosse ein Leben und Treiben, dass es eine Lust war. Droben in den Gemächern häuften sich Samte und Brokate, Gold- und Silberborten, Pelze und wallende Straußenfedern. Und auf den Stühlen ringsherum saßen hundert Schneider, die stichelten mit den Nadeln und klapperten mit den Scheren und nahmen dem jungen König Maß für seine Hochzeitskleider. Das war eine Arbeit!
Endlich hingen Mäntel, Wämse, Hosen und Barette fix und fertig im Schrank. Der Hofmarschall ließ die Hofkutsche bespannen, setzte den jungen König hinein und sich an seine Seite, und fort ratterten sie ins Land hinaus.
Natürlich wurden sie überall mit Freuden und den gebührenden Ehren empfangen. Sämtliche Prinzessinnen der Welt waren mit Vergnügen bereit, die Frau des hübschen jungen Königs zu werden. Aber was den jungen König betraf, so konnte er zu keiner von ihnen ein Herz fassen. Unwillkürlich verglich er die Blonden und Schwarzen, Großen und Kleinen, Dicken und Dünnen, Klugen und Dummen mit seiner schönen Entenhüterin. Und den Vergleich konnten sie alle nicht aushalten.
Schließlich hatten die beiden alle Königsschlösser der Welt besucht bis auf eins. Das lag auf einem verrufenen Erlenhügel und gehörte einem mächtigen alten König, von dem man sich die seltsamsten Dinge erzählte. Auch der Hofmarschall wusste davon zu berichten. So sollte des alten Königs Mutter böse Künste getrieben haben, und was schlimmer war als das: Über die Herkunft der früh verstorbenen Königin gingen allerhand dunkle Gerüchte um. Ja manche Leute behaupteten steif und fest, das sie nichts weiter gewesen wäre als eine ganz gewöhnliche Gänsemagd! Der Hofmarschall schauderte bei dem bloßen Gedanken, dass der junge König dieses Schloss besuchen könnte.
Der aber rieb sich schadenfroh die Hände. »Nun gerade!«, sagte er. Und dann klopfte er an das Kutschenfenster und befahl dem Kutscher, schnurstracks zu diesem Schlosse hinzufahren. Das machte ihm einmal ganz besonderen Spaß.
Der alte König empfing ihn in höchsteigener Person auf der Treppe. »Große Ehre!«, sagte er und tätschelte dem jungen König die glatten Wangen. Auf Etikette gab er nicht viel.
Er geleitete seine beiden Gäste in den Thronsaal und bat sie, Platz zu nehmen; sodann schickte er einen kleinen Pagen, der gerade mit Abbürsten des Thronsessels beschäftigt war, hinauf, seine Tochter zu holen.
»Ich glaube wohl, dass sie Euch gefallen wird«, sagte der alte König zum jungen. Da ging auch schon die Tür auf, und herein trat niemand anders als – die schöne Entenhüterin selber! Ihr Gesicht war weißer als die Mondstrahlen, ihre Augen dunkelblauer als der Nachthimmel und ihre Haare goldgelber und weicher als der zarteste Entenflaum. Sie trug ein hellfarbenes Schleppgewand und schritt leicht wiegenden Ganges auf den alten König zu. »Ihr habt befohlen, Vater«; sprach sie und küsste des Alten Hand.
Der alte König strich ihr wohlgefällig über das goldgelbe Haar. »Hier ist einer, der dich zur Frau haben möchte«, sagte er und wies auf den jungen König, der vor Freude und Schreck abwechselnd rot und blass wurde.
Das Mädchen blickte den jungen König an, verfärbte sich und barg sein Antlitz in den Händen.
»Seid ohne Sorge«, sagte der alte König zum jungen, »sie ist noch etwas schüchtern.« Da senkte die schöne Entenhüterin den Kopf und ging langsam wieder zur Tür hinaus; und ihr hellfarbenes Gewand schleppte rauschend hinterdrein.
»Ich sehe, Ihr liebt sie«, sprach der alte König zum jungen, »und da Ihr ein angenehmer junger Mann seid, gegen den nichts einzuwenden ist, will ich sie Euch zur Frau geben.«
Nun wurde der Hofküchenmeister herbeigerufen und ihm befohlen, das Verlobungsmahl herzurichten. In weniger als einer Viertelstunde war die Tafel bereit, und die leckersten Bratengerüche erfüllten die Luft. Und siehe! Kaum hatte man den letzten Stuhl an den Tisch gerückt, als sich auch schon die Türen öffneten und Kavaliere und Damen erschienen. Sie machten dem alten König ihre Reverenz, gratulierten und nahmen in feierlichem Zuge ihre Plätze an der Tafel ein.
Und wiederum tat sich die Tür auf, und die schöne Königstochter trat in den Saal. Sie war ganz in weiße Seide gekleidet, aber ihr Angesicht war tausendmal weißer als die Seide, und in ihren Augen standen Tränen. Sie setzte sich an des jungen Königs Seite und sprach kein Wort. Der arme junge König wusste zuletzt gar nicht mehr, was er denken sollte.
Als das Mahl zu Ende ging, erhob sich die schöne Königstochter und verschwand. Der alte König schlug seinen Gästen zum Nachtisch ein Würfelspiel vor. Aber der junge König dankte. Er wolle lieber im Garten spazieren gehen, meinte er. Ihm war nicht nach Würfelspielen zumute.
Er schritt die Marmorstufen zum Garten hinunter und wanderte zwischen den Buchsbaumhecken auf und nieder. Rechts und links vom Weg saßen bunte Papageien auf silbernen Stangen, die hackten mit den Schnäbeln nach ihm und lachten ihn aus. Der junge König drehte den boshaften Vögeln den Rücken, verließ den Garten und wanderte in den nahen Wald.
Da war es kühl und still. Die Tannen rauschten über seinem Haupt, und murmelnde Wässerlein sickerten zwischen Buschwerk und Farnen dahin. Der junge König legte sich ins Moos, stützte den Kopf in die Hände und träumte. Weil er aber traurig und müde war, dauerte es nicht lange, da war er eingeschlafen.
Als er wieder aufwachte, stand der Vollmond am Himmel und leuchtete ihm ins Gesicht. Da erschrak er, denn er merkte, dass er eine gute Weile hier gelegen haben musste und dass sie ihn im Schloss wohl vermisst haben mochten. Er stand eilig auf, schüttelte Zweiglein und Moos von seinen Kleidern und trat den Rückweg an. Weil er aber noch nie zuvor in dieser Gegend gewesen war, konnte er den Weg nicht wiederfinden, sondern geriet immer tiefer in den Wald hinein. Endlich sah er durch die Bäume eine Lichtung schimmern; er wand sich zwischen Hecken und Gestrüpp hindurch und gelangte zu einem Weiher, der inmitten des Waldes lag und im Mondschein wie Silber glänzte.
Wie er nun so am Ufer stand, hörte er plötzlich Flügel über sich rauschen. Er hob den Kopf und sah eine Schar wilder Enten, die flog geradewegs über ihn hin und mitten in den Weiher hinein. Und siehe! Es dauerte nicht lange, da trat aus dem Baumdickicht die schöne Entenhüterin hervor, setzte sich auf einen Stein an des Weihers Rand und ließ die Füße ins Wasser hängen.
»Schnatter – Schnatter«, sagten die wilden Enten, schwammen auf die Prinzessin zu und rieben die Schnäbel an ihrem Gewand.
Die Prinzessin streichelte mit ihren weißen Händen der wilden Vögel Gefieder. »Ach meine lieben Enten«, sprach sie, »ich bin sehr unglücklich!« Und sie seufzte.
Die Enten drängten sich dicht an sie heran. »Was hast du – was hast du?«, fragten sie und steckten die Köpfe zusammen.
»Mein Vater will, dass ich die Frau des jungen Königs werde«; klagte die Prinzessin. »Aber wie kann ich die Frau des schönen jungen Königs werden, da ich doch Entenfüße habe?« Und bei diesen Worten fing die Prinzessin an bitterlich zu weinen.
Die Enten schlugen mit den Flügeln. »Das ist gerade das Allerhübscheste an dir«, schnatterten sie und sträubten die Federn. Aber die Prinzessin schüttelte trübselig den Kopf. »Ja, das findet ihr«, sagte sie, »aber wüsste der junge König um mein Gebrechen, er würde mich auf der Stelle verstoßen.« Bei diesen Worten erhob sich die Prinzessin von ihrem Sitz und watschelte mit richtigen gelben Entenfüßen ein Stück Wegs am Ufer lang und gerade auf den Baum zu, hinter welchem der junge König stand.
Der jedoch sprang geschwinde aus seinem Versteck hervor und warf sich der erschrockenen Jungfrau zu Füßen. »Ich habe alles gehört«, sprach er, »und wenn es weiter nichts ist, so könnt ihr ruhig meine Frau werden. Denn ich liebe Euch noch ebenso wie vorher.«
Da fiel die schöne Prinzessin dem jungen König um den Hals und küsste ihn mitten auf den Mund. »Ich danke dir«, sagte sie und war sehr glücklich. Und dann gingen sie zusammen zu dem alten König.
Der alte König schmunzelte, als er die beiden so glückstrahlend miteinander daherkommen sah. »Ich dachte mir wohl, dass sie nicht reinen Mund halten könnte«, sprach er. »Aber weil ihr es nun doch einmal wisst, dass sie Entenfüße hat, so will ich Euch auch erzählen, wie sie dazu gekommen ist.
Die hat sie niemand anders zu verdanken als ihrer leibhaftigen Großmutter. Und das ging nämlich folgendermaßen zu: Als vor Zeiten mein alter Vater starb und die Reihe an mich kam, mir eine Königin zu nehmen, da wählte ich zum Zorn meiner Mutter ein Mädchen, das zwar schön wie der Tag war, aber auf meines Vaters Meierei die Enten hütete. Meine Mutter, die das arme Mädchen um seines niederen Standes willen hasste, gab uns die Verwünschung in die Ehe mit, dass unsere Kinder dereinst mit Entenfüßen zur Welt kommen und darauf herumwatscheln sollten.
Die junge Königin starb vor Gram, als sie beim Anblick ihres ersten Kindleins gewahrte, dass der böse Wunsch in Erfüllung gegangen war. Das Kindlein jedoch wuchs heran, ward eine schöne Prinzessin und trug von klein auf Schleppkleider, damit die boshaften Menschen nicht sehen sollten, was darunter steckte. Das ist die ganze Geschichte. Auf dass Ihr mir jedoch keinen Hass gegen die verstorbene Urschwieger hegt, will ich Euch morgen zu Eurem Hochzeitsfest ein Geschenk aus deren Nachlass machen. So unscheinbar es aussieht, hat es doch seinen Wert und wird Euch und Eurem Volke von großem Nutzen sein.«
Alsbald wurden die Einladungen verschickt. »Vergesst auch nicht den Frosch vom Moorteich zu bitten«, mahnte der junge König seine Braut, »denn, wäre er nicht gewesen, wer weiß, ob ich je Eure Bekanntschaft gemacht hätte!«
»Seid unbesorgt«, antwortete sie, »er soll nicht nur eingeladen werden, sondern auch den Ehrenplatz an meiner rechten Seite erhalten.«
Und richtig fuhr den anderen Tag die königliche Prunkkarosse zuallererst beim Moorteich vor, um den Frosch abzuholen. »Eigentlich hüpfte ich rascher zu Fuß hinüber«, quakte der Frosch, »aber der schönen Entenhüterin zuliebe will ich meinetwegen in der Staatskutsche Platz nehmen, wenngleich ich ungern auf dem Trocknen sitze.« Und platsch! sprang er quatschnass, wie er war, auf die samtenen Wagenpolster.
»Meinen besten Glückwunsch!«, quakte der Frosch, als der junge König ihn am Wagen empfing. »Du bekommst eine Prinzessin, die hübsch ist, das Wasser nicht scheut und schwimmen kann; du hast allen Grund zufrieden zu sein.«
Ja, den hatte er auch.
Wie nun alle an der Hochzeitstafel versammelt saßen, reichte der alte König dem Bräutigam ein elfenbeinernes Kästchen über den Tisch hinüber. Der Junge König öffnete es und fand darin zu seinem Erstaunen nichts anderes als eine ganz gewöhnliche Hornbrille. Neugierig zog er sie heraus und setzte sie auf die Nase.
Himmel, welche Sonderbarkeiten musste er da erblicken! Die ganze Hochzeitsgesellschaft war mit einem Schlage verändert, und zwar durchaus nicht zu ihrem Vorteile! Drüben bei seinem Hofmarschall fing es an. Dem baumelte ein Fuchsschwanz hinten zum Rockschoß heraus, und in seinen Taschen steckten sämtliche Kronschätze des Reiches. Des Marschalls Nachbarin zur Linken hatte Krallen an den zierlichen Fingern, und der zur rechten züngelte eine Schlange aus dem Munde. Viele von den Kavalieren trugen Strohköpfe, andere wieder statt des Menschenherzens ein Hasenherz, einen Mühlstein oder ein Stück Torfmoor unter der Weste.
Nur des jungen Königs Braut war unverändert geblieben, und wenn auch ihre gelben Entenfüße durch das Atlaskleid hindurchschimmerten, ihr Herz in der Brust war weiß wie Schnee und klar wie Bergkristall.
Da schloss der junge König die Prinzessin in seine Arme und freute sich sehr, dass sie weiter nichts hatte als Entenfüße. Seinem Hofmarschall aber ließ er sogleich die Taschen leeren und jagte ihn aus dem Königreich hinaus. Bloß den Fuchsschwanz musste er ihm lassen, denn der war festgewachsen.
Der Frosch mit dem Edelstein im Kopf
Von Gräfin Valeska Bethusy-Huc
Mitten im Walde lag eine Wiese, und inmitten der Wiese war ein Sumpf mit braunen Wasserlachen und alten Weidenknorren am Rande. Das war das Reich des Froschkönigs. In den Maiennächten, wenn der Mond wie eine rote Kugel über dem Walde aufstieg, hatten die Frösche großes Konzert. Der Jägerlehrling, der vorüberging, sagte: »Das ist ja ein schreckliches Gequake!« Er verstand es eben nicht besser. Der Froschkönig wusste, dass seine Untertanen sehr gute Sänger waren, und dass er sogar einige Künstler ersten Ranges darunter hatte.
Darum saß er auch jeden Abend mit der Königin und dem Kronprinzen auf dem größten Weidenknorren und hörte den Gesängen der Frösche zu. Und dabei sahen er und die Königin immer abwechselnd den Kronprinzen an; denn sie warteten darauf, dass er etwas sagen und seine Meinung äußern würde. Ein paar Mal machte er auch sein großes Maul, das seine Mutter wunderschön fand, weit auf – aber er sagte nicht einmal: »Quak!« – er gähnte ganz einfach. Und plötzlich machte er einen Satz und sprang ins Wasser.
»Er ist so originell«, sagte die Froschkönigin, »er ist anders als alle anderen Frösche, er ist durch und durch bedeutend.«
»Ja«, erwiderte der Froschkönig, »und ich denke auch daran, ihn noch bei meinen Lebzeiten zu meinem Nachfolger zu machen; denn ich bin alt, und das Regieren macht mir keinen Spaß mehr.«
»Das ist ein guter Gedanke!«, rief die Königin. »Alle Frösche auf der Welt werden dich dafür preisen; denn je jünger ein so bedeutender Frosch, wie unser Sohn, zur Regierung kommt, umso besser wird es für unser Reich und darum auch für die ganze Welt sein; einen König, der einen Edelstein im Kopf hat, den hat es noch nicht gegeben.«
Der alte Froschkönig seufzte.
»Ja, ich habe keinen Edelstein im Kopf; denn es passiert nur alle 500 Jahre einmal, dass ein Frosch einen Edelstein im Kopf trägt – und da mein Sohn ihn hat, konnte ich ihn nicht haben. Das ist klar!«
Eigentlich hätte er seine Frau gern gefragt, woher sie es denn wisse, dass der Prinz den Edelstein hatte, aber es kam ihm immer vor, als ob er sich mit dieser Frage etwas vergeben würde und deshalb unterließ er sie. Schon als der Froschprinz noch eine Kaulquappe war, hatte seine Mutter gesagt, dass er den Edelstein hätte, denn es waren gerade 500 Jahre her, dass der letzte Frosch mit einem Edelstein im Kopf gelebt hatte. Und dann hatten es die Ministerfrauen erfahren, die Minister waren zur feierlichen Gratulationscour gekommen, und der König hatte ein Volksfest gegeben, beim dem es allen Fröschen im ganzen Reich verkündet wurde: »Der Kronprinz hat einen Edelstein im Kopfe!« Und nun wussten es alle, und als der Prinz aufhörte, eine Kaulquappe zu sein, erfuhr er es auch. Er trug den Kopf so hoch, wie ein Frosch den Kopf nur tragen kann; es ist auch keine Kleinigkeit, wenn man das Bewusstsein hat, etwas zu besitzen, dass nur alle 500 Jahre einmal verliehen wird. Aber trotzdem langweilte der Prinz sich oft ganz abscheulich, und dagegen kannte er nur ein Mittel; er besuchte den kleinen grünen Frosch, der auf der anderen Seite des Sumpfes wohnte und der sein Jugendgespiele war. Als er so unversehens in das Wasser gesprungen war, hatte er gerade wieder Sehnsucht nach dem kleinen grünen Frosch bekommen, und da er sich niemals irgend einen Zwang antat, so war er zu ihm geschwommen. Der grüne Frosch war aber nicht zu Hause, der Prinz musste warten, und seine Laune wurde dadurch noch schlechter, als sie ohnedem war.
Endlich kam der grüne Frosch.
»Wo treibst du dich herum?«, schrie der Prinz ihn an, »ich komme beinahe um vor Langeweile und du hüpfst spazieren!«
»Wenn du dich langweilst, solltest du einmal mit mir ein Stückchen in die weite Welt hinaus wandern«; sagte der grüne Frosch. »Da gibt es allerlei zu sehen und zu hören …«
»Unsinn«, quakte der Prinz, »die weite Welt ist nur der Rahmen für unseren Sumpf, und ich kann meine Zeit nicht damit verlieren, dass ich mich mit etwas so Nebensächlichem wie deine ›weite Welt‹ befasse.«
»O«, meinte der grüne Frosch, »ich habe schon manchmal gedacht, dass unsere Gefährten sich irren. Vielleicht ist unser Sumpf gar nicht der Mittelpunkt der Welt und alles andere nur ›Rahmen‹ dafür.«
Gewöhnlich unterhielt es den Prinzen, wenn der grüne Frosch solche Absonderlichkeiten redete, aber heute stand ihm die Laune nicht danach.
»Schweig still«, schrie er, »du redest puren Hochverrat, und ich müsste dich eigentlich wegen gemeingefährlicher Gedanken anzeigen. Aber ich will dir noch einmal gnädig verzeihen, wenn du versprichst, solche verbotenen Gedanken nie wieder zu haben. Wir und unser Sumpf, wir sind der Mittelpunkt der Welt – punktum! Und dann habe ich noch einen anderen Grund zur Unzufriedenheit: dir leuchten die Augen so, dass es grässlich anzusehen ist. Das musst du dir abgewöhnen.«
Der grüne Frosch verneigte sich höflich, um anzudeuten, dass er sein Möglichstes tun würde, und der Prinz fuhr unzufrieden fort: »Ja, du musst dir das entschieden abgewöhnen, denn neulich hat die jüngste Ministerfrau gesagt, deine Augen seien so merkwürdig, dass man glauben könnte, du hättest auch einen Edelstein im Kopf, der durch deine Augen hervorleuchtete. Das muss ich mir aber sehr ernstlich verbitten, denn den Edelstein habe ich, wie du weißt, und er kommt nur einmal alle 500 Jahre vor!«
»Es tut mir leid, dass ich deine Unzufriedenheit erregt habe«, sagte der grüne Frosch, »aber die jüngste Ministerfrau spricht manchmal mehr, als sie verantworten kann. Wenn meine Augen heut zu glänzend waren, so kommt es wohl daher, dass ich eine große Freude gehabt habe!«
»Was?«, quakte der Prinz, »und das sagst du mir erst jetzt? Ich langweile mich zum Sterben, und du erlebst eine Freude und erzählst sie mir nicht einmal?«
»Du wolltest von der weiten Welt nichts hören, und die Freude hatte ich doch da draußen!«
»Nun erzähle endlich, was hast du erlebt?«
Und der grüne Frosch erzählte:
»Auf der anderen Seite des Waldes stehen Büsche von wilden Rosen mit vielen lichten rosa Blüten. Dort wohnt eine Prinzessin, die ist nicht viel größer als wir und trägt ein einfaches, braunes Kleid. Aber sie hat Flügel, sie fliegt von einem Rosenbusch zum anderen und hoch hinauf, wohl bald bis in den Himmel. Das schönste aber an ihr ist, dass sie singen kann« –
»Das kann ich auch, wenn ich will«, rief der Froschprinz, aber der grüne Frosch erzählte weiter:













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















