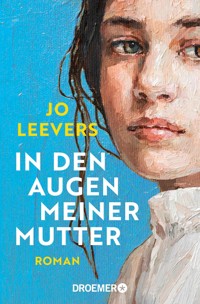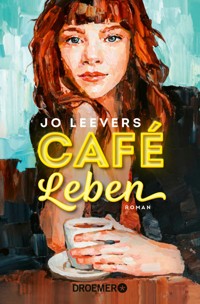
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, zwei Schicksale – eine bewegende Botschaft. »Café Leben« ist ein außergewöhnlicher Roman über zwei Frauen aus zwei Generationen, die einander ihre Lebensgeschichte erzählen: kraftvoll, eindringlich und voller Hoffnung. Die 32-jährige Henrietta Lockwood führt in Birmingham ein zurückgezogenes Leben mit ihrem Hund Dave. Schon früh hat sie eine Mauer zwischen sich und der Welt errichtet. Das verhilft ihr schließlich zu einem besonderen Job im Hospiz, bei dem man besser nicht ständig in Tränen ausbricht: Henrietta soll todkranken Menschen dabei helfen, die Geschichte ihres Lebens für die Nachwelt aufzuschreiben. Schon bei den ersten Gesprächen mit ihrer Klientin Annie merkt Henrietta, dass die 65-jährige Krebspatientin schlimmen Erinnerungen ausweicht. Ohne die wird ihre Geschichte jedoch nie vollständig sein, und das kann Henrietta nicht hinnehmen. Sie versucht auf eigene Faust herauszufinden, was Annies Schwester vor 46 Jahren zugestoßen ist. Doch um Annie dazu zu bringen, alle Puzzleteile offenzulegen, muss Henrietta etwas tun, was sie noch nie zuvor getan hat: ihre eigene Geschichte erzählen. Ergreifend, ohne rührselig zu werden, schreibt die britische Autorin Jo Leevers über Leben und Tod, über das Erinnern und das Erzählen, das die Macht hat, alte Wunden zu heilen. Ein besonderer Roman, der noch lange nachhallt. Entdecke auch Jo Leevers neuen berührenden Familienroman »In den Augen meiner Mutter« über Mutterschaft, Familiengeheimnisse und trügerische Erinnerungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jo Leevers
Café Leben
Roman
Aus dem Englischen von Maria Hochsieder
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Jeder Mensch hat eine Geschichte, die es lohnt, erzählt zu werden
Schon früh in ihrem Leben hat die 32-jährige Henrietta eine Mauer zwischen sich und der Welt errichtet. Das verhilft ihr zu einem Job, bei dem man besser nicht ständig in Tränen ausbricht: Sie soll für todkranke Menschen deren Lebensgeschichte aufschreiben. Ihre erste Klientin, die 66-jährige Krebspatientin Annie, weicht Henriettas Fragen jedoch immer wieder aus, sodass sich einfach kein klares Bild ergeben will. Um Annies Leben zu verstehen und zu erfahren, was ihrer Schwester vor 46 Jahren zugestoßen ist, muss Henrietta etwas tun, was sie noch nie zuvor getan hat: ihre eigene Geschichte erzählen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Einige Worte des Danks
Einige Worte über das Schreiben
Einige Worte über Worte
Einige Worte über Fakten
Einige Worte über das Trauern
Einige Worte zu Dave, dem Hund
Im Gespräch mit Jo Leevers
Für meine Mutter Maureen.In Liebe x
Prolog
Dezember 1974
Zwei Tage lang liegt der ordentliche Kleiderstapel am Kanalufer, bevor jemand auf die Idee kommt, die Polizei zu informieren.
Es ist kurz vor Weihnachten, und alle haben zu tun: Geschenke kaufen, Besorgungen machen.
Ein paar Leute, die die Abkürzung am Kanal nehmen, bleiben kurz stehen, aber die Sorgfalt, mit der die Kleidungsstücke zusammengefaltet sind, hält sie davon ab, sie sich genauer anzusehen. Der Kleiderstapel wirkt so absichtsvoll, als wäre die Besitzerin nur kurz weggegangen und käme jeden Augenblick wieder.
Doch die Besitzerin kehrt nicht zurück.
Eine braune Wildlederjacke liegt ganz oben, die Ärmel zusammengelegt. Ein gestreifter Schal wurde daruntergesteckt, als wollte man ihn vor dem Regen schützen. Darunter ist gerade noch der Saum eines gelben Kleids zu erkennen. Ein kleines Stück weiter am Treidelpfad stehen zwei noch glänzende, neue Lederstiefel stramm nebeneinander.
Am zweiten Tag wird der Regen stärker. In den Falten der Jacke sammelt sich das Wasser, und der Pelzkragen wird platt gedrückt und schmutzig grau. Die Stiefel sind ruiniert.
Durch den Regen wird auch der gewöhnlich ruhig dahinfließende Kanal aufgewühlt. Das grüne Wasserlinsengeflecht, das auf der Oberfläche treibt, zerteilt sich in kleinere Stücke und offenbart den Schlick, der vom Grund heraufwirbelt.
Die Zeit vergeht. Der Schlamm sinkt wieder auf den Grund.
Und noch immer kommt niemand.
Kapitel 1
Henrietta
Henrietta Lockwood entscheidet sich für eine Bank, die an der Kreuzung dreier Hauptstraßen steht. Man kann nicht gerade behaupten, dass es ein friedlicher Ort ist, aber er liegt günstig. Von hier aus dürfte es etwa eine Minute zu Fuß zur Rosendale-Beratungsambulanz sein, wo sie in zweiundzwanzig Minuten ein Bewerbungsgespräch hat. Um ganz sicherzugehen, wird sie in zwölf Minuten von der Bank aufstehen.
Es ist Ende Oktober und dementsprechend kühl, doch sie hat nicht die Absicht, für das Privileg, in einem Café zu sitzen, Geld auszugeben. Von ihrer Position aus hat sie ein Café im Blick. Es trägt den Namen Plant Life, was Henrietta für eine unkluge Wahl hält, und hätte sie nicht um zwei Uhr einen Termin, würde sie dem Inhaber auseinandersetzen, worin der Fehler liegt.
Trotz der Temperaturen spürt Henrietta, wie sich an einer Stelle am Rücken der Schweiß sammelt, also beugt sie sich nach vorn, damit er nicht in die Bluse sickert. Das kommt daher, dass sie den Rucksack konsequent auf dem Rücken behalten hat. Zugegeben, der einzige Mensch, der sie auch nur zur Kenntnis genommen hat, war eine schwermütig wirkende Frau, die zwei Chihuahuas ausführte – trotzdem, es gibt immer mehr Raubüberfälle. Henrietta weiß das, weil sie täglich darüber in den kostenlosen Anzeigenblättern liest.
Die Beratungsambulanz (warum nennt man es nicht einfach das Ich-habe-Krebs-Zentrum?, denkt Henrietta) befindet sich im westlichen Flügel eines Krankenhauses in einem exklusiven Teil Londons voller viktorianischer Plätze, Privatgärten und hoher Platanen. Von der Bank aus kann Henrietta das stattliche Gebäude mit der symmetrischen Fassade und den geriffelten Säulen rechts und links von der Glastür sehen. An einer Seite wurde eine Rollstuhlrampe angebracht, was sie wirklich schade findet, da es die Symmetrie stört.
Das Haus mag einen eleganten Eindruck machen, bei den Leuten aber, die ein und aus gehen, ist von allem etwas dabei. Eine spindeldürre Frau in Daunenjacke und sich bauschendem Rock müht sich die Rampe hinauf. Sie klammert sich an den Handlauf, ihr Körper ist merkwürdig gekrümmt. Als sie die Eingangstür erreicht, kommt ein älterer Mann im Kamelhaarmantel heraus und tritt wortlos zur Seite, um ihr Platz zu machen. Mit aschfahlem Gesicht nestelt er an seinen Knöpfen. Die Rosendale-Ambulanz scheint, so muss Henrietta erkennen, nicht gerade der vergnüglichste Arbeitsplatz zu sein.
Die Stellenanzeige war auf den letzten Seiten der Zeitschrift London Review of Books versteckt gewesen. Seit Henrietta unfreiwillig Müßiggang pflegte, hatte sie die vierzehntägliche Lektüre der Kleinanzeigen schätzen gelernt, nicht ohne die mangelnde Ernsthaftigkeit, die dort zur Schau gestellt wurde, zu missbilligen. Yoga oder Schreibworkshops in Griechenland. Leute, die eine Bekanntschaft suchten, um gemeinsam ihrem Interesse an Dichtung, Bergwanderungen »und möglicherweise mehr« nachzugehen. Doch dann hatte sie folgende Annonce entdeckt:
Das Projekt Lebensbuch
Mitarbeiter für Interviews und deren Verschriftung an drei Tagen pro Woche einschließlich Samstag gesucht. Kenntnisse in Textverarbeitung und redaktionelle Fertigkeiten sowie Einfühlungsvermögen werden vorausgesetzt. Sechsmonatiger Vertrag mit möglicher Verlängerung vorbehaltlich der Finanzierung.
Natürlich ist ein befristeter Job alles andere als ideal, aber angesichts eines mit Lücken und abrupt endenden Arbeitsverhältnissen gespickten Lebenslaufs darf Henrietta nicht allzu wählerisch sein. Auch die Sache mit dem Einfühlungsvermögen ist etwas besorgniserregend, weshalb Henrietta in der vergangenen Woche vor dem Spiegel an ihrer Mimik gefeilt hat.
Unbeobachtet probte sie im Badezimmer ein breites Lächeln. Es sollte ihr Begrüßungsgesicht sein. Dann legte sie den Kopf schief, um Empathie zu signalisieren. Selbst in ihren eigenen Augen wirkten die Ergebnisse beängstigend. Ihr wurde bewusst, wie es dazu kommt, dass Affen als Akt der Aggression die Zähne blecken.
Glücklicherweise sind Henriettas Zähne angenehm ebenmäßig. Sie hat ein rundes Gesicht und schulterlanges Haar, eine Frisur, die ihr im Alter von elf Jahren zuteilwurde und die zu ändern sie nie Veranlassung hatte. Sie erlaubt sich keine Schminke. Selbst mit zweiunddreißig wirken ihre Versuche immer so, als habe sich ein Kind mit Wachsmalkreiden ausgetobt.
Da sie weiß, dass Kleider dabei helfen, einen guten Eindruck zu machen, verbrachte sie einen ganzen Abend damit, die Fusseln von der dunkelblauen Hose aus dem Kaufhaus British Home Stores zu entfernen, die ihr im alten Job gute Dienste geleistet hatte. Eine blaue Bluse, die sie vor ein paar Jahren auf eine Anzeige in der Fernsehzeitschrift hin bestellt hatte, ist ihrer Meinung nach angemessen förmlich und doch leger.
Die Zeiger ihrer Timex-Armbanduhr (ein Geschenk zum sechzehnten Geburtstag und immer noch voll funktionstüchtig) besagen, dass es Zeit ist, von der Bank aufzustehen. Henrietta schluckt den vertrauten Kloß im Hals hinunter, setzt ihr Begrüßungsgesicht auf und macht sich mit großen Schritten auf den Weg zur Rosendale-Beratungsambulanz.
»Also …« Etwas willkürlich schiebt die Frau im rosa Pullover Papiere auf dem Schreibtisch hin und her und lässt erkennen, dass sie schlecht vorbereitet ist. Endlich hebt der Rosa Pullover den Blick. »Aha. Henrietta Lockwood. Weshalb halten Sie sich für diese Arbeit für geeignet?«
Henrietta räuspert sich. »Ich bin aus verschiedenen Gründen für die Stelle geeignet. Erstens neige ich nicht zu Gefühlsausbrüchen oder Sentimentalität. Zweitens besitze ich ausgezeichnete Qualifikationen im Büromanagement und bin somit gut gerüstet, um die Lebensgeschichten rechtzeitig zu verschriften, bevor die Betroffenen sterben. Drittens mag ich es, eine Deadline zu haben.«
Es entspricht fast Wort für Wort dem, was Henrietta in ihrem Bewerbungsschreiben aufgelistet hat. Doch der Rosa Pullover – »Bitte sagen Sie Audrey« – scheint es nicht zu bemerken. Audrey betrachtet sie durch dicke Brillengläser, die ihr riesige, an einen Fisch erinnernde Glupschaugen verleihen.
»Es ist nicht immer so einfach«, seufzt sie und legt die Hände aneinander. »Aber, nun ja, hier im Projekt Lebensbuch kann emotionale Distanz von Vorteil sein.«
Sie dreht den Computerbildschirm zu Henrietta herum. »Der letzte Teil der Bewerbung ist ein Test zum Korrekturlesen. Es ist die Lebensgeschichte von Kenton, ich habe sie selbst aufgeschrieben. Er ist letzte Woche von uns gegangen, aber den größten Teil konnte ich noch zu Papier bringen. Seine Familie wünscht sich die gedruckten und gebundenen Exemplare seiner Autobiografie rechtzeitig zur Beerdigung. Das ist oft so. Außer wir werden unversehens überrascht …« Sie verstummt. »Wie auch immer, Sie haben fünfundvierzig Minuten. Kennen Sie die Funktion ›Änderungen nachverfolgen‹?«
Darum hätte sie sich keine Gedanken machen müssen, denn »Änderungen nachverfolgen« gehört zu Henriettas absoluten Lieblingstätigkeiten. Nichts macht sie glücklicher, als Zeichensetzung, Rechtschreibung und Fakten zu korrigieren und dabei ihr überragendes Wissen in Rot herauszustellen. Als Audrey das Zimmer verlässt, ist Henrietta bereits damit beschäftigt zu tippen, streicht Wörter durch und zieht die Stirn in Falten angesichts des schockierend dürftigen grammatischen Verständnisses.
Als Audrey sie zur Tür begleitet, zeigt sie Henrietta, wo sie die Interviews für die Lebensgeschichten führen wird, sollte sie die Stelle bekommen. Im ersten Augenblick ist Henrietta irritiert, weil sie sich ausgemalt hatte, in einem eigenen Büro zu sitzen, so ähnlich wie das von Audrey, nur mit Fenster. Und einer Zimmerpflanze. Möglicherweise auch mit einem dieser Duftzerstäuber. Doch Audrey deutet auf einen Ecktisch in dem kleinen Café der Ambulanz, gleich neben dem Foyer am Haupteingang.
»Die zwanglose Atmosphäre ist den Leuten lieber. Sie trinken gern ein Tässchen, während sie erzählen«, erklärt Audrey, als Henrietta an den automatischen Schiebetüren steht. Die Glasscheiben ruckeln, versuchen auf- und zuzugehen, und Henrietta ist sich unsicher, ob sie ins Freie oder zurück ins Warme treten soll, weil Audrey noch weiterredet.
»Alle nennen es Café Leben, auch wenn es hier oft ums Sterben geht.« Bei Audrey klingt es wie die Pointe eines Witzes, aber Henrietta hält es für besser, diese Bemerkung zu ignorieren. Ihrer Erfahrung nach sind Witze wie Bälle, die einem in hohem Tempo zugeworfen werden: schwer zu fangen und noch schwerer zurückzuspielen. Und Henrietta hatte noch nie viel für Ballspiele übrig.
»Ich kann mir vorstellen, dass das Ambiente im Café ein Gespräch erleichtert«, antwortet sie unbewegt und tritt hinaus auf die Steintreppe. »Ich freue mich darauf, in Kürze von Ihnen zu hören«, sagt sie zur geschlossenen Schiebetür.
Es ist eine Erleichterung, den Mief von Handdesinfektionsmittel, alten, ungewaschenen Kleidern und alten, ungewaschenen Menschen hinter sich zu lassen. Henrietta muss sich eingestehen, dass der heruntergekommene Eindruck der Rosendale-Ambulanz sie etwas enttäuscht. Nachdem sie gründlich recherchiert hat, weiß Henrietta, dass die Ambulanz die erste Einrichtung des Projekts Lebensbuch ist, das von Ryan Brooks finanziert wird, einem Popstar aus den Achtzigerjahren, dessen Frau an Eierstockkrebs gestorben ist. Sie hat sich das Video angesehen, in dem Ryan durch die Rosendale-Ambulanz führt, eine Runde High fives durch das Fernsehzimmer macht und dann mit ernsterem Gesicht von seiner Frau Skye erzählt, die in kürzester Zeit und viel zu jung gestorben war. »Wenn jemand Skye dabei geholfen hätte, ihr Leben aufzuschreiben, dann könnte unser kleines Mädchen es später einmal lesen«, sagt Ryan und schaukelt ein kahlköpfiges Baby mit zerknautschtem Gesicht in den Armen. »Jeder Mensch hat eine Geschichte – und diese Lebensgeschichte sollte erzählt werden.«
Da Henrietta momentan viel Gelegenheit hat, um Radio zu hören und tagsüber fernzusehen, überrascht es sie nicht, dass Ryan mit seiner Idee einen Nerv trifft. Es gibt Trauer-Podcasts, Blogs über die guten, die schlechten und die Chemotherapie-Tage von Krebskranken und Videoblogs über das Sterben und das Schreiben von Löffellisten. Henrietta findet das alles ein wenig ungebührlich, aber sie gehört damit offensichtlich zu einer Minderheit, denn andere Menschen überschlagen sich geradezu, wenn es darum geht, über ihre Trauer oder ihren bevorstehenden Tod zu reden, und Ryans Hashtags #LetzteWorte, #Lebensgeschichten und #TrauernmitRyan waren ein rasanter Erfolg.
Um sich für das überstandene Bewerbungsgespräch zu belohnen, leistet Henrietta sich einen Scone im Plant Life Café. Der Preis stiftet einige Verwirrung, doch allem Anschein nach hält man vier Pfund für ein Backwerk vom Konditor in dieser Gegend für völlig akzeptabel. Mutmaßlich vegan.
Sie trägt die Papiertüte zu der Bank, die sie nunmehr als »ihre« betrachtet, und isst den Scone in kleinen Stücken, die sie kaut und schluckt, bevor sie den nächsten Bissen abbricht. Für ihren Geschmack ist er ein bisschen trocken. Eine Taube bewegt sich ruckartig und mit Umwegen auf sie zu und sieht sie aus einem orange geränderten Auge von der Seite an. Schnell lässt Henrietta den Rest ihres Scones zurück in die Papiertüte fallen und faltet sie oben zusammen. Sie misstraut diesen dreisten, unberechenbaren Vögeln, aber sie will versuchen, sich von dieser Störung ihrer Privatsphäre die Stimmung nicht verderben zu lassen, denn die Sonne ist herausgekommen, und sie hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Arbeit.
Tatsächlich hat Audrey ihr bereits eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen, doch will sie abwarten, bis sie zu Hause und Dave an ihrer Seite ist, bevor sie sie abhört. Dave nimmt gerne Anteil an den Entwicklungen in ihrem Leben, ob zum Guten oder Schlechten, und hat sie schon einige Male durch schwierige Zeiten begleitet.
Als sie aufsteht, um sich auf den Weg zu machen, will sie die Bäckertüte in einem Abfalleimer entsorgen, doch sie überlegt es sich anders. Mit einem Blick vergewissert sie sich, dass sie nicht beobachtet wird, und kippt die übrig gebliebenen Krümel in einem kleinen Häufchen auf den Gehsteig. Als Bewohnerin von Chelsea findet die Taube vermutlich mehr Geschmack an veganen Scones als Henrietta.
Zurück in der Wohnung sitzt Henrietta auf dem Sofa und hört sich Audreys Nachricht mehrere Male an. Nach dem dritten Mal erlaubt sie sich das zarteste Glücksgefühl, das wie ein Bläschen in ihrem Innern nach oben steigt. Dave hat mittlerweile das Interesse verloren und wühlt sich in die Kissen neben ihr, wobei er eine Menge struppiges schwarzes und hellbraunes Fell verteilt. Er hechelt leicht, während er auf ihre Toastkrusten wartet, und sein Mundgeruch lässt einiges zu wünschen übrig. Sie liebt Dave wirklich sehr, aber es wäre doch schön, die Nachricht mit einem anderen zu teilen. Vermutlich könnte sie ihre Eltern anrufen, aber noch ist sie nicht bereit, dass jemand das Bläschen zerplatzen lässt.
Henrietta trottet in die Küche, steckt zwei weitere Scheiben Weißbrot in den Toaster, und nachdem sie herausgesprungen sind, bestreicht sie sie dick mit Margarine. Sie isst sie im Stehen am Fenster und sieht auf die Straße hinaus. Nach einer Weile kommt die Frau von oben aus der gemeinsamen Haustür und macht sich eilig auf den Weg zur Bushaltestelle. Sie trägt ihren blauen Mantel, und Henrietta fürchtet, dass er viel zu dünn für diese Jahreszeit ist. Henrietta macht einen Schritt zurück hinter den Vorhang, nur für den Fall, dass sich die Nachbarin umdreht, doch das tut sie nie. Sie ist immer so in Eile.
Henrietta und die Frau von oben kommunizieren ausschließlich über Notizzettel oder Textnachrichten. Henrietta bevorzugt Erstere, die sie in sauberer Schreibschrift verfasst und unter der Wohnungstür durchschiebt. Die Frau von oben beantwortet sie per SMS. Die Nachrichten lauten in etwa: »Ihre Biotonne steht auf dem Gehweg. Kein schöner Anblick. Bitte umgehend entfernen« (Henrietta). Oder: »Ihr Hund klang einsam. Habe den Ersatzschlüssel benutzt, um ihn in den Hof zu lassen. Hoffe, das war okay« (Frau von oben).
Wie bestellt kommt Dave in der Hoffnung auf weitere Brotkrusten hereingetappt. Er hat definitiv wieder angefangen, schlecht zu riechen. Henrietta ist sich nicht sicher, ob es von den Ohren oder den Analdrüsen kommt. Sie seufzt. Wie auch immer, es ist Zeit für seinen Spaziergang. Henrietta schlüpft in ihre Crocs und bückt sich, um ihn anzuleinen. Es ist eine besondere, orangefarbene Leine mit dem Aufdruck TIERSCHUTZ auf der gesamten Länge. Das sichert ihnen manchen wohlwollenden Blick, wenn Dave bellend und schnappend die Straßen attackiert, weil er – in unbestimmter Reihenfolge – Radfahrer, Fußgänger, Kinderwagen, Skateboards, Katzen, Labradore und Deutsche Schäferhunde verabscheut. Genau genommen so gut wie alle Hunde. Als Nächstes zieht Henrietta ihm eine fluoreszierende Hundejacke über den Kopf und macht den Klettverschluss zu. Die Beschriftung hier lautet: BITTE NICHT BEACHTEN.
»Auf geht’s, Gassi!«, trällert sie ohne Überzeugung. Dave scharrt bereits mit den Krallen am Laminat, und in seiner Kehle baut sich ein tiefes Knurren auf. Als sie die Haustür aufzieht, hebt Daves wütendes Bellen an, ein Geräusch, das zweifellos mittlerweile jedem einzelnen Nachbarn vertraut ist. Das Bellen schwillt weiter an, als sie die Straße hinuntergehen – eine Frau und ihr Hund gegen den Rest der Welt.
Henriettas neue Stelle bedeutet einen Abstieg, aber sie wird ihr in vielerlei Hinsicht entgegenkommen. Es wird weder Teamziele noch Teambildungsmaßnahmen geben, und Tote können vom Grab aus immerhin keine offiziellen Beschwerden wegen »bedrohlichen und einschüchternden Verhaltens« einlegen. Die Menschen, denen sie begegnet, werden nicht mehr lange da sein – und Henrietta muss nichts tun, als ihre weitschweifenden, vermutlich einigermaßen ermüdenden Erinnerungen mitschreiben, sie in chronologische Reihenfolge bringen und ein Buch daraus machen. Die Beratungsambulanz macht ihr Geschäft mit dem Tod, und Henrietta ist ausgesprochen froh, dass das Geschäft boomt.
Kapitel 2
Annie
Nachts, wenn die Schlaftabletten Annie in ihren samtenen Griff ziehen, kann sie vergessen, dass sie sterben wird. In mancherlei Hinsicht erscheint es ihr falsch – eigentlich sollte sie doch versuchen, wach zu bleiben, sollte sich oscarprämierte Filme ansehen, bedeutende literarische Werke lesen, sich Opern anhören. Nun, Letzteres wäre eine Premiere, denkt sie.
Sie weiß, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, und trotzdem sehnt sie sich vom ersten Moment nach dem Aufwachen, bis es Zeit ist, ins Bett zu gehen, nach Schlaf. Sie weiß es zu schätzen, wenn der Dämmerzustand sie empfängt und sie kurz davor ist, ins Vergessen zu gleiten.
Mittlerweile verschreibt ihr der Arzt die Tabletten sehr großzügig. Als gäbe es kein Morgen, haha. Doch inzwischen empfindet Annie sogar ihre Träume als abgenutzt und ermüdend. Ihr Gehirn ist wie ein Plattenspieler, der immer wieder die alten Stücke abspielt, und gleich darauf holpert die Nadel über die Rillen und kehrt an den Start zurück.
Manchmal ist sie im Haus am Chaucer Drive, wo sie mit Terry gelebt hat, nachdem sie geheiratet hatten. Sie sieht die Holzmaserung an den Küchenwänden, den gelben Wasserkessel mit den Brandflecken an den Seiten. Oder sie träumt vom Wohnzimmer ihrer Eltern in der Dynevor Road mit dem zottigen Teppich, auf den man nicht treten durfte. Auf Zehenspitzen tippelten sie und Kath in ihren besten Sonntagssöckchen an den Rändern des Zimmers entlang.
Am häufigsten aber bestehen ihre Träume aus viel Wasser. Endlose Massen davon, schnell fließend und mit Algenfäden, die unter der Oberfläche treiben. Darunter ist dunkler, brackiger Schlamm. Die Erinnerung an all das reißende schmutzige Wasser bleibt haften, wenn sie aufwacht und ihr bewusst wird, dass sie noch lebt.
Um diese Zeit kurz vor dem Morgengrauen wird sie oft wach. Die Stimmung draußen ist stiller und weicher, und mittlerweile gibt es niemanden, der bemerken würde, wann sie aufsteht oder ob sie einen nassen Fleck auf der Matratze hinterlassen hat und ihr das Nachthemd an den Beinen klebt. Die Wasserträume machen die Sache nicht besser, denkt sie.
In der Küche knipst sie den Schalter am Wasserkocher an, und er erwacht zum Leben. Sie hängt einen Teebeutel in eine Tasse, reiht die Tabletten auf und wartet. Annie nimmt den Tee gern mit zurück ins Bett, das macht sie, seit Terry vor zwei Jahren gestorben ist. Oh, was war es für ein Gefühl von Freiheit, als sie die erste Nacht in ihrem brandneuen Bett Arme und Beine ausstrecken konnte, ohne Sorge zu haben, an seine harten knochigen Schienbeine und seinen unnachgiebigen Rücken zu stoßen.
Als sie diese kleine Wohnung bezog, waren Bett, Zimmer, das alles ganz allein ihres, unbefleckt von seiner Gegenwart. Was für ein Pech, dass sie sich nicht mehr lange daran freuen wird, auch wenn die Pflegerinnen ausweichende Antworten auf die Frage geben, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Sie wollte doch nichts als eine grobe Schätzung – Wochen, Monate? – und nicht die Gewinnzahlen der Lotterie.
Mit beiden Händen umfasst sie die Teetasse und nippt vorsichtig. Sie hat das sichere Gefühl, dass heute ein wichtiger Tag ist, aber sie mag sich täuschen. Sie neigt den Kopf zur Seite. Ihr linkes Ohr, das schlechte, geht kurzzeitig auf, und sie hört die Müllabfuhr die Straße heraufrumpeln. Mittwoch also.
Es war einfacher, die Zeit herumzukriegen, als sie noch im Krankenhaus war und Untersuchungen gemacht wurden. »Nicht der beste Krebs«, hatte der Arzt gesagt, als habe sie auf ein schlechtes Pferd gesetzt. »Gehen Sie nach Hause, verbringen Sie Zeit mit den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, und machen Sie Ihren Frieden.« Um seinen Hals wand sich ein Stethoskop, das er ständig zur eigenen Vergewisserung betastete, und er schien den Tränen nahe. Es wäre ihr grausam vorgekommen, ihm zu erklären, dass zu Hause niemand wartete und sie als Einzige übrig geblieben war.
Jetzt, wo sie wieder in der eigenen Wohnung ist, denkt sie gern daran, wie es war, in dem reinlichen Weiß auf der Station aufzuwachen. Um sieben Uhr das Rattern der Servierwagen, dann das Geplauder und die quietschenden Schuhe auf den Korridoren, wenn die Pfleger kamen und gingen. Mia, die junge Frau, die das Café führt, brachte den Tee vorbei. In ihrem Sortiment hatte sie auch Schreibwaren: Notizblöcke, Grußkarten, Malbücher und Filzstifte. Mia war es gewesen, die ihr den Prospekt über die Sache mit den Lebensgeschichten gegeben hatte. Anfangs hatte es Annie für eine alberne Idee gehalten, aber Mia hatte nicht lockergelassen.
»Annie, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen«, hatte sie gesagt, während sie auf Annies Bettkante saß. »Es geht doch auch um die Geschichte unserer Gesellschaft. Erzählen Sie, wie es wirklich war, in den Siebzigern in London jung zu sein! Waren Sie eine Glam-Rockerin oder ein Hippiemädchen? Eine Emanze?«
O doch, ich habe durchaus etwas zu erzählen, dachte Annie, aber sie war sich nicht sicher, ob es das war, was Mia im Sinn hatte. Sie hatte trotzdem ein Notizbuch gekauft, das kleinste, das Mia im Angebot hatte. Auf dem Umschlag sind Narzissen, und nun liegt es hier auf dem Küchentisch und wartet immer noch auf Annies Worte.
Der kostenlose Minibus, der sie zur Rosendale-Ambulanz bringen soll, kommt erst am Samstag, aber sie sollte wohl besser schon einmal anfangen. Sie hat die Dinge so lange für sich behalten und hofft, dass es ihr ein wenig Erleichterung bringt, wenn sie davon erzählt. Es ist an der Zeit, ein paar Wahrheiten auszusprechen, nicht alles vielleicht, aber genug, um ihr etwas von der Last zu nehmen. Sie sollte ihren Frieden machen, wie der Arzt gesagt hatte.
Später holt Annie die Fotoalben heraus, weil Mia erklärt hat, dass man auch Bilder in die Bücher mit aufnehmen kann. Sie beginnt mit dem alten Familienalbum der Doyles, das sie auswendig kennt. Es beginnt mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von der Hochzeit ihrer Eltern, auf denen alle wie Wachsfiguren aufgereiht sind, und endet mit verwackelten Bildern von ihr selbst und Kath, wie sie am Strand sitzen, während sich rechts von ihnen der Horizont gefährlich auftürmt.
Als Annie die letzte Seite umblättert, gleitet ein kleiner Umschlag auf ihren Schoß, einer von der Art, wie sie Blumenhändler in einen Strauß stecken, und für so etwas hält Annie ihn zunächst. Womöglich ist es ein besonderer Geburtstagsgruß, der aufgehoben wurde. Doch kaum hat sie den Umschlag geöffnet, ist klar, dass es nichts dergleichen ist.
Da steht die wunderbare Kath neben ihrem Fahrrad auf dem Gehweg zu dem Reihenhaus in der Dynevor Road. Sie hatte gerade die Stelle im Schuhladen bekommen und fuhr mit dem Fahrrad hin und her, um sich das Geld für den Bus zu sparen. Tick, tick, tick klickten die Räder jeden Morgen, wenn sie es auf den Gehsteig hinausschob. Und dann fuhr sie los, stellte sich in die Pedale, um es über die Hügelkuppe zu schaffen.
Auf der Rückseite des Fotos klebt ein offiziell wirkendes Formular. Annie faltet es auseinander. Die Handschrift kennt sie nicht, aber der Text ist ihr vertraut. In enger, sauberer Schrift steht da:
Kathleen Doyle, 18 Jahre. Frische Gesichtsfarbe. Haar dunkelbraun bis schwarz. Hellbraune Augen. Bekleidet mit einer braunen Wildlederjacke mit Fellbesatz, einem gelben Kleid, gestreiftem Schal und schwarzen Lederstiefeln. Körpergröße 1,67 m. Zuletzt gesehen am 21. Dezember 1974 um 17 Uhr.
Die Polizei hatte dieses winzige Foto mitgenommen, daran erinnert sie sich. Sie hatten etwas für ihre Leute gebraucht, hieß es, eine Personenbeschreibung, die sie verbreiten konnten.
Kaths Kleider hatte man am Ufer des Grand Union Canal gefunden, ordentlich zusammengelegt und aufeinandergeschichtet. Erst viel später hatte man sie ihnen in einer braunen Papiertüte zurückgegeben; der flauschige Pelzkragen am Mantel war vom Schlamm verkrustet, der mittlerweile bröckelig und trocken war.
Annie erinnert sich nicht, wann man ihnen das Foto zurückgegeben hat, vielleicht war das erst Monate später geschehen, als die Suche offiziell aufgegeben worden war. Vermutlich hatte man es ihrem Dad überreicht, von Mann zu Mann, während Annie auf der Arbeit gewesen war und ihre Mutter einen ihrer schlechten Tage hatte.
Sie zieht das Formularblatt ab, schiebt das Foto zurück in den Umschlag und legt ihn wieder zwischen die brüchigen Zellophanseiten. Es kommt ihr vor, als wäre das alles erst gestern passiert, gleichzeitig aber Ewigkeiten her. Wenn Annie heute in den Spiegel sieht, wundert sie sich über das Gesicht, das ihr entgegenblickt. Das Haar ist völlig ergraut, die Haut von Linien durchfurcht, die alle nach unten weisen. Auf andere Leute wirkt sie vermutlich wie eine alte Frau. Eine mit herzerwärmenden Anekdoten, die sich lächelnd liebevollen, verschwommenen Erinnerungen hingibt.
Ihr ist bewusst, dass die Leute in der Rosendale-Ambulanz mit so etwas rechnen: die nette Geschichte einer netten alten Dame. Wenn ihr Leben doch nur so gewesen wäre, denkt Annie, voller Sonnenschein und Lächeln und in dem sich alles hübsch fügt.
Leider trifft das auf Annie Doyle nicht zu, also wird sie nächsten Samstag den kostenlosen Minibus zur Rosendale-Ambulanz nehmen und anfangen, ihre Geschichte so gut es eben geht zu erzählen.
Kapitel 3
Henrietta
»Sollten Sie dabei sein, wenn es zu Ende geht, dann rechnen Sie nicht damit, dass es ist wie im Fernsehen«, sagt Audrey. Nur wenig ist so wie im Fernsehen, denkt Henrietta, doch das behält sie für sich. Die Frau redet gern, und solche Leute mögen es nicht, wenn man sie unterbricht.
Sie ist für »ein kleines Begrüßungsgespräch« in Audreys Büro, aber Henrietta wäre viel lieber unten im Café, um mit der Arbeit loszulegen. Seit sechs Uhr früh ist sie auf, um Dave auf einem Morgenspaziergang durch die dunklen nassen Straßen zu scheuchen, der nicht gerade erfreut war.
»Wir werden nicht oft ans Bett gerufen, aber hin und wieder bittet man uns auf die Station, um eine Geschichte fertigzustellen. Die letzten Worte, allerdings …« Audrey seufzt. »Sie sind nicht immer, was man sich erwartet.«
Audrey legt eine kurze Pause ein, verschränkt die Finger und beugt sich über den Schreibtisch. »Ein Mann trug der versammelten Familie Wettquoten vor. Eine Frau setzte sich im Bett auf und sagte: ›Ich habe ihn nie geliebt.‹ Das hat eine Menge Spekulationen und Ärger verursacht. Deswegen gibt es uns. Um alles klarzustellen und schwarz auf weiß festzuhalten, bevor es zu spät ist.«
Audrey, die heute einen anderen rosa Pullover trägt, der eher in Richtung Magenta geht, fügt hinzu: »Aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass man ans Bett gerufen wird. Sie werden den größten Teil der Zeit im Café Leben sein, und die Klienten kommen zu Ihnen. Einige wenige sind Krankenhauspatienten, aber die meisten sind Tagesbesucher in der Ambulanz.«
In Henriettas Ohren klingt das alles etwas planlos, und sie fragt sich, ob sie vorschlagen sollte, ein System mit festen Terminen einzurichten. Ein Formular könnte den körperlichen Zustand, die Krebsstufe, Lebenserwartung et cetera abfragen, um Leute mit weniger Zeit zu priorisieren. Und jenen, die ein eher prosaisches Leben geführt hatten, könnte man kürzere Termine einräumen …
Doch Henrietta hat einen entscheidenden Wendepunkt in der Unterhaltung verpasst, denn Audrey steht auf, und es geht los. Henrietta tastet nach dem Rucksack unter dem Stuhl und folgt ihrer Chefin hinaus auf den Gang. Es ist nicht einfach, mit Audrey Schritt zu halten, die Profi darin ist, gleichzeitig zu gehen und zu reden.
»Manchmal werden wir vom Partner, von einem Sohn oder einer Tochter kontaktiert«, fährt sie fort und blickt über die Schulter zu Henrietta, die ein paar hastige Hüpfer einlegt, um aufzuholen. »Manche haben Ryan Brooks im Fernsehen gesehen, oder sie sind regelmäßige Cafébesucher und haben von den Interviews mitgekriegt. Oft kommen Leute auch nur vorbei, um zu erfahren, worum es bei der ganzen Sache überhaupt geht«, erklärt sie fröhlich.
Plötzlich bleibt Audrey stehen, und Henrietta bemerkt, dass sie am Café angelangt sind. Auf einem Ecktisch steht ein laminiertes Schild mit dem Hinweis Reserviert. Ein weiteres glänzendes Pappschild hängt an der Wand, auf dem steht: Lebensgeschichten – denn jeder Mensch hat eine. Offensichtlich ist Audrey ein echtes Ass am Laminiergerät.
Um zu signalisieren, dass sie bereit ist, mit der Arbeit anzufangen, packt Henrietta ihren Rucksack aus. Er enthält ein Federmäppchen, eine Brotdose (ein Käsesandwich mit sauren Gurken, Chips und ein KitKat), ihre Thermosflasche mit Schottenmuster und das kostenlose Anzeigenblättchen von heute. Und seit eben einen Packen Fragebogen des Projekts, einen Notizblock und ein Diensthandy, um die Interviews aufzuzeichnen.
Audrey betrachtet die Gegenstände, räuspert sich und redet weiter. »Also, um es zusammenzufassen: Jedem Klienten stehen etwa sieben Sitzungen zur Verfügung, die jeweils ungefähr eine Stunde dauern. Manche wünschen sich mehr, andere schaffen es in weniger. Manche Klienten … nun ja, da müssen wir die Sache so gut es geht unter Dach und Fach bringen.«
»An den Vormittagen führen Sie die Interviews, und nachmittags verschriften und redigieren Sie die Texte und kopieren sie in die Buchvorlage. Die Vorlage hat vorgegebene Kapitelunterteilungen, damit alles seine Ordnung hat.« An dieser Stelle lässt Audrey ein knappes Lächeln sehen. »Alles klar?«
Henrietta ist mit allem, was sie gehört hat, einverstanden. »Vollkommen klar, danke. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.«
Zwanzig Minuten später sitzt sie immer noch allein am selben Fleck und kommt sich etwas dämlich vor. Ihr Terminkalender ist bis elf Uhr leer, und niemand ist einfach »hereingeschneit«, wie Audrey angekündigt hat. Wird diese Arbeit so eine Art Aneinanderreihung kurzer, gescheiterter Blind Dates? Nicht, dass sie jemals eines gehabt hätte. Es ist ihr ein immerwährendes Rätsel, warum irgendjemand sich freiwillig einer derart unangenehmen und zwecklosen Erfahrung aussetzt.
Auf dem Fernsehbildschirm an der Wand läuft in Endlosschleife ein Video von Ryan Brooks, unterbrochen von Werbespots für Bestattungsvorsorge und private Gesundheitsleistungen. Ein Spot, der für die Entfernung von Krampfadern wirbt, ist ganz besonders unappetitlich. Unterdessen preist Ryan weiter die Vorzüge des Lebensbuch-Projekts an. »Ihre Erinnerungen werden weiterleben und anderen Menschen Trost spenden. Suchen Sie eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe auf«, regt er an. Die Londoner Zweigstelle allerdings scheint an diesem Samstagvormittag einen peinlichen Mangel an Kundschaft aufzuweisen.
Immer wieder hat Henrietta unauffällige Schlucke aus dem Kaffeebecher ihrer Thermosflasche genommen, doch als sie einen dünnen, großen Mann auf ihren Tisch zukommen sieht, schraubt sie den Deckel schnell wieder darauf. Zu ihrer Enttäuschung stellt sich heraus, dass er gar kein echter Klient ist; er ist nicht einmal krank.
»Ich habe eben meinen Bruder hier abgesetzt. Er hat oben einen Beratungstermin«, sagt der Mann und deutet auf die Aufzüge. »Aber ich weiß nie, was er dort so erzählt. Im Fernsehen habe ich die Sache mit den Lebensgeschichten gesehen und dachte, es wäre schön, wenn Cody ein Buch macht. Sie wissen schon, damit wir es uns … danach ansehen können.« Ihm bricht die Stimme, er wendet sich ab und bedankt sich noch nicht einmal für den Prospekt.
Eine ältere Frau hält das für den geeigneten Zeitpunkt, sich dem Tisch zu nähern. Sie hat schon eine Weile an einem Nachbartisch gesessen, eingewickelt in einen zu großen Morgenmantel, also vermutet Henrietta, dass sie stationäre Krankenhauspatientin ist. Doch auch sie will sich nicht hinsetzen. Stattdessen stützt sie sich mit der blau geäderten Hand auf dem Tisch ab und fixiert Henrietta. »Ich habe meine Geschichte mit dem Mädchen vor Ihnen gemacht«, zischelt sie. »Aber ich bin nicht zufrieden damit.«
Henrietta durchforstet ihr geistiges Archiv nach einer Antwort, aber dort ist kein passendes Beispiel zu finden, denn weder Audrey noch sie haben mit Stammkundschaft gerechnet. »Oh?«, ist alles, was sie herausbringt.
»Ja. Ist ja alles ganz hübsch mit der goldenen Schrift auf dem Umschlag, aber sie hat die Hälfte von dem, was ich erzählt habe, weggelassen. Hat nur die schönen Sachen aufgeschrieben, wie ein Märchen. Außerdem hat sie meinen zweiten Vornamen falsch geschrieben. Ich heiße Lesley mit ›y‹, nicht Leslie mit ›ie‹.«
Bei diesen Worten lächelt Henrietta erleichtert. »Ich verstehe Sie sehr gut«, sagt sie. »Solche Fehler sind nicht zu entschuldigen. Die eine ist die weibliche Version, die andere die männliche. Wie bei Leslie Phillips.« Henrietta greift nach einem Fragebogen. »Das können wir bestimmt richtigstellen. Zusammen können wir Ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Noch einmal. Denn jeder Mensch hat eine.«
»Nein, nein, das geht nicht«, antwortet die Frau und zieht die Kordel an ihrem Morgenmantel fester zu. »Ich wollte es nur sagen. Und sie hat ununterbrochen geweint, das Mädchen vor Ihnen. Das hat mich runtergezogen, verstehen Sie?«
Sie wendet sich zum Gehen und kratzt sich am Kopf, als wolle sie diese verdrießlichen Gedanken fortwischen, und hält dann inne. »Es hat einfach überhaupt nicht nach mir geklungen, so wie sie es geschrieben hat.« Ihre Stimme wird wütend. »Es sollte doch etwas für meine Familie sein, damit sie wissen, wie es für unsere Generation war. Jetzt wünschte ich, ich hätte es gar nicht gemacht.« Und bevor Henrietta eine Antwort geben kann, ist sie fort.
Henrietta überlegt immer noch, wie eine passende Antwort lauten könnte, als sich die Schiebetüren öffnen und eine bunt zusammengewürfelte Gruppe hereinkommt – einer davon wird doch sicher ihr Elf-Uhr-Termin sein.
Der Erste ist ein junger Mann im Rollstuhl, der von einer Frau in lila Fleecejacke und mit verzücktem Gesichtsausdruck geschoben wird. Henrietta ist diesem Typ Mensch schon begegnet – als Ehrenamtliche in Wohlfahrtsläden und Wichtigtuerinnen beim Kuchenbasar der Kirche. Der Mann im Rollstuhl wirkt extrem wütend und trägt eine Wollmütze, die er über die Ohren gezogen hat. Henrietta dämmert, dass es vermutlich daran liegt, dass er darunter keine Haare mehr hat, und sie ist noch mit dieser Erkenntnis beschäftigt, als ihr bewusst wird, dass ein Paar karierte Hosen vor ihr steht.
Eine hochgewachsene strenge Frau ragt über ihr. Das weite weiße Leinenhemd hat sie mit einem Gürtel mit großer Schnalle zusammengefasst, und auf dem Kopf sitzt eine schwarze Baskenmütze mit abgewetzter Lederkante. Der Kleidungsstil hat etwas von einem Piraten; glücklicherweise trägt sie keine Augenklappe. Stattdessen sieht man zwei helle Augen, eingefallene Wangen und einen Lippenstiftstrich in einer unnatürlich leuchtenden Farbe.
Henrietta kann den Blick nicht von der Frau und ihrem Lippenstift abwenden, der von feinen Rissen durchzogen wird, als ihr Mund anfängt, sich zu bewegen.
»Hallo, ich bin Annie Doyle. Ihr Elf-Uhr-Termin«, verkündet sie.
Dankenswerterweise kommt in ebendiesem Moment die junge Frau, die das Café führt, herbei und beginnt, mit Tassen, Zuckerdosen und einem Bakewell-Törtchen herumzuhantieren. All das ist für jene Annie Doyle gedacht, doch machen sich Teile des Geschirrs auf Henriettas Schriftstücken breit. Mit der Kante ihres Klemmbretts schiebt Henrietta die Tasse und den Teller ein paar entscheidende Zentimeter aus dem vorgesehenen Arbeitsbereich.
»Guten Morgen. Mein Name ist Henrietta Lockwood. Ich arbeite für das Projekt Lebensbuch. Wir werden gemeinsam Ihre Geschichte aufschreiben, denn jeder Mensch hat eine«, sagt sie hastig.
Annie seufzt. »Lesen Sie das von einem Skript ab?«, fragt sie. »Sie klingen wie aus einem dieser Prospekte.«
»Nein, so rede ich immer«, erwidert Henrietta. »Also. Unserer Erfahrung nach hat sich der Fragebogen als praktisches Gerüst erwiesen, um sich an die wichtigen Momente in Ihrem Leben zu erinnern.« Sie schiebt ein Blatt über den Tisch.
Nachdem sie die vorangegangene Stunde damit zugebracht hat, so zu tun, als sei sie in dieses Formular vertieft, kennt Henrietta die Fragen auswendig.
Wann und wo sind Sie geboren?
Haben/Hatten Sie Geschwister/Haustiere?
Erzählen Sie über Ihre Schulzeit. Was für Spiele haben Sie beispielsweise gespielt?
Welchen Beruf haben/hatten Sie?
Sind/Waren Sie verheiratet?
Haben Sie Kinder?
Gibt es Fotos, die ins Buch aufgenommen werden sollen?
Zugegeben, die Fragen sind nicht gerade inspirierend. »Ein praktisches Gerüst«, wiederholt Henrietta, diesmal nicht mehr ganz so überzeugt.
»Eigentlich habe ich mir selbst ein paar Notizen gemacht«, sagt Annie.
Aber Henrietta hat ein Formular auszufüllen. »Vielleicht können wir einfach mit diesen Fragen anfangen …«, setzt sie an. »Und nächste Woche können Sie dann ein paar Fotos mitbringen.«
Annie Doyle fährt die Fragen mit dem Finger ab und fängt an, ein paar Antworten herunterzuspulen. »Hm. Also dann. Geboren: ja, Hammersmith Hospital, 1955. Ja, eine Schwester. Schulzeit: ja. Arbeit: im Kindergarten. Verheiratet: ja, August 1975. Mittlerweile verwitwet, nach einem bedauerlichen Unfall. Kinder: nein. Fotos: Mal sehen, was ich finde.«
Sie schiebt den Fragebogen zurück über den Tisch und schenkt Henrietta ein ironisches Lächeln. »Jetzt, wo das erledigt ist, schlage ich vor, dass ich Ihnen vorlese, was ich vorbereitet habe. Immerhin ist es meine Geschichte.«
Das Letzte, was Henrietta an ihrem ersten Tag im Café Leben gebrauchen kann, ist, dass jemand eine Szene macht, also fügt sie sich. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sie Gelegenheit finden, das Formular noch einmal unauffällig zur Sprache zu bringen. Sie platziert das Handy in der Nähe ihrer Interviewpartnerin und tippt auf den roten Kreis auf dem Bildschirm. »Wie Sie wünschen. Annie Doyle, heute ist Samstag, der 6. November, und das ist die Aufnahme der ersten Sitzung Ihrer Lebensgeschichte.«
Annie zieht einen Spiralblock mit gelben Narzissen auf dem Umschlag heraus, schlägt die erste Seite auf und fängt an vorzulesen.
»Ich bin in einem armen Stadtviertel von London aufgewachsen, das mittlerweile sehr reich geworden ist. Mein Vater Aidan war Ire, meine Mutter Deidre wurde in Kilburn als Tochter von Iren geboren. Ich bin nie in Irland gewesen und denke, jetzt ist es zu spät für mich. Es ist schade, dass ich es nie sehen werde.«
Sie hält den Notizblock dicht vors Gesicht, dann auf Armeslänge von sich gestreckt und kneift die Augen zusammen.
»Ich wurde im September 1955 geboren, und meine Eltern freuten sich über ihre Tochter. Sie hatten ein weiteres Mal Glück, als elf Monate später eine zweite Tochter geboren wurde. Meine Schwester hieß Kathleen, und wir hatten eine ganz normale Kindheit. Wir gingen beide in die Grundschule St Mary’s und besuchten dieselbe Klasse. Ich gewann einen Preis im Handarbeiten, Kath sang im Chor. Später wechselten wir an die neue Gesamtschule. Wir waren nicht schlecht in der Schule und machten beide einen O-Level-Abschluss. Wir mochten Musik, Mode und gingen gerne aus. Manche Leute hielten uns für Zwillinge, weil wir oft dieselben Kleider trugen.
Mit neunzehn heiratete ich Terry. Trauzeugin war meine Cousine Edie, weil Kath an Weihnachten zuvor leider gestorben war, mutmaßlich ertrunken. Nach unserer Hochzeit zogen Terry und ich in ein Haus aus dem sozialen Wohnungsbau im Chaucer Drive draußen in der Vorstadt. Terry war Handelsvertreter für eine Druckerei und beruflich viel unterwegs. Ich arbeitete in einem Kindergarten und wurde später die Leiterin. Wir hatten leider nicht das Glück, eigene Kinder zu haben.« Annie leckt an einem Finger und blättert zur nächsten Seite.
Langsam beugt sich Henrietta nach vorn und tippt auf dem Handydisplay auf Pause.
»Augenblick«, meint sie. »Ihre Schwester. Was, sagten Sie, ist passiert?«
Kapitel 4
Annie
Die Schmerzen sind wieder da, strahlen von tief innen aus, doch Annie hält sich so aufrecht wie möglich, als sie das Café verlässt. Diese Neue, Henrietta, die mit ihren Formularen und dem Handy herumwedelt, hat wirklich keinerlei Manieren. Und diese Fragen! Mia hatte ihr nicht gesagt, dass es so sein würde. Verdammte Mia, mit ihren ewigen Teetassen und Bakewell-Törtchen. Hatten Sie Geschwister? Haben Sie Kinder? Oberflächlich betrachtet waren es ganz unverfängliche Fragen, aber für Annie gingen sie weit über die Schmerzgrenze hinaus.
Als Annie dann begonnen hatte, ihren eigenen Text vorzulesen, wurde es noch schlimmer. Wie erbärmlich, nach einem ganzen Leben nicht mehr vorweisen zu können, sagte die Miene der Frau mit ihrem leeren, verständnislosen Blick. Doch plötzlich hatte sie ohne Vorwarnung angefangen, sie über Kath auszufragen, und Annie war absolut nicht bereit gewesen, über diese speziellen Erinnerungen zu reden.
Also hatte sie erklärt, sie brauche frische Luft, und das war nicht gelogen, denn beim Aufstehen wurde ihr bewusst, dass sie es keine Minute länger in diesem Café mit dem abgestandenen Tee und all den traurigen Menschen aushielt. Deshalb steht sie jetzt draußen, doch bis der Minibus kommt, ist es noch Ewigkeiten hin, und ihr Herz rast, und sie hat wieder dieses schwindelerregende Klingeln in den Ohren.
Annie nimmt sich Zeit, als sie die Rampe hinuntergeht. Die Kälte verschlimmert die Magenschmerzen, und sie krümmt sich, um das Biest, das sich dort drinnen eingenistet hat, nicht aufzuschrecken. Es wäre nicht schlecht, sich hinzusetzen, auf der anderen Straßenseite steht sogar eine Bank, aber ihr ist klar, dass sie zu weit weg ist. Stattdessen lehnt sie sich an die Hausmauer und atmet tief ein und aus, so wie es die Yogalehrerin erklärt hat: »Atmet wie die Wellen auf dem Meer. Ein und aus.«
Später, als die Leute für den Minibus herausgetrudelt kommen, hat sich Annies Herzschlag beinahe normalisiert. Zuerst kommt Nora mit dem straff sitzenden Kopftuch. Dann Stefan, der immer noch von dieser rechthaberischen Bonnie in ihrer lila Fleecejacke geschoben wird. Er sieht schlecht aus heute, sein Gesicht glänzt, und er hebt grüßend die Hand, als er vorbeikommt. Er dürfte kaum älter als dreißig sein, denkt Annie.
Im dichten Verkehr muss der Minibus ständig abrupt abbremsen und anfahren und kommt neben Lieferwagen, Uber-Taxis und SUVs zum Stehen. Die meisten Leute telefonieren am Handy oder reden vor sich hin, also sind sie vermutlich ebenfalls am Telefon, nur dass sie nicht am Steuer damit herumhantieren. Annie sitzt im Bus immer hinten für sich. Das Polster der Armstütze reizt ihre Haut, und sie legt die Hände in den Schoß. Sie bemerkt, dass ihre Nägel abblättern, überall zeigen sich weiße Punkte. Ich löse mich auf, denkt sie.
In der Spur neben ihnen schiebt sich ein weißer Toyota Prius nach vorn, der Fahrer ist fast auf derselben Höhe wie Annie. Er ist jung, hat kurz geschnittenes Haar und einen spitzen kleinen Bart: Er ist ein gut aussehender Mann. Annie fragt sich, wie viel er in der Stunde verdient, ob es das wert ist, ob er eine Frau hat und ob er sie liebt. Der Mann sieht zu ihr herüber und wendet sich wieder ab: Hier gibt es nichts zu sehen.
Annie möchte den Kopf gegen die Scheibe schlagen und ihn anschreien: »In deinen Augen bin ich bloß eine alte Frau, aber früher haben sich die Männer nach mir umgedreht. Ich hätte jeden haben können. Jeden. Wenn ich mich nicht auf Terry eingelassen hätte.«
Natürlich tut sie nichts dergleichen. Sie macht die Augen zu und wartet, dass der Stau sich vorwärtsbewegt. Kein Wunder, dass diese Henrietta so enttäuscht von Annies Antworten war. Ihr Gesicht drückte aus, was Annie längst wusste: Es war ein vergeudetes Leben. Als sie jünger war, hätte sie nie damit gerechnet, dass es einmal so enden würde: dass sie einsam sterben würde, ohne Kinder, ohne Familie. An welchem Punkt war es derart schiefgegangen?
Annie hat plötzlich ein deutliches Bild vor Augen, wie Kath und sie selbst an der Schwingtür des Castle Pub stehen. Das Kupferblech am Türgriff, die glänzende braune Farbe. Sie haben die gleichen Kleider an, die gerade so bis zum Oberschenkel reichen. Das von Annie ist grün, das von Kath zitronengelb. Sie tragen Wildlederjacken mit Gürtel und Kunstpelzkragen und kniehohe Stiefel, die sie in Kaths Schuhgeschäft mit Rabatt bekommen haben. Annie erinnert sich an den Rauch, den Bierdunst und den auf sie hereinstürzenden Lärm, als sie die Schwingtüren aufschoben. An der Tür warteten sie immer einen kurzen Augenblick ab, damit die Leute aufsahen und sie bemerkten und den beiden Schwestern mit Blicken folgten, wenn sie sich ihren Weg zur Bar bahnten.
Sie hatten sich einen Namen gegeben: Annie und Kath, die Doyle-Mädchen, gerade mal elf Monate auseinander und beide bildhübsch. Als sie klein waren, hatte ihre Mutter ihnen identische Kleider mit Puffärmeln und Bubikragen genäht. Abwechselnd stellten sich die Schwestern auf einen Stuhl, während die Mutter, eine Reihe Stecknadeln fest zwischen die Lippen gepresst, Änderungen vornahm. Ihre Aufgabe war es, sich so langsam wie möglich im Kreis zu drehen, damit Mum sehen konnte, ob der Saum gerade war; wenn sie sich zu schnell drehten, handelten sie sich einen Klaps auf die Unterschenkel ein.
Annie gefiel es, die Mutter zur Abwechslung zu überragen. Sie blickte auf die schwarzen Locken hinab und konnte erkennen, dass sich still und leise die ersten weißen Ansätze zeigten. Kath hingegen war ungeduldig und stöhnte und machte einen krummen Rücken, mit dem Effekt, dass sie Klapse auf den Unterschenkel und ein Festtagskleid mit schiefem Saum bekam.
Als Teenager hatten sie die Tradition, zueinanderpassende Kleider zu tragen, wieder aufleben lassen, jetzt aber waren die Säume kürzer, und sie nahmen eigenständig Änderungen vor. Manchmal teilten sie sich auch Kleider.
Doch hier schleicht sich eine schlechte Erinnerung ein, an jenes Mal, als Kath das gelbe Kleid auszog, es auf den Boden warf, fluchte und dagegentrat. Ihr Gesicht war verzerrt und die Frisur zerstört. »Ich hasse dieses Kleid. Warum sollen wir immer zusammenpassen? Ich mache das nicht mehr mit.«
Genau das ist das Problem mit Annies Erinnerungen: Bei jeder schönen Erinnerung, über die sie gern reden würde, schlüpft unversehens eine unangenehme herein und munkelt von den schlechten Tagen.
Als Erstes setzt der Minibus Stefan ab, und es ist ein ziemliches Hin und Her, bis Rampe, Rollstuhl und alles andere bereit sind. Während es rumpelt und scheppert, plaudert er mit Annie und Nora, als ginge ihn das, was unterhalb seiner Taille geschieht, gar nichts an. »Nun, meine Damen, sehen wir uns nächste Woche auf der Kaffeefahrt?«, fragt er. »Wenn wir dann noch da sind«, antworten beide mit demselben Witz wie immer, seit sie den kostenlosen Minibus benutzen.
Annie ist als Nächste dran. Ihre Wohnung ist ganz in der Nähe, aber der Busfahrer muss einen langen Umweg machen, durch ein Netz aus mit Bodenschwellen gespickten Einbahnstraßen. Zwar sieht sie immer wieder Tafeln mit Baugenehmigungen, aber sie nimmt sie nicht zur Kenntnis. Annie fährt nicht Auto, das hat sie nie getan, dafür war Terry zuständig, also hat sie die Einführung von Temposchwellen und Parkuhren nie gekümmert.
Heute allerdings stehen in Annies Straße die glänzenden panzerähnlichen Autos Stoßstange an Stoßstange, und der Fahrer muss vor ihrem Wohnhaus in zweiter Reihe stehen bleiben. Das niedrige Mehrfamilienhaus einer Baugenossenschaft stammt aus den 1970ern und wurde zwischen zwei hohe viktorianische Häuser gezwängt. Die vier Wohnungen im Erdgeschoss sind für Leute wie Annie vorgesehen. Sie verdankt das alles ihrem netten Hausarzt, der Mitleid mit ihr hatte, als Annie nach Terrys Tod für eine Weile nicht mehr alle Sinne beisammenhatte und man sie für einen längeren Aufenthalt auf die Briar-Krankenstation steckte.
Der Schock über Terrys Unfall hätte sie in diesen Zustand versetzt, sagte der Arzt. Es fielen Wörter wie »Zusammenbruch« und »gefährdet«. Möglicherweise hatte ihr Hausarzt einen gewissen Verdacht, was Terry anging, und fühlte sich schuldig, dass er nicht früher eingegriffen hatte.
Annie weiß noch, wie die Frau von der Wohnungsbaugenossenschaft sagte, dass sie »sehr großes Glück« gehabt habe, eine so schöne Wohnung zu bekommen. Sie hat nicht das Gefühl, besonders großes Glück zu haben, aber es tut gut, wieder in dem Viertel zu wohnen, in dem sie aufgewachsen ist, bevor Terry sie von hier fortholte. Die Atmosphäre, die Verkehrsgeräusche, all das ist vertraut.
Als sie die Wohnungstür hinter sich zuzieht, empfängt sie Stille, doch das stört sie nicht – sie empfindet den Anblick ihrer eigenen vier Wände, leer und exakt so, wie sie sie verlassen hat, immer als wohltuend. Die Wohnung ist klein, und ihr Mobiliar stammt vom billigen Ende des Portobello Market und aus Wohlfahrtsläden, weil sie nichts aus der ehelichen Wohnung mitnehmen wollte. Hier ist alles erfreulich unberührt von der Vergangenheit. Wenn überhaupt, erinnert es sie an ein Bed-&-Breakfast-Zimmer, das sie einmal bewohnt hat. Damals hatte sie es fertiggebracht, drei Nächte fortzubleiben, bevor sie zu Terry zurückkehrte und die Sache ausbaden musste.
Da niemand da ist, der ihr das ausreden könnte, geht Annie ohne Umschweife ins Bett und steckt die Beine unter die Decke, ohne die Hose auszuziehen. Sie wünscht sich sehnlichst, einzuschlafen, aber der Schlaf will nicht kommen. Sie war davon ausgegangen, dass dieses Buchprojekt mit ihrer Lebensgeschichte wesentlich einfacher werden würde – sie würde ein paar Geschichten erzählen und ein, zwei Fotos aussuchen, und das wär’s. Aber schon jetzt erscheint es komplizierter als gedacht.
Endlich spürt Annie, dass ihre Augenlider schwer werden. Sie schlingt die Arme um den Oberkörper, zieht die Decke bis ans Kinn und wartet, dass der Schlaf sie in die Tiefe zieht. Manchmal hilft der alte Trick, sich das Elternhaus in der Dynevor Road Stück für Stück auszumalen. Das Holzgatter, an dem man rütteln musste, damit es richtig zuging, der Backsteinweg und die Haustür mit der Milchglasscheibe und dem unzuverlässigen Sicherheitsschloss, das sich mit dem Schlüssel drehte, wenn man zu viel Druck ausübte.
Dann kam die Diele mit dem Telefontischchen und dem cremefarbenen Telefonapparat mit Wählscheibe, in die man den Finger steckte und bei der man warten musste, bis sie wieder an den Anfang zurückgekehrt war, bevor man die nächste Ziffer wählen konnte. Der Teppich mit den orangefarbenen, braunen und goldenen Wirbeln war an der Tür schon ganz abgetreten, sodass man das Kreuzmuster der Fäden darunter erkennen konnte. Wenn es Zeit fürs Abendessen war, roch es nach Pellkartoffeln.
Es war kein besonders fröhliches Zuhause, aber sie kann sich ohne große Mühe jede Ecke ins Gedächtnis rufen. Diesmal kommt sie gerade mal bis zum Schlafzimmer, als sie einnickt, aber die Leitungen im Hirn verheddern sich, und knisternd erwacht eine andere Erinnerung zum Leben. Ein kurzes Aufleuchten des gelben Kleids, das Seidenfutter. Eine Wildlederjacke, doch am Pelzkragen klebt jetzt dunkler Schlamm.
Annie schreckt hoch, ihr Magen krampft sich zusammen. Das Nachdenken über dieses Buch mit der Lebensgeschichte bringt all die schlimmen Erinnerungen zurück. So lange hat sie versucht, sie zu ignorieren, aber kaum wird sie unachtsam, sind sie wieder da, zwicken sie und zerren an ihr, drängen sich um sie wie hungrige Kinder. Aber mittlerweile ist Annie zu müde, ihr fehlt die Kraft, sie zur Ordnung zu rufen.
Vielleicht muss sie einfach aufhören, es zu versuchen. Stattdessen könnte sie die Erinnerungen der aufdringlichen Henrietta überantworten, die unbedingt alles ganz genau wissen will, und sie kann die Sache in die Hand nehmen und die Erinnerungen für immer und ewig zwischen zwei Buchdeckel sperren. Und vielleicht, nur vielleicht, kommt Annie dann zur Ruhe.
Annie setzt sich im Bett auf, weil der bittere Geschmack wieder da ist und ihr die Kehle hochsteigt. Als sie dem Arzt das erste Mal den Schmerz zu erklären versuchte, hörte sie sich sagen, es habe sich angefühlt, als habe jemand die ganze Nacht neben ihr gesessen und braunen Schlick in ihren Mund geschaufelt, ihr die Zunge damit zugepfropft und die Ohren verstopft. Kein Wunder, dass der Arzt ein wenig beunruhigt wirkte. Das sei absolut unmöglich, hatte er gesagt.
Trotzdem fühlt es sich genau so an: als wären ihre Innereien verschlammt und die saure Fäulnis käme ihr durch die Kehle hoch. Reflux, ermahnt sie sich, als sie wieder wegdämmert. Das hat ihr der Arzt unzählige Male erklärt. Es kann unmöglich Schlick sein.
Kapitel 5
Henrietta
Alles in allem muss Henrietta sich eingestehen, dass der erste Samstag im Café Leben kein Bombenerfolg war. Sie hatte damit gerechnet, dass alles sehr geradlinig vonstattengehen würde – dem Interviewpartner ein Formular zum Ausfüllen geben, in der Handy-App auf »Aufnahme« drücken, ein paar Notizen machen. Aber die Sache hat sich als etwas komplizierter erwiesen.
Anfangs musste sie mit einer wenig euphorischen ehemaligen Kundin fertigwerden, und diese komisch gekleidete Frau – Annie Doyle, 66, Pankreaskrebs im Endstadium – war auch nicht wesentlich unkomplizierter gewesen. Sie hatte wenig Lust auf das Formular gehabt, und als Henrietta ihr eine vollkommen vernünftige Frage gestellt hatte, hatte sie ganz dichtgemacht. Offen gestanden war Henrietta erleichtert gewesen, als Annie, ohne sich auch nur zu bedanken, ihren Mantel zugeknöpft hatte und aus der Tür marschiert war.
Dieser kleine Zwischenfall war zwangsläufig nicht unbemerkt geblieben. Die junge Frau vom Tresen hatte sich, den feuchten Lappen unaufhörlich kreisend, in der Nähe herumgetrieben und sicher jedes Wort mitbekommen. Unvermeidlich arbeitet sie sich jetzt zu ihr vor, während sie mit viel Aufheben Blumenvasen auf alle Tische stellt.
»Sie sind neu, oder?« Das Mädchen mit der Schürze platziert einen Strauß Plastiknelken in der Mitte von Henriettas Tisch. Mit ihrem perfekten Make-up und dem hohen geflochtenen Zopf wirkt sie eher wie eine, die Schminktipps auf YouTube gibt, und Henrietta fragt sich, wie das Mädchen ausgerechnet hier gelandet ist.
»Guten Morgen. Mein Name ist Henrietta Lockwood, ich werde jeden Dienstag-, Donnerstag- und Samstagvormittag hier sein.« Sie schiebt die Nelken auf die Seite. Immerhin ist das ihr offizieller Arbeitsplatz. »Ich werde den Menschen dabei helfen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Denn jeder Mensch hat eine.«