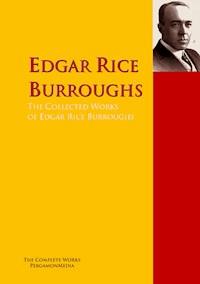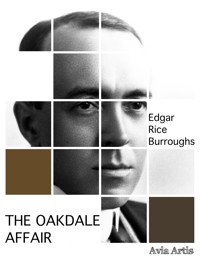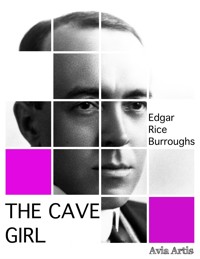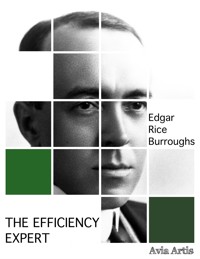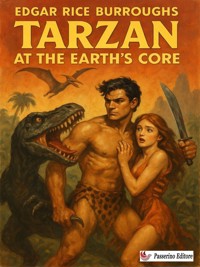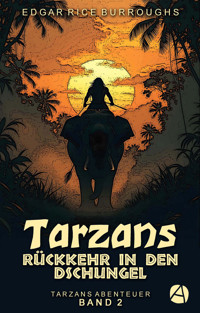Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)
- Sprache: Deutsch
Die Besatzung eines U-Bootes entdeckt eine geheimnisvolle Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Hier leben Dinosaurier und erbarmungslose Vogelmenschen in einer Stadt aus Knochen.Caprona wurde einhellig als bester Roman des Tarzan-Autors eingestuft.Vergessen Sie die schlechten Verfilmungen. Dies ist das Original!Einer der besten Fantasy-Klassiker aller Zeiten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Rice Burroughs
CAPRONA
In dieser Reihe bisher erschienen:
1001 Caprona – Das vergessene Land von Edgar Rice Burroughs
1002 Sten Nord – Der Abenteurer im Weltraum
Edgar Rice Burroughs
Caprona
Das vergessene Land
Aus dem Amerikanischen
© 2016 BLITZ-Verlag
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbild: Mark Freier
Umschlaggestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-95719-770-2
1.
1. Kapitel
Es muss sich nachmittags um kurz nach drei Uhr ereignet haben. Am Nachmittag des 3. Juni 1916, und es scheint kaum möglich zu sein, dass all das, was ich durchgemacht habe, all die seltsamen und furchtbaren Erlebnisse, sich in nur drei kurzen Monaten abgespielt haben soll. Mir kommt es eher wie eine Zeitspanne kosmischen Ausmaßes vor, so viel sah ich in diesen paar Wochen mit eigenen Augen. Ich wurde Zeuge von Dingen, die noch kein Sterblicher zuvor erblickt hatte, entdeckte eine lange verlorene Welt, eine tote Welt, die bereits vor so langer Zeit starb, dass sich selbst in den tiefsten kambrischen Schichten keine Spur mehr von ihr findet. Sie ist mit dem Magma der inneren Erdkruste verschmolzen und entzieht sich somit für immer der Kenntnis der Menschheit – mit Ausnahme dieses entlegenen Winkels der Erde, an den das Schicksal mich verschlagen hat, und wo mein Untergang besiegelt ist. Ich bin hier – und hier muss ich bleiben.
Als ich bis dorthin gelesen hatte, erreichte meine Neugierde, die von dem Fund des Manuskriptes schon angeheizt gewesen war, den Siedepunkt. Ich verbrachte auf Anraten meines Arztes den Sommer in Grönland, und da ich leichtsinnigerweise nicht genügend Lesestoff eingepackt hatte, langweilte ich mich inzwischen zu Tode. Zwar bin ich alles andere als ein begeisterter Angler, doch in Ermangelung anderer Freizeitbeschäftigungen fand ich mich schließlich doch in einem viel zu kleinen Boot vor Kap Farvel am südlichen EndeGrönlands wieder.
Grönland – grünes Land! Das ist eher ein schlechter Witz als eine zutreffende Beschreibung. Doch meine Geschichte hat mit Grönland genauso wenig zu tun wie mit mir selbst, also werde ich mich so knapp wie möglich mit beiden Themen beschäftigen.
Das viel zu kleine Boot erreichte endlich einen unsicheren Anlegeplatz, wobei mir bis zur Hüfte im Wasser stehende Einheimische zu Hilfe eilten. Ich wurde an Land getragen, undwährend man das Abendessen zubereitete, ging ich entlang der rauen, felsigen Küste spazieren. Der verwaschene Granit – so die Felsen am Kap Farvel denn Granit sind – wurde von spärlichen Strandabschnitten unterbrochen. Und als ich über einen dieser weichen Flecken der Ebbe folgte, entdeckte ich es.
Selbst wenn ich in der Schlucht hinter den Bädern von Bimini auf einen Tiger gestoßen wäre, hätte meine Überraschung nicht größer sein können als beim Anblick einer vollkommen neuwertigen Thermoskanne, die in derBrandung vor Kap Farvel trieb. Es gelang mir, sie an Land zu holen, auch wenn ich dabei bis zu den Knien durchnässt wurde. Ich setzte mich in den Sand, öffnete sie und las im Licht der endlosen Dämmerung in dem sauber geschriebenen und ordentlich gefalteten Manuskript, das ich in ihr vorfand.
Sie haben die Einführung bereits gelesen, und wenn Sie genauso ein verträumter Spinner sind wie ich, dann werden Sie auch den Rest lesen wollen. Darum werde ich es hierwiedergeben und bewusst auf Anführungszeichen verzichten, da ich diese sowieso früher oder später vergessen würde. In spätestens zwei Minuten werden Sie mich vergessen haben.
Ich bin in Santa Monica zu Hause. Ich bin oder vielmehr war Juniorpartner in der Firma meines Vaters. Wir sind Schiffbauer. In den letzten Jahren haben wir uns auf Unterseeboote spezialisiert, die wir für Deutschland, England, Frankreich und die Vereinigten Staaten bauten. Ich kenne mich mit U-Booten so gut aus wie eine Mutter mit ihrem Kind und steuerte Unmengen davon bei ihren Probeläufen. Und dennoch galt mein wahres Interesse immer der Luftfahrt.
Ich lernte bei Curtiss, und nachdem ich meinen Vater lange genug belagert hatte, erteilte er mir schließlich die Erlaubnis, mich an der Lafayette Escadrille Militärakademie zu bewerben. Zum Einstieg wurde ich dem amerikanischen Sanitätsdienst zugewiesen und war auf dem Weg nach Frankreich, als drei schrille Pfiffe meine gesamte Lebensplanung durcheinanderbrachten.
Ich saß mit ein paar Kollegen vom Sanitätsdienst auf dem Deck. Mein Airedaleterrier, Kronprinz Nobbler, lag mir zu Füßen. Plötzlich unterbrach der erste Pfeifton den Frieden und die Sicherheit an Bord des Schiffes. Seit wir uns in der U-Boot-Zone befanden, hatten wir nach Periskopen Ausschau gehalten und es in unserer kindlichen Naivität bedauert, dass wir am nächsten Tag Frankreich unbeschadet erreichen würden, ohne eines dieser gefürchteten Raubtiere ansichtig geworden zu sein.
Wir waren jung, wir liebten die Aufregung. Und davon bekamen wir an jenem Tag weiß Gott genug. Aber im Vergleich zu dem, was ich seither erlebte, war die Aufregung damals ein zahmes Kasperletheater. Ich werde niemals die aschfahlen Gesichter der Passagiere vergessen, als sie sich auf ihre Schwimmwesten stürzten, wenn auch keine Panik ausbrach.
Nobs stand mit einem leisen Knurren auf. Auch ich erhob mich und entdeckte keine zweihundert Meter von unserem Schiff entfernt das Periskop eines U-Boots. Im Wasser, deutlich zu sehen, die Spur eines Torpedos, der auf den Passagierdampfer zuraste. Natürlich war das amerikanische Schiff, an dessen Bord wir uns befanden, nicht bewaffnet. Wir waren vollkommen wehrlos und wurden doch ohne jegliche Vorwarnung mit Torpedos beschossen.
Ich stand bewegungslos da und starrte wie gebannt auf das Kielwasser des Torpedos. Er traf uns fast genau in der Mitte der Steuerbordseite des Schiffes. Der Dampfer schaukelte, als wäre die See unter ihm von einem gewaltigen Vulkan aufgewühlt worden. Schmerzhaft wurden wir auf das Deck geschleudert und blieben betäubt liegen. Dann stieg eine Säule aus Wasser, Holz- und Stahlsplittern und verstümmelten Menschenkörpern mehrere Hundert Meter hoch in die Luft. Die Stille, die der Explosion des Torpedos folgte, war nicht weniger grauenvoll. Sie hielt vielleicht zwei Sekunden an, bevor die Schreie und das Stöhnen der Verwundeten einsetzten, das Fluchen der Männer und die heiseren Befehle der Offiziere des Schiffes. Sie waren großartig, sie und ihre Besatzung. Noch nie zuvor war ich so stolz auf mein Vaterland gewesen wie in jenem Augenblick. In all dem Chaos, das der Bombardierung des Dampfers folgte, verlor weder einer von ihnen auch nur für einen winzigen Augenblick den Kopf, noch zeigte jemand das geringste Anzeichen von Panik oder Furcht.
Während wir versuchten, die Rettungsboote zu Wasser zu lassen, tauchte das U-Boot auf und man richtete Waffen auf uns. Der befehlsführende Offizier wies uns an, die Flagge zu senken, doch der Kapitän unseres Schiffes weigerte sich. Das Schiff neigte sich bedenklich nach Steuerbord, wodurch die Backbordboote unbrauchbar wurden. Die Rettungsboote auf der anderen Seite waren zu allem Unglück von der Explosion stark beschädigt worden. Noch während die Passagiere sich dort an der Reling drängten und sich bemühten, sich in die wenigen verbliebenen Boote zu retten, eröffnete das U-Boot wieder das Feuer auf das Schiff.
Ich sah, wie eine Granate eine Gruppe von Frauen und Kindern traf, dann wandte ich den Kopf ab und hielt mir die Augen zu. Als ich sie wieder öffnete, gesellte sich zu meinem Entsetzen Zorn. Denn als das U-Boot auftauchte, erkannte ich es als Produkt meiner eigenen Werft. Ich kannte es bis zur kleinsten Niete in- und auswendig. Ich hatte seine Konstruktion überwacht. In genau diesem Kommandoturm hatte ich gesessen und der schwitzenden Besatzung Befehle zugerufen, als sein Bug zum ersten Mal das von der Sommersonne beschienene Wasser des Pazifiks durchpflügt hatte. Und nun war aus diesem Geschöpf meines Geistes und meiner Hand ein Monster geworden, das versuchte, mich in den Tod zu treiben.
Eine zweite Granate explodierte auf Deck. Eines der lebensgefährlich überladenen Rettungsboote schaukelte furchterregend an den Kränen. Ein Granatsplitter zerschmetterte den Seilzug und ich musste zusehen, wie Frauen, Kinder und Männer ins Meer gespuckt wurden, während das Boot noch eine Weile tapfer an dem einen verbliebenen Kran hängen blieb, bevor es schließlich mit wachsender Beschleunigung auf die im Wasser ums Überleben kämpfenden, kreischenden Menschen zuraste. Als Nächstes sah ich Männer über die Reling hechten und ins Meer springen. Die Neigung des Decks hatte ein unglaubliches Maß angenommen. Nobs krallte sich mit allen vier Pfoten fest, um nicht durch das Speigatt zu rutschen, und sah mich winselnd an.
Ich beugte mich hinab und kraulte ihn zwischen den Ohren. „Komm mit, Junge!“, rief ich und sprang kopfüber über die Reling.
Als ich wieder auftauchte, war das Erste, was ich sah, Nobs, der nur ein paar Meter von mir weg hektisch schwamm. Als er mich entdeckte, legte er die Ohren an und schenkte mir das für ihn typische Lächeln.
Das U-Boot zog sich in Richtung Norden zurück, wobei es aber noch immer auf die drei offenen Boote schoss, die bis zum Rand mit Überlebenden gefüllt waren. Glücklicherweise waren die kleinen Boote nicht einfach zu treffen. Dies und die schlechten Schießkünste der Deutschen retteten den Menschen an Bord das Leben.
Nach ein paar Minuten erschien eine Rauchwolke am Horizont, das U-Boot tauchte ab und war verschwunden. Die Rettungsboote bemühten sich, um sich vor dem Sog des sinkenden Dampfers in Sicherheit zu bringen, und obwohl ich so laut rief, wie ich konnte, hörten sie mein Flehen entweder nicht, oder sie wagten es nicht, für meine Rettung umzukehren. Nobs und ich hatten uns schon recht weit von dem Schiff entfernen können, als es endgültig umkippte und versank. Der Sog vermochte lediglich, uns ein paar Meter zurücktreiben zu lassen, zog uns aber nicht unter Wasser. Ich schaute mich hektisch nach etwas um, an dem man sich festhalten konnte.
Ich sah gerade in Richtung des gesunkenen Dampfers, als der gedämpfte Nachhall einer Explosion aus den Tiefen des Ozeans heraufdrang, auf den fast unmittelbar eine Fontäne aus Wasser folgte. Sie katapultierte zerschmetterte Rettungsboote, Leichen, Dampf, Kohle, Öl und zersplitterte Schiffsplanken hoch über die Wasseroberfläche – eine Wassersäule als Grabstein eines weiteren Schiffes im gewaltigen Friedhof des Ozeans.
Als die Wellen sich etwas gelegt hatten und das Meer keine weiteren Trümmer mehr ausspuckte, wagte ich es zurückzuschwimmen, um nach einem Stück Treibgut zu suchen, das groß genug war, um mein und Nobs Gewicht zu tragen. Ich hatte die Untergangsstelle gerade erreicht, als keine fünf Meter vor mir ein Rettungsboot mit dem Bug voraus fast in voller Länge aus dem Wasser schoss und laut platschend mit dem Kiel auf der Wasseroberfläche aufschlug. Es musste sehr weit in die Tiefe gezerrt worden sein, bis das eine Seil, mit dem es wohl noch am Mutterschiff gehangen hatte, endlich der Belastung nachgegeben hatte. Nur so konnte ich mir erklären, dass es so weit aus dem Wasser geschossen war.
Diesem glücklichen Umstand verdanke ich sicherlich mein Leben und ein weiteres Leben, das mir sehr viel mehr bedeutet als mein eigenes. Ich bezeichne es als einen glücklichen Umstand – obwohl mich jetzt ein viel grauenhafteres Schicksal erwartet, als ich damals zu befürchten hatte –, da ich es nur diesem Umstand verdanke, dass ich einer Frau begegnete, die ich sonst nie kennen- und lieben gelernt hätte. Wenigstens dieses große Glück hatte ich in meinem Leben. Und selbst Caspak kann es, so sehr es sich auch bemüht, nicht ungeschehen machen.
Also danke ich zum tausendsten Mal dem Schicksal dafür, dass es mir dieses Boot aus den grünen Untiefen befreit hat, in die es gezogen worden war, dass es dieses so hoch über die Wasseroberfläche schießen ließ, dass das Wasser aus ihm hinaus fließen konnte, und dass es sicher auf den Wellen zu ruhen kam.
Kurz darauf war ich über den Rand geklettert und hatte auch Nobs in die relative Sicherheit des Bootes gebracht. Ich betrachtete die leblose Verwüstung um uns herum. Zwischen den Trümmern schwammen die mitleiderregenden Leichen von Frauen und Kindern, die von ihren nutzlosen Schwimmwesten an der Oberfläche gehalten wurden. Einige von ihnen waren schwer verstümmelt, andere trieben still und mit friedlich gefasstem Gesicht auf den Wellen, wieder andere waren erstarrt in Schrecken und Entsetzen.
Unweit des Bootes trieb der Körper eines Mädchens. Ihr Gesicht war dank ihrer Schwimmweste nach oben gerichtet und wurde von einer im Wasser schwebenden Wolke schwarzen Haares eingerahmt. Sie war außergewöhnlich schön. Ich hatte noch nie derart perfekte Gesichtszüge gesehen, solch göttliche Gestalt, die zugleich unbestreitbar menschlich war. Ihr Gesicht war voller Charakter, Stärke und Weiblichkeit, dazu erschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden. Ihre rosigen Wangen zeigten die Farbe von Leben, Gesundheit und Freude, doch sie trieb tot auf dem Wasser.
Ich spürte eine Regung in meiner Kehle, sah auf diese strahlende Erscheinung hinab und schwor lauthals, ihren Tod zu rächen. Der Anblick, der sich mir bot, als ich ein letztes Mal auf das Gesicht im Wasser blicken wollte, ließ mich beinahe rückwärts ins Meer taumeln. Die Augen im toten Antlitz hatten sich geöffnet, die Lippen bebten und eine Hand wurde mir mit einer stummen Bitte nach Rettung entgegengestreckt. Sie war nicht tot! Sie lebte!
Ich lehnte mich über den Rand des Bootes und zog sie in die beschränkte Sicherheit, die Gott mir geschenkt hatte. Behutsam befreite ich sie von der Schwimmweste und formte daraus und aus meinem durchtränkten Mantel ein Kopfkissen für sie. Ich massierte ihr die Hände, Arme und Füße. Eine Stunde lang mühte ich mich ab, bis ich endlich mit einem tiefen Seufzer belohnt wurde und sich die großen Augen wieder öffneten, um in die meinen zu sehen. Von da an war ich vollkommen verschüchtert.
Ich war nie ein Frauenheld gewesen. In Leland-Stanford hatte sich die ganze Klasse über mich lustig gemacht, weil ich mich in Anwesenheit eines hübschen Mädchens stets so tollpatschig benahm, auch wenn meine Kameraden mich durchaus gut leiden konnten. Als sie jetzt die Augen aufschlug, ließ ich die Hand, die ich gerade gerieben hatte, wie ein glühendes Stück Eisen fallen. Ihr Blick musterte mich von Kopf bis Fuß und streifte dann über den von den sich hebenden und senkenden Dollborden des Rettungsbootes begrenzten Horizont. Der Blick wurde sanft, als er sich auf Nobs richtete, bevor er fragend zu mir zurückkehrte.
„Ich … Ich …“, stammelte ich und stolperte rückwärts über die Ruderbank hinter mir.
Die Erscheinung lächelte matt. „Aye, aye, Sir!“, erwiderte sie leise, bevor ihr die Lippen wieder den Dienst versagten.
„Ich hoffe, dass es Ihnen besser geht“, brachte ich endlich hervor.
„Wissen Sie“, sagte sie nach kurzem Schweigen, „ich bin schon lange wach! Doch ich habe nicht gewagt, die Augen zu öffnen. Ich war mir sicher, dass ich tot bin und nur Dunkelheit um mich herum sehen würde. Ich habe Angst vor dem Tod! Berichten Sie mir, was nach dem Untergang des Schiffes geschah. Ich erinnere mich noch an alles, was davor geschah, und ich wünschte, ich könnte es vergessen!“ Ein Schluchzen brachte ihre Stimme zum Brechen. „Diese Bestien!“, fuhr sie wenig später fort. „Wenn ich denke, dass ich beinahe einen von ihnen geheiratet hätte. Einen Leutnant der deutschen Marine.“
Sie fuhr mit ihrem ursprünglichen Gedanken fort, als wäre sie nie abgeschweift. „Ich sank immer tiefer und tiefer. Ich hatte das Gefühl, ich würde niemals anhalten. Ich war nicht sonderlich aufgeregt, bis ich plötzlich immer schneller nach oben schoss und meine Lungen zu platzen drohten. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben, denn das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich die Augen aufschlug, nachdem ich eine lange Schimpftirade auf Deutschland und die Deutschen vernommen hatte. Berichten Sie mir bitte genau, was nach dem Sinken des Schiffes geschehen ist.“
Ich beschrieb ihr, was ich gesehen hatte. Sie fand es außergewöhnlich, dass unsere Leben durch einen derartig unwahrscheinlichen Akt der Vorsehung gerettet worden waren. Mir lag eine hübsche Erwiderung auf der Zunge, ich wagte aber nicht, sie auszusprechen. Nobs war herübergekommen und hatte seine Schnauze auf ihren Schoß gelegt. Sie streichelte sein hässliches Gesicht und beugte sich schließlich hinab, um ihre Wange an seine Stirn zu legen.
Ich hatte Nobs schon immer gemocht, doch nun kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass ich gerne den Platz mit ihm getauscht hätte. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde, da er an Frauen genauso wenig gewöhnt war wie ich. Doch er war ein Naturtalent. Ich mag zwar kein Frauenheld sein, aber Nobs ist zweifellos ein Frauenhund. Der alte Strolch schloss einfach die Augen, bewerkstelligte einen unfassbar süßen Gesichtsausdruck und genoss die Zuwendung. Es machte mich eifersüchtig.
„Sie mögen Hunde?“, bemerkte ich.
„Ich mag diesen Hund“, erwiderte sie.
Ob sie mit dieser Antwort irgendetwas Persönliches andeuten wollte, konnte ich nicht beurteilen, aber ich fasste es so auf und fühlte mich deshalb viel besser.
Da wir zusammen durch die unendlich weite Einsamkeit trieben, war es nicht verwunderlich, dass wir einander schon bald sehr vertraut wurden. Ohne Unterlass suchten wir den Horizont nach Rauch ab und äußerten Vermutungen über unsere Rettungsaussichten. Doch die Sonne ging unter und die schwarze Nacht hüllte uns ein, noch bevor wir auch nur einen kleinen Hoffnungsschimmer auf dem Wasser entdeckt hatten.
Es war kalt und ungemütlich und wir litten Hunger und Durst. Unsere Kleidung war immer noch ziemlich nass und ich wusste, dass für das Mädchen die Kälte der Nacht auf dem offenen Boot ohne ausreichende Kleidung und Essen sehr gefährlich werden konnte.
Es war mir gelungen, das Wasser mit bloßen Händen aus dem Boot zu schöpfen und den Rest mit einem Taschentuch aufzuwischen. Es war eine langwierige Knochenarbeit gewesen, doch wenigstens hatte die junge Frau so einen vergleichsweise trockenen Platz, um sich hinzulegen. Die Wände des Bootes schützten sie vor dem Nachtwind. Als sie sich erschöpft und übermüdet hinlegte, warf ich meinen feuchten Mantel als zusätzlichen Schutz vor der Kälte über sie. Doch es war nicht genug. Als ich ihre schlanke Gestalt im Mondlicht betrachtete, bemerkte ich, wie sehr sie zitterte.
„Gibt es nichts, was ich tun kann?“, fragte ich. „Sie können da nicht einfach die ganze Nacht liegen und frieren. Fällt Ihnen gar nichts ein?“
Sie schüttelte den Kopf. „Wir müssen es wohl mit einem Lächeln ertragen“, antwortete sie schließlich.
Nobbler kam und legte sich neben mich auf die Ruderbank, den Rücken an mein Bein gelehnt. Frustriert starrte ich das Mädchen an. In meinem tiefsten Herzen wusste ich, dass sie noch vor Anbruch des Morgens sterben würde. Die meisten Frauen hätten der Schock und die Unterkühlung schon längst getötet. Und als ich sie so klein und zart hilflos da liegen sah, wurde in meiner Brust langsam ein neues Gefühl geboren. Es war noch nie zuvor da gewesen, doch nun würde es für immer dort sein. Es ließ mich fast verzweifelt wünschen, dass ich das Blut in ihren Adern irgendwie warm halten könnte.
Ich fror selbst, obwohl ich es fast vergessen hatte, bis Nobbler sich bewegte und ich ein neues Kälteempfinden an meinem Bein verspürte, wo er gelegen hatte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass mir an dieser Stelle warm gewesen war. Da kam mir die Erleuchtung, wie ich das Mädchen wärmen konnte. Ich kniete mich sofort neben sie, um meine Idee umzusetzen, als große Scham mich plötzlich zurückhielt. Würde sie es zulassen, wenn ich den Mut aufbringen würde, es vorzuschlagen? Dann sah ich, wie sie von Krämpfen geschüttelt wurde, als ihre Muskeln auf ihre rasch fallende Körpertemperatur reagierten. Ich warf die Prüderie über Bord, legte mich neben sie, nahm sie in den Arm und drückte sie fest an mich. Sie wich hektisch zurück, stieß einen leisen, ängstlichen Schrei hervor und versuchte, mich wegzustoßen.
2. Kapitel
Gegen Morgen muss ich eingenickt sein, obwohl es mir zu jenem Zeitpunkt so schien, als hätte ich nicht Stunden, sondern Tage wach gelegen. Als ich endlich die Augen aufschlug, war es bereits hell, und das Haar des Mädchens berührte mein Gesicht. Sie atmete regelmäßig, wofür ich Gott dankte. Sie hatte mir im Schlaf das Gesicht zugewendet, sodass es, als ich aufwachte, nur wenige Zentimeter von meinem eigenen lag. Meine Lippen berührten beinahe ihren Mund. Es war Nobs, der sie schließlich weckte. Er stand auf, streckte sich, drehte sich ein paarmal auf der Stelle und legte sich wieder hin. Das Mädchen öffnete die Augen und sah mich an. Ihr Blick weitete sich erst erschrocken, doch dann begriff sie die Situation und lächelte.
„Sie waren sehr nett zu mir“, murmelte sie, als ich ihr beim Aufstehen half, obwohl ich offen gestanden viel hilfsbedürftiger war als sie. Die Durchblutung in meiner ganzen linken Körperhälfte schien vollkommen zum Erliegen gekommen zu sein.
„Sie waren sehr nett zu mir.“ Mehr sagte sie zu dem Geschehen nicht, trotzdem wusste ich, dass sie mir dankbar war und dass nur höfliche Zurückhaltung sie daran hinderte, die peinliche, wenn auch unvermeidbare Situation weiter zu erwähnen.
Kurz nach Sonnenaufgang entdeckten wir Rauch, der unmittelbar auf uns zukam. Bald darauf konnten wir den gedrungenen Umriss eines Schleppers erkennen, eines jener furchtlosen Vertreter der englischen Überlegenheit auf See, die Segelschiffe in französische und englische Häfen ziehen. Ich stellte mich auf eine Ruderbank und winkte mit meinem feuchten Mantel. Nobs stand auf einer anderen Bank und bellte. Die junge Frau saß mir zu Füßen und blinzelte zu dem auf uns zukommenden Boot hinüber.
„Sie sehen uns“, sagte sie endlich. „Da ist ein Mann, der unser Signal erwidert.“
Sie hatte recht. In meinem Hals formte sich ein Kloß, mehr um ihret- als um meinetwillen. Das Mädchen war gerettet. Und keinen Augenblick zu früh. Sie hätte keine zweite Nacht mehr auf dem Ärmelkanal überlebt, wahrscheinlich hätte sie noch nicht einmal den vor uns liegenden Tag überstanden.
Der Schlepper kam nah an uns heran, und ein Mann auf Deck warf uns ein Seil zu. Hilfsbereite Hände zogen uns über die Reling, nur Nobs kletterte ohne Unterstützung an Bord. Die rauen Männer gingen mütterlich sanft mit dem Mädchen um. Sie fragten uns ein Loch in den Bauch und brachten sie zur Kabine des Kapitäns, mich in den Kesselraum. Sie baten das Mädchen, sich auszuziehen und die nassen Kleider vor die Tür zu werfen, damit sie diese trocknen könnten, während sie sich in der Koje des Kapitäns aufwärmte. Mich mussten sie gar nicht erst bitten mich auszuziehen, als ich nun im heißen Kesselraum stand. Meine Kleidung war im Handumdrehen da aufgehängt, wo sie am schnellsten trocknen würde, und ich sog durch jede Pore die Hitze des bedrückend engen Raums auf.
Sie brachten uns heiße Suppe und Kaffee, und dann saßen die Männer, die gerade keinen Dienst hatten, bei mir und unterstützten mich darin, den Kaiser und seine Brut zu verfluchen. Sobald unsere Kleidung getrocknet war, bat man uns, sie wieder anzuziehen, da man, wie ich aus schmerzlicher Erfahrung ja wusste, in diesen Gewässern jederzeit damit rechnen musste, dass es Ärger mit dem Feind gab.
Nun, da mir warm war und ich wusste, dass das Mädchen in Sicherheit war und sie sich mit ein wenig Nahrung und Ruhe schnell von den hinter ihr liegenden Strapazen erholen würde, war ich meines Lebens zum ersten Mal wieder froh, seit am vorherigen Nachmittag jene drei schrillen Pfiffe meiner Welt den Frieden geraubt hatten. Doch seit August 1914 war Frieden auf dem Ärmelkanal nie ein lang anhaltender Zustand gewesen.
Kaum hatte ich meine trockene Kleidung angelegt und dem Mädchen seine Sachen zur Kapitänskabine gebracht, als dem Maschinenraum volle Kraft voraus befohlen wurde – und im nächsten Augenblick hörte ich den dumpfen Donner eines Schusses. Ich war sofort auf Deck und entdeckte ein feindliches U-Boot, keine zweihundert Meter von unserem Bug entfernt. Es hatte uns Zeichen gegeben anzuhalten, doch unser Kapitän hatte sich geweigert, und nun war das Geschütz des U-Boots auf uns gerichtet. Der zweite Schuss streifte uns, was unseren streitlustigen Kapitän darauf hinwies, dass man nun doch besser gehorchen solle. Wieder ging ein Befehl an den Maschinenraum und der Schlepper wurde langsamer.
Das U-Boot stellte das Feuer ein und befahl dem Schlepper näherzukommen. Der Schwung hatte uns ein Stück weit von dem feindlichen Schiff entfernt, doch wir schwenkten nun in einen Kreis ein, der uns an seine Seite führen würde. Als ich dem Manöver zuschaute und mich fragte, was wohl aus uns werden sollte, spürte ich eine Berührung am Arm. Die junge Frau hatte sich neben mich gestellt. Sie sah mich verbittert an. „Die scheinen uns unbedingt vernichten zu wollen“, sagte sie. „Es sieht wie dasselbe Schiff aus, das uns gestern versenkt hat.“
„Das ist es auch“, erwiderte ich. „Ich kenne es genau. Ich habe es mit entworfen und die ersten Probeläufe damit gemacht.“
Das Mädchen wich mit einem leisen Ausruf der Überraschung und der Enttäuschung von mir zurück. „Ich dachte, Sie wären Amerikaner“, sagte sie. „Ich hatte keine Ahnung, dass Sie ein … ein …“
„Bin ich auch nicht“, entgegnete ich. „Wir Amerikaner bauen schon seit vielen Jahren U-Boote für alle möglichen Länder. Aber es wäre mir lieber, mein Vater und ich wären Pleite gegangen, anstatt diese Monstrosität zu bauen.“
Wir näherten uns nun mit halber Kraft dem U-Boot und ich konnte beinahe schon die Gesichter der Männer an Deck ausmachen. Ein Matrose kam zu mir und drückte mir etwas Kaltes, Hartes in die Hand. Ich musste es nicht ansehen, um zu wissen, dass es sich um eine schwere Pistole handelte.
„Nimm se un benutz se“, sagte er lediglich.
Unser Bug war nun geradewegs auf das U-Boot gerichtet und ich hörte, wie dem Maschinenraum befohlen wurde, volle Kraft voraus zu fahren. Mir wurde sofort klar, welche dreiste Unverschämtheit der tapfere englische Kapitän vorhatte. Er wollte das fünfhundert Tonnen schwere U-Boot mitten ins kanonenbewehrte Gesicht rammen. Ich konnte nur mit Mühe ein Jubeln unterdrücken.
Zuerst schienen die Krauts seine Absicht nicht zu erahnen. Sie nahmen offenbar an, sie hätten ein Beispiel schlechter Navigationskunst vor sich, denn sie schrien dem Schlepper Warnungen zu, das Tempo zu drosseln und das Steuer hart nach Backbord zu werfen. Wir waren nur noch fünfzehn Meter entfernt, als ihnen die beabsichtigte Bedrohung unseres Manövers bewusst wurde. Ihre Schützen waren vollkommen überrumpelt, doch sie sprangen nun auf und jagten ein nutzloses Geschoss über unsere Köpfe hinweg. Nobs hechtete hin und her und bellte wütend.
„Gebt’s ihnen!“, befahl der Kapitän des Schleppers, und sofort ergossen sich aus Revolvern und Gewehren Schüsse auf das Deck des Unterseeboots. Zwei der U-Boot-Schützen sanken zu Boden, die anderen richteten ihre Geschütze auf den Bug des auf sie zukommenden Schleppers. Die restlichen Männer auf Deck erwiderten unsere Schüsse, wobei sie es vor allem auf unseren Mann am Steuer abgesehen hatten.
Ich schubste das Mädchen hastig in den Gang, der zum Maschinenraum führte. Dann hob ich den Revolver und gab meinen ersten Schuss auf die Krauts ab. Die Ereignisse der nächsten Sekunden liefen so schnell ab, dass meine Erinnerung an sie verschwommen ist.
Ich sah, wie der Steuermann nach vorne auf das Steuer stürzte, wodurch das Schiff zügig ausscherte und vom Kurs abkam. Ich erinnere mich, dass mir klar wurde, dass all unsere Mühen umsonst gewesen waren, da ausgerechnet dieses Besatzungsmitglied vom Schicksal ausgewählt worden war, als Erstes einem feindlichen Geschoss zum Opfer zu fallen.
Ich sah, wie die verbliebenen Schützen auf dem U-Boot feuerten, und spürte die Wucht der lauten Explosion an unserem Bug. Ich nahm all diese Dinge wahr, während ich ins Steuerhaus hastete, mich über die Leiche des gefallenen Seemanns stellte und das Steuer packte. Ich riss es mit aller Kraft nach Steuerbord herum, doch es war zu spät, um die Absicht unseres Kapitäns zu erfüllen. Es gelang mir lediglich, an dem U-Boot entlang zu schrammen.
Ich hörte einen Befehl, der an den Maschinenraum gekreischt wurde, das Schiff bebte und zitterte beim plötzlichen Umkehren der Motoren und wir wurden zusehends langsamer. Da verstand ich, was dieser wahnsinnige Kapitän nun vorhatte, da sein ursprünglicher Plan missglückt war. Er brüllte einen Befehl und hechtete auf das schlüpfrige Deck des Unterseeboots, seine hartgesottene Besatzung folgte ihm.
Ich verließ das Steuerhaus und sprang ihnen nach, um beim Kampf gegen die Krauts nicht zurückzustehen. Die Techniker und Heizer kamen aus dem Gang zum Maschinenraum geströmt und wir stürzten uns gemeinsam auf die gegnerische Besatzung. Der Kampf, der sich entwickelte, überzog das nasse Deck mit rotem Blut. Nobs eilte zu mir, jetzt stumm und grimmig.
Deutsche kletterten durch die offene Luke, um an dem Kampf auf Deck teilzunehmen. Anfangs hörte man über das Fluchen der Männer und die lauten Befehle des Kommandanten und seines Ersten Offiziers noch das Peitschen von Pistolenschüssen, doch bald schon war die Situation so konfus, dass man die Schusswaffen nicht mehr ohne Gefahr für die eigene Seite einsetzen konnte. So ging der Kampf in ein Handgemenge um die Kontrolle des Decks über. Jeder von uns hatte nur ein Ziel: den Gegner in die See zu werfen.
Ich werde niemals den abstoßenden Gesichtsausdruck des riesigen Mannes vergessen, den der Zufall zu meinem Gegner bestimmt hatte. Er senkte den Kopf, schrie wie ein wilder Stier und stürzte sich auf mich. Ich wich ihm aus, indem ich rasch zur Seite trat und mich außer Reichweite seiner ausgestreckten Arme duckte. Als er sich nach mir umdrehte, um nachzusetzen, traf ihn mein Schlag genau aufs Kinn und er taumelte zum Rand des Decks. Ich beobachtete, wie er verzweifelt versuchte, sein Gleichgewicht zurückzugewinnen, wie er einen endlosen Augenblick lang auf dem schmalen Grat zur Ewigkeit schwankte, um dann mit einem lauten Schrei im Meer zu verschwinden.
Gleichzeitig schlossen sich zwei kräftige Arme von hinten um meinen Oberkörper und hoben mich vollständig vom Boden ab. So sehr ich mich auch wand und um mich trat, es wollte mir weder gelingen, mich nach meinem Gegner umzudrehen, noch konnte ich mich von seinem harten Griff befreien. Unnachgiebig trug er mich zur Seite des Schiffes und auf den Tod zu. Es war niemand da, der ihn hätte aufhalten können, da jeder meiner Mitkämpfer mit ein bis drei Gegnern mehr als beschäftigt war.
Eine Zeit lang fürchtete ich um mich selbst, doch dann sah ich das, was mich panische Angst für ein anderes Leben empfinden ließ. Mein Gegner trug mich zu der Seite des Unterseeboots, gegen die noch immer der Schlepper schlug. Ich verschwendete keinen Gedanken daran, dass ich zwischen den beiden Schiffen zerquetscht werden könnte, als ich das Mädchen allein auf Deck des Schleppers stehen sah, dessen Vordersteven hoch in die Luft ragte und dessen Bug bald zum letzten Mal ins Wasser eintauchen würde.
Ich musste hilflos zusehen, wie sich der Tod an die Rockzipfel der Frau klammerte, von der ich mittlerweile nur zu gut wusste, dass ich sie liebte. Mir blieb vielleicht noch der Bruchteil einer Sekunde zu leben, als sich hinter mir ein zorniges Knurren mit dem Schmerzensschrei des Riesen, der mich trug, mischte. Er fiel sofort rückwärts aufs Deck und öffnete seine gnadenlose Umarmung, um seinen Sturz abzufangen, sodass ich frei war. Ich stürzte mich mit Wucht auf ihn, war aber unmittelbar wieder auf den Beinen und warf einen kurzen Blick auf meinen Gegner: Nie wieder würde er mich oder andere bedrohen, denn Nobs’ kräftiger Kiefer hatte seine Kehle zerrissen. Dann sprang ich zur Kante des Decks, die dem Mädchen auf dem sinkenden Schlepper am nächsten war.
„Springen Sie!“, rief ich. „Springen Sie!“ Ich streckte ihr die Arme entgegen.
Ohne zu zögern und voll Vertrauen in meine Fähigkeit, sie zu retten, sprang sie über die Reling auf das schwankende, schlüpfrige U-Boot. Ich beugte mich weit vor, um ihre Hand zu packen. Im gleichen Augenblick erhob sich der Vordersteven des Schiffes senkrecht in den Himmel und verschwand unter der Wasseroberfläche. Meine Hand verfehlte die des Mädchens knapp, und ich sah sie ins Meer fallen. Sie hatte das Wasser kaum erreicht, als ich ihr auch schon nachsprang.
Der sinkende Schlepper riss uns tief unter Wasser, doch ich hatte das Mädchen sofort gepackt, als ich die Oberfläche erreicht hatte, und wir gingen gemeinsam unter und tauchten auch zusammen wieder auf, nur wenige Meter von dem U-Boot entfernt.
Als Erstes hörte ich Nobs’ wildes Bellen. Er hatte mich offenbar aus den Augen verloren und suchte mich. Ein Blick auf das deutsche Schiff genügte, und ich wusste, dass der Kampf vorbei und wir die Sieger waren. Unsere Überlebenden hielten eine Handvoll Feinde mit vorgehaltenen Pistolen in Schach, die restliche deutsche Besatzung kam aus dem Inneren des Schiffs und reihte sich unter den Gefangenen ein.
Als ich mit dem Mädchen auf das U-Boot zu schwamm, erregte Nobs’ anhaltendes Bellen die Aufmerksamkeit der Besatzung des Schleppers, und sobald wir das Schiff erreicht hatten, half man uns an Bord. Ich fragte die junge Frau, ob sie verletzt sei, doch sie versicherte mir, dass dieses zweite unfreiwillige Bad ihr keineswegs geschadet hatte. Auch schien sie nicht unter Schock zu stehen. Ich sollte noch früh genug herausfinden, dass dieses schlanke und scheinbar so zerbrechliche Wesen das Herz und den Mut einer Kriegerin besaß.
Der Maat des Schleppers war gerade dabei, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und zählte die Überlebenden. Unser kühner Kapitän weilte nicht mehr unter uns sowie acht weitere Männer. Wir hatten mit neunzehn Mann angegriffen und uns auf die eine oder andere Art während des Kampfes sechzehn Deutscher entledigt, dazu neun Gefangene genommen, darunter den U-Boot-Kommandanten. Sein Leutnant war tot.
„Kein schlechtes Ergebnis“, fand Bradley, der Maat, als er mit dem Abzählen fertig war. „Den Kapitän zu verlieren, ist das Schlimmste“, fügte er hinzu. „Er war ein guter Mann, ein hervorragender Mann.“
Olson, der trotz seines Namens Ire und an Bord des Schleppers der Maschinist war, stand bei Bradley und mir. „Ja“, erwiderte er mit schwerem irischen Akzent, „wir haben ordentlich was erreicht, aber was stellen wir mit dem Ding jetzt an?“
„Wir steuern es in den nächsten englischen Hafen“, schlug Bradley vor und fügte lachend hinzu: „Und dann holen wir uns unsere Orden.“
„Wie wollen Sie es denn steuern?“, fragte Olson. „Diesen Kartoffelfressern kann man nicht trauen.“
Bradley kratzte sich am Kopf. „Da haben Sie wohl recht“, gab er zu. „Und ich kenne mich mit U-Booten überhaupt nicht aus.“
„Aber ich“, versicherte ich ihm. „Bei diesem U-Boot hier weiß ich besser Bescheid als der Offizier, der auf ihm Befehl geführt hat.“
Die beiden Männer starrten mich verblüfft an. Wieder musste ich all das erklären, was ich zuvor dem Mädchen anvertraut hatte. Bradley und Olson waren begeistert. Mir wurde sofort das Kommando übertragen und ich begab mich umgehend nach unten, um das Schiff nach versteckten Krauts und beschädigten Maschinenteilen abzusuchen. Es waren keine Deutschen mehr im Inneren des U-Bootes und alles war in erstklassigem Zustand.
Ich befahl allen Männern, nach unten zu kommen, bis auf einen, den ich zum Ausguck bestimmte. Auf Befragung erklärten sich mit Ausnahme des Kommandanten alle Deutschen bereit, ihre Posten wieder einzunehmen und das Schiff in den nächsten britischen Hafen zu steuern. Ich schätze, dass sie nach den Gefahren und Schwierigkeiten, die sie durchgemacht hatten, froh waren, den Rest des Krieges in einem komfortablen englischen Gefangenenlager verbringen zu können.
Der Offizier jedoch bekräftigte, dass er sich niemals an der Übernahme seines Schiffes beteiligen würde. Uns blieb also keine andere Wahl, als den Mann in Ketten zu legen. Als wir uns gerade daranmachten, diese Entscheidung umzusetzen, kam das Mädchen vom Deck herabgestiegen. Ich half ihr die Leiter hinab und hielt immer noch ihren Arm, obwohl sie meine Hilfe sicher nicht mehr nötig hatte, als sie sich umdrehte und dem deutschen Offizier ins Gesicht sah. Beide stießen einen überraschten Entsetzensschrei aus.
„Lys!“, rief er und ging einen Schritt auf sie zu.
Das Mädchen riss die Augen auf, sah ihn mit wachsendem Schrecken an und wich zurück. Dann jedoch richtete sich die zierliche Gestalt auf wie ein stolzer Soldat und drehte dem Offizier mit erhobenem Haupt den Rücken zu. Sie sagte kein Wort.
„Schaffen Sie ihn weg“, wies ich die beiden Männer an, die ihn bewachten. „Und legen Sie ihn in Ketten.“
Der Mann wurde weggebracht.
Das Mädchen sah mir in die Augen. „Das ist der Deutsche, von dem ich sprach“, sagte sie. „Er ist der Baron von Schönvorts.“
Ich senkte stumm den Kopf. Sie hatte ihn geliebt! Ich fragte mich, ob sie ihn tief in ihrem Herzen nicht immer noch liebte. Eifersucht packte mich. Der intensive Hass, den ich auf Baron von Schönvorts empfand, ließ mich ein seltsames Hochgefühl verspüren.
Ich hatte nicht die Gelegenheit, meinen Hass lange zu genießen, da in diesem Moment der Ausguck seinen Kopf durch die Luke steckte und hinunter grölte, dass bugwärts Rauch am Horizont zu sehen sei. Ich begab mich sofort an Deck, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bradley begleitete mich.
„Wenn es Freunde sind, werden wir mit ihnen sprechen“, sagte er. „Wenn nicht, werden wir sie versenken, was, Kapitän?“
„Jawohl, Leutnant“, erwiderte ich und er lächelte zufrieden.
Wir hissten die britische Flagge. Ich blieb auf Deck, während Bradley nach unten ging, um den Besatzungsmitgliedern ihre Aufgaben zuzuteilen, wobei er einen bewaffneten Engländer neben jeden Deutschen stellte.
„Halbe Kraft voraus“, befahl ich.
Wir verringerten den Abstand zwischen uns und dem anderen Schiff nun zügig, und schon bald konnte ich die rote Flagge der britischen Handelsmarine deutlich erkennen. Mit vor Stolz geschwellter Brust stellte ich mir vor, wie uns die britischen Seeleute zu unserem bemerkenswerten Sieg gratulieren würden.
Der Dampfer musste uns nun entdeckt haben, denn er schwenkte plötzlich nach Norden um. Kurz darauf strömte dichter Rauch aus seinen Schornsteinen. Dann manövrierte er einen hektischen Zickzackkurs, um uns wie die Beulenpest zu meiden. Ich ließ das U-Boot den Kurs ändern, um die Verfolgung aufzunehmen, doch der Dampfer war schneller als wir und hatte uns rasch abgehängt. Mit bitterem Lächeln gab ich den Befehl, wieder unseren ursprünglichen Kurs aufzunehmen, und wiederum waren wir auf dem Weg ins gute alte England.
Das geschah vor drei Monaten, und wir sind immer noch nicht in England angekommen. Es sieht auch nicht so aus, als würden wir dies jemals tun. Der Dampfer, dem wir begegnet waren, muss über Funk eine Warnung gesendet haben, denn keine halbe Stunde später sahen wir wieder Rauch am Horizont, und diesmal wehte die weiße Flagge der Königlichen Marine auf dem bewaffneten Schiff. Dieses Schiff schwenkte nicht nach Norden oder sonst wohin aus, sondern kam zügig auf uns zu.
Gerade wollte ich ein Signal geben, als plötzlich eine Flamme an seinem Bug aufblitzte und das Wasser unmittelbar vor uns von einer explodierenden Granate aufgewirbelt wurde. Bradley war zurück auf Deck und stand neben mir. „Noch eine davon, und sie haben die Entfernung zu uns präzise genug abgeschätzt, um uns zu treffen“, sagte er. „Die scheinen auf unseren Union Jack nicht viel zu geben.“
Eine zweite Granate flog über uns hinweg. Ich befahl eine Kursänderung und wies Bradley an, nach unten zu gehen und das Tauchmanöver zu veranlassen. Ich reichte ihm Nobs nach unten, und nachdem ich ihm selbst gefolgt war, überwachte ich das Schließen und Versiegeln der Luke. Das Füllen der Tauchtanks war mir noch nie so langsam vorgekommen. Wir hörten eine laute Explosion, die direkt über uns gewesen zu sein schien und das ganze Schiff so stark erschütterte, dass wir allesamt von den Füßen gerissen wurden. Ich rechnete kurzzeitig damit, von hereinströmendem Wasser überschüttet zu werden, doch dies blieb aus. Stattdessen tauchten wir weiter ab, bis das Manometer 12 Meter anzeigte, und ich wusste, dass wir in Sicherheit waren.
In Sicherheit! Beinahe hätte ich gelächelt. Ich entließ Olson, der auf meine Anweisung hin im Turm geblieben war, da er einst Mitglied einer der ersten britischen U-Boot-Besatzungen gewesen war und sich einigermaßen auskannte.
Bradley war bei mir und sah mich fragend an. „Was zum Teufel sollen wir jetzt tun?“, fragte er. „Die Händler flüchten vor uns, die Kriegsschiffe wollen uns zerstören. Niemand glaubt unserer Flagge oder gibt uns die Gelegenheit, uns zu erkennen zu geben. Der Empfang in einem britischen Hafen wird noch schlimmer sein: Minen, Netze und alles, was dazugehört. Das können wir vergessen.“
„Wir wollen es noch einmal versuchen, wenn der da oben unsere Fährte verloren hat“, ließ ich nicht nach. „Irgendein Schiff wird uns schon glauben.“ Und wir versuchten es tatsächlich noch einmal, nur um beinahe von einem riesigen Frachtschiff gerammt zu werden.
Später feuerte ein Zerstörer auf uns und zwei Handelsschiffe drehten ab und flüchteten vor uns.
Zwei Tage lang fuhren wir kreuz und quer durch den Ärmelkanal auf der Suche nach jemandem, der uns unsere Geschichte abkaufen würde. Schon nach unserer ersten Begegnung mit einem Kriegsschiff hatte ich den Befehl erteilt, in einem Funkspruch auf unsere schwierige Situation hinzuweisen, doch zu meiner großen Enttäuschung stellte ich fest, dass sowohl die Sende- wie auch die Empfangsanlage defekt war.
„Sie können nur noch ein Ziel ansteuern, und zwar Kiel. Sie werden in keinem anderen Hafen mehr landen können. Wenn Sie möchten, bringe ich Sie dorthin und verspreche, dass man Sie gut behandeln wird“, ließ Baron von Schönvorts mir mitteilen.
Meine Antwort lautete: „Wir können auch zur Hölle fahren. Die würde ich Deutschland auf jeden Fall vorziehen.“
3. Kapitel
Es waren Tage der Angst, in denen ich nur selten Zeit hatte, mit Lys zusammen zu sein. Ich hatte ihr die Unterkunft des Kommandanten gegeben, während Bradley und ich uns die des Ersten Offiziers teilten. Olson hatte sich mit drei unserer besten Männer in einer Kajüte für Unteroffiziere einquartiert. Nobs’ Lager richtete ich in Lys’ Kabine ein, da ich wusste, dass sie sich dann nicht so allein fühlen würde.
Nachdem wir die britischen Gewässer verlassen hatten, geschah eine ganze Weile nichts Bemerkenswertes. Wir fuhren stetig an der Oberfläche und kamen gut voran. Die ersten beiden Boote, denen wir begegneten, suchten hastig das Weite. Das dritte, ein gewaltiger Frachter, schoss auf uns, sodass wir tauchen mussten.
Und dann fing unser Ärger erst richtig an. Einer der Dieselmotoren gab an jenem Morgen seinen Geist auf, und während wir daran arbeiteten, nahm der vordere Backbord-Tauchtank plötzlich Wasser auf. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf Deck und bemerkte, wie wir langsam Schlagseite bekamen. Ich ahnte sofort, was geschah, und hastete zur Luke, schlug sie hinter mir zu und ließ mich in die Zentrale fallen. Das Schiff versank mittlerweile mit der Nase voraus in unangenehmer Schräglage.
Ich verschwendete keine Zeit damit, jemand anderem Befehle zu erteilen, sondern rannte selbst so schnell, wie meine Füße mich trugen, zu dem Ventil, das Meerwasser in den bewussten Tauchtank ließ. Es stand sperrangelweit offen. Es war im Handumdrehen wieder geschlossen und die Pumpen angeworfen, doch die Situation war äußerst brenzlig gewesen.
Mir war klar, dass dieses Ventil sich nicht von alleine geöffnet hatte. Jemand hatte sich daran zu schaffen gemacht, jemand, der bereit war zu sterben, wenn er den Rest von uns damit auch in den Tod reißen würde. Nach diesem Zwischenfall ließ ich eine Wache in dem schmalen Schiff auf und ab gehen.
Wir arbeiteten den ganzen Tag, die ganze Nacht und die Hälfte des folgenden Tages an dem defekten Motor. Die meiste Zeit trieben wir einfach nur auf dem Wasser, doch gegen Mittag entdeckten wir im Westen Rauch. Da ich begriffen hatte, dass diese Welt für uns nur mit Feinden besiedelt war, gab ich den Befehl, den verbliebenen Motor anzuwerfen, damit wir dem auf uns zukommenden Dampfer aus dem Weg gehen konnten. Doch sobald der Motor sich in Bewegung setzte, ertönte das Geräusch gequälten Stahls, und als wir ihn wieder anhielten, entdeckten wir einen Kaltmeißel, den jemand ins Getriebe gesteckt hatte.
Es dauerte zwei weitere Tage, bis wir uns halb repariert weiterschleppen konnten. In der Nacht, bevor die Reparaturen abgeschlossen werden sollten, kam die Wache in meine Kabine und weckte mich. Er war ein ausgesprochen intelligenter Kerl aus der britischen Mittelschicht, dem ich vertraute.
„Was ist denn jetzt schon wieder, Wilson?“, fragte ich erstaunt.
Er legte den Finger auf die Lippen und kam näher an mich heran. „Ich glaube, ich habe unseren Saboteur gefunden“, flüsterte er und nickte in Richtung der Kabine des Mädchens. „Ich habe sie gerade aus der Kabine der Besatzung schleichen sehen“, fuhr er fort. „Sie hat da drin mit dem Kraut-Kommandanten gequasselt. Benson hat sie letzte Nacht auch schon da gesehen, aber er hat es niemandem gesagt, bis ich heute meine Wachschicht angetreten habe. Benson ist keine große Leuchte. Der zählt zwei und zwei immer erst dann zusammen, wenn ihm jemand vorsagt, dass es vier macht.“
Es wäre kein größerer Schock für mich gewesen, wenn Wilson hereingekommen wäre und mir ins Gesicht geschlagen hätte.
„Sagen Sie niemandem etwas davon“, befahl ich ihm. „Halten Sie Augen und Ohren offen und berichten Sie mir alles, was Ihnen verdächtig vorkommt.“
Der Mann grüßte und verließ die Kabine. Ich wälzte mich noch mindestens eine Stunde lang schlaflos auf meiner harten Koje herum und verzehrte mich vor Eifersucht und Furcht. Endlich fand ich unruhigen Schlaf.
Der Tag war schon angebrochen, als ich wieder aufwachte. Wir fuhren langsam an der Wasseroberfläche. Ich hatte Befehl erteilt, mit halber Kraft zu fahren, bis wir unsere genaue Position bestimmen konnten. Der Himmel war den ganzen Vortag und die ganze Nacht über bewölkt gewesen, doch als ich an jenem Morgen die Zentrale betrat, war ich erleichtert, die Sonne zu sehen. Die Männer schienen besser gelaunt und die Lage günstiger zu sein. Ich vergaß die unangenehmen Offenbarungen der vergangenen Nacht und begann mit der Positionsbestimmung.
Doch was für ein Schock! Der Sextant und das Chronometer waren zerstört. Der Schaden war in der vergangenen Nacht angerichtet worden, die Geräte hatte man also in der Nacht zerstört, in der Lys im Gespräch mit von Schönvorts beobachtet worden war. Es war wohl dieser letzte Gedanke, der mir am meisten wehtat.
Der anderen Katastrophe konnte ich mit Todesverachtung ins Gesicht starren, doch die nackte Tatsache, dass Lys eine Verräterin war, bereitete mir Übelkeit. Ich befahl Bradley und Olson, an Deck zu kommen, und berichtete ihnen, was vorgefallen war, aber ich brachte es nicht über mich, das zu wiederholen, was Wilson mir in der Nacht zuvor berichtet hatte. Es schien mir bei näherer Betrachtung auch vollkommen aberwitzig, dass Lys die Kabine durchquert haben sollte, in der Bradley und ich schliefen, um in die Besatzungskabine zu Baron von Schönvorts zu gelangen, ohne dabei von mehr als einer Person gesehen worden zu sein.
Bradley schüttelte den Kopf. „Ich werd’ nicht schlau daraus“, sagte er.
„Einer der Krauts muss wirklich verdammt clever sein, um uns alle so an der Nase herumführen zu können. Aber er hat uns nicht so geschadet, wie er glaubt. Wir haben ja noch die Ersatzinstrumente.“
Doch ich schüttelte den Kopf. „Es gibt keine Ersatzinstrumente. Die sind merkwürdigerweise verschwunden.“
Die beiden sahen mich überrascht an. „Dann bleiben uns immerhin noch der Kompass und die Sonne“, sagt Olson. „Vielleicht machen sie sich nachts irgendwann einmal am Kompass zu schaffen, aber tagsüber laufen hier zu viele von uns herum, als dass sie die Sonne auch noch klauen könnten.“
Ein Mitglied unserer Besatzung steckte den Kopf durch die Luke und bat um Erlaubnis, an Deck kommen zu dürfen. Ich sah, dass es Benson war, der laut Wilson Lys vor zwei Nächten mit von Schönvorts gesehen haben wollte. Ich bat ihn herauf, nahm ihn dann zur Seite und fragte ihn, ob ihm während seiner Wachschichten etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei.
Der Seemann kratzte sich am Kopf. „Nein“, sagte er zunächst, um dann hinzuzufügen, er habe das Mädchen in der Kabine der Besatzung gesehen, wie es mit dem deutschen Kommandanten sprach. Er hatte sich aber nichts dabei gedacht und die Sache nicht gemeldet.
Ich wies ihn an, mir in Zukunft auch die kleinsten Vorkommnisse zu melden, und ließ ihn abtreten. Eine ganze Reihe der Männer bat nun um Erlaubnis, an Deck kommen zu dürfen. Schon bald stand unsere gesamte Besatzung bis auf diejenigen, die gerade eine wichtige Funktion zu erfüllen hatten, auf Deck, rauchten und unterhielten sich in bester Laune. Ich nutzte die Abwesenheit der Männer, um mein Frühstück einzunehmen.
Lys erschien, als ich die Zentrale betrat. Nobs folgte ihr. Sie begrüßte mich mit einem freundlichen „Guten Morgen!“, das ich recht angespannt und verärgert erwiderte. „Möchten Sie mit mir frühstücken?“, fragte ich sie spontan. Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, eine eigene Untersuchung durchzuführen, die meinen Pflichten gerecht werden sollte.
Sie nahm meine Einladung mit einem grazilen Nicken an und wir setzten uns an einen der winzigen Tische in der Offiziersmesse. „Haben Sie letzte Nacht gut geschlafen?“, fragte ich.
„Wie ein Stein“, erwiderte sie. „Ich schlafe eigentlich nie schlecht.“
Ihre Antwort klang so offen und ehrlich, dass ich es nicht über mich brachte, sie des doppelten Spiels und der Lüge zu verdächtigen. Doch um sie zu überrumpeln und zu einem Eingeständnis ihrer Schuld zu bringen, stieß ich hervor: „Das Chronometer und der Sextant sind letzte Nacht zerstört worden. Wir haben einen Verräter unter uns.“
Sie ließ sich nicht anmerken, ob sie schon vorab von dieser Katastrophe gewusst hatte. „Wer kann das getan haben?“, rief sie. „Die Deutschen wären doch wahnsinnig, so etwas zu tun. Ihr Leben steht schließlich genauso auf dem Spiel wie unseres.“
„Männer sind oft nur zu gerne bereit, für ein Ideal zu sterben. Zum Beispiel für ihr Vaterland“, erwiderte ich. „Und die Bereitschaft, sich zum Märtyrer zu machen, schließt auch die Bereitschaft ein, andere zu opfern. Sogar die Menschen, die einen lieben. Frauen sind da gar nicht so anders, nur dass sie meistens noch weiter gehen als Männer. Sie würden für die Liebe alles opfern, selbst die Ehre.“
Während ich sprach, beobachtete ich ihr Gesicht ganz genau. Mir schien, dass ich die Andeutung eines Errötens auf ihren Wangen bemerkte. Ich erkannte die Gelegenheit und packte sie beim Schopfe. „Denken Sie nur einmal an von Schönvorts“, fuhr ich fort. „Er würde sein eigenes Leben und das unsere liebend gern beenden, wenn er damit verhindern könnte, dass dieses Schiff in Feindeshand fällt. Er würde jeden opfern, sogar Sie. Und wenn Sie ihn immer noch liebten, wären Sie auch sein bereitwilliges Werkzeug. Können Sie mir folgen?“
Sie sah mich bestürzt aus weit aufgerissenen Augen an, wurde dann sehr blass und stand auf. „Das kann ich“, sagte sie, drehte mir den Rücken zu und ging eilig zu ihrer Kabine. Ich ging ihr nach, da es mir, trotz meines Glaubens an ihre Schuld, leidtat, ihr wehgetan zu haben. Gerade als sie an der Tür zur Kabine der Besatzung vorbeiging, holte ich sie ein. Ich kam genau rechtzeitig, um zu sehen, wie von Schönvorts sich vorbeugte und ihr etwas zuflüsterte. Doch sie schien sich bewusst zu sein, dass sie beobachtet wurde, und ging unbeirrt weiter.
An jenem Nachmittag zogen Wolken auf, der Wind frischte zu Sturmböen auf und die See wurde so rau, dass das Schiff furchterregend schwankte und schaukelte. Fast alle an Bord wurden seekrank, die Luft stank ekelerregend. Ich verließ meinen Posten im Kommandoturm vierundzwanzig Stunden lang nicht, da sich Bradley und Olson beide krankmeldeten.
Als ich beim besten Willen nicht mehr konnte, sah ich mich nach jemandem um, der mich ablösen konnte. Benson meldete sich freiwillig. Er war noch wohlauf und versicherte mir, dass er als ehemaliger Marinesoldat zwei Jahre Erfahrung im Umgang mit U-Booten gesammelt hatte. Ich war froh, dass er es war, der sich gemeldet hatte, da ich ihn für sehr loyal hielt und mich also beruhigt in meiner Kabine zur Ruhe legen konnte.
Ich schlief zwölf Stunden am Stück. Als ich wach wurde und bemerkte, wie spät es war, verlor ich keine Zeit und begab mich sofort in den Kommandoturm. Dort fand ich Benson, hellwach, und der Kompass zeigte an, dass wir schnurgerade nach Westen fuhren. Der Sturm war immer noch schlimm, und das blieb er auch bis zum vierten Tag. Wir waren alle ziemlich mitgenommen und konnten es kaum erwarten, wieder an Deck zu gehen und unsere Lungen mit frischer Luft zu füllen.
Die junge Dame hatte ich im Verlauf der vier Tage kein einziges Mal gesehen, da sie offenbar ihre Kabine nicht mehr verließ. Während dieser Zeit gab es auch keinen verdächtigen Vorfall, was den Indizienbeweis gegen sie nur noch glaubhafter machte.
Sechs Tage nach Abschwächen des Sturms hatten wir immer noch ziemlich schlechtes Wetter. Die Sonne zeigte während all dieser Zeit nicht einmal kurz ihr Gesicht. Für diese Jahreszeit, es war Mitte Juni, war der Sturm sehr ungewöhnlich. Doch da ich aus Südkalifornien stamme, war ich an unberechenbares Wetter gewöhnt. Genau genommen hatte ich festgestellt, dass das Wetter auf der ganzen Welt eigentlich immer unberechenbar ist.
Wir blieben unbeirrbar auf unserem Westkurs, und da die U-33 eines der schnellsten U-Boote war, das wir je gebaut hatten, wusste ich, dass wir der nordamerikanischen Küste schon sehr nah sein mussten. Was mich am meisten verwirrte, war die Tatsache, dass wir seit sechs Tagen kein Schiff mehr gesehen hatten. Es schien mir eigentümlich, dass wir den Atlantik fast bis zum amerikanischen Kontinent durchqueren konnten, ohne je Rauch oder ein Segel am Horizont zu sehen. Ich kam schließlich zu der Einsicht, dass wir weit von unserem Kurs abgekommen waren, doch ob nach Norden oder nach Süden, vermochte ich nicht mit Sicherheit zu sagen.
Am siebten Tag lag die See bei Morgendämmerung vergleichsweise ruhig. Die Luft war etwas dunstig, sodass wir die Sterne nicht sehen konnten, aber alles deutete auf einen klaren Vormittag hin, und ich wartete auf Deck ängstlich auf den Sonnenaufgang. Mein Blick war starr auf den undurchdringlichen Nebel achtern gerichtet, denn dort im Osten musste ich das erste Glühen der aufgehenden Sonne sehen, wenn wir noch immer auf dem richtigen Kurs waren.
Nach und nach wurde der Himmel heller, doch ich konnte kein intensiveres Leuchten hinter dem Nebel entdecken. Bradley stand neben mir. Er berührte mich am Arm. „Schauen Sie, Kapitän“, sagte er und deutete nach Süden.
Ich folgte mit dem Blick seinem Finger und keuchte. Dort, genau an Backbord, sah ich durch den Dunst den roten Umriss der aufgehenden Sonne. Ich eilte zum Kommandoturm und überprüfte den Kompass. Er zeigte an, dass wir immer noch gen Westen fuhren. Entweder ging die Sonne im Osten auf, oder jemand hatte sich am Kompass zu schaffen gemacht. Der Fall schien ziemlich klar zu sein.
Ich ging zurück zu Bradley und berichtete ihm von meiner Entdeckung. Abschließend bemerkte ich: „Wir schaffen es ohne Öl keine fünfhundert Seemeilen weiter, Proviant und Wasser gehen zur Neige. Wir sind Gott weiß wie weit nach Süden abgekommen.“
„Es bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren Kurs nach Westen zu korrigieren. Wenn wir nicht bald Land sichten, sind wir alle verloren“, bemerkte er nur.
Ich wies ihn an, dies zu tun und bastelte dann einen Sextanten, mit dem wir unsere Position aber nur grob und wenig zufriedenstellend zu bestimmen vermochten. Nach Durchführung der Messungen konnten wir unmöglich wissen, wie weit die Ergebnisse von der Wahrheit entfernt waren. Wir schienen uns etwa an zwanzig Grad nördlicher Breite und dreißig Grad westlicher Länge zu befinden, waren also fast zweitausendfünfhundert Meilen vom Kurs abgekommen. Kurz gesagt: Wenn unsere Messungen auch nur annähernd zutrafen, waren wir sechs Tage lang Richtung Süden gefahren.
Bradley löste Benson ab, der sich nach der neuesten Einteilung der Schichten die Nächte mit Olson teilte, während Bradley und ich uns am Tag abwechselten. Ich befragte sowohl Olson als auch Benson eindringlich über die Sache mit dem Kompass, doch beide behaupteten steif und fest, dass niemand sich während ihrer Wache an dem Gerät zu schaffen gemacht hatte.
Benson lächelte mich hintergründig an, als wollte er sagen: „Wir wissen doch beide, wer es getan hat.“ Doch ich konnte einfach nicht glauben, dass es das Mädchen gewesen sein sollte.
Wir blieben mehrere Stunden auf Westkurs, bis der Ausguck rief, er würde ein Segel sichten. Ich ließ den Kurs der U-33 ändern und wir fuhren auf das unbekannte Schiff zu, da ich notgedrungen zu einer Entscheidung gekommen war. Wir konnten nicht einfach hier mitten im Atlantik verhungern, solange es noch einen Ausweg gab.
Das Segelschiff bemerkte uns schon von Weitem, wie man an seinen Fluchtversuchen deutlich sehen konnte. Doch es war fast windstill, und es hatte keine Chance. Als wir näher kamen und das Schiff zum Stehenbleiben aufforderten, wurde es in den Wind gedreht und blieb mit nutzlos flatternden Segeln liegen. Wir näherten uns so weit wie möglich an.
Das Schiff war die Balmen aus Halmstad in Schweden, die diverse Güter von Brasilien nach Spanien transportierte. Ich erklärte dem Kapitän unsere Lage und bat um Essen, Wasser und Öl, doch als der Mann begriff, dass wir keine Deutschen waren, wurde er sehr wütend und ausfallend. Er wollte abdrehen und uns zurücklassen, aber für derlei Spielerei war ich nicht in Stimmung.
„Schützen an Deck! Tauchstationen besetzen!“, rief ich Bradley zu, der sich im Kontrollturm befand. Für militärischen Drill hatten wir keine Zeit gehabt, aber alle waren über ihre Pflichten informiert, und die Deutschen an Bord wussten, dass ihnen bei Befehlsmissachtung der Tod drohte, da jeder eine bewaffnete Wache neben sich stehen hatte. Doch die meisten Männer folgten meinen Befehlen nur allzu gerne.
Bradley leitete den Befehl ins Innere des Schiffes weiter und im nächsten Augenblick kletterten die Schützen die schmale Leiter empor. Auf meine Anweisung hin richteten sie ihre Waffen auf das schwedische Schiff. Ich befahl ihnen, einen Schuss über den Bug abzufeuern. Glauben Sie mir, der Schwede erkannte seinen Fehler blitzschnell und befestigte die rot-weiße Flagge am Mast, die ichverstehe signalisiert.
Wieder flatterten die Segel schlaff. Ich befahl ihm, ein Boot zu Wasser zu lassen und mich zu holen. Ich ging mit Olson und zwei anderen Engländern an Bord des Segelschiffes und suchte aus der Fracht das aus, was wir brauchten: Öl, Nahrungsmittel und Wasser. Ich gab dem Schiffsherrn der Balmen eine Quittung über das, was wir uns genommen hatten, sowie eine von mir, Bradley und Olson unterzeichnete eidesstattliche Erklärung, die kurz darstellte, wie wir in den Besitz der U-33 gekommen waren und wie dringend wir diese Vorräte brauchten. Wir adressierten beides an jeglichen Vertreter Großbritanniens mit der Bitte, die Besitzer der Balmen für ihren Verlust zu entschädigen. Ob dies jemals geschehen ist, weiß ich nicht.
(Anmerkung des US-Verlegers: Im späten Juli 1916 berichtete eine Meldung in den Schifffahrtsnachrichten, dass ein schwedisches Segelboot, die Balmen, die zwischen Rio de Janeiro und Barcelona verkehrte, von einem deutschen Kaperschiff irgendwann im Juni versenkt worden war. Ein einzelner Überlebender in einem offenen Boot wurde, dem Tode nahe, vor den Kapverdischen Inseln aufgelesen. Er starb, ohne Einzelheiten nennen zu können.)
Mit Wasser, Nahrung und Öl an Bord schienen wir wieder eine Chance zu haben. Außerdem wussten wir nun genau, wo wir waren, und ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, Georgetown in Britisch Guyana zu erreichen. Doch wieder sollte ich bitter enttäuscht werden.
Während unseres Zusammentreffens mit dem schwedischen Schiff befanden sich sechs Mitglieder der loyalen Besatzung an Deck, um die Geschütze zu bemannen oder um an Bord des Segelschiffes zu gehen. Nun stiegen wir, einer nach dem anderen, die Leiter zur Zentrale hinab. Ich bildete das Schlusslicht, und als ich unten ankam, starrte ich in die Mündung einer Pistole, die von Baron Friedrich von Schönvorts gehalten wurde. Meine ganze Besatzung stand aufgereiht an einer Seite und wurde von den Deutschen in Schach gehalten. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie dies geschehen sein konnte, aber es war passiert.
Später erfuhr ich, dass sie zunächst den auf seiner Koje schlafenden Benson überwältigt und ihm seine Pistole entwendet hatten. So hatten sie leichtes Spiel mit dem Koch und den verbliebenen beiden Engländern unter Deck gehabt. Danach war es auch kein großes Problem gewesen, am Fuß der Leiter zu stehen und jeden Einzelnen unter Arrest zu nehmen, wenn er unten ankam.
Von Schönvorts’ erste Amtshandlung war, mich als Piraten zu bezeichnen und zu entscheiden, dass ich früh am nächsten Morgen erschossen werden sollte. Dann erklärte er, dass die U-33 nun eine Weile durch diese Gewässer kreuzen würde, um neutrale und feindliche Schiffe zu versenken, bis sie auf eins der deutschen Kaperschiffe stießen, die sich in dieser Gegend aufhalten sollten.
Er hielt sein Versprechen, mich am nächsten Morgen zu erschießen, nicht. Bis heute weiß ich nicht, warum er die Vollstreckung des Urteils verschob. Stattdessen ließ er mich in Ketten legen, wie es zuvor mit ihm geschehen war. Er warf Bradley aus unserer Kabine und nahm sie wieder für sich alleine.
Wir kreuzten lange über den Ozean und versenkten viele Schiffe, fast ausnahmslos durch Granatenbeschuss. Doch einem deutschen Kaperschiff begegneten wir nicht. Ich stellte überrascht fest, dass von Schönvorts relativ häufig Benson das Kommando übertrug, doch ich führte dies darauf zurück, dass Benson sich mit den Pflichten eines U-Boot-Kommandanten sicher besser auskannte als irgendeiner der Deutschen.