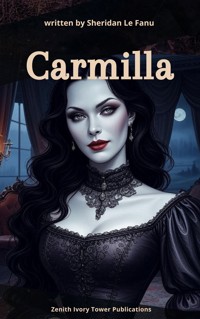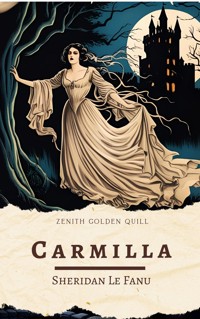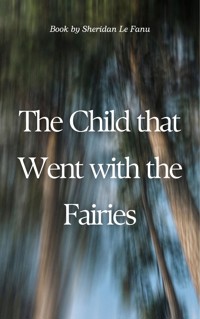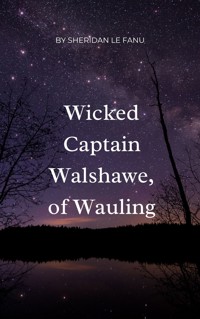Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Carmilla ist eine gotische Novelle aus dem Jahr 1872 des irischen Autors Joseph Sheridan Le Fanu und eines der frühen Werke der Vampirliteratur, das bereits 26 Jahre vor Bram Stokers Dracula (1897) geschrieben wurde. Die Geschichte erzählt von einer jungen Frau in der Steiermark, die einsam in einem abgelegenen Herrenhaus in den Wäldern der Steiermark lebt. Laura sehnt sich nach Abwechslung und Gesellschaft - bis ein Kutschenunfall eines Tages eine andere junge Frau in ihr Leben bringt: die verschwiegene und manchmal unberechenbare Carmilla. Als Carmillas Handlungen immer rätselhafter und unberechenbarer werden, entwickelt Laura bizarre Symptome und als sich ihre Gesundheit verschlechtert, entdecken Laura und ihr Vater etwas Monströses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CARMILLA
von J. Sheridan Le Fanu (1872)
Übersetzung: Fritz Nordsieck (2021)
Aureon Verlag GmbH
VORWORT
Auf ein Blatt Papier, welches dem folgenden Bericht beigegeben war, hat Dr. Hesselius ziemlich ausführliche Notizen niedergeschrieben und ihnen einen Hinweis auf seine Abhandlung über das merkwürdige Problem, das im Manuskript beleuchtet wird, hinzugefügt.
In der erwähnten Schrift behandelt er jenes geheimnisvolle Thema mit der ihm eigenen Gelehrsamkeit und Geistesschärfe und zudem bemerkenswert unumwunden und präzis. Die Abhandlung wird übrigens nur einen Band der gesammelten Werke dieses außergewöhnlichen Mannes ausmachen.
Wenn ich diesen Fall in diesem Buch öffentlich bekannt mache, so geschieht es nur, um den „Laienstand“ zu interessieren. Ich will jedoch der klugen Dame, die die Geschichte erzählt, nicht vorgreifen und ich habe mich daher nach gebührender Überlegung entschieden, davon abzusehen, eine Zusammenfassung der Gedankengänge des gebildeten Doktors zu präsentieren oder aus seinen Aussagen zu dem Thema, das er beschreibt, etwas herauszulesen, das „wahrscheinlich die tiefsten Geheimnisse unserer dualen Existenz und ihrer Übergangsstadien einschließt.“
Als ich diesen Aufsatz entdeckte, war ich bestrebt, die Korrespondenz wieder aufzunehmen, die Doktor Hesselius vor so vielen Jahren mit seiner Informantin, die so klug und sorgfältig zu sein schien, begonnen hatte. Zu meinem größten Bedauern stellte ich jedoch fest, dass sie in der Zwischenzeit bereits verstorben war.
Sie hätte wahrscheinlich kaum mehr zu der Erzählung hinzufügen können, die sie uns bereits auf den folgenden Seiten mitteilt – soweit ich sagen kann, mit einer gewissenhaften Eigenart.
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL I
EIN FRÜHZEITIGER SCHRECKEN
Wir wohnen in einem Schloss in der Steiermark, obwohl wir keineswegs reiche Leute sind. Mit einem geringen Einkommen kann man in diesem Teil der Welt viel ausrichten. Acht oder neunhundert Pfund im Jahr können Wunder bewirken. Den wohlhabenden Leuten zu Hause wäre unser Einkommen spärlich erschienen. Mein Vater ist Engländer und ich trage einen englischen Namen, auch wenn ich noch nie in England war. Hier in diesem einsamen und urtümlichen Land, wo alles so wunderbar preiswert ist, kann ich wirklich nicht erkennen, wie mehr Geld uns zur mehr materieller Bequemlichkeit oder Luxusgütern verhelfen könnte.
Mein Vater war ein österreichischer Beamter und ging mit einer Pension und seinem väterlichen Erbe in den Ruhestand. Er erwarb dieses feudale Domizil und das kleine Grundstück auf dem es erbaut wurde, für sehr wenig Geld – eine günstige Gelegenheit.
Nichts könnte malerischer oder einsamer sein. Das Schloss steht auf einer kleinen Erhebung inmitten eines Waldes. Eine sehr alte und enge Straße verläuft vor seiner Zugbrücke, die während meiner Lebenszeit noch nie hochgezogen wurde. Der Burggraben ist voller Barsche und wird von Schwänen überflogen. Und an seiner Oberfläche schwimmen mengenweise Seerosen.
Darüber thront das Schloss mit seiner Fassade aus vielen Fenstern, den Türmen und seiner gotischen Kapelle. Vor dem Tor öffnet sich eine unregelmäßige, malerische Lichtung im Wald und auf der rechten Seite verläuft die Straße über eine steile gotische Brücke über einen Bach, der sich im tiefen Schatten durch den Wald schlängelt. Wie ich bereits sagte, handelt es sich um eine sehr einsame Gegend. Urteilen Sie selbst, ob dem so ist.
Wenn man von der Haustür aus auf die Straße blickt, erstreckt sich der Wald, in dem das Schloss steht, vierundzwanzig Kilometer weit zur rechten und neunzehn Kilometer weit zur linken Seite. Das nächste bewohnte Dorf liegt etwa elf Kilometer weit entfernt auf der linken Seite. Das nächste bewohnte Schloss gehört dem alten General Spielsdorf, über dreißig Kilometer entfernt auf der rechten Seite.
Ich sagte, „das nächste bewohnte Dorf“, denn es gibt noch in derselben Richtung von General Spielsdorfs Schloss ein verfallenes Dorf etwa fünf Kilometer entfernt mit einer reizenden kleinen Kirche, inzwischen jedoch ohne Dach, in deren Seitenschiff sich die zerfallenen Grabmäler der stolzen Familie Karnstein befinden, die inzwischen ausgestorben ist und die einst das verwahrloste Schloss besaß, das über den stillen Gemäuern des Dorfes thront.
Es gibt eine Legende darüber, warum dieser überraschende und melancholische Ort verlassen wurde, die ich ein anderes Mal erzählen werde.
Ich muss Ihnen nun erzählen, wie klein die Gruppe von Menschen ist, die unser Schloss bewohnt. Ich schließe dabei die Bediensteten oder die Familienangehörigen, die in den zum Schloss gehörenden Gebäuden leben, nicht mit ein. Hören Sie zu und wundern Sie sich! Es waren nur mein Vater, der netteste Mensch auf Erden, der aber langsam alt wurde und ich, zur Zeit der Erzählung nur neunzehn Jahre alt. Seitdem sind acht Jahre vergangen.
Die Familie in dem Schloss bestand nur aus meinem Vater und mir. Meine Mutter, eine Dame aus der Steiermark, war bereits während meiner Kindheit gestorben, aber ich hatte eine gutmütige Gouvernante, die, wie ich sagen würde, seit meiner Kindheit bei mir war. Ich kann mich jedenfalls nicht an die Zeit erinnern, zu der ihr dickliches gütiges Gesicht mir nicht vertraut gewesen wäre.
Das war Madame Perrodon, geboren in Bern, deren Pflege und Gutmütigkeit mir nun zum Teil den Verlust meiner Mutter ersetzte, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, weil ich sie schon so früh verloren habe. Madame Perrodon machte also ein Drittel unserer kleinen Tischgesellschaft aus. Es gab noch eine Vierte, Mademoiselle De Lafontaine, eine Dame die man das „Kinderfräulein“ nennen könnte. Sie sprach Französisch, Deutsch und gebrochen Englisch, wozu mein Vater und ich noch ein besseres Englisch hinzufügten. Wir sprachen jeden Tag Englisch, zum Teil um zu verhindern, dass es bei uns zu einer verlorenen Sprache würde und teilweise auch aus patriotischen Motiven. Die Folge davon war ein babylonisches Sprachengewirr, worüber Fremde lachten und das ich nicht versuchen werde, in dieser Erzählung wiederzugeben. Außerdem gab es noch zwei oder drei junge Damen, hübsche Freundinnen etwa in meinem Alter, die uns gelegentlich besuchten – in größeren oder kleineren Abständen – Besuche, die ich manchmal erwiderte.
Dies war unser normaler sozialer Umgang; aber es gab natürlich auch gelegentlich Besuche von „Nachbarn“, die nur zehn oder zwölf Kilometer weit weg wohnten. Trotzdem war mein Leben eher einsam – das kann ich Ihnen versichern.
Meine Gouvernanten hatten gerade so viel Kontrolle über mich wie diese klugen Leute auch nur über ein ziemlich verwöhntes Mädchen haben können, deren einziges Elternteil ihr praktisch alles erlaubte, was auch immer sie wollte.
Die erste Begebenheit in meinem Leben, die einen fürchterlichen Eindruck auf mich machte und tatsächlich nie aus meiner Erinnerung verschwand, war eines der frühesten Ereignisse in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann. Manche einer wird es für so unbedeutend halten, dass es hier eigentlich gar nicht erwähnt werden müsste. Sie werden jedoch mit der Zeit erkennen, warum ich es erwähne. Der Kindergarten, wie er genannt wurde, obwohl ich ihn ganz für mich allein hatte, war ein großer Raum im obersten Stock des Schlosses mit einem steilen Dachgeschoss aus Eichenholz. Ich war nicht mehr als sechs Jahre alt, als ich eines Nachts aufwachte und mich von meinem Bett aus in dem Raum umschaute, das Kindermädchen aber nicht sehen konnte. Auch meine Pflegerin war nicht da und ich dachte, ich sei allein. Ich hatte keine Angst, denn ich war eines dieser glücklichen Kinder, denen absichtlich nichts von Gespenstergeschichten und Märchen erzählt worden war – von all diesen Sagen, derentwegen wir uns die Decke über den Kopf ziehen, wenn plötzlich die Tür knarrt oder wenn das Flackern einer erlöschenden Kerze den Schatten eines Bettpfostens in der Nähe unseres Gesichts an der Wand tanzen lässt. Ich war beunruhigt und gekränkt, weil ich mich, wie ich fand, vernachlässigt fühlte und begann zu quengeln, der Vorstufe eines herzhaften Gebrülls, als ich zu meiner Überraschung ein ernstes, aber sehr hübsches Gesicht erblickte, das mich von der Bettkante aus ansah. Es war das Gesicht einer jungen Dame, die mit den Händen unter der Tagesdecke vor dem Bett kniete. Ich sah sie mit einer Art von erfreuter Verwunderung an und hörte auf zu quengeln. Sie streichelte mich mit ihren Händen, legte sich auf mein Bett und zog mich lächelnd zu sich. Ich fühlte mich sofort wunderbar beruhigt und schlief wieder ein. Ich wurde von einem Gefühl aufgeweckt, als würden zwei Nadeln gleichzeitig sehr tief in meine Brust stechen und ich schrie laut auf. Die junge Dame schreckte zurück, während ihre Augen mich fixierten und sie ließ sich dann zu Boden gleiten und versteckte sich, wie ich glaubte, unter dem Bett.
Ich hatte nun zum ersten Mal Angst und schrie mit aller Kraft. Die Pflegerin, das Kindermädchen und die Haushälterin stürzten ins Zimmer und als sie meine Geschichte hörten, machten sie Licht und beruhigten mich so gut sie konnten. Ich war zwar noch ein Kind, aber ich bemerkte, dass ihre Gesichter bleich waren und sie ungewohnt, ängstlich drein blickten. Ich sah, wie sie unter das Bett schauten und den Raum absuchten, einen kurzen Blick unter die Tische warfen und die Schränke öffneten. Die Haushälterin flüsterte der Pflegerin zu. „Legen Sie mal ihre Hand auf diese Vertiefung im Bett; da hat tatsächlich jemand gelegen. Sie waren das nicht; die Stelle ist noch warm.“
Ich erinnere mich, wie das Kindermädchen mich an sich drückte und alle drei meine Brust untersuchten, die Stellte an der ich die Einstiche verspürt hatte. Und sie sagten, dass es keine sichtbaren Anzeichen dafür gäbe, dass mir etwas derartiges, wie ein Stich, zugestoßen sei.
Die Haushälterin und die beiden anderen Bediensteten, die sich um das Kind kümmern mussten, blieben die ganze Nacht wach und von diesem Tage hielt sich immer einer der Bediensteten im Kinderzimmer auf, bis ich etwa vierzehn Jahre alt war.
Ich war noch eine lange Zeit nach diesem Vorfall sehr nervös. Ein Arzt wurde gerufen, ein blasser älterer Herr. Ich erinnere mich gut an sein langes, finsteres Gesicht, das übersät war mit Pockennarben, und an seine kastanienfarbene Perücke. Für einige Zeit kam er jeden zweiten Tag und gab mir Medizin, was ich natürlich hasste.
An dem Morgen, nachdem ich diese Erscheinung gesehen hatte, befand ich mich in einem Zustand von Angst und Schrecken und konnte es nicht ausstehen, auch nur für einen Moment allein gelassen zu werden, auch nicht am hellichten Tag.
Ich erinnere mich, dass mein Vater auf mein Zimmer kam und an meinem Bett stand. Er redete aufmunternd auf mich ein und stellte der Pflegerin eine Reihe von Fragen. Dann lachte er herzhaft über eine der Antworten, klopfte mir auf die Schulter und küsste mich. Er sagte, ich solle keine Angst haben, denn es sei nur ein Traum gewesen und der könne mir nichts anhaben.
Aber ich war beunruhigt, denn ich wusste, dass der Besuch der seltsamen Frau kein Traum gewesen war und ich hatte schreckliche Angst. Ein wenig tröstete es mich, als mir das Kindermädchen versicherte, dass sie es gewesen war, die nach mir gesehen und sich dann neben mich ins Bett gelegt hatte und dass ich halb im Traum ihr Gesicht nicht wiedererkannt hätte. Allerdings war ich damit nicht ganz zufrieden, auch wenn die Pflegerin diesen Hergang bestätigte.
Ich erinnere mich, dass an diesem Tag ein ehrwürdiger alter Mann in einer schwarzen Soutane mit der Pflegerin und der Haushälterin in mein Zimmer kam und etwas mit ihnen besprach. Und er sprach auch sehr freundlich mit mir. Sein Gesicht war sanft und lieblich und er sagte mir, dass sie beten würden. Er legte meine Hände zusammen und wollte, dass ich, während sie beteten, sagte: „Oh Herr, erhöre alle unsere guten Gebete um Jesu Christi Willen.“ Ich glaube, es waren genau diese Worte, weil ich sie oft für mich wiederholt habe und meine Pflegerin verwendete sie jahrelang, damit ich sie in meinen Gebeten wiederholte.
Ich kann mich sehr gut an das liebliche, nachdenkliche Gesicht dieses weißhaarigen alten Mannes in seiner schwarzen Soutane erinnern, als er in diesem braunen und hohen Raum stand – mit seinen grob bearbeiteten Möbeln, die schon seit dreihundert Jahren nicht mehr in Mode waren. Spärliches Licht drang durch ein kleines Gitter und schuf eine düstere Stimmung in dem Zimmer. Er kniete sich hin und die drei Frauen mit ihm. Er betete mit lauter, aufrechter und zitternder Stimme für eine längere Zeit, so kam es mir jedenfalls vor. Ich habe mein ganzes Leben vor diesem Ereignis vergessen und auch das, was einige Zeit danach passierte. All das liegt im Dunkeln, aber die Szenen, die ich gerade beschrieben habe, zeichnen sich lebendig ab wie ein einzelnes Bild einer Phantasmagorie umgeben von Finsternis.
KAPITEL II
EIN GAST
Ich werde Ihnen jetzt etwas derartig merkwürdiges erzählen, dass Sie großes Vertrauen in mich haben müssen, um mir diese Geschichte zu glauben. Trotzdem ist sie nicht nur wahr – ich war sogar selbst Augenzeuge dieser Begebenheit.
Es war ein milder Sommerabend und mein Vater forderte mich wieder einmal zu einem Spaziergang in der herrlichen Waldlichtung auf, die, wie ich schon erwähnte, direkt vor dem Schlosstor beginnt. „General Spielsdorf kann uns nicht so bald besuchen kommen, wie ich gehofft hatte“, sagte mein Vater, während wir unseren Spaziergang fortsetzten.
Er wollte uns schon seit einigen Wochen besuchen und wir hatten mit seiner Ankunft am nächsten Tag gerechnet. Er wollte seine Nichte und Mündel, Mademoiselle Rheinfeldt mitbringen, die ich noch nie gesehen hatte, aber die mir als ein überaus bezauberndes Mädchen beschrieben worden war und von deren Gesellschaft ich mir viele glückliche Tage erhofft hatte. Ich war weit mehr enttäuscht, als es sich eine junge Dame vorstellen könnte, die in der Stadt oder in einer belebteren Umgebung zu Hause ist. Von diesem Besuch und der sich daraus ergebenen neuen Bekanntschaft hatte ich wochenlang geträumt.
„Und wann wird er uns dann besuchen kommen?“ fragte ich.
„Erst im Herbst. In zwei Monaten, könnte ich mir denken“, antwortete er. „Und ich bin jetzt sehr froh, meine Liebste, dass du Mademoiselle Rheinfeld nie kennengelernt hast.“
„Und warum?“ fragte ich gekränkt und neugierig.
„Weil die arme junge Dame verstorben ist“, antwortete er. „Ich hatte ganz vergessen, dass ich es dir nicht gesagt hatte, aber du warst gerade nicht im Zimmer, als ich an diesem Abend den Brief des Generals bekam.“
Ich war total schockiert. General Spielsdorf hatte in seinem ersten Brief sechs oder sieben Wochen zuvor bereits erwähnt, dass es ihr nicht so gut ging, wie er es sich gewünscht hätte, aber es gab nicht den leisesten Hinweis darauf, dass für sie Lebensgefahr bestand.
„Hier ist der Brief des Generals“, sagte mein Vater und gab mir den Brief. „Ich fürchte, es hat ihm großen Kummer bereitet. Mir scheint, er war sehr verwirrt, als er diesen Brief schrieb.“
Wir setzten uns auf eine grob bearbeitete Bank unter einer Gruppe von prächtigen Lindenbäumen. Die Sonne ging gerade unter – mit all ihrem melancholischen Glanz hinter dem bewaldeten Horizont. Der Bach, der neben unserem Zuhause vorbei und unter der steilen alten Brücke her floss, schlängelte sich durch eine Gruppe von vielen erhabenen Bäumen zu unseren Füßen, wobei sich in seinem Wasser der verblassende, blutrote Himmel spiegelte. General Spieldorfs Brief war so außergewöhnlich, so leidenschaftlich und an manchen Stellen so widersprüchlich, dass ich ihn noch einmal lesen musste – und so lass ich ihn ein zweites Mal meinem Vater laut vor – ihn aber trotzdem nicht richtig verstehen konnte, es sei denn, man geht davon aus, dass der Schmerz den Verstand des Generals arg verwirrt haben musste.
Dort hieß es: „Ich habe meine geliebte Tochter verloren, denn als solche liebte ich sie. Während der letzten Tage der Krankheit meiner geliebten Bertha war ich nicht fähig, Ihnen zu schreiben.“
„Bevor sie starb, hatte ich keine Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebte. Ich habe sie verloren und habe alles viel zu spät verstanden. Sie starb in friedlicher Unschuld und mit der glorreichen Hoffnung auf eine gesegnete Zukunft. Das Scheusal, das unsere liebevolle Gastfreundschaft missbrauchte, hat das vollbracht. Ich dachte, ich empfinge in meinem Haus die Unschuld und Fröhlichkeit – eine bezaubernde Weggefährtin für meine verlorene Bertha. Heiliger Himmel! Welch ein Narr ich doch war!