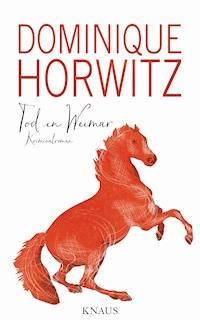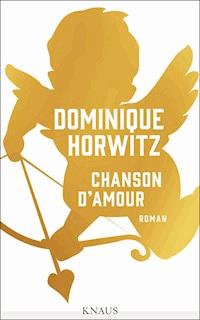
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die ach so verschiedenen Spielarten der Liebe - raffiniert und lebensklug erzählt
Spätsommer in Weimar. Theaterintendant Johannes Sander ist neu in der Stadt, aber die Kulturschickeria, voran der Chefredakteur der Lokalzeitung, will ihn wieder loswerden. Dazu ist jede Intrige recht. Doch ausgerechnet zwischen Sander und Christiane, der Frau des Journalisten, funkt es gewaltig: Das ist nicht die einzige gefährliche Liebschaft im Schatten des Nationaltheaters. In der jungen Ehe von Sanders Freund Roman Kaminski kriselt es, und dessen Adoptivtochter verliebt sich das allererste Mal. Lebensklug und mit viel Esprit erzählt Dominique Horwitz von den ach so verschiedenen Spielarten der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: Shutterstock/Levente
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18717-0V001
www.knaus-verlag.de
Kapitel 1
Das Kastagnettengeklapper der Pferdehufe. Das Flirren des Lichts neben den Radspeichen. Der heiße Atem der Stadt, staubiges Kopfsteinpflaster, Essensdünste, Parfumschwaden, gemischt mit kühleren, modrigen Noten aus geöffneten Kellerluken. All das nahm Roman Kaminski überdeutlich wahr. Er ließ die Pferde im Schritt gehen, locker lagen die Leinen in seinen Händen. Von der Herderkirche schlug es sieben Mal. Kaminski hatte keine Eile an diesem Sonntagabend. Es war Vorfreude, die ihn erfüllte, auch Dankbarkeit. Fast zwei Jahre waren vergangen, seit Laura seinem Leben eine völlig neue Wendung gegeben hatte – ihm, dem scheuen Kutscher und Touristenführer, der so gar kein Talent für Frauen besaß. Noch immer konnte er kaum fassen, dass ihm ein derart unverhofftes Glück widerfahren war.
Laura. In sein wettergegerbtes, vom langen Sommer gezeichnetes Gesicht stahl sich ein Lächeln. Vor seinem inneren Auge sah er sie schon, die Prinzipalin der Wilhelm Meister-Schänke, wie sie mit kluger Besonnenheit die gastronomischen Abläufe lenkte und mit unnachahmlicher Beiläufigkeit an den Geschicken ihrer Gäste teilnahm.
Träge wichen ein paar Touristen der Kutsche aus, ermattet von der Hitze des Tages.
Laura, seine Frau. Darüber konnte er immer noch staunen, so wie über die Tatsache, dass sie gleich nach der Hochzeit zu ihm gezogen war, auf sein halb verfallenes Pferdegestüt. Seitdem hatten sie es halbwegs restauriert oder doch zumindest bewohnbar gemacht. Vor allem das Innere des Gutsgebäudes trug nun eine weibliche Handschrift. Laura hatte die Räume entrümpelt, Wände und Fensterrahmen gestrichen, Bilder ausgesucht. Zum Schluss hatten sie gemeinsam ein neues Bett gekauft.
Das Bett. Kaminski schluckte. Nie würde er ihrer überdrüssig werden, seiner schönen, rätselhaften Frau, nie würde sich die Vibration im Sonnengeflecht legen, wenn sein Blick über ihr spitzbübisches Gesicht wanderte, die kristallblauen Augen, den anmutigen Körper, wenn ihr Blick ihn traf wie ein südlicher Windhauch, der seine Wangen rötete.
Herrje, du bist immer noch so verliebt wie damals, dachte er halb schamhaft, halb belustigt. Falls du je einen Liebesroman schreibst, musst du unbedingt sparsamer mit den schmückenden Adjektiven umgehen und den hohen Ton zurückdrehen. Ist ja kaum auszuhalten, diese Schwärmerei.
Ein abendlicher Sonnenstrahl streifte die Häuserfassaden und warf einen goldenen Widerschein auf die Bogenfenster des WMS, wie die Stammgäste die Schänke nannten. 1890 errichtet, hatte der schmale einstöckige Bau an der Geleitstraße einst als Wintergarten des Hotels Chemnitius gedient. Noch immer ging etwas Heiteres, Spielerisches von ihm aus. Eine Ahnung von Zeiten des gepflegten Müßiggangs, als man nach Weimar pilgerte, um in aller Ruhe durch deutsche Geistesgeschichte zu flanieren. Auch Kafka hatte mit seinem Freund Max Brod in diesem Wintergarten am Tee genippt, zwischen Palmwedeln und livrierten Kellnern.
»Hey, du Penner!« Eine kehlige Mädchenstimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Denk bloß nicht, ich sag jetzt Papa zu dir!«
Kaminski hielt die Kutsche an.
»Hallo Chantal.«
Da stand sie, seine Adoptivtochter. Mit einer Zigarette zwischen den Fingern und abgerissen wie immer, in einem durchlöcherten ultrakurzen Jeansrock und einem schwarzen Netzhemd, unter dem sich ein winziger pinkfarbener BH abzeichnete. Trotz ihrer sechzehn Jahre hätte man sie für zwölf halten können, so schmächtig war sie. Schmutzig grüne Socken hingen über den ausgetretenen Springerstiefeln. Ihr stoppelkurzes Haar trug sie neuerdings weiß gebleicht.
»Hättste nicht gedacht, dass so ein halb verhungertes Aas wie ich mal deine Tochter wird, was?«
»Vorsicht, Süße, sonst überlege ich es mir anders.«
Sie zeigte Kaminski den Stinkefinger.
»Kannst ruhig weiter Frettchen zu mir sagen, du Wichser.«
Nein, von außen betrachtet konnte man dieses Mädchen wahrlich nicht als Wunschtochter bezeichnen, schräg und aufsässig wie sie war. Genau das mochte Kaminski an ihr. Chantal nahm kein Blatt vor den Mund, doch sie hatte das Herz auf dem rechten Fleck. Heute würden sie ihre offizielle Aufnahme in die Familie feiern. Für Kaminski war es eine Herzensangelegenheit gewesen, und Laura hatte ohne Zögern zugestimmt. Auch dafür liebte er seine Frau.
Mit einem Satz sprang er vom Kutschbock. Während er die Pferde zu dem kleinen Brunnen neben der Schänke führte, trat Frettchen ihre Zigarette aus. Nein, nicht Frettchen – sie heißt Chantal, ermahnte er sich. Noch am Abend zuvor hatte ihm Laura eindringlich die Macht der Sprache erklärt: dass Begriffe die Wahrnehmung steuern und Worte die Wirklichkeit erschaffen. Deshalb nahm er sich vor, ab heute nur noch Chantal zu sagen statt Frettchen, auch wenn ihm dieser eigenwillige Spitzname in Fleisch und Blut übergegangen war.
»Wenn du glaubst, dass ich später deinen Rollstuhl schiebe und dir deinen bescheuerten Arsch abwische, dann kannste dir das gleich von der Backe putzen. Kapiert?«, riss Frettchen – nein, Chantal! – ihn aus seinen Überlegungen.
»Wie schön, dass die neuen Familienverhältnisse dich so euphorisieren«, brummte Kaminski. »Sonst noch was?«
»Ja, drinnen ist die Hölle los. Alles voll. Lauter blöde Wichser …«
»Chantal!« Sein Ton wurde scharf. »Arbeite an deiner Ausdrucksweise!«
Sie streckte ihm die Zunge heraus. Dann band sie Wanda und Bismarck an, die freudig schnaubten, und tätschelte ihnen den Hals.
»Okay, ich halt die Klappe. Sweet Laura wartet schon auf dich. Küsschen, Küsschen!«
Geschickt duckte sie sich unter der Peitsche hindurch, mit der Kaminski scherzhaft nach ihr schlug, und verschwand in der Wilhelm Meister-Schänke. Es versprach, ein interessanter Sonntagabend zu werden. An der Klapptafel auf dem Bürgersteig stand »Wegen Familienfeier durchaus geöffnet«. Stimmengewirr und das Klirren von Gläsern drangen nach draußen, zusammen mit abgerissenen Musikfetzen einer italienischen Melodie: That’s amore.
Kaminski summte leise mit. Manchmal schalt er sich einen verliebten Esel, aber das war Selbstironie. Die alte Angewohnheit eines Mannes, der Glück in der Liebe für verlogenen Kitsch gehalten hatte. Bis Laura in sein Leben getreten war.
Sie empfing ihn an der Türschwelle, in einem Etuikleid aus hellblauer Seide, das er besonders mochte, weil es einen aparten Kontrast zu ihrem blonden, straff nach hinten gebundenen Haar bildete. Dazu trug sie pfirsichfarbene Pumps. Sie war fast ungeschminkt und hatte keinen Schmuck angelegt, bis auf den goldenen Ehering. Wie elegant sie wirkte. Wie souverän.
»Mein kleiner Philosoph. Hast dich ja richtig fein gemacht. Weißes Oberhemd, dunkelblaue Hose, sogar anständige Schuhe – alles für Chantal?«
Er berührte ihre Wangen mit den Lippen, sog ihren Duft ein, widerstand der Versuchung, sie an sich zu pressen.
»Alles für dich«, murmelte er, und beide wussten, dass er nicht nur seine Kleidung meinte.
»Dann lass uns reingehen. Die Gäste sind schon da, mit gezückten Handys, versteht sich. Wenn wir die Neuigkeit verkünden, wird sie sofort die Runde machen, via Twitter, Snapchat, Facebook …«
Kaminski stöhnte.
»Snap- was?«
Nacheinander betraten sie den lang gestreckten Schankraum. An den honigfarben gebeizten Paneelen hingen Efeugirlanden, überall standen Vasen mit Sonnenblumen, als hätte Laura den ausklingenden Sommer hereingeholt. Einige der abgeschabten Holztische waren weiß eingedeckt und zu einer festlichen Tafel zusammengeschoben worden.
Während Kaminski auf den Tresen zuging, schwoll das Stimmengewirr an. Er wusste, dass man eine Rede von ihm erwartete oder doch zumindest einige Worte über den Anlass dieses Abends. Unschlüssig rieb er seinen rasierten Kopf. Die vielen Jahre als Kutscher hatten ihn verändert. Obwohl er früher Schauspieler gewesen war, lagen ihm öffentliche Auftritte nicht mehr. Zumal dann, wenn es um Gefühle ging. Und diese Patchworkfamilie war hoch emotionales Terrain.
Er begrüßte gerade Freunde und Stammgäste an der Tafel und überlegte, wann der angemessene Zeitpunkt für ein paar Sätze sein mochte, als Chantal unaufgefordert mit einem silbernen Esslöffel auf den Metalltresen schlug.
»Tädäää! Der olle Kaminski will was ablassen! Spoileralarm, Leute – hat was mit Kindern zu tun!«
Zu früh, viel zu früh. Es wurde still. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Laura nickte ihm zu.
»Tja, sieht so aus, als hätte ich den Hauptgewinn abgeräumt«, seufzte Kaminski. »Erst die tollste Frau der nördlichen Hemisphäre, und nun auch noch …«
»... ein perfekt geschorenes Frettchen. Hab mich sogar zur Feier des Tages extra zwischen den Beinen rasiert.«
Kaminski klappte die Kinnlade runter. Er brauchte einen Moment, bevor er sich wieder an seine Zuhörer wenden konnte.
»Wie immer verhaltensoriginell, unsere Chantal.«
»Für dich immer noch Frettchen«, krähte das kleine Biest dazwischen.
»Egal, sie hat sich hervorragend gemacht, seit sie vor mehr als einem Jahr hier im WMS angefangen hat. Sogar ihren Schulabschluss hat Chantal«, er blickte streng zu ihr hinüber, »nebenbei hingebogen, und den Mopedführerschein hat sie auch bestanden. Deshalb hat das Jugendamt zugestimmt, dass wir sie – adoptieren.«
Nun war es totenstill. Alle starrten Kaminski und Laura mit offenem Mund an, manche lächelten ungläubig, und im selben Augenblick wurde ihm klar, dass die Gäste offenbar etwas ganz anderes erwartet hatten: selbst gemachten Nachwuchs im Hause Kaminski.
Als Erste fing sich Christiane, Lauras engste Freundin. Sie stand auf und lief mit federnden Schritten zum Tresen. Überschwänglich umarmte sie erst Kaminski, dann seine Frau.
»Ihr seid wunderbar«, flüsterte sie Laura sichtlich bewegt ins Ohr. »Als Lehrerin weiß ich, wie schwer es ist, labilen Jugendlichen eine Struktur zu geben, eine Perspektive, ein Lebensziel. Genau das habt ihr geschafft, obwohl niemand daran geglaubt hat.« Sie erhob ihre Stimme. »Respekt – und herzlichen Glückwunsch! Auch dir, Chantal!«
Damit war das Eis gebrochen. Chantal grinste vergnügt, als sich die Gäste nun einer nach dem anderen zu Laura und Kaminski durchdrängten, ihnen die Hände schüttelten, auf die Schulter klopften und versicherten, dass sie diese Adoption einfach großartig fänden.
Kaminski wusste, was er davon zu halten hatte. Sicher, dies waren ihre besten Freunde und einige langjährige Stammgäste des WMS, doch dieses Mädchen war und blieb eine Außenseiterin, so wie auch er letztlich immer ein skeptisch beäugter Exot bleiben würde. Ein zugereister Wessi, der in einem kleinen Dorf nahe Weimar das Gestüt seiner Großeltern übernommen hatte und nun Touristen durch die Stadt kutschierte, wobei er nur zu gern Verse der Klassiker rezitierte. Ein aus der Zeit gefallener Beruf, wie manche meinten. Dass er wegen seines Könnens und seiner Belesenheit von den Honoratioren der Stadt geachtet wurde, machte es nicht besser.
Er zuckte zusammen, als direkt neben ihm auf dem Tresen Korken knallten. Mit geübten Bewegungen öffnete Chantal Proseccoflaschen und füllte eine ganze Batterie von Gläsern. Laura verteilte sie an der Tafel, wo die Sensation lautstark besprochen wurde.
»Wohl bekomm’s, lang lebe deine Prostata«, raunte Chantal Kaminski zu, während sie ihm ein Glas reichte.
Er trank einen Schluck.
»Gratulation zur gelungenen Resozialisierung, mein Schatz. Wenn du brav bist, darfst du demnächst die eine oder andere Kutschfahrt übernehmen.«
Chantals Augen wurden groß wie Untertassen. Für einen Moment wich ihr notorischer Trotz kindlicher Begeisterung. Aufgeregt fuhr sie sich mit beiden Händen durch das weiße Raspelhaar.
»Echt jetzt?«
Es war ihr größter Traum. Seit Monaten übte sie das Kutschieren auf dem Hofgelände unter Kaminskis wachsamen Augen. Überdies striegelte sie täglich die Pferde, gab ihnen frisches Heu und spannte sie an, wenn Kaminski nach Weimar aufbrach. Chantal liebte Pferde. So hatte alles angefangen, damals, als sie zum ersten Mal im Gestüt aufgetaucht war. Eine verkommene Streunerin, die sich ihren täglichen Wodka mit kleinen Einbrüchen finanziert hatte, vom Vater misshandelt, von jugendlichen Dorf-Neonazis verfolgt.
»Wie gesagt, wenn du brav bist.« Er zwinkerte ihr zu. »Also halt dich gerade, Sonnenschein.«
Kaminski schaute zu seiner Frau. Sie wurde förmlich belagert. Voller Stolz registrierte er, wie viel Achtung man ihr entgegenbrachte. Laura war mehr als die Geschäftsführerin ihres Lokals. In Weimar galt sie als umsichtige Gastgeberin und verschwiegene Vertrauensperson. Und natürlich hatte sie jede Menge Verehrer, die nicht verstanden, warum sie ausgerechnet den seltsamen Kauz mit dem heruntergekommenen Pferdegestüt geheiratet hatte.
»Gnädigste, darf ich Sie küssen?«, fragte ein untersetzter Herr mit Halbglatze und einem sorgfältig gestutzten, ergrauten Kinnbärtchen.
Laura ließ es geschehen, aber Kaminski entging nicht, dass sie innerlich auf Abstand ging, als der Mann seine fleischigen Lippen ihrem Gesicht näherte und ihr weltmännisch Küsschen auf die Wangen hauchte. Torsten Kuzer arbeitete beim Weimarer Anzeiger für das Ressort »Vermischtes«. Tagtäglich pumpte er lokale Petitessen wie Taschendiebstähle, Erbstreitigkeiten oder Probleme mit der Müllabfuhr zu relevanten Nachrichten auf. Kein unsympathischer Mann, aber ein wenig aufdringlich, wie Kaminski fand. Offenbar musste er sich immer wieder selbst beweisen, dass er dazugehörte. Eine lässliche menschliche Schwäche. Leider übertrieb er es bisweilen damit, und auch mit seinem Humor konnte Kaminski beim besten Willen nichts anfangen.
»Ist ja mutig, so eine Göre unter seinem Dach wohnen zu lassen«, lachte Kuzer. »Da kann man nur hoffen, dass sie keine Filzläuse einschleppt, was?«
Seine Hand legte sich um Lauras Hüfte. Höchste Zeit einzuschreiten.
»Darf ich Ihnen meine Frau entführen?«, fragte Kaminski.
»Immer chevaleresk, der Herr Kutscher«, antwortete der Journalist.
Chevaleresk. Das war typisch Kuzer. Dauernd warf er mit Fremdwörtern um sich wie ein Karnevalsprinz mit Kamellen.
Laura lächelte unergründlich.
»Ja, Kaminski ist mein Ritter. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen würden …«
Sie entwand sich Kuzers Griff und ließ sich von Kaminski zu einem Tisch am Fenster führen, wo Christiane saß. Allein, abseits der festlichen Tafel und nachdenklicher als sonst. An ihrem Prosecco hatte sie nicht einmal genippt. Müde strich sie ihr langes, dunkles Haar aus dem madonnenhaften Gesicht.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Laura.
»Jaja. Doch.«
Es klang halbherzig. Christiane gehörte zu jenen Frauen, um die man sich immer ein wenig Sorgen machen musste. Weil sie dünnhäutiger war, als sie schien, durchlässig für Stimmungen und Zwischentöne, die anderen entgingen.
»Die Leute hier begreifen gar nicht, was ihr leistet«, flüsterte sie. »Dass ihr ein Mädchen gerettet habt. Die tun so, als würden sie andauernd für Katastrophenopfer und hungernde Kinder spenden, aber was vor ihrer eigenen Haustür passiert, interessiert sie einen feuchten Kehricht.«
»Wundert dich das etwa?«, erwiderte Laura. Sie tauschte einen Blick mit Kaminski. »Doch was sie wirklich nicht begreifen – wie viel Spaß man mit Chantal haben kann. Stell dir vor, neulich hat dieser Satansbraten …«
Die Ankunft eines neuen Gastes unterbrach sie. Kaminski kannte ihn flüchtig. Johannes Sander war der neue Intendant des Nationaltheaters, ein muskulöser Hüne mit braunem halblangem Haar, das strähnig in die Stirn fiel und ihm etwas Jungenhaftes verlieh. Mit energischen Schritten durchquerte er das Lokal und stützte sich auf den Tresen.
»Einen Espresso. Und einen Bourbon. Bitte schnell.«
»Alles in eine Tasse?«, feixte Chantal. »Vielleicht noch einen Schuss Zitrone rein?«
Johannes Sander atmete schwer. Geistesabwesend betrachtete er seine zitternden Hände.
»Von mir aus …«
An den Tischen wurde getuschelt, wissende Blicke flogen hin und her. Alle hatten zwei Wochen zuvor den vernichtenden Verriss seiner Inszenierung des Freischütz gelesen. Dr. Wolf von Nesselröden, Chefredakteur des Weimarer Anzeigers, hatte den Artikel höchstpersönlich geschrieben und – so kolportierte man es im WMS – auch höchstpersönlich auf die Titelseite der Zeitung gehievt. Tagelang war seine Fundamentaldemontage des neuen Intendanten das Topthema in Weimar gewesen, und noch immer wurde darüber debattiert.
Natürlich hatte auch Kaminski den Artikel gelesen und sich über den aggressiven Stil gewundert. Er kannte den Zeitungschef nicht persönlich, hatte ihn aber mehrfach bei offiziellen Veranstaltungen erlebt. Wolf von Nesselröden war eine auffallende Erscheinung, hoch aufgeschossen, mit einer seltsam linkischen Eleganz. Selbst bei größter Hitze trug er stets einen dunklen Anzug. Im WMS wurde gemunkelt, er verfüge über einen ausgeprägten Ehrgeiz und strebe womöglich hohe politische Ämter an. Er galt als Strippenzieher hinter den Kulissen von Politik und Kultur. Warum er jedoch den neuen Intendanten in Grund und Boden kritisierte, war Kaminski ein Rätsel. Sander wirkte ziemlich mitgenommen. Guter Typ, dachte Kaminski. Einer, der zupacken kann. Laura war zu ihm geglitten, Kaminski schloss sich ihr an.
»Jeder hat es hier am Anfang schwer, Herr Sander«, sagte Laura. »Die sogenannte Weimarer Kulturelite kennt nur Dünkel, Neugier ist ihr fremd. Bevor die jemanden akzeptieren, schleifen sie ihn erst mal durch den Schlamm.«
Fahrig öffnete der frischgebackene Intendant den zweitobersten Knopf seines blau-weiß gestreiften Hemds.
»Nur der verdient sich Freiheit, der täglich sie erobern muss«, erwiderte er heftig.
»Faust, der Tragödie zweiter Teil, keine schlechte Wahl für den Anfang.« Kaminski streckte ihm die Hand hin. »Gestatten, Roman Kaminski, Kutscher und Gatte unserer charmanten Gastgeberin. Willkommen in Weimar. Dann hoffen wir mal, dass Sie sich nicht so schnell ins Bockshorn jagen lassen. Wir haben lange darauf gewartet, dass ein frischer Wind durchs Nationaltheater weht.«
»Danke, sehr nett von Ihnen.« Johannes Sander schüttelte Kaminskis Hand. »Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass ich gleich mit meiner ersten Regiearbeit einen derartigen Sturm entfache. Normalerweise gibt man Neulingen eine faire Chance, statt sie sofort niederzumachen.«
Plötzlich stutzte er. Seine Züge entspannten sich. Die Zeit schien stillzustehen. Kaminski folgte Sanders Blick. Er sah zum Fenster, wo Christiane saß, das Kinn in die Hände gestützt, und den Intendanten wie eine Erscheinung anstarrte. Was ging hier vor?
»Nur nicht so vorwitzig, Herr Sander«, meldete sich Torsten Kuzer zu Wort, der sich unbemerkt herangedrängelt hatte. »Doktor von Nesselröden ist nicht nur Chefredakteur des Weimarer Anzeigers, er ist auch ein hoch kompetenter Journalist und in den Künsten versierter Connaisseur.«
Johannes Sander musterte den Herrn vor sich.
»Ach ja? Sagt wer?«
»Kuzer, Torsten. Torsten ohne H und Kuzer mit langem U, Redakteur des Weimarer Anzeigers. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Lassen Sie die Klassiker unversehrt. Wir sind hier in der Stadt Schillers und Goethes, nicht in Berlin, wo auf der Bühne kopuliert und fäkiert wird.«
»Fäkiert?« Chantal, die hinter dem Tresen stand und zugehört hatte, lachte dreckig. »Heißt das etwa, die scheißen sich eins vor Publikum?«
»Kind, sei so gut und kümmere dich um die Bestellung von Herrn Sander«, sagte Laura mit einem warnenden Unterton.
»Steht schon direkt vor seiner niedlichen Nase«, antwortete Chantal kichernd und fügte ein »liebste Mami« hinzu.
Wortlos kippte der Intendant erst den Espresso, dann den Bourbon hinunter. Als er wieder zum Fenster schaute, war Christianes Platz leer.
»Ich geh dann mal.« Er fingerte einen Geldschein aus seiner Hosentasche. »Tut mir leid, dass ich in Ihre Feier reingeplatzt bin. Ich habe zwar das Schild vor der Tür gesehen, aber …«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen«, fiel Kaminski ihm ins Wort. »Sie sind hier immer willkommen. Und ganz egal, was dieser von Nesselröden schreibt, wir jedenfalls sind ehrlich froh, dass Sie das Theater übernommen haben.«
»Die Getränke gehen selbstverständlich aufs Haus«, ergänzte Laura.
»Dankeschön. Was feiern Sie eigentlich?«
»Die Adoption eines Satansbratens«, griente Kaminski.
Grüßend hob Johannes Sander die Hand.
»Na, dann viel Glück.«
Nach einem erneuten Blick zum Fenster trottete er mit hängenden Schultern hinaus.
»Hast du es bemerkt?«, wisperte Laura.
Kaminski deutete mit dem Kopf auf Christianes verlassenen Stuhl.
»Du meinst …«
»Der vögelt sie bald, hundert pro!«, krakeelte Chantal los.
Kaminski fixierte sie drohend.
»Apropos Vögel, du kannst jetzt die Hühnersuppe servieren«, beendete Laura das Gespräch. »Und bitte, wasch dir unbedingt die Hände, bevor du wieder die Daumen in die Teller hängst.«
Kapitel 2
Von Ferne hallte der Stundenschlag der Herderkirche durch das nächtliche Weimar. Zehn, elf, zwölf, zählte Dr. Wolf von Nesselröden. Mitternacht schon. Wo Christiane nur blieb? Er hatte es rundheraus abgelehnt, seine Frau zur groß angekündigten Feier in der Wilhelm Meister-Schänke zu begleiten. Zu ihrer Freundin Laura, die streng genommen kein Umgang für seine Gattin war. Und überhaupt – was wollte Christiane auf dieser als Familienfeier deklarierten Party? Familie, das waren für ihn Name, Ehre, Stolz, Verpflichtung. Und ganz bestimmt keine Wirtin, die einen Kutscher geheiratet hatte, wenn auch Kaminski einen gewissen Ruf als Kenner der Geschichte und Literatur Weimars genoss. Nun ja. Jedenfalls opferte er solch zweifelhaften Leuten keine Zeit. Lieber saß er zu Hause am Schreibtisch und arbeitete.
Seine Feder glitt über das Büttenpapier, vielmehr – sie hätte gleiten sollen. Gleiten, und nicht dieses irritierend kratzende Geräusch von sich geben, wie von leichtem Juckreiz verursacht. Auf der Stelle spürte er seine Neurodermitis, ein Spannen und Jucken, als häute er sich wie ein Reptil. Seine Haut wimmerte geradezu danach, entfernt zu werden, und er wusste, dass er dieser Versuchung nicht mehr lange widerstehen konnte. Bald würden sich seine Fingernägel erbarmen und die jammernde Haut unter den Hemdmanschetten erlösen, endlich erlösen. Einstweilen wollte er sich noch beherrschen.
Mit einer abgezirkelten Bewegung tauchte Wolf von Nesselröden die Feder in ein Tintenfass, das neben ihm auf dem Schreibtisch stand. Kugelschreiber oder Filzstifte lehnte er kategorisch ab. Nein, Tinte und Feder – so viel Stil musste sein. Sein Schreibzeug betrachtete Wolf von Nesselröden als eine Hommage an den Geheimen Rat von Goethe, der Politiker und literarisches Genie in Personalunion gewesen war. Ein Vorbild, keine Frage.
Vorsichtig, um keine Flecken zu machen, setzte er die Feder wieder auf das Papier und schrieb ein großes W. W wie Weimar. Das Kratzen auf dem Bütten – er hatte sich vor Kurzem aus dem Badischen zweihundert Bögen kommen lassen – war ihm ein trauter Gefährte geworden. Kein Freund, eher ein schicksalhafter Begleiter auf dem Marsch zum großen Ziel. Wenn er es schaffte, sein Werk zu vollenden, das niederzuschreiben, was sich außer ihm niemand traute, dann wäre er es, der unbestechliche Dr. Wolf von Nesselröden, der die skandalösen Missstände am Nationaltheater entlarven und das große Weimar, Symbol deutscher Kunst und Kultur, retten würde. Und nicht nur Weimar …
Der Schreibtischsessel knarzte, als er sich zurücklehnte. Feindselig blickte er auf den beigefarbenen Bogen, der ihn hämisch anzugrienen schien. Na los doch, schreib was, Wolf, etwas Einzigartiges, Brillantes, das dich wie ein Komet an allen anderen vorbeiziehen lässt. Worauf wartest du denn? Etwa Angst vor der eigenen Courage?
Nein, die Zeit war noch nicht reif. Die wenigen unnützen Worte, die er sich in langen Stunden abgequält hatte, schauten verloren drein. Sie mussten sich noch ein wenig gedulden, bis er sie schmieden und zu schneidenden Sätzen schärfen würde.
Er stand auf, ignorierte das Gefeixe des Papiers. Da wurde der aufgestaute Drang übermächtig, und endlich gab er ihm nach, kratzte sich wie von Sinnen an der Innenseite des rechten Handgelenks, kratzte sich bis aufs Blut. Ah, wie sehr er die wenigen Sekunden seliger Erleichterung genoss, die winzige Zeitspanne zwischen befriedigtem Juckreiz und neuerlichen Attacken.
Hör auf, dich zu kratzen, hörte er wie von fern die strenge Stimme seines Vaters. Wolf von Nesselröden verzog das Gesicht.
Mein Vater, der immer wollte, dass ich etwas Besseres werde – das sei ich unserem Namen schuldig. Mein Vater, der aus völlig verarmtem Adel stammt und sich als Buchhalter eines Steinbruchs im Westerwald durchgeschlagen hat, stets überkorrekt gekleidet und peinlichst darauf bedacht, dass wenigstens sein Sohn es zu etwas bringt
Als Kind hatte Wolf von Nesselröden unter dem immensen Erwartungsdruck seines Vaters gelitten, mittlerweile war er fest entschlossen, ihn nicht zu enttäuschen. Zuerst würde er in Weimar aufräumen. Danach würde er für immer der Provinz entfliehen, zurück nach Berlin, wo er studiert hatte, anschließend jedoch von den Hauptstadtmedien verschmäht worden war. Das würde sich ändern, schon bald.
Er schritt durch sein spartanisch eingerichtetes Arbeitszimmer. Eine gläserne Schreibtischplatte auf Stahlrohrbeinen, ein ergonomisch geformter Arbeitsstuhl, schwarze Metallregale voller Lexika. Nachschlagewerke waren seine Leidenschaft. Ein Wolf von Nesselröden googelte nicht. Stattdessen holte er bevorzugt die alten Folianten des Brockhaus oder des Meyers Konversations-Lexikons aus dem Regal, manchmal auch einen Band der Encyclopaedia Britannica, die er für ein paar Hundert Euro in einem Jenaer Antiquariat erstanden hatte. Bei literarischen Fragen konsultierte er den Kindler, bei musikalischen Unsicherheiten den Riemann. Klassiker. So, wie es sich gehörte.
Zerstreut nahm er den ersten Brockhausband aus dem Schuber, A bis AT. Manchmal schaute er aus purer Verlegenheit in seine Lexika, weil er sich irgendeine Inspiration erhoffte, wenn er durch die Seiten blätterte. »Altnordisches Schrifttum, Alto Adige, Altona …«, las er halblaut. Doch nichts klingelte. Keine zündende Idee, keine noch so vage Assoziation, die zu einem erhellenden Gedanken hätte führen können, wollte sich einstellen. Nein, selbst diese bewährte Technik funktionierte heute nicht. Frustriert schob er den Band zurück ins Regal.
Sein Rücken schmerzte stärker als sonst. Als er sich streckte, knackte seine Wirbelsäule, wütend und gekränkt, als sei ihr der aufrechte Gang mit Gewalt auferlegt worden. Überhaupt waren sein Körper und er einander immer fremd geblieben. Viel zu früh war er in die Höhe geschossen. Grausame Pubertät. Kaum im Stimmbruch, hatte er sich in eine dürre Bohnenstange verwandelt. Doch sein Körper hatte die Stimme nicht mitgenommen, oder sie, unachtsam wie er war, vielleicht einfach nur in den Strapazen des Wachstums vergessen. Deshalb war sie nie die Stimme eines Mannes geworden, sondern einsam und piepsig im Niemandsland zwischen Kinderzeit und Erwachsensein gefangen geblieben, auf ewig zum Fisteln verdammt. Er hasste seine Stimme, wegen der er als junger Mann so oft gehänselt worden war.
Wolf von Nesselröden erschauerte. Fröstelnd sah er sich um. Dieser Trakt der Wohnung war eigentlich viel zu kalt, selbst jetzt, im ungewöhnlich heißen Spätsommer, der seine alles versengende Hitze über die Stadt breitete. Doch die Kühle der nördlich ausgerichteten Räume war gut, gut für seine geschundene Haut.
Immer noch steif vom langen Sitzen wechselte er ins Nebenzimmer. Als er die Zeitung mit seinem Artikel über den Freischütz auf dem schlichten Beistelltisch des Nebenraums, Empfangsraum genannt, entdeckte, besserte sich seine Laune. Plötzlich war alles vergessen, die Erinnerungen an seine freudlose Kindheit, die Antriebsschwäche, das permanente körperliche Unbehagen. Auf der Titelseite prangte ein Foto von Johannes Sander. Ein unvorteilhaftes Foto, mit Bedacht ausgewählt. Es zeigte den neuen Intendanten verschwitzt und erschöpft auf der Premierenfeier, mit einem Glas Wein in der Hand. Überfordert? Oder dreist provokant? Das Desaster des Johannes Sander. Chronik einer Fehlentscheidung stand in großen Lettern darüber.
Der Artikel hatte für einigen Wirbel gesorgt, ein erster Schritt in die richtige Richtung, davon war Wolf von Nesselröden überzeugt. Auch wenn er heute so gut wie nichts zu Papier gebracht hatte, war er auf dem besten Wege, sich als unerschrockener Kämpfer für die Kultur zu profilieren. Zunächst würde er Johannes Sander systematisch als Hochstapler und Nichtskönner entlarven, danach wäre die Bahn frei für eine glänzende Karriere, am besten als Herausgeber eines renommierten Blattes.
Nachdenklich drehte er an dem goldenen, mit einem Smaragd verzierten Siegelring, den er sich vor Kurzem hatte anfertigen lassen und seither am linken kleinen Finger trug. In den dunkelgrünen Edelstein hatte er das Wappen derer von Nesselröden einprägen lassen: zwei fünfblättrige Nesselstauden mit Wurzelwerk, anmutig umrankt von einer Blättergirlande. Noblesse oblige. Auch hohe politische Ämter sind vorstellbar, überlegte er. Als Chefredakteur war ihm die Mechanik politischer Karrieren vertraut. Kluges Networking, exzellente Kontakte zur Presse, immer bereit sein, einem Höhergestellten einen Gefallen zu tun, um später die Belohnung einzustreichen, Eintreten in die richtige Partei zur richtigen Zeit, so funktionierte das Postenkarussell.
Wieder streckte er sich, und es kam ihm auf einmal so vor, als sei ihm der Maßanzug zu eng geworden. Auch Weimar war ihm längst zu eng geworden. Es gab eben Menschen, die zu Höherem bestimmt waren, und er gehörte definitiv in diese Kategorie. Das war auch die Meinung seiner Professoren gewesen, als er in Berlin studiert hatte. Weimar war ein Sprungbrett, mehr nicht. Jetzt kam es nur noch darauf an, die richtige Strategie zu verfolgen, um es allen zu zeigen – seinem ewig nörgelnden Vater genauso wie der staunenden Öffentlichkeit.
Aber immer anständig bleiben, hörst du?, flüsterte die Stimme seines Vaters, mach deinem Namen Ehre. Unangenehm berührt biss sich Wolf von Nesselröden auf die Unterlippe. Ja doch, dachte er, aber zuweilen darf man es mit den Details nicht so genau nehmen, wenn man einer größeren Wahrheit dienen will. Hieß es nicht, der Zweck heilige die Mittel? Sander musste weg. Seine Ära würde beendet sein, bevor der erste Schnee fiel.
Mit verschränkten Armen trat Wolf von Nesselröden zum Fenster. Es war stockdunkel draußen, von der nahen Herderkirche schlug es ein Viertel nach Mitternacht. Straßenlaternen tupften hellgelbe Lichtinseln auf den Asphalt, nur wenige Wagen waren noch unterwegs.
Wann kam Christiane endlich nach Hause? Feierte sie etwa unbedarft mit ihren seltsamen Freunden, während er über ihre Zukunft nachdachte? Ihm gefielen diese Alleingänge seiner Frau nicht. Überhaupt gefiel ihm in letzter Zeit so einiges nicht an seiner Ehe. Manchmal schien es ihm, als entgleite Christiane seiner Autorität. Mehr noch – als habe sich ihr Verhältnis empfindlich abgekühlt. In unbeobachteten Momenten ertappte er Christiane neuerdings dabei, dass sie ihn wie einen Fremden betrachtete. Skeptisch, fast ablehnend. Niemals hätte er ihr gestanden, wie sehr ihn das verletzte.
Er schluckte. Ich will geliebt und geachtet werden, Christiane, nicht nur geduldet. Will nicht jeder Mensch geliebt und geachtet werden?
Ein Auto hupte. Jetzt erst sah er unten auf der Straße die Kutsche, die sich aus der Schwärze schälte. Hinten auf der Sitzbank hockte eine kleine, magere Gestalt, ein Kind vielleicht, das dem hupenden Autofahrer den Mittelfinger zeigte. Auf dem Kutschbock schmiegte sich ein Paar eng aneinander, fast schien es, als würden die beiden sich küssen.
Wolf räusperte sich unwillkürlich. Die Vorstellung körperlicher Nähe war ihm unbehaglich. Sekundenlang betrachtete er sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Warum feierte Christiane mit anderen die Nacht durch, statt dort zu sein, wo sie hingehörte? Zögerte sie absichtlich den Moment hinaus, in dem sie gemeinsam im Ehebett lagen und sich schlafend stellten, stumm einander im Dunkel belauernd, wie so oft in letzter Zeit? Mit einer heftigen Bewegung zog er die Vorhänge vor die Fensterscheibe.
Kapitel 3
Es war weit nach Mitternacht, als die Kutsche das kleine Dorf hinter sich gelassen hatte, in dessen Nähe Kaminskis Pferdehof lag. Seit einigen Jahren wohnte er hier auf dem Land, doch erst seit Laura dort mit ihm lebte, empfand er stets eine freudige Wärme, wenn er den hölzernen Torbogen passierte. Im fahlen Licht der Hofbeleuchtung zeichneten sich linker Hand die niedrigen Stallungen ab, gegenüber das wuchtige Gutsgebäude. Ein einstmals herrschaftlicher Bau, dessen bröckelnder Stuck gnädig vom Dunkel verschluckt wurde. Was die DDR überlebt hatte, rottete seit Jahrzehnten weiter vor sich hin. Es würde noch lange dauern, bis alles vollständig renoviert war und man die alte Pracht zumindest wieder erahnte.
Tief atmete Kaminski die nächtlichen Gerüche ein, den Duft von frisch gemähtem Gras, die penetranten Aromen des Misthaufens, die würzigen Noten der taubedeckten Wiesen ringsum. Wanda und Bismarck warfen ungeduldig die Köpfe hin und her in Erwartung des Stalls und einer Extraportion Hafer nach diesem langen Tag.
Sacht drückte Kaminski Laura an sich, deren Kopf im Halbschlaf an seine Schulter gesunken war.
»Sind wir zu Hause?«, murmelte sie.
Zuhause. Ein ungewohntes Wort, immer noch. So ungewohnt wie das Wort Familie. Er küsste Laura aufs Haar, ihre rechte Hand schlang sich in seine linke.
»Wenn ihr dauernd rummacht wie die Karnickel, krieg ich Geschwister, und das stresst brutal«, gluckste Chantal, die hinten quer auf dem Sitz lag.
»Möchtest du heute im Stall übernachten, Liebes?«, knurrte Kaminski.
»Okay, hab’s geschnallt.« Sie richtete sich auf und gab ihm einen Klaps auf den Rücken. »Ihr könnt ins Bett und losrattern, ich kümmere mich um die Pferde.«
Laura drehte sich zu ihr um.
»Wie lieb von dir. Wenn du doch bloß ab und zu deine Klappe halten könntest.«
»Negativ.«
Chantal streckte ihr die Zunge heraus und sprang aus der Kutsche. Kaminski schüttelte den Kopf, halb verärgert, halb amüsiert. Dann saß er ab und streckte die Arme nach Laura aus.
»Reich mir die Hand, mein Leben, komm auf mein Schloss mit mir«, trällerte er.
Die erhoffte Reaktion blieb aus. Trotz der Dunkelheit sah Kaminski, dass Laura einen erschöpften Eindruck machte. Kerzengerade blieb sie auf dem Kutschbock sitzen.
»Ich bin todmüde.«
»Verstehe, es war ein anstrengender Tag, aber die Feier war doch gelungen, oder? Alle haben sich sehr wohlgefühlt.«
»Auch ich habe den Abend genossen. Aber weißt du überhaupt, wie anstrengend es ist, dauernd dieses Frettchen im Auge zu haben, damit es die Leute nicht vor den Kopf stößt? Sie zerschlägt permanent Porzellan, und ich bin es leid, immer die Scherben aufzusammeln.«
Nach einem langen Seitenblick auf Chantal, die demonstrativ pfeifend begonnen hatte, die Pferde abzuschirren, räusperte er sich.
»Lass uns morgen darüber reden.«
»Nein, jetzt«, beharrte Laura. »Der richtige Zeitpunkt kommt sowieso nie. Chantal tanzt uns auf der Nase herum. Sie macht sich zwar ganz gut im Restaurant, aber sie schwänzt die Berufsschule, und, ehrlich gesagt, habe ich pubertäres Gehabe immer schon verabscheut.«
Irritiert schaute Kaminski zu ihr hoch. Himmelherrgott noch mal, was war bloß in Laura gefahren, dass sie ausgerechnet jetzt so ein Fass aufmachte? Sicher, Chantal war dankbar, dass er sie aufgenommen hatte, damals, als sie bei ihm im Stall aufgetaucht war, verwahrlost, grün und blau geprügelt von ihrem trinkenden Vater. Und genauso sicher war Kaminski, dass sie sich glücklich schätzte, jetzt offiziell zur Familie zu gehören. Aber Umgangsformen oder gar Taktgefühl ließen sich nicht mit dem Morgenkaffee verabreichen. Nach wie vor hatte Chantal etwas Asoziales an sich. Ihr nie gestilltes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit äußerte sich immer noch in nervtötenden Provokationen. Bislang hatte Laura diese Verhaltensauffälligkeit ebenso gelassen und humorvoll hingenommen wie er. Bislang.
»Sag mir, Schatz, wieso reagierst du gerade jetzt so heftig?«, erkundigte er sich vorsichtig.
»Weil ihr Kerl heute da war«, ging Chantal dazwischen.
Kaminski schluckte.
»Ihr – was?«
»Na, ihr Ex-Lover. Scharfes Gerät. So’n Porsche-Sack mit Rolex und so. Hat sich aber sofort verpisst, als du angewackelt kamst.«
Vollkommen perplex sah Kaminski zu, wie Laura mit eigentümlich steifen Bewegungen vom Kutschbock stieg. Im Halbdunkel konnte er ihren Gesichtsausdruck schwer deuten. Doch er spürte, dass eine Gänsehaut über seinen Körper kroch.
»Laura?« Seine Stimme klang heiser. »Von wem spricht sie?«
Statt einer Antwort stapfte Laura wortlos zum Haus. Ließ ihn einfach stehen wie einen dummen Jungen.
»Tja, Alter, ich würd mal sagen …«, begann Chantal.
»Du bist still!«, herrschte Kaminski sie an. »Versorg die Pferde, verzieh dich auf dein Zimmer und lass dich heute Nacht bloß nicht mehr blicken!«
Abwehrend hob Chantal die Hände.
»Ich kann auch gleich ganz abhauen. Du bist so was von beschissen, weißt du das? Steck dir die Adoption sonst wohin. Deine Tochter bin ich sowieso nicht. Ach, was soll’s, Blut ist eben dicker als Wasser.«
»Das gilt nur für Schafe, nicht für Menschen«, widersprach Kaminski, der seinen harten Ton bereute. »Familie ist etwas, das man entscheidet. Und ich habe mich für dich entschieden. Für Laura und für dich.«
Er berührte das Mädchen an der Schulter, und sie lehnte sich an ihn.
»Cool, Mann. Dafür könnte ich dir glatt einen blasen.«
Kichernd rannte sie davon, und Kaminski musste sich zusammenreißen, um eine unfreundliche Ermahnung zu unterdrücken. Was hätte das schon gebracht? Ändern würde er sie nicht, nur vielleicht ein bisschen formen.
Er wandte sich zum Gutshaus. Ganz ruhig, befahl er sich, während er an Lauras merkwürdiges Verhalten dachte. Einatmen, ausatmen. Bloß keine Eifersuchtsszene. Ist doch klar, dass Laura andere Männer vor dir hatte. Sie ist ja keine siebzehn mehr. Im selben Augenblick fiel ihm auf, dass sie kaum über ihre vorherigen Beziehungen gesprochen hatten. Nun ja, bei ihm gab es auch nicht viel zu berichten. Aber Laura? Warum hatte sie sich darüber ausgeschwiegen? Aus Taktgefühl? Oder weil sie etwas zu verbergen hatte?
Er fand sie in der Küche, über den Spülstein gebeugt, wo sie sich ein Glas Wasser eingoss. Sein Blick glitt über ihren schmalen Rücken. Auf einmal wirkte sie so zerbrechlich. Ihre Schultern bebten.
»Was ist los?«, fragte er leise.
Langsam wandte sie sich um. Einen Moment lang trafen sich ihre Blicke, doch ihrer ging durch Kaminski hindurch, in eine beunruhigende Ferne.
»Nichts Besonderes«, erwiderte sie. »Bevor du heute ins WMS kamst, hat Carsten vorbeigeschaut. Nur ganz kurz. Wir waren mal zusammen. Er lebt mittlerweile in Leipzig.«
Schwerfällig ließ sich Kaminski auf einen der Biedermeierstühle fallen, die den Küchentisch umstanden. Seine Fingerkuppen trommelten auf die hölzerne Tischplatte ein, ohne dass es ihm bewusst gewesen wäre. Geistesabwesend musterte er den alten Kachelofen, den Küchenschrank mit den weißen Scheibengardinen, den monströsen Gasherd. Also doch. Chantal mochte impertinent sein, aber sie besaß ein untrügliches Gespür für emotionale Verwerfungen. Vermutlich lernte man so etwas, wenn man in einer Familie aufwuchs, die einem Vulkan glich, der jederzeit ausbrechen konnte.
»Carsten?«, wiederholte er lahm.
Laura nahm einen Schluck Wasser. Wollte sie Zeit gewinnen? Warum setzte sie sich nicht zu ihm?
»Wir haben, na ja, acht Jahre oder so zusammengewohnt«, erzählte sie stockend. »In der Westvorstadt.«
»Was du nicht sagst.«
Kaminski kannte das Viertel. Dort residierten die Wohlhabenden, jene Glücklichen, die meinten, es geschafft zu haben. Ihre noblen, penibel restaurierten Jugendstilvillen gehörten zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Natürlich kein Vergleich zu seinem maroden Pferdegestüt. Er senkte den Kopf
»Also, Laura?« Schräg von unten schaute er sie unsicher an.
Sie sah wirklich sehr müde aus.
»Ehrlich gesagt wächst mir manchmal alles über den Kopf. Das WMS, diese ewige Baustelle hier, dann noch … Frettchen …also, Chantal …«
»Und ich?«
Sie wartete ein wenig zu lang mit der Antwort. Zu lang für Kaminski, der sie bedingungslos liebte, jedoch nur zu gut wusste, dass er nicht gerade der Traumkandidat irgendwelcher Schwiegermütter war. Seine kräftige Gestalt, die markanten Züge und der rasierte Schädel verliehen ihm zwar eine virile Ausstrahlung, doch die abstehenden Ohren und die gebrochene Nase, ein Relikt seiner Boxervergangenheit, waren nicht jedermanns Geschmack. Ganz abgesehen davon, dass er weit davon entfernt war, seiner Frau ein sorgloses Leben ermöglichen zu können, geschweige denn einen Porsche.
»Mein kleiner Philosoph«, brach Laura das Schweigen, »es ist alles gut, wie es ist. Mach dir keine Gedanken. Ich bin glücklich mit dir. Lass uns schlafen gehen, ja?«
Sie machte einen Schritt auf ihn zu, er stand auf. Und nun, endlich, schmiegte sie sich an ihn, legte ihre Arme um seinen Hals, streichelte seinen Nacken. Zu spät, durchzuckte es Kaminski, während er sie an sich zog, einen Lidschlag nur zu spät und doch so unendlich verletzend. War der anfängliche Zauber dahin? Beiläufig verloren gegangen in den Ritualen und Pflichten des Alltags? Was war noch übrig vom Rausch der ersten Monate, als sie unablässig ineinander geschwelgt hatten, leidenschaftlich und sehnsuchtsbesoffen?
Das Poltern von Chantals Stiefeln auf der Treppe zum oberen Stockwerk holte ihn in die Gegenwart zurück. Laura ließ von ihm ab.
»Ich werde mit ihr reden«, versprach er.
Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Reden allein hilft nicht. Du siehst ja, wie sie sich aufführt. Das Mädchen braucht eine starke Hand. Eine echte Vaterfigur, keinen Pseudokumpel, der auch noch über ihre unflätigen Bemerkungen lacht.«
Kaminski fühlte eine ungewohnte Wut in sich aufwallen, etwas, was ihn zugleich aus der Fassung brachte und hilflos machte.
»Dein Superheld Carsten hatte natürlich eine starke Hand, stimmt’s?«
»Womit diese Diskussion auf Kindergartenniveau gelandet wäre«, befand Laura. »Lass Carsten aus dem Spiel. Tu einfach, was getan werden muss, damit der Laden hier funktioniert.«
Ohne ein weiteres Wort machte sie sich von ihm los und verließ die Küche. Das Klappern ihrer Absätze dröhnte in Kaminskis Ohren. Nach einigen Schrecksekunden sank er auf seinen Stuhl zurück. Lange starrte er die Küchentür an, durch die Laura verschwunden war. Es war ihr erster richtiger Streit. Ein Riss in dem feinen Gewebe aus Zuneigung und Vertrauen. Er spürte diesen Riss körperlich.
Falls ich jemals einen Liebesroman verfasse, ging es ihm durch den Kopf, werde ich nicht nur über das Glück des Einanderfindens schreiben müssen, sondern auch darüber, wie gefährdet dieses Glück ist. Mit einem Happy End samt Hochzeit ist es nicht getan. Vor allem dann, wenn sich ein Einzelgänger wie ich an der Zweisamkeit versucht. Du bist ein Beziehungstölpel, Kaminski.
Leicht benommen erhob er sich und stolperte zum Kühlschrank. Im Eisfach lag eine Flasche Wodka. Mit steifen Fingern schraubte er sie auf, goss Lauras leeres Wasserglas voll und trank einen großen Schluck. Und noch einen. Der Alkohol fraß sich durch seinen Körper. Weit schmerzhafter aber war der Zweifel. War Laura noch glücklich mit ihm?
Du hast sie nicht verdient, flüsterte eine höhnische Stimme in ihm. Was kannst du ihr schon bieten außer einem zugigen Gutshaus, einem krawalligen Teenager und deiner jungenhaft überschwänglichen Liebe? Reichte das? Würde es für die nächsten Jahre reichen? Für immer?
Kapitel 4
Von der Herderkirche schlug die Uhr ein Mal, als Christiane von Nesselröden die Wohnungstür aufschloss. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Viertel nach eins schon. Nach der Feier im WMS war sie eine Weile ziellos durch die nächtlichen Straßen geirrt, wie ein Kind, das etwas angestellt hat und sich nicht nach Hause traut. Dabei hatte sie sich nichts vorzuwerfen, außer dass es sie größte Überwindung kostete, in die Wohnung zurückzukehren, wo ihr Mann auf sie wartete. Oder lag es daran, dass sie heute jemandem begegnet war, der sie angeschaut hatte, als gäbe es eine geheime Verbindung zwischen ihnen?
Sie trat in den Flur und zögerte. Es war eine Angewohnheit geworden, dieses kurze Innehalten und Horchen. Sie legte den Kopf schräg. Fast so, als müste sie sich vergewissern, ob es überhaupt ihr Zuhause sei. Ihr Blick glitt über die orangeroten Wände des Flurs, ein warmes, pulsierendes Leuchten, das sie umfing, über die messingfarbenen Kronleuchter, mehr ironisches Zitat als Wille zur Pracht, über die alten, handkolorierten Stiche. Es waren Schäferszenen aus einer galanten Zeit – längst vergessene Gesten wie Verbeugungen, Handküsse, verstohlene Blicke. Linien wie zart geführte Melodien, in Farben verwandelte Klänge.
Ja, genau so hatte sie sich immer die Liebe vorgestellt, ein nicht enden wollendes Spiel von Koketterie und Verführung, ein lebenslanges Werben und Umgarnen, ein unwiderstehliches Taumeln zwischen respektvoller Fremdheit und glücklicher Nähe.
Eine hoffnungslose Romantikerin bist du, das hatte sie oft genug zu hören bekommen. Manchmal war sie sogar dafür ausgelacht worden. Dennoch wollte sie sich nicht mit den allseits gelebten Realitäten abfinden. Nur nicht abstumpfen, bloß nicht resignieren. Und lebten Laura und Kaminski es nicht vor, das Funkeln und Leuchten einer Liebe, die keinerlei Gedankenlosigkeit oder gar Nachlässigkeit erlaubte?
Das größte Glück ist es, wenn man um seiner selbst willen geliebt wird, überlegte sie. Liebe ohne Wenn und Aber. Doch solange Christiane zurückdenken konnte, hatte ihr Mann sie immer formen wollen. »Veredeln«, wie er es nannte. Er wurde nicht müde, sie darauf hinzuweisen, ihm sei es gelungen, aus der Apoldaer Landpomeranze ein kultiviertes Gewächs zu erschaffen. War das Ironie? An den weniger gewordenen guten Tagen ihrer Ehe hoffte sie es. Oder dachte er wirklich derart herablassend über sie?
Sie streifte den cremefarbenen Seidenmantel ab, mit dem sie ihren hellen Teint betonte, und ließ ihn auf eine niedrige, mit buntem Blumenstoff bespannte Chaiselongue gleiten. Direkt darüber hing ein gold gerahmter Spiegel. Nachdenklich strich sie eine dunkle Strähne aus der Stirn. Sie trug ihr gewelltes Haar immer noch lang, bis zu den Schulterblättern. Keine Frisur für eine Frau Mitte dreißig, sagte ihr Mann, keine Frisur für eine Respektsperson, stichelten die Kolleginnen an der Schule hinter ihrem Rücken, wie sie wusste. Ihre Schüler nannten sie heimlich Zeta, nach Catherine Zeta-Jones, jener Schauspielerin, der sie nicht nur wegen ihrer dunklen Mähne, sondern auch des herzförmigen Gesichts und der vollen Lippen wegen ähnelte. Sie wusste es und nahm es als Kompliment.
Christiane sah genauer hin.
Die Falte zwischen den Augenbrauen war neu. Hatte sich einfach eingeschlichen, ein Vorbote des Alters. Christiane, was ist von deinen Träumen geblieben, von deiner Vision eines erfüllten Lebens mit Musik, Literatur und dem großen schönen Lachen der Liebe?
Plötzlich fühlte sie sich unbehaust. Als sei sie aus dem Nest gefallen, das sie sich selbst gebaut hatte, aus dieser Wohnung, die einst eine Zuflucht gewesen war. Damals, als sie geheiratet hatte.
Obwohl es warm im Flur war, überlief sie eine Gänsehaut. Jetzt erst bemerkte sie, dass die Tür zum Arbeitsbereich ihres Mannes halb offen stand. Ein kühler Hauch streifte ihr Gesicht, als würden eisige Hände sie befingern. Sonst blieb dieser Teil der Wohnung stets verschlossen. Ein Hochsicherheitstrakt intellektueller Kontemplation, eine geheime Kommandozentrale des Geistes, wie ihr Mann betonte. Sein Arbeitsbereich, das sei die große, weite Welt, die Kapitale, der übrige Teil der Wohnung – Apolda.
Ihr Mann konnte weder mit farbigen Wänden noch originellen Möbeln etwas anfangen. Das alles fand er scheußlich, so wie die galanten Stiche, die verwegenen Aktzeichnungen aus den Zwanzigerjahren und die gerahmte Sammlung historischer Notenblätter, ein Geschenk ihres Vaters, Cellist der Staatskapelle Weimar, wo er ihre Mutter, eine Geigerin, kennengelernt hatte. Ihre bildungsbürgerliche Familie aus dem benachbarten Apolda – für Wolf ein Synonym für Provinzialität. Weimar, pflegte er zu sagen, das ist kulturelle Grandeur, Apolda hingegen nichts weiter als ein zu groß geratenes Bauerndorf, in dem es nach Rostbratwurst stinkt.
Der schwache Lichtschein, der auf den Flur fiel, zeigte ihr, dass Wolf noch arbeitete, obwohl es mitten in der Nacht war. Große Geister kennen keinen Feierabend, sagte er stets, per aspera ad astra! Sie konnte diesen Spruch nicht mehr hören. Nur durch aufopferungsvolle Anstrengungen gelangte man zu den Sternen? Welche Sterne denn? Manchmal schien es Christiane, als habe er über seinen brennenden Ehrgeiz das Leben vergessen. Und auch sie, seine Frau. Sie spürte, wie müde sie es war, ihn ständig zu irgendwelchen angeblich wichtigen Veranstaltungen zu begleiten. Als Paar, nur zu zweit, unternahmen sie so gut wie gar nichts mehr. Ihre gemeinsamen Abende opferte Wolf entweder seiner Arbeit an irgendeinem ominösen Projekt, oder er schleppte sie zu offiziellen Empfängen, Politikerstammtischen und Essenseinladungen vermeintlich einflussreicher Leute.
Leise schloss sie die Tür und machte sich auf den Weg in die Küche. Ein bemalter Bauernschrank beherbergte das Geschirr, am Fenster stand ein anmutig verwitterter Gartentisch mit schmiedeeisernem Fuß nebst passendem Stuhl. Gekocht wurde auf einem ultramodernen Gasherd. Wenn Christiane überhaupt kochte. Früher hatte sie ganze Menüs zelebriert, inzwischen taute sie nur noch Tiefkühlgerichte auf oder aß auswärts. Manchmal fragte sie sich, was ihr eigentlich derart den Appetit verschlagen hatte.
Am Kühlschrank hingen Fotos ihrer Schüler. Sofort wurde ihr warm. Sie betrachtete die jugendlichen Gesichter, manche grimassierend, andere scheu lächelnd, aber alle mit unverhohlener Begeisterung für die AG Theater und Zeitgenössische Musik, die Christiane im Musikgymnasium Schloss Belvedere gegründet hatte.
Als Lehrerin für musische Fächer nahm sie sich gewisse Freiheiten heraus, methodisch und auch im Umgang mit ihren Schülern. Statt in der Schulaula fanden die Proben schon mal draußen an der Ilm statt, im Park neben Goethes Gartenhaus oder vor dem Nationaltheater, bestaunt von Touristen.
Grenzen sprengen, lautete Christianes Credo, und doch fühlte sie sich wie eingekerkert.
Sie öffnete den Kühlschrank und holte eine angebrochene Flasche Weißwein heraus. Hastig trank sie einige Schlucke direkt aus der Flasche. Dann sank sie auf den Stuhl und strich mit den Fingerkuppen über den glatten Flaschenhals. Wie lange würde sie das noch unbeschadet überstehen, dieses Dulden und Durchhalten? Wie lange würde sie noch das Kunststück hinbekommen, zu tun wie alle hier, obwohl sie anders war? Aber selbst wenn es ihr gelang, um welchen Preis?
Und dann war es wieder da, dieses Gesicht. Die Augen, die sich an sie geheftet hatten, dieser sanfte, fragende Blick. Ein paar Sekunden nur, und doch hatte der Mann etwas in ihr zum Schwingen gebracht, wie die Saite eines Streichinstruments, die ohne jede Berührung vibriert, wenn die richtige Frequenz getroffen wird.
Johannes Sander. Wie hatte sie mit ihm gelitten, als man ihn nach der Premiere seines Freischütz im DNT erbarmungslos ausgebuht hatte. Die Sänger waren bejubelt, der Regisseur und neue Intendant hingegen geschmäht worden – angeführt von Torsten Kuzer, dem willfährigen Werkzeug ihres Mannes, von dem er immer so verächtlich sprach. Wolf hatte Johannes Sanders Inszenierung in der Luft zerrissen, obwohl sie, Christiane, begeistert gewesen war. Naiver Apolda-Geschmack, hatte ihr Mann gespöttelt, mit jener Herablassung, die er so selbstgefällig zur Schau trug wie seine Maßanzüge.
Mit dem Zeigefinger malte sie unsichtbare Großbuchstaben auf die Tischplatte.
JOHAN…
Im Bruchteil einer Sekunde hatten sie einander im Innersten erkannt. Ein kurzer Blickwechsel nur, und alles in ihr war in Bewegung geraten.
…NES
Sie erschrak und wischte den unsichtbaren Namen weg. Ganz schnell vergessen, Christiane. Da war nichts. Nur ein schwacher Moment. Vergiss ihn. Ganz bestimmt war er einfach immer noch aufgewühlt wegen des Verrisses und der möglichen Konsequenzen seines verpatzten Debüts. Und du warst in melancholischer Stimmung, weil niemand Chantals Adoption würdigt, weil niemand begriff, welch ungeheure Verantwortung Laura und Kaminski damit übernommen haben. Es war eine zufällige Begegnung. Ein zufälliger Blick. Mehr nicht.
Auf der Fensterbank verblühte eine Kletterrose. Die Hitze, keine Frage. Schlaff hingen die Blätter nach unten, einzelne rosa Blütenblätter rieselten herab, als Christiane die Pflanze berührte. Sie gab ihr einen Schluck Wein zu trinken und erledigte den Rest der Flasche.
Ohne sich auszuziehen, ging sie ins Schlafzimmer. Dort ließ sie sich aufs Bett fallen. Sieh dich doch an. Liegst beschwipst im Ehebett, wo du viel zu lange schon unberührt eintrocknest. Jammervoll. Jetzt fiel ihr zu allem Überfluss auch noch der erste Tag in der Redaktion des Weimarer Anzeigers ein, wo sie für die Semesterferien ein Praktikum ergattert hatte. Gleich an diesem ersten Tag hatte Dr. Wolf von Nesselröden sie entdeckt, ihr charmant den Hof gemacht und, nachdem sie ihm eine Tasse Kaffee gebracht hatte, zwinkernd versichert, es sei der bei Weitem delikateste, gleichsam rassigste Kaffee, den er jemals habe trinken dürfen. Bis lange nach Redaktionsschluss hatten sie in seinem Büro gesessen, geredet und geredet, über Goethe und Wieland, über Mahler und Schostakowitsch. Wie lange das her war. Mittlerweile trank ihr Mann keinen Kaffee mehr, nur noch ungesüßten Brennnesseltee, wegen seiner Allergien.
Ein Würgen kroch ihre Kehle hoch. Du Idiotin. Nicht mal anständig einen heben kannst du, hättest besser was essen sollen, bevor du zu Hause becherst. Sogar zum Saufen bist du zu blöd, würde Wolf jetzt sagen. Wolf von Nesselröden, der den »dahergelaufenen Möchtegern-Zadek«, wie er sich ausdrückte, vernichten wollte. Für Weimar, für das kulturelle Erbe der Deutschen und für den langersehnten Ruf in die Hauptstadt.
Unruhig wanderten ihre Hände über die Bettdecke. Im fahlen Licht schimmerte ihr Ehering auf, ein Goldreif mit drei Aquamarinen. Einen normalen Ehering hatte sie abgelehnt, und ihr Mann weigerte sich, etwas anderes als diesen lächerlichen Siegelring zu tragen. Was wollte er denn damit beweisen? Sein edles Geblüt? Eine höhere Bestimmung?
Nachdenklich betrachtete sie ihren Ring. Aquamarin, das Blau von Santorin, ging es ihr durch den Kopf. Als junge Frau war sie mit ihren Eltern gleich nach der Wende auf der griechischen Insel gewesen, ein Urerlebnis, weil sie damals das Gefühl überwältigt hatte, sie gehöre dorthin. Diese Weite! Dieser Blick über das Meer in fernste Fernen! Santorin war wie ein Versprechen gewesen, das Versprechen auf ein Leben in Freiheit, Schönheit und auf einen Mann, der ihre Sehnsüchte teilte.
Auch so ein Blütentraum, der zerplatzt ist, dachte Christiane. Du bist nicht frei. Du unterwirfst dich dem Reglement eines Mannes, dem deine Sehnsüchte völlig egal sind und der dich stattdessen auf standesgemäße Gattin trimmen will. Kleide dich damenhafter. Halte dich in Gesprächen vornehm zurück. Guck nicht so gelangweilt, wenn der Bürgermeister mit dir redet. Bis jetzt hatte sie seine Zurechtweisungen ertragen, sich angepasst, gute Miene zum entwürdigenden Spiel gemacht.
Sie zog die Bettdecke übers Gesicht. Was ist bloß passiert, dass ich in diese furchtbare Resignation driften konnte? Spektakuläre Vorfälle waren es nicht, das wusste sie. Nur ein verächtlicher Blick hier, eine abwertende Bemerkung dort. Das alles hatte sie zunehmend erstarren lassen, wie ein Gift, das sein Opfer schleichend lähmte, unerträglich langsam, bevor es zum Tod führte.
Die Übelkeit wurde stärker. Mit weichen Knien wankte Christiane ins Badezimmer, wo sie vor der Toilettenschüssel niedersank und sich schluchzend erbrach.
Kapitel 5
Als Kaminski übermüdet und leicht schwankend vom Wodka ins Schlafzimmer kam, schlief Laura bereits. Verwunderlich ist das nicht, überlegte er, die Feier im WMS