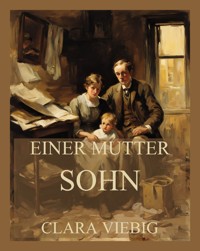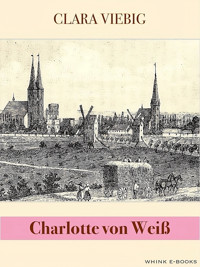
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: whink e-books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willibald Alexis hatte in seinem »Neuen Pitaval« 1842 über den aufsehenerregenden Kriminalfall der Giftmörderin Ursinus berichtet, die in den ersten Kreisen Berlins verkehrte und zu Beginn des 19. Jahrhunderts vermutlich mehrere Menschen vergiftet hatte, darunter ihren Ehemann, ihren Geliebten und ihre Tante. – Clara Viebig greift in ihrem Roman den berühmten Fall auf und versucht, das Wesen und die Motive dieser Mörderin zu ergründen. Sie zeichnet das vielschichtige Bild einer bis zuletzt rätselhaften Frau, die sich den Konventionen ihrer Zeit widersetzt und für ihr Glück und ihre Unabhängigkeit kämpft, jedoch letztlich an den Verhältnissen und an sich selbst scheitert. – Mit einem Nachwort von Wolfgang Hink.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charlotte von Weiß
Der Roman einer schönen Frau
Clara Viebig
Berlin: Ullstein, 1930.
IMPRESSUM | COPYRIGHT
whink e-Books unterliegen (außer in den gemeinfreien Teilen) den Urheber- und Leistungsschutzrechten, insbes. dem § 70 des UrhG. Die Nutzung dieses e-Books ist ausschließlich zu privaten Zwecken erlaubt; es darf ansonsten weder neu veröffentlicht, kopiert, verteilt, vertrieben noch irgendwie anders verwendet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung. © 2025 whink e-Books10555 Berlin | Elberfelder Str. 12whink44@posteo.de
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Epilog
Nachwort
Zu diesem E-Book
[5]
1
An dem niedrigen Gitter, das den Altarraum mit dem mächtigen Schnitzwerk seines Hochaltars gegen das Schiff der alten Kirche abschließt, kniete Charlotte Sophie Elisabeth von Weiß. Wenn sie denn schon alle Morgen zur Messe gehen mußte, an diesen frühen kalten Morgen, an denen es allein schon grauslich war, das Bett zu verlassen und Finger und Nasenspitze in das mit einer leichten Eiskruste überzogene Wasser des kleinen Waschnapfes zu tauchen, und noch viel grauslicher, durch die immer öden, jetzt im schmutzig-grauen Morgenzwielicht noch öderen Straßen zu tappen, so wollte sie wenigstens ganz hier vorne knien und die gemalten alten Flügeltüren des Hochaltars betrachten wie ein Bilderbuch. Die ganze Geschichte von Christus und seiner Mutter Maria war darauf zu sehen; gegen die umstrahlten Gesichter der Heiligen stachen verzerrt-finstere Gestalten doppelt ab. Die Frommen waren alle sehr schön dargestellt, die Bösen sehr scheußlich, doch der kleinen Lotte waren gerade diese sehr interessant: Teufel, Dämonen, aber Menschen waren es auch. Sie sah sie sich sehr genau an und vergaß darüber das Beten. Wohl hielt sie ihr Meßbüchlein vor sich in beiden Händen, aber über die Seiten weg schweiften ihre Blicke, Andacht war nicht in ihrem Innern, obgleich ihr Äußeres danach aussah. Ihr zartes, leicht emporgehobenes Gesicht schimmerte wie eine weiße Blüte aus der dunklen Kapuze, die man ihr, der Morgenkälte wegen, über die Locken gezogen hatte; die kindlich-runde Stirn in ihrer un[6]getrübten Reinheit leuchtete förmlich durch den trüben Halbdämmer der grauen Kirche.
»Wie ein Engel«, sagten die Stendaler von der jungen Demoiselle Weiß. »Ein Engelsantlitz«, so schwärmte auch der ganz in sein Töchterchen verliebte Papa. Selbst die französische Mamsell, die man sich, wie es jetzt allgemein in guten Häusern Sitte war, wegen eines feinen Französisch hielt, fand, daß ihre Schülerin, »une âme candide« sei und »parfaitement jolie«.
Mademoiselle Zéphire war nicht gern nach Stendal gekommen. Sie wäre lieber in Berlin geblieben, aber es gab dort so viele Töchter aus den Familien der Refugiés, die Stellung suchten, daß sie sich genötigt sah, diese hier anzunehmen. Ach, es war ja jetzt so schwer, auf redliche Weise sich etwas zu verdienen! Die langen Schlesischen Kriege, die ganz Europa in Aufruhr gebracht hatten, waren freilich vorüber, auch der noch längere Siebenjährige Krieg, aber vergessen waren sie noch nicht. Man war doch so viele Jahre in Preußen geschröpft worden, gleicherweise durch Freund wie durch Feind, daß kaum einer mehr da war, der Geld hatte. Der Adel nicht, der Bürger nicht, der Bauer nicht; und wenn der König sich nicht zu helfen gewußt und nicht hätte neue Taler prägen lassen durch Veitel Ephraim Söhne am Mühlendamm, Taler, die statt des fehlenden Silbers Kupfer im Leibe hatten und die man doch genau so annehmen mußte, als wären es noch die alten guten ehrlichen Silbertaler, so hätte auch er nicht gewußt, womit all das zahlen, was er zu zahlen hatte. Schulden, Schulden, Schulden.
Mademoiselle Zéphire hörte ihren Brotherrn, den Herrn von Weiß, so viel darüber stöhnen und bitter seufzen, daß man jetzt sein fälliges Gehalt nur in Zettelchen angewiesen bekam, die man sich dann mit mehr oder weniger Verlust eintauschen lassen mußte, daß sie schon ganz zufrieden war, am Ende des Monats ein paar von den neuen Ephraimiten bar in ihre Tasche [7] stecken zu können. Und sie hatte doch auch ihren Unterhalt frei; am Morgen die Mehlsuppe, am Mittag ein Mahl, das nicht gerade sehr reichlich war, aber einem nicht anspruchsvollen Magen doch genügte, und am Abend wieder eine Suppe und Brot à discrétion. Und ein Bett, das ganz schmal war, aber nicht in der Dienstbotenkammer stand, sondern gegenüber dem Bett der Tochter des Hauses an der langen Wand im Schulzimmer. Wenn nur nicht der alle Morgen wiederkehrende Gang zur Messe gewesen wäre! Mademoiselle Zéphire haßte den. Sie gehörte der reformierten Kirche an und verabscheute alles, was katholisch war. Zudem war es so kalt in diesem Stendal, kalt wie auf freiem, aller Wetterunbill preisgegebenem Feld. Und noch kälter in jener alten gräßlichen Kirche, die nach Weihrauch, Moder und Schimmel roch. Bis ins Innerste erschauernd, kroch sie ganz in sich zusammen, wenn sie im Hintergrund der Kirche auf kalten Steinfliesen wartete, bis ihre Schutzbefohlene die vorgeschriebene Zeit der Andacht beendet hatte. Sie hustete und nieste: war die Demoiselle denn noch immer nicht mit ihren Gebeten fertig? Ach, das dauerte ja ewig! Und das gute Kind war so rührend in seiner frommen Versunkenheit, daß sie nicht gewagt hätte, es zu stören.
Zitternd vor Kälte machten sie sich dann endlich auf den Heimweg. Es war inzwischen etwas heller geworden, und es begegneten ihnen die Söhne der besseren Bürger und die der um Stendal ansässigen Besitzer, die in der Klosterschule zur höheren Bildung vorbereitet wurden. Das Fräulein tippelte voran; die französische Mamsell in der vorgeschriebenen respektvollen Entfernung hinterdrein, so sah sie nicht, wie dies eben noch so fromme Gesicht blicken konnte. Es war gar nicht so kindlich mehr. Die schönen Augen der jungen Weiß waren munter, unter den langen Wimpern hervor blitzten sie nach den angehenden Jünglingen. Die waren alle begeistert: Oh, [8] was für zierliche Füßchen hatte die Demoiselle Weiß und was für schöne blonde Locken! Wäre ihr Vater nicht so in ewiger Geldbedrängnis und ginge nicht die Sage, daß Herr von Weiß einstmals, als er noch österreichischer Legationssekretär gewesen war, Aktenstücke ausgeliefert und sich dafür hatte bezahlen lassen von Preußen — er sollte sogar damals Baron gewesen sein, ein Baron von Weingarten —, so hätte man sich kein höheres Zukunftsideal vorstellen können, als einmal diese blonde Fee zum Traualtar zu führen.
Ob Charlotte von Weiß auch schon an dergleichen dachte? Das wußte niemand. Sie ging ins dreizehnte Jahr. Mit fünfzehn Jahren hatte sich ihre ältere Schwester Henriette schon verheiratet, sie aber war jetzt noch Kind, »ganz Kind«, sagte die Mutter und war gerührt, wenn Lotte Fragen stellte, die andere Mädchen in ihrem Alter längst nicht mehr gestellt haben würden. Es war eben der Segen der kleinen Stadt, daß dieses Kind so völlig unberührt war. Und dabei von einem Mutterwitz und einer Schelmerei, die alle entzückten.
»Denken Sie sich«, erzählte Frau von Weiß einer sie besuchenden Freundin, »was für ein Kind meine Lotte ist! Da komme ich gestern in die Bedienstetenstube, wo auch unsere Hauskatze ihr Lager hat, und da finde ich meine Lotte bei der Katze, die eben Junge bekommen hat. ›Mon Dieu‹, rufe ich entsetzt, ›sieben kleine Katzen, wohin soll man mit denen?!‹ ›Ertränken‹, sagt der Bediente und zuckt die Achseln. Aber als ich ihm gebiete, das zu tun, weigert er sich: ›Nee, gnädige Frau, ich nicht!‹ Ich bin ganz außer mir: wohin mit den Tieren?! Da sagt das gute Kind und lächelt dabei unter Tränen, die ihr unter den langen Wimpern vorquellen: ›Ich werde es tun. Und zwar sofort, ehe sie wissen, daß sie sterben.‹ Und nimmt, ehe ich ihr Einhalt tun kann, die sieben Kätzchen in ihren Schoß und wirft sie alle miteinander in einen Bottich voll Wasser. Mit wahrhaft [9] stoischem Mut und bewunderungswürdiger Selbstbeherrschung. Ich sehe, wie ein Zittern dabei über sie hinläuft. ›Oh, oh, was tust du!‹ rufe ich wahrhaft erschrocken. Da sagt dieses Kind ganz ernsthaft und sieht mich dabei groß an: ›Ich habe ihnen in den Katzenhimmel geholfen, Mama‹, geht und kauert sich bei der alten Katze, die kläglich miaut, nieder und tröstet sie damit, daß ihre Kätzchen nun im Himmel sind, und spricht so zärtlich mit ihr und mit einer so lieben Stimme, daß es selbst mich fast rührt. Sie ist ein merkwürdiges Kind.«
»Ein seltenes Kind«, das fand auch der Vater. »Mein Töchterchen«, pflegte er zärtlich zu sagen, »was wünscht sich denn mein Töchterchen?«
Aber Charlotte hatte keine Wünsche, sie küßte nur seine Hand: »Mon cher Papa!«
Herr von Weiß empfand dann über diese jeder Berechnung ferne kindliche Liebe eine so große Freude, daß die ihn über alles übrige Mißgeschick seines Lebens tröstete. Er war ein etwas verbitterter Mann: hatte es ihm der König denn nicht viel zu wenig gelohnt, daß er ihn damals von dem geheimen österreichisch-russischen Abkommen etwas wissen ließ, die Akte darüber kopierte und dem preußischen Kabinett zustellte? Bei aller Schwärmerei seiner Frau, der Preußin, für ihren großen König, er hätte das nicht tun sollen; abgesehen davon, daß die paar tausend Taler, die er dafür bekommen hatte, dahinschwanden wie Spreu vor dem Winde. Seine Liebe zu ihr, die ihn so schwach gemacht hatte, um an seinem Österreich Verrat zu begehen, war auch dahingegangen wie Spreu vor dem Winde, er begriff nicht mehr, daß er ihr je hatte so nachgeben können; es gab Stunden, in denen er von einem heftigen Widerwillen geplagt war, wenn er an sein schönes Wien dachte, das er hatte verlassen müssen, und seine Stellung dort verglich mit dem kleinen unbedeutenden Amt, das man ihm in Preußen ge[10]geben hatte, noch dazu in einem solch elenden Nest wie Stendal. Er verabscheute diese Stadt, die reizlos in sandiger Ebene liegt, deren zwei Tortürme nur davon Kenntnis geben, daß sie einstmals etwas mehr gewesen war. Der riesige Roland, der, den hageren, knochigen Leib schwer gepanzert, ungefüge vor dem Schwibbogen des alten Rathauses reckt, rief ihm die weichen Leiber der schönen Wienerinnen und die noch schöneren der Marmorfrauen in den kaiserlich-königlichen Gärten zu schmerzlichem Vergleich ins Gedächtnis zurück. Nein, er konnte es nicht vergessen, sein Wien, und er trauerte ihm hier nach in diesem kalten, nüchternen, unliebenswürdigen Preußen, das so verarmt und ausgesogen war, daß es fast einem Wunder gleichkam, sollte es jetzt wieder anfangen aufzublühen.
In Schlesien und Pommern hatte der König Tausende von niedergebrannten Wohnstätten wieder aufbauen lassen, Saatgetreide war überall in den bedürftigen Landkreisen verteilt, die früheren Artilleriepferde zu Ackergespannen zusammengestellt und unter die verteilt worden, die keine Gäule hatten bekommen können. Und die Schlesische Landbank lieh Geld und Land aus. Schlesien war für sechs Monate, Pommern und die Neumark für zwei Jahre von allen Abgaben befreit worden, und mit 20 389 000 Talern, die im Staatsschatz für den Fall eines neuen Feldzugs noch vorhanden waren, kam der König den geschädigten Provinzen zu Hilfe. Dazu war er persönlich auch nicht faul, reiste überall in seinen Provinzen umher, bestellte sich auch den Landrat des betreffenden Kreises an seinen Wagenschlag: »Wieviel Roggen für Brot? Wieviel Sommersaat? Wie viele Pferde, Ochsen und Kühe sind höchstnötig? Hat Er crayon? Nun, so schreib Er mir’s auf!«
O ja, der König war schon ein Staatswirt, das mußte Herr von Weiß, wenn auch zögernd, seiner Frau, dieser immer noch gleich törichten Schwärmerin, zugestehen, Aber trotz einiger [11] guter Einfälle und einer gewissen Genialität, die man diesem König nicht absprechen konnte, war es nicht doch ein Mißgeschick, in einem Lande zu wohnen, das seit Jahren vertrampelt worden war von russischen, französischen, österreichischen, sächsischen Stiefeln? Das auch jetzt noch meilenweite Strecken aufweist, die Wüsten glichen, das nicht die Kultur Österreichs hatte, von gleicher Schönheitspflege gar nicht zu reden. Herr von Weiß seufzte. Freilich, in Berlin mochte das nicht so bemerkbar sein wie hier in Stendal. Da waren das Sanssouci des Königs, die königlichen Schlösser, vorzüglich das neue Schloß im großen Potsdamer Park, den der König mit Nachbildungen aus der Antike bevölkert hatte. Und da war die große Stadt selber mit ihren breiten Straßen, die auch endlos lang waren, die Dome auf dem Gendarmenmarkt mit ihren runden Kuppeln, die uralte Marienkirche, die Petrikirche mit der ragenden Spitze ihres gen Himmel strebenden gotischen Turmes, das Königstor und die neue Königsbrücke, über die die Reisenden aus dem Osten gleich mitten hinein kamen in die belebteste Geschäftsstraße Berlins, während am anderen Ende das Potsdamer Tor den, der von Westen kam, zwischen Wachthaus und Tor-Akzise durch über das große Achteck mit den Sandsteingruppen einführte in die Schönheit der Stadt. Ja, es gab dort schon etwas zu sehen: Reiter, Kutschen, Hofkarossen und täglich das Aufziehen der Wachtparade mit klingendem Spiel.
Gelegentlich eines Besuches, den die Eltern von Weiß bei ihrer ältesten Tochter in Spandau gemacht hatten, waren sie auch nach Berlin gekommen, und Frau von Weiß, eine geborene Witte aus Charlottenburg, hatte triumphierend ihren Mann umhergeführt. War ihr Berlin nicht herrlich, kam es seinem Wien nicht gleich, war dem vielleicht gar über? Das wollte er freilich nicht zugeben. Die Luft, die Luft dort war eben ganz anders, die gab den Duft, die Lust, die Lebensleichtigkeit und [12] den Genuß. Aber daß es sich in Berlin ganz anders leben lassen würde als in Stendal, das gab er ihr unumwunden zu. Und der Wunsch stieg in ihm auf, ja der feste Entschluß, seiner geliebten Jüngsten ein Leben dort zu ermöglichen.
Es war eine ausgemachte Sache, daß Lotte zur letzten Vollendung ihrer Erziehung nach Spandau zur Schwester gegeben werden sollte. Schwester Jettchen war zehn Jahre älter, war die Frau des Hofrats von Hauke. Jettchen hatte große Fortune gehabt, obgleich sie nicht halb so hübsch war wie Lottchen; man konnte diesem Kind also nichts Besseres antun, als es dorthin zu geben, sowie es einigermaßen den Kinderschuhen entwachsen war. Lotte konnte dann auch ihrer Mutter unverehelichte Schwester, die Tante Christiane Witte in Charlottenburg besuchen, die dort in recht angenehmen Verhältnissen lebte; hatte doch ein Mann, der sie geliebt, aber nicht um ihre Hand angehalten hatte, weil ihm in der Schlacht bei Leuthen, als er, seinem Fußvolk voran, mit gezogenem Säbel stürmte, beide Beine unterm Leib weggerissen wurden, sie zur Erbin seines nicht unbeträchtlichen Nachlasses eingesetzt. Es würde Lotten ein Leichtes sein, die Liebe der Tante im Sturm zu erobern. Vielleicht daß diese dann Lottchen wiederum zu ihrer Erbin — aber das waren nur ganz geheime Gedanken, von denen das Ehepaar nichts miteinander sprach.
Ob Charlotte von dem Plan, sie in einiger Zeit nach Spandau zu geben, etwas wußte? Gesagt war ihr nichts davon worden, aber sie ahnte es; vielleicht hatte sie’s auch erhorcht. Sie hatte sehr feine Ohren, und sie hatte ein oft seltsam vorahnendes Empfinden, so daß sich ihr manchesmal Dinge als Tatsachen vorstellten, die in Wirklichkeit noch nicht vorhanden waren.
»Man darf nicht lügen — fi donc«, sagte dann Mademoiselle Zéphire und sah die Schülerin mit ihren hübschen braunen Au[13]gen mehr betrübt als strafend an. Dann warf sich Charlotte ihr stürmisch in die Arme und schluchzte heftig an ihrem Halse: »Du mußt nicht denken, daß ich lüge — nein, nein, ich lüge nicht, ich will gar nicht lügen, aber es ist nun einmal so, daß ich das so sagen muß. Dich belügen, du Geliebte, o nein!« Und sie küßte die über solchen Ausbruch ganz Erschrockene mit so viel stürmischer Heftigkeit, daß die arme kleine Zéphire die Augen schloß und sich für selige Momente unter den Küssen ihres Geliebten wähnte, den sie, ach, so lange schon nicht mehr gesehen hatte.
Es war dem Fräulein von Weiß streng verboten, ihre französische Mamsell allzu vertraulich zu behandeln. »Man muß Untergebenen gegenüber immer in einer gewissen Reserve bleiben«, hatte ihr der Vater gesagt, und besonders der Mutter wäre es höchst unliebsam gewesen, hätte sie das schwesterliche Du gehört, das die beiden gebrauchten, wenn sie ganz allein waren. Besonders am Abend. Frau von Weiß hatte die Gewohnheit, wenn Charlotte zu Bett lag, noch einmal das Schulzimmer zu betreten; sie küßte dann ihr Töchterchen flüchtig auf die Stirn und rauschte wieder hinaus. Die Turnüren auf ihren beiden Hüften bauschten sich, der Springrock, dessen Reifen nur bis zum Knie gingen, endigte in einem von starrer Seide steifstehenden Volant. Frau von Weiß war, wenn sie abends in Gesellschaft ging, schon vom Morgen an fest geschnürt, die Jungfer mußte über Tag noch ein paarmal nachziehen. Dann zeigte sich der Ansatz ihres Busens über der vorn tief ausgeschnittenen Taille; aus den am Ellbogen endigenden weiten Manschetten der seidengeblümten Ärmel streckte sich aus der mehrfachen Reihe der Spitzen der volle weiße Arm. Auf der hochgetürmten, gepuderten Frisur wippte eine Rose. Obgleich Frau von Weiß schon mehrfach Großmutter war — die Hofrätin in Spandau beschenkte ihren Gatten alljährlich mit einem [14] Kind —, war sie noch immer eine sehr schöne Frau. Und sie wußte sich zu kleiden; sie hielt sich das »Magazin des Modes«. Trotzdem schien Herr von Weiß blind geworden für die Reize seiner Gattin, die ihn einst so betört hatten.
Die Weiß gingen oft in Gesellschaft — was sollten sie auch zu Hause? Sie hatten sich nichts zu sagen. Und da es Theater in Stendal nicht gab, Konzerte auch nicht, so war das Zusammenkommen in geselligem Kreise die einzige Abwechslung. Viel Anregung hatte man zwar dadurch auch nicht, aber die Gazetten wurden besprochen, und die Männer politisierten, wobei sie sich oft sehr erregten, denn über die Teilung Polens und über das, was Preußen sich dabei eingesteckt hatte, war man sehr verschiedener Meinung.
»Was soll uns ein so verwahrlostes Land ohne Zucht und ohne Gesetz? Blödes Landvolk ohne Webstuhl, ohne Spinnrad, ohne Backofen. Unbestellte Felder, ungedielte Hütten, elender Hausrat, unterm Kruzifix an der Wand ein Weihwassernapf, der nach Branntwein riecht!« Herr von Weiß gehörte zu denen, die über das Unrecht, das man Polen angetan, indem man es zerstückelte und darüber herfiel wie Hunde über einen Knochen, am strengsten urteilten. Wie konnte ein König sich von der Zarin für die ihr geleisteten Dienste mit gestohlenem Gut ablohnen lassen? Das war —
»Sssst!« Man sah sich scheu um: »Vorsicht!« Man war Beamter, man hatte zu schweigen, der König hörte alles, der König war überall.
Aber Weiß ließ sich nicht zum Schweigen bringen: »Das ist eines Herrschers nicht würdig, den schon seine Zeit — etwas voreilig, wie mich bedüngt — den ›Großen‹ nennt!« Er war im besten Zuge, noch mehr zu sagen, die Bitterkeit, die in ihm aufquoll, wenn er an die geringe Ablohnung dachte, die er für geleistete Dienste erhalten hatte, übermannte seine Klugheit. [15] Er erhob wiederum seine Stimme: »Es ist vom moralischen Gesichtspunkt aus eine unleugbare Schuld, die« — er stockte, seine Gattin hatte ihn angesehen.
Ihre Augen blitzten: »Und dein Österreich? Dein Österreich, hat das etwa nicht zugelangt? Es hat sich von Polen Galizien genommen und hat nicht einmal etwas dafür geleistet. Da müßte ja unser König ganz ohne Weltkenntnis sein oder bereits in das Engourdissement eines müden Greises versunken, wenn er eine so vorteilhafte Gelegenheit verpaßt hätte. Oh, er ist dazu ein viel zu großer Staatsmann und ein zu wahrer Vater seines Volkes. Er gibt uns jetzt eine Entschädigung für all das, was man uns entrissen hat. Warte nur einmal ab, wenn sein Pflug erst über die polnischen Wüsten geht, dann wird bald Weizen dort reifen. Es wird noch unsere Kornkammer werden, dies polnische Preußen. Oh, unser König!« Sie hob beide Hände zum Himmel: »Lang lebe der König!« Ihre Wangen glühten, ihr Busen stieg immer höher aus dem Ausschnitt, er wogte, als wollte er die enge Einschnürung sprengen.
Die Herren lächelten: eine allerliebste Abfuhr hatte der von Weiß von seiner Frau Gemahlin bekommen, die war ja ordentlich ins Zeug gegangen, und ihre hohe Röte und ihre aufgereckte Haltung schienen anzukündigen: ›Warte du, laß uns nur erst daheim unter vier Augen sein!‹ Wenn sie auch wohl etwas viel Temperament zeigte, eine Frau war sie aber doch, mit der jeder Mann sich hätte sehen lassen können —, Haltung, Turnüre, Esprit — wie eine aus ältestem Adel und war doch nur bürgerlicher Herkunft. Und was für eine Preußin! Eine Preußin aus jenem Stamm, der durch dick und dünn mit seinem Herrscher geht. Ein Vollweib zudem, ein Prachtweib, viel zu schade für diesen galligen, trocknen Schleicher.
Sie waren alle dem von Weiß nicht grün. Es war eben so eine Sache mit dem; wenn man auch nicht daran glaubte, was [16] Frau Fama tuschelte, er war eben doch kein Preuße, sondern einer aus diesem lappigen Österreich, das immer falsches Spiel spielte. Herübergeweht — warum, wieso —, einem vor die Nase gesetzt in die Stellung eines Kammerrates, die ebenso gut, ja viel besser, jeder Preuße hätte ausfüllen können. Die Herren waren alle auf Seiten der noch immer schönen Frau, es wäre auch jeder geneigt gewesen, eine kleine Liaison mit ihr anzuknüpfen. Man war zurzeit nicht so engherzig, die Herren und Damen in Berlin genierten sich ja in keiner Weise, so daß man sich’s wohl auch gestatten durfte, ein Veilchen zu pflücken, wenn es am Wege stand. Aber die Dame von Weiß war unnahbar; die war eine Festung, gegen die man Batterien hätte auffahren lassen müssen, wie damals der König bei Prag.
Die Frau Landrat, die Frau Amtsrat, die Frau Justizrat, die Frau Forstrat, die Frau Oberschulrat, die Frau Medizinrat, die Frau Geheimrat, und wer sonst noch von Damen der höheren Gesellschaft zugegen war, waren ganz anderer Meinung als ihre Männer. Laut hätten sie sich freilich nichts zu sagen getraut, nicht einmal zu ihren Männern im ehelichen Schlafgemach, aber untereinander wechselten sie Blicke; und war es nicht chokant, wie sie ihrem Mann übers Maul fuhr mitten in einer Gesellschaft? Und was dieses Weib für einen Hochmutsteufel hatte, hielt sich das »Magazin des Modes«? Trug sich hier in Stendal so, als käme sie aus Paris! Und man wußte doch, daß die Vermögensverhältnisse der Weiß durchaus keine glänzenden waren — ach, der arme Mann, der mühte sich ab, während sie sich einen Bedienten hielt, eine Jungfer und eine französische Mamsell für ihre Kleine. Was aus der wohl werden konnte bei solcher Erziehung? Alles im Hause nur auf den äußeren Schein gestellt.
»Mein Sohn hat mir erzählt«, flüsterte die Geheime Rätin hinter der vorgehaltenen Hand der Landrätin zu, »daß diese [17] kleine Weiß schon Blicke wirft, denken Sie an, meine Liebe, ein Kind noch und schon Blicke! Es wird nicht lange dauern, und die Amouren fangen an. Es müßte denn sein, daß sie zu klug dazu ist, so klug wie die Mama — sie soll ja sehr klug sein.«
Die, von der die Frau Geheimrätin und auch andere dachten, sie wäre sehr klug, war heute abend gar nicht klug. Kaum daß ihre Mutter nach dem flüchtigen Gutenachtkuß das Zimmer verlassen hatte und man hörte, daß unten die Haustür geschlossen wurde, richtete sie sich auf im Bett. Ihre Augen funkelten neugierig: Ah, da stand ja Zéphire jetzt im Hemde, es war so kurz, ging kaum bis an die Knie. Und was sie für einen hübschen Busen hatte, viel hübscher und voller schon, als der ihre war, und was für schöne weiße Arme! »Komm, komm her zu mir«, rief sie und streckte beide Arme aus.
Mademoiselle Zéphire folgte: ach Gott, es tat wohl, ein bißchen Liebe zu spüren, sie war ja hier so weggesetzt, so vereinsamt. Sie folgte den sie ziehenden Armen und kroch zu Charlotte ins Bett. Eng aneinandergeschmiegt lagen sie.
»Wie weich dein Busen ist«, flüsterte Charlotte. Sie streichelte und küßte die Brust der anderen, ihre Lippen waren heiß, plötzlich biß sie spielerisch in die weiche Rundung.
»Au, was tust du? Das tut ja weh!«
»Das soll auch wehtun«, kicherte das Mädchen. »Was dir wehtut, das tut mir wohl! Aber nein, nein, ich tu’s nicht mehr!« Sie hielt mit Kraft Zéphire fest, die aufspringen wollte; es war eine merkwürdige Kraft in diesen noch mageren Armen. Willenlos sank Zéphire wieder zurück.
Und nun flüsterte Charlotte an ihrem Ohr: »So, und nun erzähle mir von deinem Geliebten. Was sagt ihr, wenn ihr so beisammen seid? Und was sagst du dann?«
»Non, non!« Zéphire wehrte verschämt. »Laß mich, ich will [18] nicht!« Aber dann wollte sie doch, es war ja so süß, vergangenen Glückes zu gedenken, und sie erzählte die halbe Nacht, erzählte sich heiser.
Als die Eltern schon längst nach Hause gekommen waren, flüsterten sie noch. Zéphire war aufgefahren, als die Schritte der Heimkehrenden auf der Treppe zu hören waren: wenn Madame etwa noch einmal hereinkäme!
Aber Charlotte sagte kalt: »Sie soll nicht kommen. Sie kommt auch nicht, das fühle ich. Bleibe! Du bist weich und warm. Ich liebe nur dich!«
[19]
2
Ob Nanette, die Jungfer, beim täglichen Frisieren der gnädigen Frau etwa Andeutungen gemacht hatte? Nanette ärgerte sich schon lange über die Vertraulichkeit der französischen Mamsell mit dem Fräulein. War sie, Nanette, denn nicht ebenso viel wie die dumme junge Person, die nur ein bißchen Französisch parlieren konnte? Konnte die vielleicht das Haar so fein toupieren, daß es hoch stand über der Stirn und dann von hinter den Ohren her in langen gedrehten Locken nach vorn auf den Hals fiel? Und verstand die, eine Casaque so geschickt zu schneidern, daß sie bauschte und doch nicht dick machte?
Die Jungfer hatte eine geheime Wut auf die französische Mamsell. Ehe die gekommen war, hatte sie bei dem Fräulein geschlafen, ihr Bett hatte nicht in der Dienstbotenkammer gestanden, die nur ein winziges Fensterchen besaß und stets halb dunkel war und ganz ohne Ofen. Auch hatte sie der Bediente da nicht so oft belästigen können. Oh, sie war eine anständige Person, eine sehr anständige, sie würde dem jungen Fräulein nicht solche unanständigen Geschichten erzählt haben, wie die Französin es tat! Nanette verstand sich aufs Lauschen, sie hatte das »Du« gehört und auch noch anderes.
Es war an einem Abend, als Herr und Frau von Weiß wieder in Gesellschaft gegangen waren. Charlotte lag schon im Bett, Zéphire saß noch am Schultisch und schrieb einen Brief an ihren Geliebten.
[20] Charlotte diktierte: »Nun schreib: ›Du, mein Geliebter, Sehnsucht meiner Seele, einziger Wunsch meines Lebens!‹«
»Aber so kann ich doch nicht schreiben!« »Schreibe: ›Einziger Wunsch meines Lebens! Ich sehne mich so nach Dir, daß ich krank bin. Wann werden wir uns wiedersehen? Wann uns küssen, wann uns in den Armen halten, von niemandem belauscht? Wenn das nicht bald sein kann, dann sterbe ich. Ich werde an den Fluß gehen — der ist tief —, ich werde mich ertränken, mich und mein Verlangen.‹«
Zéphire fuhr auf: »Non, mais — non, das kann ich nicht schreiben! Er wird sich ängstigen, er wird glauben, daß es die Wahrheit ist.«
Das Mädchen lachte. »Nun, so laß es ihn doch glauben.« Und altklug setzte sie hinzu: »Das schadet nicht, wenn ein Mann sich ein bißchen um uns ängstigt, desto liebevoller ist er nachher.«
»Nein, ich kann so nicht schreiben!« Zéphire sagte es weinerlich. »Ich werde schreiben, wie mir wirklich zumute ist: daß ich ihn liebe, so liebe, daß ich geduldig warten will, bis wir uns wiedersehen. Ganz geduldig warten werde und sparen, sparen, bis wir so viel beisammen haben, daß wir uns heiraten können.«
»Du bist dumm!« Charlotte rümpfte das feine Näschen. »Und was hast du dann? Dann bist du doch alt und häßlich, denn so lange dauert es sicherlich, bis ihr so viel gespart habt, daß ihr heiraten könnt. Wenn du ihn aber recht ängstigst, dann sputet er sich, dann wird er alles tun, um dich eher heiraten zu können. Also schreibe: ›Oder ich werde zu einem Apotheker gehen, und er wird mir das geben, was ich, ein einsames, verlassenes Mädchen, das keinen Freund auf Erden mehr hat, brauche, damit es —«
»Oh, mon Dieu! Non, non!« Zéphire hob abwehrend die Hände: »So etwas kann ich nicht schreiben. Das ist ja lauter Unsinn.«
[21] »Gar kein Unsinn. Aber wenn du nicht willst, dann laß es.« Charlotte war ärgerlich, sie hatte sich ganz hineingedacht in die Rolle eines liebend-verzweifelnden Mädchens. »Ich würde jedenfalls so schreiben.« Sie wendete sich im Bett nach der Wand und kehrte der Stube den Rücken.
Es blieb eine Weile still, nur Zéphires Gänsekiel kratzte wieder über das Papier. Plötzlich hielt das Kratzen inne, die kleine Zéphire warf den Gänsekiel hin, seufzte und stützte den Kopf in die Hand: ach, es war wirklich eine aussichtlose Sache! Lotte hatte recht: man wurde alt und häßlich darüber. Ihre Tränen fingen an zu rinnen und machten große runde Flecken auf dem dünnen Papier des Briefbogens. Und sie hatte doch wirklich so großes, großes Verlangen. Ein Schluchzen stieg in ihr auf — ach, da stand er ja vor ihrer Sehnsucht, der Liebe, der Geliebte! Wie hübsch er ist, stramm und schlank, die Knöpfe an seiner Uniform blitzen — seine Augen blitzen nicht minder — er schaut zu ihr, die verstohlen hinterm Vorhang vorlugt, mit einem raschen Blick hinauf. Zu ihrem Fenster steigt er empor mit verliebten Grüßen. Die Grenadiere marschieren, ihre Beine in den gelben Gamaschen heben und senken sich so gleichmäßig, als stecke eine Maschine in ihnen — trab, trab, eins, zwei, eins, zwei — sie hört es ganz deutlich. Die Regimentsmusik spielt, der junge Leutnant, den Säbel gezogen, führt sie zur Übung auf die Tempelhofer Heide, und ihre achtzehn Jahre ziehen hinterdrein. »Oh, mon Dieu, mon Dieu!« So nah, so nah, und doch so fern, so erschrecklich fern! Es würgte sie in der Kehle. Und wenn sie daran dachte, daß sie morgen in aller Frühe wieder in diese scheußliche kalte Kirche mußte, in der sie nicht beten konnte, in der der seit Jahrhunderten drinsteckende, mit Moder feucht durchschwängerte Weihrauchdunst ihre Kehle zum Husten kitzelte, dann war es ihr besonders traurig zumute. ›Ein einsames, verlassenes Mädchen, das keinen Freund auf Erden mehr hat‹ — sie schluchzte laut.
[22] »Siehst du, nun weinst du!« Charlotte hatte sich wieder nach der Stube gekehrt. Sie hatte noch nicht geschlafen, ihre Gedanken waren noch bei Zéphires Brief und waren all den Empfindungen nachgegangen, die die Schreiberin erregt hatten. Zéphire hatte ihr so oft von dem Geliebten erzählt, daß sie ganz genau wußte, wie der aussah, wie er sprach, selbst den Klang seiner Stimme, der noch nicht rauh war, noch ein wenig jünglinghaft hoch, hatte sie im Ohr. Liebte auch sie ihn? Nein, so dumm war sie nicht, daß sie sich solch einen pauvren kleinen Leutnant aussuchen würde, der im Monat nichts hatte als seine zehn Taler Gold. So pauvre zu sein, war unerträglich, ebenso unerträglich wie es war, hier in dem langweiligen Nest zu wohnen und alle Morgen in die graue Kirche zu laufen, in der sie das Bilderbuch am Hochaltar nun schon so oft gesehen hatte, daß sie das herzlich satt hatte. Ach, wie kalt würde es morgen wieder da sein! Es wäre viel angenehmer, man wäre nicht katholisch. Zéphire hatte in Berlin erst viel später in ihre Kirche gemußt. Und auch nicht zu knien hatte die gebraucht auf eiskaltem Steinboden, sondern gesessen in einer Bank. Oh, die scheußliche Messe! Es fror sie jetzt schon. »Ich höre den Wind am Fenster, er bläst bis hierher. Laß das Schreiben, Zéphire, komm zu mir, daß wir uns wärmen!«
Und Zéphire gehorchte. Sie hielten sich fest umschlungen und flüsterten. Da öffnete sich plötzlich die Tür, sie hatten keinerlei Geräusch gehört.
Mit einem raschen Schritt trat Frau von Weiß ein. Zéphire hatte nicht mehr die Zeit, hinüber in ihr Bett zu schlüpfen; sie war aufgesprungen und stand nun im kurzen Hemdchen zitternd vor der Gnädigen — eine arme ertappte Sünderin.
Auch Charlotte war sehr erschrocken: sie war bleich geworden, aber mit Trotz sah sie die Mutter starr an.
Frau von Weiß kochte vor Empörung. »Was — wie — und [23] das untersteht Sie sich?« fuhr sie die Mademoiselle an. »Ich habe es nicht glauben wollen, nun sehe ich es ja selber. Heraus aus dem Zimmer, heraus hier! Packe Sie ihre paar Sachen zusammen, morgen mit dem Frühesten verläßt Sie mein Haus!«
»Oh, Madame, pardon, mille fois pardon, haben Sie Mitleid mit mir, gnädige Frau! Es soll nie mehr wieder geschehen, haben Sie Erbarmen mit mir! Ich bitte sehr, jagen Sie mich nicht fort — meine Mutter, oh, meine arme Mutter!« Zéphire weinte, sie hob flehend die Hände: wie konnte sie so plötzlich zu Hause bei der Mutter auftauchen, weggejagt, ohne Stellung! Sie machte Mine, sich vor der gnädigen Frau niederzuwerfen.
Frau von Weiß wich zurück. »Keine Sentiments«, sagte sie streng. »Ich kann keine Person im Hause dulden, die ein Kind zu Ungehorsam und Unschicklichkeiten verführt.«
»Sie hat mich nicht verführt«, schrie plötzlich Charlotte. Sie bäumte sich auf, sie ballte die Fäuste. »Warum lassen Sie uns so frieren, warum wird hier nicht mehr Holz in den Ofen getan? Weil Sie pauvre sind, ganz miserabel pauvre!« Sie kreischte gellend, sie zitterte am ganzen Körper. »Zéphire soll nicht gehen, Zéphire soll bei mir bleiben! Wenn eine andre kommt, ich kratze sie ins Gesicht. Ich will nicht mehr in die Kirche gehen — ich friere, oh, wie ich friere! Ich sterbe!« Sie verdrehte die Augen, Schaum trat ihr vor den Mund.
Entsetzt riß die Mutter am Klingelzug: »Hilfe! Das gnädige Fräulein hat Krämpfe!«
Das gnädige Fräulein wurde jetzt ganz steif.
Nanette stürzte herbei, der Bediente, Herr von Weiß schon im Nachtkamisol. Die Eltern aufgelöst vor Schrecken, die französische Mamsell im Hemde und in verzweifelten Tränen — eine unbeschreibliche Szene. [24] Es hatte Charlotte nichts genutzt, am anderen Tage verließ Zéphire das Haus. Gerade noch, daß man sie so lange duldete, bis die Post nach Berlin abging. Einen dichten Schleier übergehängt, daß man ihr verweintes, von den vielen Tränen ganz zerstörtes Gesicht nicht sehen sollte, bestieg sie den Postwagen. Nanette schmiß ihr den Reisekorb nach: dich bin ich los! Aber wenn sie gedacht hatte, nun von der Demoiselle wieder in alten Gnaden angenommen zu werden, so hatte sie sich getäuscht.
Charlotte war krank, blieb auch noch lange krank. Vergebens flehte die Mutter sie an, eine Suppe zu sich zu nehmen; es wurde etwas Besonderes für sie gekocht, ein Lieblingsgericht, aber auch das verschmähte sie. Mit einer Zähigkeit sondergleichen hielt sie daran fest, nichts zu essen.
»Eine Krise, eine Krise«, sagte der Medizinalrat, den die besorgten Eltern zu Rate zogen, »die liegt in den Jahren.« Weiter wußte er nichts. Er verordnete kalte Umschläge auf den Kopf, heiße Umschläge auf den Leib und Baldriantee, der die Stube mit seinem widerwärtigen Geruch erfüllte, denn die Patientin goß ihn heimlich hinter das Bett. Und die Umschläge vertauschte sie, sowie sie allein war; die heißen auf den Kopf, die kalten auf den Leib.
»Sie hat Fieber, hohes Fieber«, seufzte die Mutter, »ihre Stirn glüht, schon wieder ist die Kompresse ganz heiß.« In diesen Tagen gab es Augenblicke, in denen Frau von Weiß sich doch heimlich Vorwürfe machte, die französische Mamsell so Knall auf Fall hinausgeworfen zu haben. Es war zwar empörend, was diese Person sich erlaubt hatte — ›Du‹, und des Fräuleins Bett mit zu benutzen! — man hätte sie natürlich in einigen Wochen entlassen, doch erst wenn Lotte gesund war. Aber es schien der stolzen Frau wiederum unmöglich, sich nur einen Tag länger so demütigen zu lassen. Sie redete Charlotte zu, sie ging sogar so weit, ihr zu versprechen, keine andere [25] Mamsell mehr ins Haus zu nehmen. Herr von Weiß erschien immer wieder ängstlich am Bett seines Töchterchens und streichelte das über den Bettrand niederhängende, keinen Druck erwidernde schlaffe Händchen. — —
Als Charlotte es vor quälendem Hunger nicht mehr aushielt, wurde sie wieder gesund. Sie bekam freilich noch einmal einen Rückfall, als sie an Zéphire geschrieben hatte und nun die Mutter nach deren Straße und Hausnummer fragen mußte, denn diese Angabe war nötig in dem großen Berlin. Aber Frau von Weiß behauptete, sie nicht zu wissen. Da zerriß Charlotte ihren Brief in winzige Fetzchen, stampfte mit den Füßen und fiel wieder zuckend aufs Bett.
Nach und nach verloren sich solche Krisen. Aber es war, als sei etwas anderes hineingekommen in Lottes Gesicht — war die reine Stirn dieses Engelsantlitzes nicht mehr ganz so rein? War dies zarte schöne Oval des Gesichtes: nicht mehr ganz so kindlich? — —
»Es wird das beste sein, wir geben Lotte jetzt zu unserer Hofrätin nach Spandau«, entschied die Mutter, »da sie doch durchaus keine neue französische Mamsell mehr leiden will. Und ich muß sagen, nach den gemachten Erfahrungen ist es mir selbst lieber, es kommen solche Weibsbilder nicht mehr ins Haus. Jettchen ist eine vorzügliche Person, eine vorbildliche Gattin und Mutter, Lottchen hat da nur Gutes vor Augen, und wir haben die schönste Gelegenheit, sie weiterbilden zu lassen. Ihr Französisch ist noch immer mangelhaft. Und einen Tanzmeister hat sie noch gar nicht gehabt.«
Herr von Weiß war diesmal ganz einverstanden mit seiner Gattin: sie hatte recht, obgleich er sein Töchterchen schwer vermissen würde, war es für dessen Wohl so das beste. Wenn nur die unvermeidlichen Kosten der Reife und der weiteren Bildung nicht wären! Wenn Hofrats sie auch sicher gern umsonst [26] aufnehmen würden, bare Ausgaben konnte man ihnen doch nicht zumuten.
»Ich werde an meine Schwester Christiane nach Charlottenburg schreiben«, sagte Frau von Weiß. »Es muß ihr doch eine Freude sein, für ihr Schwesterkind etwas zu tun.«
Fräulein Christiane Sophie Regine Witte saß in ihrer hübschen kleinen Wohnung, die sie in dem ersten Stockwerk eines angenehmen Landhauses inne hatte, an der baumbepflanzten Landstraße, die fast vom großen Tiergarten bis zum Königlichen Charlottenburger Schloß einigermaßen gut chaussiert hinlief, und wunderte sich. So hatte ihre Schwester Ernestine ja noch nie geschrieben, so liebreich und so vertrauensvoll! Schon die Anrede: »Teure, geliebte Schwesterseele!« tat ihr unendlich wohl.
Durch die fast unmöglich zu überbrückende Entfernung nach Wien — selbst eine Extrapost brauchte dorthin acht Tage — war bei aller Liebe doch eine gewisse innere Trennung eingetreten; auch als die Weiß nach Stendal übersiedelt waren und einmal die in Spandau verheiratete Tochter besuchten, hatte man sich nicht wiedergefunden. Nicht, daß man nicht einen gewissen Anteil aneinander genommen und auch gern an die gemeinsam im Elternhaus zu Berlin verlebten harmlos-glücklichen Mädchenjahre zurückgedacht hätte, aber wenn viele Meilen von Sand und Moor dazwischen liegen, dann wird eben auch das Band von Herz zu Herzen lockerer. Stendal konnte man in einer Tagesreise erreichen, Frau von Weiß hatte auch einmal zu einem Besuch aufgefordert, aber wie es die empfindsame Christiane dünkte, nur so nebenbei. Und so hatte die Demoiselle Witte sich ganz in ihr einsames Leben eingesponnen und in die Erinnerungen an den verlorenen Freund. Es schien ihr auch nach Stendal zu weit; sie war ein wenig stark gewor[27]den und ein wenig kränklich und ein wenig bequem. Aber heute wachte ein warmes, lange in ihr verkümmertes Gefühl auf, als sie las, was die Schwester schrieb von nie erstorbener schwesterlicher Sehnsucht, und daß es ihr größter Wunsch sei, bevor Charon, der finstere Fährmann, sie in seinem Nachen entführe, die teure Christel noch einmal in die Arme zu schließen. Oh, was war mit Tinchen, dachte die Witte, war sie krank, daß ihr Gedanken an Scheiden und Tod kamen? Die Witte wurde ernstlich besorgt, und die Rührung über soviel immer noch zärtliche Liebe übermannte sie. Tränen tröpfelten nieder, sie weinte sich erst einmal recht satt. Dann aber jubelte es in ihr: Tinchen wollte, da sie nicht selber jetzt abkommen konnte, das Teuerste, was sie besaß, zu ihr schicken, das geliebte Kind Lotte, dessen Haupt alle Grazien geküßt hatten.
»Du glaubst nicht, wie beruhigend es mir ist, daß ich Dich so in der Nähe von Spandau weiß. Lotte soll einige Zeit bei unserer Hofrätin dort zubringen, da hier alle Möglichkeiten zu einer höheren Erziehung fehlen. Weiß und ich leben in leider recht beengten Verhältnissen. Weiß hat ein gänzlich unzureichendes Gehalt. Wir wissen zwar vor der Hand noch nicht, wie wir es aufbringen sollen, Lotten den Unterricht zuteil werden zu lassen, der unerläßlich für sie ist, will sie sich dereinst in der Welt die Stellung erringen, zu der ihre körperlichen und geistigen Gaben sie berechtigen, aber wir halten es für unsere Pflicht, wenigstens die Möglichkeiten dazu anzubahnen. Du, geliebte Schwester, die Du Hand in Hand, Herz an Herz mit mir aufgewachsen bist, wirst es verstehen, welchen Kummer es mir bereitet, daß ich nicht die Mittel habe, diesem so begabten Kinde die allerbesten Lehrstunden zuteil werden zu lassen. Arme Mutter, ach, wo sind deine Wünsche, deine Hoffnungen hin, wohin deine ehrgeizigen Pläne?! Ach, meine geliebte [28] Christiane, könnte ich doch an Deinem treuen Busen die Tränen ausweinen, die ich vor der mißgünstigen Welt verbergen muß! Du allein verstehst mich, der Gedanke an dich ist mir ein Trost.
Ich bitte Dich, schreibe mir mit wendender Post, ob Du ein mütterliches Auge auf meine Lotte haben willst und ob ich darauf rechnen darf, sie in Deine besondere Fürsorge aufgenommen zu wissen. Binnen acht Tagen bei günstiger Witterung soll sie reisen. Sie muß der Ersparnis wegen allein reisen. Ein Bekannter von uns, ein höherer Beamter, der hier zu tun hatte, — soll um diese Zeit nach Berlin zurückkehren, wir werden versuchen, ihm Lotten anzuempfehlen. Der Himmel segne Dich, Du Teure! Alles, was Du an Lotten tust, wird er Dir vergelten. Mit Spannung Deiner Antwort entgegenharrend,
in unwandelbarer Liebe
Deine Schwester Ernestine von Weiß.«
Der Demoiselle Witte bleiches Gesicht hatte sich gerötet; nun sah sie noch ganz anmutig aus, ›Mütterliches Auge — besondere Fürsorge‹ — oh, wie gern wollte sie die kleine Lotte in ihre mütterliche Fürsorge nehmen! Ein Kind — sie hatte ja kein Kind, hatte in ihrer Jugend keines haben dürfen, und hätte doch gerne eins gehabt — nun würde sie, älter geworden, doch eins haben! Ja, Tinchen sollte ihr nur ihre Lotte schicken; von Spandau war es ja nicht weit, hier an ihrem Haus führte die große Straße dorthin, täglich marschierten Truppen nach der Festung, und regelmäßig verkehrte die Journalière. Ein Kind, ein Kind! Es würde sie besuchen, sie würde es sich holen können zur Erheiterung in ihrer Einsamkeit, schon fühlte sie warme liebende Händchen. Wie alt das Kind wohl sein mochte? Sie rechnete nach; die Hofrätin von Hauke war um vieles älter als das nachgeborene Schwesterchen — aber um wie viele Jah[29]re genau? Jedenfalls war Lottchen noch längst nicht erwachsen. Ein Kind, ein Kind! Ach, Tinchen konnte ganz ruhig sein, sie würde schon sorgen, daß es dem Kind an nichts fehlte. Die besten Lehrer — selbstverständlich —, auch sie liebte Bildung und kam gern dafür auf. Und wenn das Kind einmal noch einen besonderen Wunsch hatte — gern, gern, dafür ist man doch liebende Mutter und vermögende Tante zugleich.
[30]
3
Es war ein noch trüber, nebliger, eben erst grauender Frühlingsmorgen, als der Geheime Gerichtsrat Herr Theodor Ursinus in die Postkutsche stieg, die, niedrig und auf dem Deck mit hoch aufgebauten Gepäckstücken beladen, auf sehr hohen Rädern wie ein viereckiger Kasten ruhte.
Der Gerichtsrat setzte sich gleich in die bequemste Ecke, streckte seine Füße in einen gestickten Fußsack, breitete eine warme Pelzdecke über seine Knie und zog sie sich bis zum Halse herauf. Noch einen Wollschal um die Ohren, und nun würde er es wohl aushalten können bis Berlin. Er hüstelte und nieste: eine leidige Fahrerei, hätte man nicht einen anderen mit dieser Revision im Kreis Stendal betrauen können? Aber freilich, auf ihn konnte und durfte man sich verlassen, seinem unbestechlichen Auge entging nichts. Das erst verdrießliche, etwas fahle Gesicht erheiterte sich, zufrieden lächelte Ursinus vor sich hin; es erheiterte sich noch mehr, als jetzt eine vornehm aussehende Dame, der ein Bedienter mit Gepäck folgte, ein junges Mädchen in den Wagen schob.
Ihn bemerkend, hob die Dame, anscheinend freudig überrascht, beide Hände: »Herr Geheimrat Ursinus? Sie erinnern sich — Frau von Weiß. Wir sahen uns bei — ach, wo war es doch gleich?«
Nein, er erinnerte sich nicht, aber er begrüßte sie höflich, wie es sich gehörte: Frau von Weiß, die Frau des Kollegen Weiß. »Wollen gnädige Frau auch nach Berlin?«
[31] »Nein, ich nicht, aber meine Tochter. Gestatten Sie, daß ich sie Ihnen hier präsentiere. Herr Geheimrat Ursinus, liebe Lotte, ein Kollege — nein, ein Vorgesetzter von Papa!«
Das junge Mädchen knickste und errötete, die Augen niedergeschlagen.
»Ach, Herr Geheimrat, wenn ich offen sein soll, so hoffte ich schon auf Ihre Reise. Mein Mann hörte von dieser, aber er hatte nicht den Mut, Sie zu bitten. Nun bitte ich, recht herzlich« — Frau von Weiß sah noch jugendlich und sehr liebenswürdig aus bei dieser Bitte —, »haben Sie die Güte, nehmen Sie sich meiner Tochter ein wenig an! Sie reist zu ihrer Schwester, meiner älteren Tochter, der Hofrätin von Hauke, nach Spandau. Ach, es ist für eine Mutter recht ängstlich, eine Tochter allein auf eine so weite Reise zu schicken, es gibt so viel Dreistigkeit — sie ist noch so jung!«
Ja, jung war sie, das sah Ursinus auch. Er erklärte sich bereit, sein Bestes zu tun. Er würde schon sorgen, daß das junge Fräulein gut reiste und auch in keiner Weise belästigt würde.
»Dafür sorge ich schon selber«, sagte die Kleine und warf das bis jetzt gesenkte Köpfchen auf.
Das schien Ursinus recht keck, und auch die Mutter schien es zu finden: »Aber Lotte!«
Zu weiterer Ermahnung kam es nicht mehr, der Postillion stieß schmetternd in sein Horn: trari, trara.
»Adieu, adieu, meine geliebte Lotte!« Die Mutter riß mit einigen Tränen ihr Kind noch einmal ans Herz.
»Adieu, chère Maman!« Die Tochter küßte ihr noch rasch die Hand. »Leben Sie wohl, grüßen Sie den Papa!«
Frau von Weiß sprang von dem hohen Einsteigetritt herunter, der Schlag flog zu, die Pferde — vier waren es — zogen kräftig an, Charlotte von Weiß warf noch eine Kußhand zum Fenster hinaus, dann schleuderte ein starker Stoß des Wagens, [32] der rasselnd um eine Ecke bog, ihre leichte Gestalt heftig gegen die hart gepolsterte Sitzbank. Sie seufzte und lächelte: Stendal war jetzt vorbei, was kam nun?!
Die Strecke Stendal–Berlin schien nicht sehr frequentiert, sie blieben lange die einzigen in der Postkutsche. Der Geheimrat hatte noch ein wenig zu schlummern gedacht, der Nachtschlaf war ihm durch den frühen Aufbruch erheblich verkürzt worden, aber die Demoiselle war munter, sie hielt ihn wach. Er sah erst jetzt ganz, wie hübsch sie war: ihrer Mutter ähnlich, ein stolzes Gesicht, aber milder und weicher durch die Reize der Jugend. Und recht aufgeweckt schien sie, sie fragte viel nach Berlin.
»Kriegt man da den König zu sehen? Mama schwärmt für ihn. Ist er wirklich ein so großer König?«
»Er ist ein sehr großer Monarch und wird Preußens größter Monarch stets bleiben«, sagte ehrfurchtsvoll der Geheime Gerichtsrat.
»Aber er ist doch schon so alt. Und wenn sein Neffe nun mal an die Regierung kommt, wie wird es dann sein?«
Ursinus räusperte sich: »Wie darf ich mir erlauben, meinen künftigen Herrscher zu kritisieren — Preußen wird auch unter ihm groß sein.«
»Aha!« Charlotte kicherte: »Ich merke schon was.« Sie kniff die Augen blinzelnd zusammen, dann machte sie sie groß und klug wieder auf.
Er sah, daß diese langbewimperten Augen sehr schön waren; er hätte nie gedacht, daß Augen, die bald tief dunkelblau, bald hell grünlichgrau schillerten, schön sein könnten. Sie hatten auch einen leicht schielenden Blick; aber der störte nicht, im Gegenteil. Wie alt mochte die Demoiselle Weiß eigentlich sein? War es indiskret, sie nach ihrem Alter zu fragen? Nach ihren Blicken zu urteilen, schien sie bereits eine Erwachsene, [33] ihrer Gestalt nach noch Kind, obwohl schlank aufgeschossen; die Formen waren noch unentwickelt, die Brust flach. Als sie jetzt, da eine neugierige Sonne anfing durchs Fenster zu stechen, den Capuchon ihres Reisemantels herunterzog, hingen lange Locken, ohne künstliche Frisur, ganz kindlich noch, um ihr dünnes Hälschen.
Theodor Ursinus war nicht verheiratet, seine schwächliche Konstitution hatte ihn auch als Junggesellen enthaltsam gemacht, trotzdem verstand er sich auf Frauenschönheit. Aber mußte man die gleich mit groben Sinnen antasten? Sie als Ästhet zu genießen, war weit bekömmlicher. Diese Kleine hier war ganz wie einer jener berühmten englischen Kupfer, die er so liebte — entzückend, entzückend!
»Darf ich fragen, mein Fräulein, wieviel Lenze Sie zählen? Noch darf man ja fragen.«
»Raten Sie!«
»Fünfzehn, Sechzehn?«
Sie zog die Stirn kraus: »Leider erst dreizehn. Noch nicht einmal ganz, erst nächsten Monat werde ich’s, Anfang Mai. Ich gäbe was darum, wenn ich älter wäre!«
Er lächelte väterlich: »Wenn man so jung ist, dann wünscht man sich das. Später ist gerade das Gegenteil der Fall. Ich zum Beispiel wäre gern jünger.«
»Ja, Sie —! Das glaube ich wohl.«
Ihr Ton traf ihn peinlich: sah sie in ihm denn schon einen Methusalem? Unwillkürlich ließ er die Pelzdecke von den Knien gleiten und zog verstohlen den Schal von seinen Ohren herab. Nun, so alt, wie sie zu glauben schien, war er denn doch noch nicht! Er richtete sich aus seiner bequemen Haltung auf. Freilich, dreizehn Jahre — und er?! Sie könnte gut seine Tochter sein. Auch wenn er erst mit vierzig geheiratet hätte, könnte sie das sein.
[34] »Aber ich werde ja bald erwachsen sein«, tröstete sie sich. »Bei meiner Schwester in Spandau bekomme ich einen Tanzmeister. Sind in Spandau viele Bälle? Spandau ist Garnison, nicht wahr?«
»Spandau ist Festung«, sagte er ernst. »In den Kasematten liegen viele eingeschlossen — strengste Haft, allerstrengste in Ketten — Mörder, gefährliche Staatsverbrecher.«
»Kann man die sehen? Oh, die möchte ich gern mal sehen!« Ihre Augen funkelten neugierig.
»Da sei Gott vor! Solche Impressionen wären ja fürchterlich für der Demoiselle junges Gemüt. Die Schwerverbrecher sieht kein Mensch, die sind verschwunden auf ewig. Unterirdisch sind ihre Gelasse, angeschmiedet liegen sie tief unterm Wasserspiegel des Grabens.«
Sie schüttelte sich leicht.
»Sehen Sie, schon schaudern Sie bei dem bloßen Gedanken!« Er lächelte beruhigend: »Aber fürchten Sie nur nichts, kleines Fräulein, was Sie von Gefangenen zu sehen bekommen sollten, das hat nichts zusagen. Von weitem vielleicht einmal welche, die Erde karren, Schlamm herausschaffen. Aber auch sie sind durch eine schwere eiserne Kugel am Bein unschädlich gemacht; Eisenhörner wachsen aus ihrem Kopfreifen über der Stirn.«
»Warum, warum das?«
»Damit sie sich die Stirn nicht einrennen können, wenn der Aufseher einmal nicht aufpaßt. Aber lassen wir das, es ist eine angreifende Unterhaltung für ein junges glückliches Wesen.«
»Mich greift es nicht an.« Aber sie war doch ganz bleich geworden. Unter ihrer zarten Haut schien das leicht erregbare Blut zurückgewichen. Sie zog ihren Reisemantel fröstelnd um sich. »Bitte, erzählen Sie mir noch mehr davon. Ich will noch mehr hören.«
[35] Und er erzählte von dem Gefangenen mit der Maske, von dem kein Mensch wußte, wer er war, selbst der Kommandant der Festung wußte das nicht. Und erzählte noch einiges, er hatte ja keine Ahnung, daß Grausen Wollust sein kann.
Table of Contents
Umschlag
Titelseite
Impressum | Copyright
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Epilog
Nachwort
Zu diesem E-Book
Guide
Inhalt
Beginning
Cover