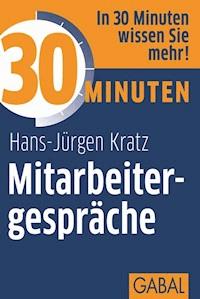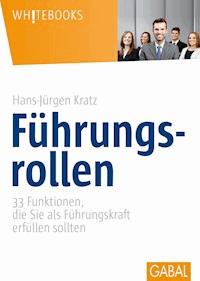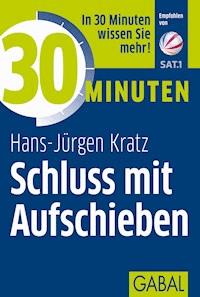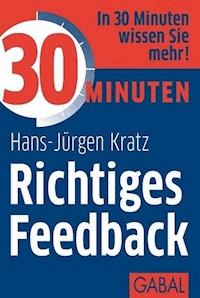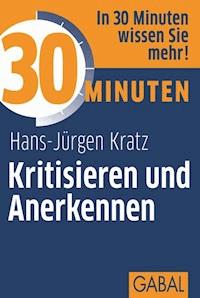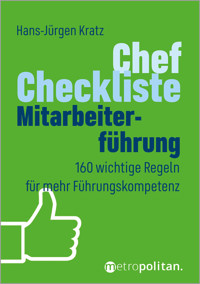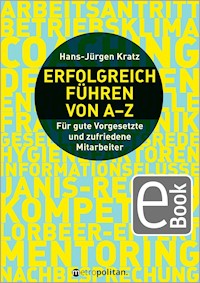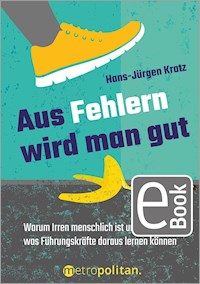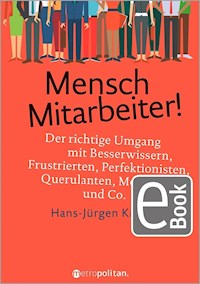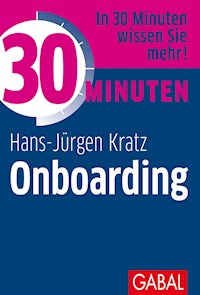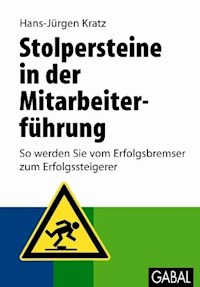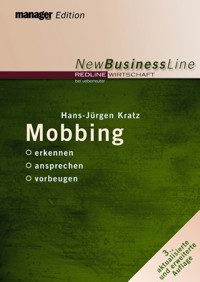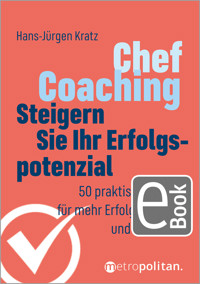
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seien Sie Ihr eigener Coach!
Ziel zeitgemäßer Mitarbeiterführung ist die bestmögliche Aufgabenerledigung bei gleichzeitig größtmöglicher Zufriedenheit von Führungskräften und Mitarbeitern. Dieser Ratgeber beschäftigt sich daher mit den gleichberechtigten Aspekten der Führungsarbeit: Selbstmanagement und Selbstfürsorge.
Führungskräfte verfolgen das Ziel, die richtigen Dinge zu tun, während den ausführenden Mitarbeitern vorrangig die Aufgabe obliegt, die Dinge richtig zu tun. Um der eigenen Führungsaufgabe nachkommen zu können, müssen sich Führungskräfte, Team- oder Abteilungsleiter selbst erfolgreich managen, um ihrer Aufgabenerledigung konsequent und diszipliniert nachgehen zu können und das Unternehmen, das Team oder die Abteilung dauerhaft in der Erfolgsspur zu halten.
Daher liefern zunächst 25 Tools zum Selbstmanagement praktikable Handlungsanstöße und Bewältigungsstrategien, um sich dem anspruchsvollen und herausfordernden Teilziel „bestmögliche Aufgabenerledigung“ signifikant anzunähern und im besten Fall auch zu erreichen.
Im Zeitalter des demografischen Wandels, der rasanten technologischen Entwicklung, der permanenten Erreichbarkeit sowie dem Anspruch an sofortige Einsatzbereitschaft bei maximaler Flexibilität stehen Führungskräfte täglich vor physischen, vor allem aber psychischen Herausforderungen. Um den damit einhergehenden beruflichen Belastungen standzuhalten, ist eine nachhaltige Selbstfürsorge unerlässlich.
25 Tools zur Selbstfürsorge vermitteln Führungskräften praxisorientierte Detail- und Hintergrundinformationen sowie Empfehlungen zu deren Umsetzung. Diese Leitlinien sollen dazu ermutigen, sich selbst regelmäßig zu reflektieren und zu hinterfragen, für sich selbst die Initiative zu ergreifen und Selbstfürsorge zu betreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected]
Kurzbeschreibung
Seien Sie Ihr eigener Coach!
Ziel zeitgemäßer Mitarbeiterführung ist die bestmögliche Aufgabenerledigung bei gleichzeitig größtmöglicher Zufriedenheit von Führungskräften und Mitarbeitern. Dieser Ratgeber beschäftigt sich daher mit den gleichberechtigten Aspekten der Führungsarbeit: Selbstmanagement und Selbstfürsorge.
Führungskräfte verfolgen das Ziel, die richtigen Dinge zu tun, während den ausführenden Mitarbeitern vorrangig die Aufgabe obliegt, die Dinge richtig zu tun. Um der eigenen Führungsaufgabe nachkommen zu können, müssen sich Führungskräfte, Team- oder Abteilungsleiter selbst erfolgreich managen, um ihrer Aufgabenerledigung konsequent und diszipliniert nachgehen zu können und das Unternehmen, das Team oder die Abteilung dauerhaft in der Erfolgsspur zu halten.
Daher liefern zunächst 25 Tools zum Selbstmanagement praktikable Handlungsanstöße und Bewältigungsstrategien, um sich dem anspruchsvollen und herausfordernden Teilziel „bestmögliche Aufgabenerledigung“ signifikant anzunähern und im besten Fall auch zu erreichen.
Im Zeitalter des demografischen Wandels, der rasanten technologischen Entwicklung, der permanenten Erreichbarkeit sowie dem Anspruch an sofortige Einsatzbereitschaft bei maximaler Flexibilität stehen Führungskräfte täglich vor physischen, vor allem aber psychischen Herausforderungen. Um den damit einhergehenden beruflichen Belastungen standzuhalten, ist eine nachhaltige Selbstfürsorge unerlässlich.
25 Tools zur Selbstfürsorge vermitteln Führungskräften praxisorientierte Detail- und Hintergrundinformationen sowie Empfehlungen zu deren Umsetzung. Diese Leitlinien sollen dazu ermutigen, sich selbst regelmäßig zu reflektieren und zu hinterfragen, für sich selbst die Initiative zu ergreifen und Selbstfürsorge zu betreiben.
Autor
Hans-Jürgen Kratz, der erfolgreiche Fachbuchautor und Diplom-Verwaltungswirt aus Cuxhaven veröffentlicht Bücher zu den Themen Mitarbeiterführung, Selbstmanagement und Kommunikation. Er war langjährig als Führungskraft mit unterschiedlichen Schwerpunkten tätig. Anschließend vermittelte er als freiberuflicher Trainer und Dozent sein Wissen in mehr als 600 Seminaren und Bildungsveranstaltungen.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Selbstmanagement? Selbstmanagement!
2. Selbstfürsorge? Selbstfürsorge!
Der Autor
1. Selbstmanagement? Selbstmanagement!
Selbstmanagement? Selbstmanagement!
Tool 1: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Führungsaufgaben.
Tool 2: Steigern Sie Ihre persönliche Autorität.
Tool 3: Akzeptieren Sie Ihre Sandwichposition.
Tool 4: Machen Sie Ziele zu Ihren Wegweisern für erfolgreiches Arbeiten.
Tool 5: Planen und strukturieren Sie künftiges Geschehen.
Tool 6: Nutzen Sie Ihre Hochleistungszeiten.
Tool 7: Setzen Sie Prioritäten.
Tool 8: Motivieren Sie sich und andere: Lachen Sie!
Tool 9: Reduzieren Sie Störungen.
Tool 10: Betreiben Sie Mono- statt Multitasking.
Tool 11: Strukturieren Sie den Arbeitstag schriftlich.
Tool 12: Streben Sie Qualität statt Perfektion an.
Tool 13: Teilen Sie umfangreiche Arbeiten auf.
Tool 14: Ordnung ist das halbe Leben: Machen Sie den Papierkorb zu Ihrem besten Freund.
Tool 15: Terminieren Sie Arbeiten.
Tool 16: Gehen Sie konstruktiv mit Fehlern um.
Tool 17: Schaffen Sie Entlastung durch verstärktes Delegieren.
Tool 18: Lassen Sie Rückdelegation nur ausnahmsweise zu.
Tool 19: Geben Sie Zeitdieben keine Chance: Sagen Sie NEIN!
Tool 20: Lernen Sie Nachgeben, verlernen Sie Aufgeben.
Tool 21: Werden Sie zum Klimabeobachter/-verbesserer.
Tool 22: Sie müssen kein Multifunktionswunder sein.
Tool 23: Vertrauen gewinnt.
Tool 24: Führen Sie mit positiven Formulierungen zum Erfolg.
Tool 25: Ihre Verpflichtung: Aktiv zuhören!
Selbstmanagement? Selbstmanagement!
Führungskräfte verfolgen das Ziel, die richtigen Dinge zu tun, während den ausführenden Mitarbeitern vorrangig die Aufgabe obliegt, die Dinge richtig zu tun. Hierbei obliegt es jeder Führungskraft, sich selbst bei der Aufgaben erledigung in erfolgreicher Weise zu managen, also konsequent und diszipliniert den als richtig erkannten Weg zu beschreiten. Werden dabei erhebliche Defizite erkennbar, kann daraus geschlossen werden, dass diese Führungskraft möglicherweise mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wenn sie ein Team, eine Abteilung oder ein Unternehmen dauerhaft in der Erfolgsspur halten soll.
Aus der Vielzahl möglicher Empfehlungen zu einem verbesserten Selbstmanagement werden in diesem ersten Teil die 25 Tipps vorgestellt, die für die Führungskraft die größten Erfolgsergebnisse versprechen.
Selbstmanagement beinhaltet eine Reihe von Einzelkomponenten, mit deren Hilfe Sie Ihren Führungsbereich und Ihre Arbeit konstruktiv und erfolgreich steuern, um definierte Ziele in überzeugender Weise zu erreichen.
Nur wer sich selbst und seinen Tag organisieren kann, wer sich nicht verzettelt, sich nicht ablenken lässt und Wichtiges nicht aufschiebt, bleibt auf Kurs zu seinen Zielen.
Tool 1: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Führungsaufgaben.
Während das Gros der Aufgaben in Ihrem Bereich als Fachaufgaben von den Mitarbeitern erledigt wird, stehen Sie bei den nicht delegierbaren Führungsaufgaben im Vordergrund. Je höher Sie in der betrieblichen Hierarchie angesiedelt sind, umso mehr verändert sich das Verhältnis von Fach- zu Führungsaufgaben.
Im Regelfall erfordern die mit Ihren Führungsaufgaben im Zusammenhang stehenden Aktivitäten Ihre volle Konzentration und Ihr uneingeschränktes Engagement. Aber das scheint manchen Führungskräften nicht zu genügen. Sie haben den Ehrgeiz, auch bei den Fachaufgaben die Nummer eins zu sein.
Sie sind überzeugt, sie müssten ein umfangreicheres Wissen als jeder ihrer Mitarbeiter besitzen. Würde diese Auffassung tatsächlich zutreffen, wären viele Vorgesetzte sicherlich überfordert, weil immer häufiger die Mitarbeiter (= Spezialisten) dem Vorgesetzten (= Generalist, Universalist) in ihrem Teilbereich an Sachwissen überlegen sind. Heutzutage kann sich kaum noch ein Vorgesetzter ständig mit jedem seiner Mitarbeiter im fachlichen Bereich messen und den Vergleich für sich entscheiden. Würde er sich dennoch in diesen fachlichen Wettbewerb stürzen, käme es zu einem unangemessen hohen Energieeinsatz, unter dem seine Führungsaufgaben leiden würden. Auch könnten Mitarbeiter bald zu dem Urteil gelangen: „Der Chef weiß zwar nicht alles, dafür weiß er aber alles besser!“
Vorgesetzte müssen nicht alles wissen, sondern sollen ein in die Breite gehendes Fach- und Methodenwissen aufweisen, während von den als Spezialisten eingesetzten Mitarbeitern ein in die Tiefe gehendes Fachwissen zu fordern ist.
Hierzu ein Beispiel:
Ein Kfz-Betrieb wird von einem Kfz-Mechatronikermeister geleitet. Bei speziellen Fragen von Mitarbeitern aus der Lackiererei, bei IT-Problemen oder betriebswichtigen Steuerfragen muss er „passen“, sobald es in die Tiefe geht. Dafür stehen ihm jedoch kompetente Mitarbeiter bzw. externe Fachleute zur Verfügung, die jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich das fachliche Know-how besitzen. Trotzdem kann er mit seinem in die Breite gehenden Fach- und Methodenwissen seine Mitarbeiter kompetent führen und die unbedingt erforderliche Koordination innerhalb des Betriebs gewährleisten.
Allerdings müssen Sie als Führungskraft über ein fachliches Grundlagenwissen zu den Tätigkeiten Ihrer Mitarbeiter verfügen, um diese richtig einsetzen, beurteilen und im Bedarfsfall mit geeigneten Maßnahmen unterstützen zu können. Fehlt dieses Grundlagenwissen und fallen Sie in der Sache als Gesprächspartner aus, wird die Luft für Sie recht dünn.
Vor dem in die Tiefe gehenden Fachwissen der Spezialisten mögen Sie zwar Respekt haben, der aber nicht dazu führen darf, diesen Experten Narrenfreiheit zuzugestehen. Sie beziehen die besonders qualifizierten Spezialisten, auf die Sie als Generalist angewiesen sind, intensiv in das Betriebsgeschehen ein. „Divaallüren“ Ihrer Fachleute wie Absonderungstendenzen, Egoismus und Einzelkämpfertum lassen Sie im Interesse des Unternehmenserfolgs und des Betriebsklimas nicht zu.
Worauf sollten Sie bei der Führung von Spezialisten besonders achten?
Machen Sie von der Möglichkeit des Delegierens Gebrauch. Hierdurch ermöglichen Sie Ihren Experten eine hohe Selbstständigkeit mit großen Entscheidungsräumen. Dies stärkt die Eigenverantwortung, die wiederum motivierend wirkt.
Nutzen Sie das fachliche Potenzial Ihrer Spezialisten durch deren Beteiligung an Ihren Aufgabenstellungen (z. B. vorbereitende Arbeiten für Ihre wichtigen Entscheidungen) im Status eines Beraters.
Um nicht erpressbar zu sein, achten Sie auf eine Aufgabenverteilung, durch die auch bei Ausfall des Spezialisten schnell ein Ersatz zur Verfügung steht.
Geben Sie dem Spezialisten bei guter Aufgabenerledigung die redlich verdiente Anerkennung. Vor allem bei besonders qualifizierten Mitarbeitern ist man versucht, positive Arbeitsergebnisse als selbstverständlich zu betrachten.
Rufen Sie sich die Ihnen obliegenden Führungsaufgaben in Erinnerung.
Als Vorgesetzter müssen Sie neben Ihren Fachaufgaben schwerpunktmäßig fünf Punkte im Auge behalten:
1. Ziele vereinbaren
Jeder Führungsprozess wird von einer Problemsituation eingeleitet. Es gilt, das gewünschte SOLL zur Überwindung der Problemsituation festzulegen. Kooperativ Führende formulieren nach partnerschaftlicher Diskussion mit ihren Mitarbeitern Ziele. Diese im Konsens festgelegten Ziele bündeln die vorhandenen Energien der Mitarbeiter für konkrete Handlungen.
2. Planen
Weil bei zukunftsgerichteten Aktivitäten der Informationsstand immer kleiner als eins ist, werden im Rahmen der Planungen vielfältige Informationen eingeholt, Lösungswege ermittelt und untaugliche Lösungsmöglichkeiten ausgesondert, um das vereinbarte Ziel mit geringstmöglichem Aufwand zu erreichen.
3. Entscheiden
Aus den verbliebenen Lösungsmöglichkeiten wird das beste Handlungsprogramm ausgewählt und damit eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Da diese in die Zukunft wirkt, hofft der Entscheidungsträger auf die Richtigkeit seiner Informationen und Erfahrungen sowie seiner auf Intuition beruhenden Einschätzung.
4. Realisieren
Jede Entscheidung ist nur so gut, wie sie ausgeführt wird. Deshalb müssen Entscheidungen in Handlungen umgesetzt werden. Hierbei sind Vorgesetzte aufgerufen, zu motivieren, zu delegieren, zu koordinieren und zu veranlassen.
5. Kontrollieren
Schließlich ist durch Kontrolle zu ermitteln, ob das Handlungsergebnis (= IST) dem gewünschten und vereinbarten SOLL entspricht. Dabei ist es unbedingt zu vermeiden, dass dieser Kontrollfunktion der negative Beigeschmack eines Überwachungs-, Fehlerfindungs- und Bestrafungsinstruments anhaftet.
Diese fünf Führungsaufgaben sind um die Querschnittsaufgabe „Informieren“ zu ergänzen. Ohne den funktionierenden Austausch von Informationen zwischen den Akteuren, könnten Vorgesetzte ihre Führungsaufgaben nicht in Erfolg versprechender Weise wahrnehmen.
Neben bestimmten Ihnen obliegenden Fachaufgaben richten Sie Ihr besonderes Augenmerk auf Ihre Führungsaufgaben. Damit werden Sie auch ausgelastet sein und verzetteln sich nicht, sodass ein ständiges Einmischen in die Aufgaben der Mitarbeiter unterbleibt. Andernfalls käme bei Mitarbeitern der Verdacht auf, sich auf einem Schiff ohne Kapitän und Steuermann zu befinden.
Tool 2: Steigern Sie Ihre persönliche Autorität.
Selten begegnen uns charismatische Führungskräfte, die sich durch ihre Ausstrahlung, ihre Persönlichkeit und ihre Begeisterungsfähigkeit auszeichnen und die Herzen und Köpfe ihrer Mitarbeiter im Flug erobern. Die Zahl der „geborenen Führer“ ist verschwindend klein, sodass im Regelfall „Normalsterbliche“ Führungsfunktionen übernehmen. Für sie kann die Frage existenziell sein, ob es gelingt, sich zu behaupten und Entscheidungen in erfolgreiche Aktionen umzusetzen.
Neben dem unverzichtbaren fachlichen Grundlagenwissen für die Führungsposition ist zusätzlich das Ausmaß der persönlichen Autorität entscheidend. Persönliche Autorität wird der Führungskraft von den Mitarbeitern aufgrund ihrer Persönlichkeit zuerkannt. Nach Goethe ist die persönliche Wertschätzung durch die Mitmenschen das „höchste Glück der Erdenkinder“. Grundlage der persönlichen Autorität sind die positive Einstellung und die offene Haltung gegenüber der Führungskraft, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Das erfordert ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Erst dieses Vertrauenskapital ermöglicht eine fruchtbare Zusammenarbeit, sodass sich Mitarbeiter ohne Druck für das Erreichen betrieblicher Ziele einsetzen und eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen. Letztlich beruht die Akzeptanz einer Führungskraft in ihrer Persönlichkeit und ihrer Fähigkeit, ihr unter- und zugeordnete Personen zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zu bringen.
Unter Experten gilt die persönliche Autorität als Königsweg der Mitarbeiterführung. Fehlt es an dieser Eigenschaft, ist es an der Führungskraft, sich mit sozialem Einfühlungsvermögen und viel Geduld – Ungeduld wäre hier die Mutter des Misserfolgs – um die Verstärkung der persönlichen Autorität zu bemühen.
Hierbei wird die Führungskraft
Mitarbeiter ohne Vorurteile und Überheblichkeit als Partner betrachten und behandeln und diese aktiv am Willensbildungsprozess im Rahmen ihrer Fähigkeiten, ihres Wissens und ihrer Erfahrung mitwirken lassen
eine ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft (die Bereitschaft, sich mit zuteilen, sowie die Fähigkeit, zuzuhören und sich einzufühlen) zeigen
im persönlichen Verhalten Vorbild für die Mitarbeiter sein (z. B. Einsatz bereitschaft dokumentieren, Loyalität gegenüber Mitarbeitern zeigen, nicht auf Privilegien beharren)
ein gesundes Selbstvertrauen beweisen, in schwierigen Situationen gelassen bleiben, den Mut besitzen, Entscheidungen zu treffen, und auch bereit zu sein, eigene Fehler einzugestehen
den Mitarbeitern durch Delegierung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung ein großes Maß an Selbstständigkeit ermöglichen
die Führungsmittel Anerkennung und Kritik situationsgerecht und auf bauend einsetzen
eine „gedeihliche Distanz“ anstreben (Das Problem von Nähe und Distanz zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitern gleicht oft genug einem Drahtseilakt. Weder eine gelebte Unnahbarkeit noch ein kumpelhaftes Verhalten sind zu empfehlen. Jede Führungskraft wird sensibel ausloten, welche Distanz für sie angemessen ist. Dazu gibt es allerdings keine klare Empfehlung, da es immer die jeweilige Situation zu beachten gilt. Erfahrungsgemäß kommen Menschen im beruflichen Alltag am besten miteinander aus, wenn dies in einer „mittleren Entfernung“ geschieht.)
Der Philosoph Arthur Schopenhauer empfahl eine „gedeihliche Distanz“, die er mittels einer Parabel anschaulich beschrieb:
Eine Herde Stachelschweine zog frierend bei klirrendem Frost und eisigem Sturm umher, bis eines der Tiere eine Höhle entdeckte, die Schutz bot. Schnell bemerkten die Herdenmitglieder, dass die Höhle auf der dem Eingang entgegengesetzten Seite einen Ausgang aufwies, sodass es in der Höhle sehr zog. Sogleich drängten sie sich eng aneinander, um der kalten Zugluft nur eine geringe Angriffsfläche zu bieten und sich gegenseitig zu wärmen. Weil sie sich jedoch fürchterlich gegenseitig stachen, sprangen sie sofort auseinander und hielten Abstand zueinander. Jetzt hatte der Wind ein leichtes Spiel. Nach einiger Zeit, in der sie bibbernd und zähneklappernd dem kalten Wind ausgesetzt waren, entwickelten sie ein Verhalten, das dem Prinzip der gedeihlichen Distanz entspricht: Sie bewegten sich so weit aufeinander zu, dass sie dem Wind keine großen Angriffsflächen boten und sich auch nicht gegenseitig stechen konnten!
das richtige Maß an Führungswillen (= als richtig Erkanntes durchsetzen) zeigen (Das Führen am „überlangen Zügel“ bringt kaum die gewünschten Ergebnisse, sondern wird von Mitarbeitern als Führungsschwäche bewertet. Auch wird ein zu starker Führungswille abgelehnt, weil er oft mit Druck und Manipulation einhergeht.)
einen klaren Kurs steuern
Auf keinen Fall darf fehlende persönliche Autorität durch gelegentlich in der Praxis erkennbare „Überlebensstrategien“ ersetzt werden, so zum Beispiel:
Betonen des Befehlscharakters einer Weisung
übermäßig kollegiales Verhalten (Mitarbeiter werden zu „Kumpeln“, deren Kooperationsbereitschaft durch Anbiederung/Schulterklopfen erkauft wird)
künstliche Distanz (jeder persönliche Kontakt wird auf das Minimum beschränkt in der Hoffnung, dadurch eine eher unangreifbare Position zu erlangen)
intrigantes Ausspielen der Mitarbeiter untereinander („Solange sie sich gegenseitig bekämpfen, bleibe ich unangetastet.“)
Zurückhalten von Informationen (Mitarbeiter werden in Abhängigkeit gehalten, weil diese wegen fehlender Informationen nur unzureichend eigenständig arbeiten können und demzufolge ständig auf den im Besitz der erforderlichen Informationen befindlichen Vorgesetzten angewiesen sind)
Die Führungsposition ist optimal besetzt, wenn die Führungskraft das erforderliche Fachwissen besitzt und ihm von seinen Mitarbeitern persönliche Autorität zuerkannt wird. In diesem Fall wird aus einem Guss geführt.
Was geschieht aber, wenn die Führungskraft in den Augen ihrer Mitarbeiter keine fachliche und/oder persönliche Autorität besitzt?
Dann werden bestehende Freiräume regelmäßig von informellen Führern gefüllt. Während die Führungskraft für eine optimale Aufgabenerledigung verantwortlich ist, kann der informelle Führer diesen Gesichtspunkt bei seinem Handeln vernachlässigen. Hier lassen sich sogar populäre Gegenpositionen zum Vorgesetzten aufbauen und vertreten. Konflikte werden dann wahrscheinlich und für den Vorgesetzten wird es schwierig, sich in der Arbeitsgruppe durchzusetzen. Sind sich der Vorgesetzte und der informelle Führer auch noch unsympathisch, können bedrohliche Krisen nicht ausgeschlossen werden.
Das Gruppenmitglied, das die Rolle des informellen Führers ausfüllt, ist häufig an typischen Charakteristika zu erkennen:
Es meldet sich häufiger zu Wort als andere Gruppenmitglieder.
Es versteht besser, sich mündlich auszudrücken als die meisten Gruppenmitglieder.
Es spricht für die Gruppe („Wir sind der Meinung ...“).
Es fühlt sich für das Gruppengeschehen verantwortlich.
Es wird von der Gruppe als Sprecher akzeptiert.
Es steht erkennbar im Vordergrund (Manchmal tritt ein Wortführer in den Vordergrund, während der informelle Führer als Drahtzieher im Hintergrund wirkt!).
Kollidieren die betrieblichen Ziele und Interessen mit denen des informellen Führers, kann die Position der Führungskraft untergraben werden: Die Mitarbeiter widersetzen sich offen oder insgeheim deren Anordnungen und streuen fortwährend Sand ins Getriebe.
Kluge Führungskräfte versuchen, die Einwirkungsmöglichkeiten des informellen Führers für die betrieblichen Zwecke nutzbar zu machen. Bekämpfen sie ihn, solidarisieren sich vielfach die Gruppenmitglieder mit ihm gegen den Vorgesetzten. Besser ist es, sich um eine Situationsverbesserung zu bemühen:
eigene Sympathiehemmer erkennen, Kontakt aufbauen, mit dem informellen Führer sprechen (sich dem informellen Führer keinesfalls verschließen)
den informellen Führer informieren, in wichtige Problemstellungen einbeziehen und mitplanen lassen (aber keinesfalls mitentscheiden lassen – das Entscheiden ist und bleibt Führungsaufgabe des Vorgesetzten!)
den informellen Führer nicht vor der Gruppe bloßstellen (wird er blamiert, ist mit unangenehmen Reaktionen zu rechnen, weil er sein Gesicht gegenüber den Gruppenmitgliedern wahren will)
sich bei unterschiedlichen Auffassungen intensiv um einen Konsens bemühen, damit der informelle Führer danach als Multiplikator dienen kann
bei Abweichungen die Folgen dieses Verhaltens mit dem informellen Führer besprechen (in menschlich einwandfreier Form wird ihm dargestellt, dass es nicht hingenommen werden kann, wenn die Entscheidungen des Vorgesetzten von ihm konterkariert werden)
sich vom informellen Führer trennen, wenn dieser trotz vorangegangener ernsthafter Bemühungen im Sinne vorstehender Empfehlungen permanent die Oppositionsrolle einnimmt
Da eine Führungskraft nicht ewig mit der geschilderten Situation leben kann, wird sie sich ohne Zögern um eine Situationsverbesserung bemühen, indem sie ihre Kompetenz im fachlichen und/oder persönlichen Bereich peu à peu steigert. Sind Defizite schließlich ausgeräumt, haben die Mitarbeiter längst registriert und akzeptiert, dass sich neben der Führungskraft kein informeller Führer mehr einmischen muss.
Wer zur Quelle gehen kann, geht nicht zum Wassereimer.LEONARDO DA VINCI
Abschließend halten wir fest:
Autorität ist unverzichtbar. Zwar wird oft der soziale Wandel moderner Industriegesellschaften irrtümlich für eine Auflösung von Autorität verantwortlich gemacht. Tatsächlich haben sich nur Inhalt und Form der Autorität gewandelt. Die ursprünglich auf Tradition und Herkunft gegründete Autorität ist einem komplexen Autoritätsbegriff gewichen, der erst erfolgreiche Mitarbeiterführung in unserer Zeit ermöglicht. Während ein Vorgesetzter seine fachliche Autorität durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen verbessern kann, muss er sich die ihm von seinen Mitarbeitern „verliehene“ persönliche Autorität tagtäglich neu verdienen. Dabei ist vor allem die persönliche Autorität entscheidend für das Führungsgeschehen, denn:
Die Autorität, die sich auf Zuneigung stützt, hat sichere Gefolgschaft.GOTTLIEB DUDWEILER
Tool 3: Akzeptieren Sie Ihre Sandwichposition.
Zwischen Ihrem Vorgesetzten und den Mitgliedern Ihrer Arbeitsgruppe fungieren Sie als Bindeglied/Scharnier/Brückenbauer/Pufferzone/Troubleshooter. Über diese Sandwichposition beklagen sich manche Führungskräfte, weil es nicht immer einfach ist, den Vorstellungen der Beteiligten gleichermaßen gerecht zu werden. Einerseits ist man dem Betrieb verpflichtet und muss den eigenen Vorgesetzten loyal unterstützen und Anweisungen „von oben“ an die Mitarbeiter übertragen. Andererseits laufen diese Weisungen möglicherweise eigenen Vorstellungen, den Teaminteressen oder den Erwartungen einzelner Mitarbeiter zuwider, was sich in krassem Widerspruch ausdrücken kann.
Wenn Sie jede Anforderung vorgesetzter Stellen akzeptieren und sich für deren Beachtung und Umsetzung einsetzen, werden Sie von Ihren Mitarbeitern bald als Radfahrer (nach oben buckeln, nach unten treten) abgestempelt. Vertreten Sie aber mit Nachdruck eine zu den offiziellen Vorstellungen entgegengesetzte Position, werden das zwar möglicherweise die Mitarbeiter mit Respekt zur Kenntnis nehmen, dafür kann Ihre Stellung im Unternehmen nach einigen Wiederholungen unhaltbar werden.
Ihre Sensibilität und Ihr Fingerspitzengefühl sind gefragt, um diese Gratwanderung unbeschadet zu überstehen. Dabei können Ihnen folgende Empfehlungen helfen:
Ihre Position zeichnet sich dadurch aus, dass Sie eine besondere Funktion als Wissensträger und -vermittler wahrnehmen und hierbei in alle Richtungen kommunizieren. Machen Sie sich bewusst, dass Sie als Scharnier fungieren zwischen den strategischen Plänen und Zielen der nächsthöheren Ebene und dem, was Ihre Mitarbeiter denken, was sie können und was sie tun. Hiermit sind größere Gestaltungsräume verbunden, die von Ihnen genutzt werden sollten.
Indem Sie sachlich bleiben und Kritikwürdiges weder beschönigen noch verdammen, können Sie manchen Sachverhalt in beide Richtungen steuern. Lassen Sie hierbei Ehrlichkeit und Loyalität erkennbar, wird die Vertrauensbasis zwischen den Akteuren gestärkt.
Bevor Sie Zielvorstellungen „von oben“ akzeptieren, sollten Sie diese genau verstehen. Sie vermeiden Unklarheiten und Missverständnisse, indem Sie durch Nachfragen Gewissheit erlangen.
Es zahlt sich immer aus, die Faktoren transparent zu machen, die eine Entscheidung bewirkt haben. Verschweigen Sie dabei auch nicht Nachteiliges. Wissen die Mitarbeiter die Gründe für das künftige Vorgehen, sind Sie eher zu einer gemeinsamen Anstrengung bereit.
Sind Sie sich bewusst, dass Sie über ein wertvolles Basiswissen verfügen und vieles als „Experte vor Ort“ besser im Blick haben als Ihr Vorgesetzter? Unter Verweis auf Ihre fachliche Expertise können Sie mit etwas Diplomatie als Chefberater dafür sorgen, dass manche fehlerhafte Anweisung frühzeitig berichtigt wird. Achten Sie hierbei auf eine sachliche, begründete und konstruktiv vorgetragene Kritik. Äußern Sie eigene Bedenken und Überlegungen und zeigen Sie wohlbegründete Alternativen auf.
Werden Sie von Entscheidungsprozessen der nächsthöheren Führungsebene ausgeschlossen, sind Sie nur noch ein ausführendes Organ, ein Erfüllungsgehilfe, der mit seinem Team zu „spuren“ hat. Ihre Motivation nimmt Schaden und Ihre Mitarbeiter werden Ihnen auf Dauer die Gefolgschaft versagen. Indem Sie Ihr Know-how mit konstruktiven Vorschlägen aktiv einbringen, werden Sie für den Vorgesetzten sichtbar. Bald werden Sie aus einem leidenden Mitarbeiter zu einem leitenden Mitarbeiter Ihres Unternehmens.
Spannungen sind in Sandwichpositionen nicht zu vermeiden, denn auf Dauer wird immer irgendjemand über Ihr Verhalten enttäuscht sein. So berichten beispielsweise aus dem Kollegenkreis aufgestiegene Führungskräfte von Erwartungen der Exkollegen, Probleme unabhängig von betrieblichen Vorgaben in alter Verbundenheit in ihrem Sinne zu regeln. Sind solche Erwartungen nicht erfüllbar, reagieren die Enttäuschten mit Unverständnis und Sympathieentzug selbst dann, wenn bei objektiver Betrachtung die Führungskraft nur ihren Verpflichtungen in angemessener Weise nachkommt. Vertreten Sie auch in diesen Fällen eine unmissverständliche Linie.
Tool 5: Planen und strukturieren Sie künftiges Geschehen.
Spötter behaupten, Planen bedeute das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum. Sie erklären mit Unschuldsmiene, nicht planlos zu agieren, sondern kreativ, neugierig und erlebnisoffen zu sein. Dem Zufall sind wir schutzlos ausgeliefert, während wir als Planende immerhin die Möglichkeit haben, aus Irrtümern zu lernen und damit bessere Entscheidungen vorzubereiten. Würden Sie auf Planung verzichten, könnten manche Vorhaben nicht realisiert werden, viel kostbare Zeit ginge verloren und Arbeit würde zu reiner Glückssache werden. Die Praxis lässt erkennen: Wer nicht plant, der wird schnell von außen (z. B. Umstände, Kollegen) verplant. Der „Zeitmanagementpapst“ Prof. Lothar Seiwert warnt:
Arbeiten ohne Plan und Ziel ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse.
Gewiss bringt jede Planung eine Einschränkung von Freiheit und Spontaneität mit sich, denn man legt sich auf eine bestimmte Vorgehensweise fest und schließt andere aus. Dieses Manko wird jedoch aufgehoben, denn bei rechtzeitiger und effektiver Planung sind wesentlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Volksmund hat erkannt, dass ein guter Plan bereits die halbe Miete ausmacht. Allerdings ist jeder Plan überflüssig, wenn Sie nicht das tun, was Sie geplant haben!
Angestrebte Ziele sollten auf dem kürzesten Weg bei geringstmöglichem Aufwand erreicht werden. Hier hilft eine gründliche Planung, Umwege und Sackgassen zu vermeiden. Der Planungsprozess enthält vier Punkte:
Formulierung des Ziels (SMART)
2.Informationsgewinnung über Umweltbedingungen, das heißt Verwerten von Erfahrungen und Sammeln von Informationen
3.Analyse und Auswertung der Informationen, Gewichtung ausgewählter Daten, Aufstellen alternativer Entscheidungspläne
4.Entscheidung für einen Plan
Konkret beinhaltet eine aussagefähige Planung mehrere Elemente:
sinnvolle Reihenfolge der Planungsschritte
Ermitteln vorhersehbarer und unerwarteter Risiken (Risikoanalyse)
Terminplanung: Start-, End-, Zwischentermine (Meilensteine)
Ressourcenplanung (Personal und Sachmittel)
Budgetierung
Da sich Plandaten durch neue Erkenntnisse bei der Realisierung verändern können, sehen Sie Planungen als dynamischen Prozess an. Sie werden einen Plan B aus der Schublade ziehen müssen, wenn der ursprüngliche Plan A zu scheitern droht. Prinzipiell sollten Sie:
schriftliche Pläne bevorzugen (Pläne, die man nur im Kopf hat, verlieren an Bedeutung und werden leichter über den Haufen geworfen, während schriftliche Pläne für mehr Disziplin/Konsequenz sorgen und eine Entlastung des Gedächtnisses darstellen. Doch aufgepasst: Papier ist geduldig! Mit der Schriftform sind Sie Ihrem Vorhaben noch keinen Schritt nähergekommen. Sie wissen: Gute Absichten sind wertlos. Lassen Sie also Ihrem schriftlich fixierten Plan bald Taten folgen. Nach mehr als drei Tagen Untätigkeit wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass Sie Ihr eben fixiertes Ziel überhaupt angehen werden.)
gegenseitige sachliche Abhängigkeiten über mehrere betriebliche Ebenen hinweg berücksichtigen und koordinieren
ständig prüfen, ob Ihre Planung noch mit gültigen Zielfestlegungen über einstimmt