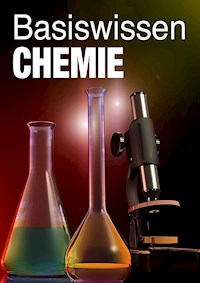
Chemie E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Serges Medien
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was ist ‚Chemie‘? Eine einfache Frage, auf die eine Antwort – zugegebenermaßen – nicht immer ganz leicht fällt. Nach und Chemie heranführen und so auf die Frage antworten. Die Chemie nach sollen die folgenden Kapitel an die vielfältigen Themen der prägt unseren Alltag weit stärker, als uns bewusst ist. Deswegen Vorteil. Auf Anhieb denkt fast jeder an Chemiker, die mit ihren ist ein Einblick in und Überblick über dieses Fach sicherlich von Mitarbeitern in Laboratorien und Fabrikanlagen forschen und produzieren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Chemie
Die Chemie – die große Unbekannte
Der weite Weg zur Wissenschaft Chemie
Eigene Charaktere – Stoffe und ihre Eigenschaften
Nicht nur sauber, sondern rein: Stoffmischungen – Reinstoffe – Trennverfahren
Grundlagen der Chemie
Modelle und Aggregatzustände
Hurtig und geschwind – die Teilchenbewegung
Auch die Atome sind nicht mehr die alten
Das Ende der alten Physik – das Zwiebelschalenmodell
Wolkige Kugeln – das Kugelwolkenmodell der Atome
Das Periodensystem der Elemente
Die Chemie und ihre Liebe zur Ordnung – das Periodensystem der Elemente
Nichts ist praktischer als eine gute Theorie – die physikalischen Grundlagen des Periodensystems
Die spät entdeckten „Adligen“ – die Edelgase
Chemische Reaktionen I
Wenn die Chemie stimmt – chemische Reaktionen
Das ‚Buchstabenmodell‘ chemischer Reaktionen und eine kleine Anleihe bei der Mathematik
Wasserstoff und Sauerstoff
Sauerstoff – ein chemisches Element als Grundlage des Lebens auf unserer Erde
Kein Wasser ohne diesen Stoff – der Wasserstoff und die Moleküle
Das Verhalten von Gasen
Das späte Glück der Chemiker – die physikalischen Ähnlichkeiten unter den Gasen
Chemische Reaktionen II
Gasig leichtes Rechnen – chemische Reaktionen mit Beteiligung von Gasen
Man rechnet fest mit ihnen – Feststoffe und ihre Reaktionen
Stets energisch – chemische Reaktionen und die Energie
Metalle
Metalle – das Grundgerüst der Technik
Auch die Metalle sind Individualisten
Die Tausendsassas der Technik – die Verwendungszwecke der wichtigsten Gebrauchsmetalle
Die Erze haben‘s in sich: Von der Gewinnung der Metalle
Übergänge zwischen Metallen – die Übergangsmetalle
Halbmetalle
Nichtmetalle
Auch schlecht kann gut sein – die Nichtmetalle und ihre elektrische Leitfähigkeit
Kohlenstoff – ein chemisches Element mit unterschiedlichen Gesichtern
Schwefel und Phosphor – vielseitige Nichtmetalle
Halogene – natürlich nicht elementar
Wasser
Die wichtigste Substanz der Welt: Gewöhnliches Wasser
Gase und Luft
Brausetabletten, Regentropfen, Ammoniak und das Prinzip vom kleinsten Zwang
Emissionen und Immissionen von Nichtmetalloxiden
Wer wird denn gleich in die Luft gehen – die Chemie tut es
Radikales Rendezvous über den Wolken: UV trifft auf FCKWs – Ozon verhindert Schlimmeres
Das größte natürliche Treibhaus – die Erde unter einer riesigen Kuppel
Salze und Ionen
Der lange Marsch – von den polaren Atombindungen zu den Salzen und Ionen
Ein Gitter für die Salze – Ionengitter und ihre Besonderheiten
Die Chemie der versalzenen Suppe
Absolut unverzichtbar – Ionen und Salze als Nährstoffe
Alkali- und Erdalkalimetalle
Die Alkalimetalle: Eine hochreaktive Elementfamilie
Die Erdalkalimetalle: Für farbiges Feuerwerk und Mumm in den Knochen
Säuren und Basen
Wenn Rotkohl sauer wird …
Die Vorstellung des pH-Wertes
Säuren und Basen – die Geschichte holt uns immer wieder ein
Die Geschichte geht weiter – Anwendungen der Säure-Base-Theorie
Batterien und Akkumulatoren
Energie hin und her – elektrisch und chemisch
Organische Chemie I
Organische Chemie – Stoffe der belebten Natur?
Fossile Energieträger und erneuerbare Energien
Die Alkane – das kleine Einmaleins der gesättigten Kohlenwasserstoffe
Fast gleich ist nicht identisch – das Phänomen der Isomerie
Petrochemie
Schwarzes Gold – der wertvolle Rohstoff Erdöl
Crack – das Knacken von langkettigen Alkanen für Treibstoffe
Kunststoffe
Von der Kunst, Stoffe in langen Ketten herzustellen
Naturstoffe und Ernährung
In Shampoo, Seife und Kaugummis – Alkohole
Ameisensäure, Essigsäure, Zitronensäure … – Carbonsäuren auf Schritt und Tritt
Gesundheit, Gerüche und Glanz durch Ester und Wachse
Fett mag Fett und macht fett
Nicht nur Schaumschläger – Seifen und Waschmittel
Kohlenhydrate – vielseitige Naturstoffe
Amine – von A wie Amphetamin bis V wie Vitamin
Aminosäuren und Proteine – fast unendliche Vielfalt durch komplexe Strukturen
Energie, Nährstoffe und die i-Tüpfelchen der Nahrung
Von Triebtätern und Feinschmeckern – Exkurs: Chemie für Gourmets
Kosmetik
Schöner Schein? Chemie schafft‘s
Das Periodensystem
Das Periodensystem der Elemente
Die Chemie – die große Unbekannte
Was ist ‚Chemie‘? Eine einfache Frage, auf die eine Antwort – zugegebenermaßen – nicht immer ganz leicht fällt. Nach und nach sollen die folgenden Kapitel an die vielfältigen Themen der Chemie heranführen und so auf die Frage antworten. Die Chemie prägt unseren Alltag weit stärker, als uns bewusst ist. Deswegen ist ein Einblick in und Überblick über dieses Fach sicherlich von Vorteil. Auf Anhieb denkt fast jeder an Chemiker, die mit ihren Mitarbeitern in Laboratorien und Fabrikanlagen forschen und produzieren (Abb. 1, 2).
Abb. 1: Chemielaborant bei der Arbeit
Abb. 2: Eine chemische Großanlage
Die Chemie beschränkt sich jedoch nicht auf die Industrie. Denn das Leben selbst hat chemische Grundlagen: Bei der Fülle von Substanzen im Körper und der Vielfalt der hier ablaufenden chemischen Prozesse kann man alle Lebewesen als „Chemiefabriken“ bezeichnen, gleich ob Bakterien, Pflanzen oder Tiere (Abb. 3,4). Kein Leben also ohne Chemie. Dieselbe natürliche Chemie kann Leben auch gefährden: Es existiert eine Vielzahl biologischer Gifte. Viele Drogen wie Opium, Kokain, Haschisch und Nikotin sind pflanzliche Wirkstoffe. Das Rauschmittel Alkohol entsteht durch die Wirkung bestimmter Hefen aus natürlichem Zucker. Die Grenzen zwischen ‚Naturchemie‘ und ‚Laborindustrie‘ verschwimmen. Die harten Drogen Heroin und LSD lassen sich recht einfach durch leichte Abwandlung von Naturstoffen im Labor herstellen – von jedem, der sich mit ‚der Chemie‘ auskennt und seinen Profit auf Kosten der Gesundheit anderer macht. Heroin ist teurer als Gold. ‚Ecstasy‘ wird gewinnbringend in Hinterhoflabors hergestellt. Ähnlich undurchschaubar erscheint vielen Betrachtern die chemische Industrie im Allgemeinen.
Abb. 3: Frucht wie Blüte sind Vertreter der Naturchemie
Abb. 4: Ein Regenwurm als „Chemiearbeiter“
Was aber wäre ohne chemische Industrie im weitesten Sinne? Einige Gebrauchsmetalle stünden gar nicht, andere nur unzureichend zur Verfügung. Ohne elektrischen Strom müsste man auf manche lieb gewonnene Annehmlichkeit verzichten – z.B. Fernseher, CD-Player, Waschmaschine. Der Verzicht auf Kunststoffe würde die Lebensqualität weiter senken. Ohne gebrannten Kalk, Zement und ähnliche Produkte wäre man auf das Bauen mit Natursteinen, Lehm und Holz angewiesen. Wie bei Glas und Keramik herrschten hier arge Engpässe. Die wenigen natürlichen Farbstoffe wären wie in der Antike den Betuchten vorbehalten. Die Ärmeren trügen schlichtes Grau. Die Ernten fielen durch den Mangel von Kunstdünger und Schädlingsbekämpfungsmitteln viel niedriger aus – die Umwelt jedoch würde geschont. Ohne den Einsatz von besonderen Chemikalien, den Medikamenten, läge auch in den Industrieländern die Sterblichkeit hoch. Man sieht: Die moderne Chemie hat für die Menschheit Großes geleistet.
Ohne Frage ist einiges von dem, was die Industrie herstellt, nicht ohne Risiken für die Menschen und die Natur allgemein. Umweltverschmutzung ist in den letzten 20 Jahren zu einem festen Begriff geworden. Stichworte wie ‚Dioxine‘, DDT und viele weitere Stoffe mit unaussprechlichen Namen sind mittlerweile allgemein verbreitet. Das Unglück im indischen Bhopal 1984 zeigte mit seinen Tausenden von Toten, wie weit Schlamperei im Umgang mit Chemikalien führen kann.
Die „Chemie“-Kritiker, z. B. von Greenpeace, sind selbst Leute vom Fach. Daher mussten die Vertreter der Industrie ihre Warnungen ernst nehmen. Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen wurden ergriffen und Produktionsabläufe immer sicherer. In den schlimmsten Fällen schloss man ganze Betriebe. Die Schadstoffbelastung von Boden, Wasser und Luft nimmt seit Jahren in den Industrieländern ab. Der Einsatz besserer Filter hält giftige Stoffe zurück. Kraftwerke stoßen weniger Schadgase aus: Unter hohen Kosten hat man sie mit ‚Reinigungsfabriken‘ ausgestattet. Über den Strompreis finanziert sie jeder Stromverbraucher mit. Auch der Dreiwege-Katalysator der Benzinmotoren, der ‚Kat‘, hat seinen Preis – und arbeitet chemisch.
Alle diese Beispiele sollen eines zeigen: Entscheidend ist, wie man ‚Chemie‘ auffasst und wie bzw. wo man sie einsetzt.
Die vorwissenschaftliche Chemie
Am Anfang der Menschwerdung stand das Feuer. Der Urmensch tat den entscheidenden Schritt weg vom Tier, als er seine Scheu vor Wald- und Steppenbränden verlor (Abb. 5). Er lernte, es zu bewahren, zu nutzen und zu erzeugen. Feuer hielt Raubtiere fern und erhellte die Nächte. Gegrilltes Fleisch war besser zu kauen und zu verdauen; die Hitze tötete Bakterien ab. Bestimmte Bohnensorten wurden erst erhitzt genießbar. Das Feuer sicherte das Überleben bis nach Feuerland, Sibirien und Alaska. Seine Vernichtungskraft indessen bleibt bis heute bedrohlich. Ob in Kriegen oder im tiefsten Frieden – Feuersbrünste legten ganze Städte mit verheerenden Resultaten in Schutt und Asche.
Feuer konnte noch viel mehr leisten, z. B. beim Brennen von Lehm zu Keramiken als Behälter für Lebensmittel; bekannt sind griechische Weinamphoren. Später gesellte sich wieder mit Hilfe des Feuers das Aufbringen von Glasuren sowie die Fertigung von Glaswaren hinzu. Beim Gebäudebau half hoch erhitzter Kalkstein, ‚Branntkalk‘, als Kalkmörtel. Der Name ‚Seifensieder‘ für einen angesehenen Beruf weist auf die Bedeutung des Feuers hin. Lange Zeit verwendete man nur verbrannte Pflanzen, d.h. die darin enthaltene Pottasche, um Seife herzustellen.
Abb. 5: Das Lagerfeuer wärmt und schützt vor Raubtieren
Die feurige Hilfe – neue Techniken und neue Materialien
Über eine Million Jahre verwendete der Mensch nur ein dauerhaftes Material – den Feuerstein und seine Verwandten. Die Steinzeit ist sprichwörtlich geworden. Abgelöst wurde sie durch eine rasche Folge von Metallzeiten: Kupferzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Ohne Feuer hätte es die neuen Materialien nicht gegeben! Und ohne die neuen Materialien keine neuen Techniken.
Kupfer war am einfachsten chemisch aus seinen Erzen zu gewinnen; es diente zur Herstellung von Schmuck, Gefäßen und – eingeschränkt – Waffen. Diese Zeit wird meist nicht genannt; denn reines Kupfer konnte der härteren Bronze (Kupfer-Zinn-Legierungen)‘ waffentechnisch nicht standhalten: Ihre Besitzer waren den Nachbarvölkern militärisch überlegen. Das häufige Eisen bzw. der kohlenstoffhaltige härtere Stahl lösten vor etwa 3500 Jahren vom östlichen Mittelmeerraum aus allmählich die Bronze ab. Ihre ‚kriegerische‘ Rolle haben die Metalle behalten – ihre friedliche Nutzung verbreitete sich und überwiegt heute bei weitem. Ob aus ihnen ein Panzer oder ein Lkw entsteht, beschließt allein der Mensch. Als weitere Metalle kannte man schon in der Antike Blei, Zinn, Quecksilber, Gold und Silber.
Chemie und Information
Der Beginn aller Hochkulturen, die ‚geschichtliche Zeit‘, zeichnet sich durch die Erfindung der Schrift aus. Damit ließen sich Mitteilungen genauer und dauerhafter weitergehen als bloß mündlich. Chemische Stoffe bestimmten die Form der Zeichen, nämlich durch das Schreibmaterial: Die Dreiecke und Striche der sumerischen Keilschrift sind leicht in feuchten Ton zu ritzen. Die fertig gebrannten Tafeln blieben teils bis heute erhalten. Ähnlich kantig fielen anfangs die in Marmor gemeißelten griechischen und römischen Großbuchstaben wie A, H, Z, T, K, M aus. Runde Buchstaben setzten sich erst mit anderen Materialien durch, auf Pergament und Papyrus, dem Vorläufer des heutigen Papiers. Verschiedenste chemische Behandlungen verhalfen Letzterem zu einer Vielseitigkeit, die man nicht ahnen konnte. Dank der Chemie sind neue Materialien als Informationsträger hinzugekommen: Silbersalze bei Fotos und Filmen, Magnetbänder und -platten sowie die CD zum Speichern von Musik, Filmen und Computerdaten. Der endgültige Durchbruch zum derzeitigen Informationszeitalter vollzog sich wieder mit viel Chemie. Aus Quarzsand – Siliciumdioxid – stellt man den Halbleiter Silicium in höchster Reinheit her. Kein Groß- oder Personalcomputer, kein ABS, keine Raumfahrt und kein CD-Spieler wären ohne diesen Stoff möglich geworden (Abb. 6).
Abb. 6: Ohne Silicium kein Computer
Zum Weiterlesen:
→ Der weite Weg zur Wissenschaft Chemie
→ Eigene Charaktere – Stoffe und ihre Eigenschaften
→ Nicht nur sauber, sondern rein – Reinstoffe – Trennverfahren
Der weite Weg zur Wissenschaft Chemie
Als Wissenschaft gilt die Chemie seit etwa 1700. Nach dem großen deutschen Philosophen Kant (1724-1804) braucht jede Wissenschaft eine theoretische Basis. Das ist besonders in den Naturwissenschaften sehr praktisch, denn ihre Theorien lassen sich experimentell überprüfen. Ausgerechnet die erste rein chemische Theorie erwies sich als falsch; wir müssen nicht näher auf sie eingehen. Aber sie war nützlich, denn sie machte Voraussagen, an denen sich viele Experimente orientierten, deren Ausgang schließlich diese Theorie widerlegte. Aber schon davor wurde Chemie betrieben, auch wenn man sie noch nicht so nannte. Man denke nur an die Alchemisten und ihre Suche nach dem „Stein der Weisen“ (Abb. 1).
Abb. 1: Experimentierraum eines Alchemisten
Vom Nutzen der Wissenschaftsgeschichte
Ein umfassender Rückblick auf die Geschichte der Naturwissenschaften hat einige nützliche Aspekte. Erstens: Das Ausüben dieser Wissenschaften ist nur möglich, wenn das Nachdenken über ‚die Natur der Natur‘ nicht nur im Vokabular des betreffenden Faches stattfindet. Die frühen europäischen Naturforscher, Aristoteles (384–322 V. Chr.) an ihrer Spitze, waren stets herausragende Philosophen. Deswegen ist die Wissenschaftsgeschichte auch eine Geschichte der Denkweisen und -methoden. Zweitens: Manche anerkannten Lehrsätze der ‚Alten‘ sind heute nicht mehr haltbar – Irren ist menschliche Natur. Drittens: Der Weg der Wissenschaft von ihren Anfängen an erfolgte durchaus nicht so geradlinig und folgerichtig, wie manche Lehrbücher das glauben machen. Mancher Irrweg und Umweg wurde beschritten, bis man die zugrunde liegenden Fehler erkannte. Kolumbus hatte eben nicht Indien entdeckt; aber im Namen ‚Westindische Inseln‘ in der Karibik ist sein Irrtum heute noch abzulesen. Und umgekehrt: Etliche Hypothesen wurden zur Zeit ihres Entstehens verächtlich gemacht, setzten sich aufgrund weiterer Forschungsergebnisse dann aber klar durch. In der Chemie ist dies die Atomlehre. Bereits in der Antike hatten Leukipp (etwa 500-450 v. Chr.) und Demokrit (etwa 460-380 v. Chr.) über Atome philosophiert, aber in der Antike mit ihrer Spekulation wenig Anklang gefunden. Viertens: Wissenschaftliche Begriffe fallen nicht vom Himmel, sondern sind Schöpfungen des Menschen ihrer Zeit. Vor allem am Anfang sind sie darum nicht immer leicht zu begreifen und manchmal widersprüchlich. Hier gilt: Die Schwierigkeiten der heutigen Anfänger ähneln häufig denen der frühen Wissenschaftler. Fünftens: Viele naturwissenschaftliche Entdeckungen und Erfindungen hatten und haben gesellschaftliche und politische Auswirkungen.
Die Elemente von Aristoteles bis Lavoisier…
Wir sprechen in vielen Alltagssituationen immer noch von den ‚wütenden‘ Elementen im Sinne von Aristoteles: Feuer, Wasser, Luft, Erde. (Genau genommen hatte er mit dem ,Äther‘ ein fünftes eingeführt.) Sein Verdienst war, dass er die chemischen Verbindungen und Reaktionen für seine Zeit sehr scharfsinnig analysierte. Das Manko bestand darin, dass seine Elementenlehre mit den Grundeigenschaften warm – kalt, trocken – feucht den Blick zu sehr auf die qualitative Veränderung – z. B. des Eisens beim Rosten – richtete und dabei den mengenmäßigen, den quantitativen Zusammenhang vernachlässigte.
Abb. 2: Jede Naturwissenschaft interessiert hier etwas anderes
Auf der Basis seiner Lehre entwickelte sich, in der Kombination mit fernöstlichen Ansichten, bald der Glaube, weniger geschätzte Stoffe in den ‚König der Metalle‘, das Gold, umwandeln zu können. In China schätzte man eher seine medizinische Wirkung. Im Westen brachte die verbissene Suche nach der Goldherstellung die Chemie in Verruf: Seit Beginn der Neuzeit war ziemlich klar, dass es den ‚Stein der Weisen‘ nicht gibt und somit jeder ‚Goldmacher‘ als Betrüger auftrat.
In der Renaissance wurden die Menschen kritischer gegenüber den Lehren von Autoritäten wie Aristoteles, jedenfalls im nichtkirchlichen Bereich. Was überprüfbar erschien, hatte sich dem Urteil des Experimentators und dessen Vernunft zu stellen. Spätestens mit Galilei begann sich um 1600 das physikalische Experiment durchzusetzen. In der Chemie, damals noch als Alchemie bezeichnet, hatte man schon Jahrhunderte vorher immer sorgfältigere Versuche durchgeführt. Was fehlte, war eine angemessene Theorie.
Sie entwickelte sich mit der Wiederaufnahme einer ‚echten‘ Elementen- und Atomlehre im 17. Jahrhundert, wenn anfangs auch ziemlich zaghaft. Immerhin musste man gegen eine rund 2000 Jahre alte Tradition ankämpfen. Aber die berühmten Experimente des O. von Guericke zu Vakuum und Luftdruck hatten die Theorien des Aristoteles schwer erschüttert: Dieser hatte die Atomlehre abgelehnt, weil er die Existenz des Vakuums vehement bestritt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es etwas geben könne, was er sich nicht vorstellen konnte. Und die grenzenlose Leere zwischen den Atomen war eine denknotwendige Folgerung von Demokrits Atomvorstellungen.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts hatte sich die experimentelle chemische Technik immer weiter verfeinert. Insbesondere hatte man erkannt, dass es verschiedene Gase gab und dass sie bei manchen chemischen Reaktionen wesentlich mitbeteiligt waren. Auch auf der Basis dieser neuen Erkenntnisse stellte Lavoisier gegen Ende des Jahrhunderts den modernen Begriff des chemischen Elements auf. Dies sei ein Stoff, der sich chemisch nicht mehr zerlegen lasse. Dabei räumte dieser führende Chemiker seiner Zeit ein. dass man sich bei einzelnen Stoffen durchaus irren könne, ob sie Element oder chemische Verbindung seien. Das sei auch eine Frage der experimentellen Möglichkeiten. Er hatte Recht: Chlor hielt man aufgrund einer falschen Theorie über die Säuren für eine Verbindung, gebrannten Kalk (Calciumoxid) aber für ein Element. Lavoisier starb 1794 unter der Guillotine. Als Steuerpächter des Königs hatte er sich politisch missliebig gemacht. Und wohl einen Teil seiner aufwendigen Experimente mit dem Einkommen aus dieser Tätigkeit finanziert.
Abb. 3: Jede Naturwissenschaft betrachtet das gleiche Ei anders
… und die Atome bis Dalton
Etwa zehn Jahre später kam der Brite J. Dalton aufgrund der zahlreichen experimentellen Befunde seiner Vorgänger und Zeitgenossen, aber durchaus auch durch eigene physikalische Versuche auf den Atombegriff von Demokrit zurück. Mit dem ‚Atom‘ ließen sich eine ganze Reihe chemischer wie physikalischer Versuchsergebnisse zwanglos deuten. Als Dalton sogar noch ein weiteres chemisches Gesetz vorhersagte, war dem Atomismus der neuzeitliche Durchbruch gelungen – bei den Chemikern immerhin. Viele Physiker hielten sich beim neuen Glauben an die Atome aber sehr zurück.
Die Chemie und einige Nachbarfächer
Wie der Name sagt, beschäftigen sich Naturwissenschaften mit den vielfältigen Erscheinungen der Natur. Stark vereinfacht gesagt, beschäftigt sich die Physik mit den messbaren Aspekten von Materie und Energie, die Biologie mit dem lebendigen Organismus, die Chemie mit den Stoffen und deren Vielfalt, aus denen die unbelebte wie die belebte Natur besteht. An Abbildung 2 würde einen Physiker wohl am ehesten die Fahrt des Surfbrettes interessieren, wie aus der Windbewegung die Bewegung des Brettes auf dem Wasser entsteht. Ein Biologe konzentriert sich vermutlich auf den Surfer als lebendiges Wesen. Ein Chemiker könnte nach den verwendeten Kunststoffen des Surfbrettes fragen, ihrer Zusammensetzung und Herstellung.
Abb. 4: Das Haus der Naturwissenschaften
Doch auch der gleiche Vorgang, das gleiche Objekt kann alle drei interessieren, wie das Ei in Abbildung 3. Vielleicht würden sie sich auf unterschiedliche Aspekte konzentrieren, der Physiker etwa auf das Gewicht, die Stabilität der Schale, das Schlingern eines rohen Eies, wenn man es dreht; der Biologe darauf, von welchem Tier das Ei stammt, wie aus ihm ein neues Lebewesen entstehen kann und dass es anderen Lebewesen als Nahrung dient; der Chemiker auf die Inhaltsstoffe des Eies wie Lecithine, Proteine. Tenside, und dass das Eiweiß anders aufgebaut ist als der Dotter und beides wiederum ganz anders als die Schale.
Vielfach sind diese drei Naturwissenschaften aber gar nicht so getrennt voneinander. Um beim Beispiel mit dem Ei zu bleiben: Die Frage mit dem Ei als biologische Nahrung ist verknüpft mit den chemischen Vorgängen im Körper. Eine physikalische Betrachtung der Schale wird unterstützt vom Wissen um deren chemische Zusammensetzung.
In der Schule gesellt sich Chemie gleichberechtigt zu Physik und Biologie. Wie Abbildung 4 zeigt, bildet die Physik das Fundament aller Naturwissenschaften. Auf sie stützen sich etagenartig Chemie und Biologie. Von der Chemie her leiten sich physikalische Chemie und Biochemie als Überlappungen zu den Nachbarwissenschaften ab.
Daneben wären ohne Chemie die moderne Medizin, die Pharmazie und die Ernährungswissenschaften undenkbar. Die Landwirtschaftswissenschaft stützt sich zu einem guten Teil auf chemische Erkenntnisse, selbst dann, wenn sie zu ,ökologischem Landbau‘ rät. Die Geologie, die Wissenschaft von der Erde, könnte ohne Chemie keine vernünftige Ordnung in ihre Welt der Gesteine, Erze und weiterer Bodenschätze bringen.
Zum Weiterlesen:
→ Die Chemie – die große Unbekannte
→ Eigene Charaktere – Stoffe und ihre Eigenschaften
→ Nicht nur sauber, sondern rein – Reinstoffe – Trennverfahren
Eigene Charaktere – Stoffe und ihre Eigenschaften
Die biologisch wichtigsten chemischen Grundstoffe sind wohl jedermann vom Namen her bekannt: Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Sie dokumentieren am besten, wie wichtig der Begriff ‚Stoff in der Chemie ist. Wie weit er in den Alltag hineinreicht, zeigt die folgende, sehr verkürzte Auflistung gebräuchlicher Bezeichnungen: Arzneistoffe, Brennstoffe, Eiweißstoffe, Farbstoffe, Geschmacksstoffe, Impfstoffe, Kunststoffe, Mineralstoffe, Nährstoffe, Rohstoffe, Sprengstoffe, Treibstoffe, Wertstoffe. Der für alle Lebewesen weitaus wichtigste Begriff enthält ebenso das Wort ‚Stoff: Stoffwechsel, also die Gesamtheit aller chemischen Reaktionen in einem biologischen Organismus wie dem menschlichen Körper.
Hingewiesen sei darauf, dass die obige Liste der Stoffe zu ergänzen ist. Denn eine ganze Reihe von Stoffen wird im Alltagsgebrauch als ‚Mittel‘ bezeichnet: Arzneimittel, Betäubungsmittel, Düngemittel, Frostschutzmittel, Insektenvertilgungsmittel, Kühlmittel, Lebensmittel, Nahrungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Schmerzmittel, Waschmittel.
Auch im Haushalt werden sehr viele verschiedene Stoffe verwendet (Abb. 1). Je nach ihren ganz speziellen Eigenschaften benutzt man sie für alle möglichen Zwecke.
Abb. 1: Einige Stoffe aus dem Haushalt
An ihren Eigenschaften erkennt man sie …
Jeder Mensch besitzt Eigenschaften, die er mit anderen teilt, und solche, die ihn von anderen unterscheiden: Augen-, Haar- und Hautfarbe, Größe und Gewicht, Form von Augen, Ohren und Kopf, Blutgruppe und weitere. In ihrer Summe charakterisieren sie eindeutig eine bestimmte Person unter knapp sechs Milliarden Menschen.
Abb. 2: Stoffe können sich durch ihre Farbe unterscheiden
Auch die Chemie charakterisiert – nämlich Stoffe. Weit über 13 Millionen sind mittlerweile bekannt. Um diese voneinander zu unterscheiden, untersucht man ihre Eigenschaften. Hier ist es wie bei den Eigenschaften eines Menschen: Auch die Stoffe besitzen solche, die sie mit anderen gemeinsam haben, und solche, die sie von anderen unterscheiden. Vergleichbar mit den Einträgen in einem Ausweis fasst man die Stoffmerkmale in Tabellenwerken zusammen. Dort kann man nachschlagen, wenn man eine bestimmte Substanz identifizieren will. Manche dieser Eigenschaften sind sehr einfach, schon auf den ersten Blick zu erkennen, andere erkennt man erst durch genauere Untersuchung, teilweise nicht ohne Hilfsmittel. Oft fasst man viele Stoffe, die eine oder mehrere Stoffeigenschaften gemeinsam oder vergleichbar haben, in einer Stoffklasse zusammen. Da jeder Stoff aber viele Eigenschaften hat, kann der gleiche Stoff durchaus zu mehreren Stoffklassen gehören, je nachdem, welche seiner Eigenschaften gerade von Interesse ist.
… nach ihren Eigenschaften verwendet man sie
Wer eine Tür weiß streichen will, wird Titan- oder Zinkweiß benutzen, kein Chromgrün oder Cobaltblau. Die Farbe ist ein erstes Merkmal der Stoffe (Abb. 2). Kompakte und polierte Metallgegenstände besitzen einen typischen Glanz: Es ist eine blanke Silberschicht auf der Rückseite von Spiegeln, die uns zurücklächelt. Diese Silberschicht wird chemisch auf dem Glas aufgebracht (Abb. 3). Wenn wir jemanden ‚nicht riechen können‘, ist es, wenn man es wörtlich nimmt, sein Geruch, den wir nicht ausstehen können. Oder den von Gülle und Jauche. Umgekehrt macht uns ein Parfüm oder Gesichtswasser eventuell sympathisch.
Abb. 3: Ein im Labor hergestellter Silberspiegel
Abb. 4: Steinsalz/Kochsalz hat immer die gleich Kristallform
Viele Stoffe besitzen einen charakteristischen Geruch. Oftmals mischt man dabei verschiedene duftende Stoffe, wie beim Parfüm, um einen neuen Geruch zu kreieren. Über Geschmack kann man sich sehr wohl streiten, wenn bei der Zubereitung der Rindfleischsuppe versehentlich Zucker verwendet wurde und beim Vanillepudding das Salz. Wer Kandiszucker für seinen Tee verwendet, kann ihn anhand seiner Kristallform leicht von Kochsalz unterscheiden (Abb. 4). Die Härte eines Bohrers entscheidet darüber, ob wir mit ihm ein Loch in die Wand bohren können. Die Sprödigkeit von Glasflaschen ist einer ihrer Nachteile gegenüber solchen aus Kunststoffen: Sie sind zerbrechlich. Die leichte Verformbarkeit von Metallen und vielen Kunststoffen ist in der Technik wie im Alltag von immenser Bedeutung. Metalle besitzen außerdem elektrische Leitfähigkeit. Es existieren aber auch schon leitfähige Kunststoffe. Die gute Wärmeleitfähigkeit der Metalle ist beim Kochen, Braten und Backen hochwillkommen, dabei nutzt man aber auch, dass Kunststoffe die Wärme schlechter leiten (Abb. 5). Der Magnetismus von Eisen gibt mit der Kompassnadel Seefahrern seit langer Zeit die Richtung vor. Die Dichte als ‚spezifische Masse‘
entscheidet darüber, ob feste Verunreinigungen im Wasser schwimmen wie Holz und Kork oder absinken/untergehen wie Sand und die ‚Titanic‘. Sie ist für den Flug von großen und kleinen Ballons (Abb. 6) sowie von Luftschiffen zuständig. Und dafür, dass der Einsatz von Leichtmetallen Flugzeuge immer größere Nutzlasten befördern lässt. Werkstoffe mit geringer Dichte und gleichzeitig hoher Festigkeit machen das Drei-Liter-Auto schon heute möglich. Denn geringes Gewicht bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch.
Abb. 5: Die geringe Wärmeleitfähigkeit von Kunststoffgriffen ist bei Kochgeräten nützlich
Abb. 6: Nur Gase mit niedriger Dichte lassen Ballons frei fliegen
Die Mischbarkeit oder Löslichkeit ist für den Fortbestand des Lebens mitentscheidend: Jede Zelle schottet sich durch Membranen von der Umgebung ab und bildet damit ihr eigenes Reich. Jedes Wasserlebewesen ist erst durch wasserunlösliche Stoffe an seiner Körperoberfläche existenzfähig. Aber auch der Mensch profitiert davon. Denn es wäre schlimm, wenn sich unsere Haut bei jedem Regenguss auflösen würde. Oder die Knochen, die Zähne, die Schleimhäute sich in Wasser leicht lösen würden. Und umgekehrt: Ohne die Löslichkeit von Sauerstoff, Kochsalz, Zuckern und vielen anderen Stoffen könnte sich kein Lebewesen ernähren (Abb. 7).
Abb. 7: Die Löslichkeit verschiedener Stoffe in Wasser ist sehr unterschiedlich
Eine der wichtigsten Kenngrößen eines Stoffes ist sein Aggregatzustand bei Raumtemperatur und Normaldruck (1013 Hektopascal). Leben ist nur durch die Gase Sauerstoff und Kohlendioxid denkbar, wenn genügend viel flüssiges Wasser vorhanden ist. Für die mechanische Stabilität der Lebewesen ist die Existenz vom Feststoffen notwendig. Die Cellulose der Pflanzen, das Chitin der Insektenpanzer und die Knochen der Wirbeltiere. Die Lage der Schmelztemperatur und der Siedetemperatur sind daher nicht nur für Chemiker relevante Größen in den Stoffdatenbanken (Abb. 8).
Abb. 8: Schmelz- und Siedetemperatur eines Stoffes gehören zu seinen charakteristischen Eigenschaften
Zum Weiterlesen:
→ Der weite Weg zur Wissenschaft Chemie
→ Nicht nur sauber, sondern rein – Reinstoffe – Trennverfahren
→ Modelle und Aggregatzustände
Nicht nur sauber, sondern rein: Stoffmischungen – Reinstoffe – Trennverfahren
Mischungen – Unterschiede und Beispiele
Beim Schwimmen Zeitung lesen? Unmöglich? Die Dame von Abb. 1 zeigt, dass es geht. Dann jedenfalls, wenn man ein Bad im Toten Meer nehmen kann. Im Toten Meer wohl nicht, eher auf ihm.
Abb. 1:Im Toten Meer schwimmt ein Mensch aufgrund des hohen Salzgehaltes ohne Schwimmbewegungen
Die Physik lehrt, dass ein Körper – passivschwimmt, wenn seine Dichte kleiner ist als die der Flüssigkeit – und wenn er sich nicht in ihr auflöst. Jeder weiß, dass Fett oben schwimmt. Seine Dichte ist etwas niedriger als die des Wassers. Sehr dick wirkt die Dame aber nicht. Also liegt‘s am Wasser. Besser, an seinem Salzgehalt von etwa 30 %. Eine konzentrierte Kochsalzlösung hat eine Dichte von rund 1,19 g/1, das ist etwa 10 % mehr als die mittlere Dichte des menschlichen Körpers. Stoffmischungen besitzen eben andere Eigenschaften als die reinen Stoffe.
Zum Trinken ist dieses Wasser jedoch gänzlich ungeeignet. So seltsam es klingen mag: Wer seinen Durst mit Salzwasser löscht, verdurstet. Dem Körper wird dabei zu viel Salz zugeführt. Das überflüssige Salz wird aus dem Körper geschwemmt, wobei mehr Flüssigkeit verloren geht, als man aufgenommen hat. Zum Durstlöschen eignet sich also besser das so genannte Trinkwasser, zum Beispiel aus einem Brunnen oder einer Quelle (Abb. 2).
Abb. 2: Sauberes Trinkwasser ist ideal zum Durstlöschen
Auch das Wasser aus dem Wasserhahn eignet sich zum Trinken. Dass dieses aber überhaupt noch genießbar ist, könnte verwundern. Jedenfalls jeden, der das Schmutzwasser einer öffentlichen Kanalisation kennt. Auch das Wasser der Flüsse und Seen ist meist viel zu verschmutzt, um es zu trinken. Kläranlagen sind zumindest in Ballungsgebieten nötig, um die Selbstreinigungskraft der Natur zu unterstützen. Erst komplizierte und langwierige Prozesse machen das verschmutzte Wasser wieder genießbar. Unsauberes Trinkwasser erweist sich in der Dritten Welt immer mehr als Träger von Krankheit und Tod. Unser Trinkwasser hingegen gilt als (weitgehend) sauber. Dennoch ist es nicht rein. Es enthält gelöste Gase und verschiedene Salze. Und das ist gut so; Auch chemisch reinstes Wasser, gereinigt durch mehrfache Destillation, ist nicht für die Ernährung geeignet, in größeren Mengen verzehrt ist es sogar tödlich. Es dringt in die Körperzellen ein, bringt diese zum Platzen und schädigt dadurch das Gewebe. Auch hier gilt: Die Reinstoffe besitzen andere Eigenschaften als Mischungen. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der Siedekurven von reinem Wasser und von Salzwasser (Abb. 3).
Abb. 3: Die Siedetemperatur von reinem Wasser bleibt konstant, die von Salzwasser steigt an
Im Alltag umgeben uns fast nur Stoffmischungen. Diese lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: heterogene Mischungen und homogene Mischungen. (Heterogen lässt sich hier am besten als ‚uneinheitlich‘, homogen als ‚einheitlich‘ aufgebaut übersetzen.)
Abb. 4: Wolken sind wie Nebel Ansammlungen kleinster Wassertropfen in der Luft
Abb. 5: Säfte mit festem Fruchtfleisch sind Suspensionen
Abb. 6: Die Fetttröpfchen der Milch sind erst unter dem Mikroskop sichtbar
Eines haben heterogene Mischungen alle gemeinsam: Sie sind in mehr oder weniger dicken Schichten undurchsichtig. Wer je im Nebel unterwegs war, weiß das.
Die verschiedenen Komponenten homogener Mischungen lassen sich dagegen nicht optisch unterscheiden. Selbst unter dem Lichtmikroskop sind keine einzelnen Bestandteile zu erkennen. Daher sehen alle farblosen Lösungen (fast) genauso wie reines Wasser aus, ob sie nun Salz enthalten, Alkohol oder gelösten Sauerstoff In Goldlegierungen lassen sich die einzelnen Metalle nicht unterscheiden. Und Mischungen von farblosen Gasen sehen immer gleich aus.
Abbildung 7 fasst die Bezeichnungen für verschiedene Mischungen zusammen.
Abb. 7: Wichtige Beispiele für heterogene und homogene Mischungen
Mischungen lassen sich leicht herstellen: Salate, Suppen, Puddings, Kuchenteige, Spülwasser. Oder Mischungen aus den verschiedenen Farben eines Malkastens (Abb. 8). Die Mischungseigenschaften lassen sich durch Änderung der Zusammensetzung praktisch beliebig verändern. Das gilt für alle Stoffe, die sich in jedem Verhältnis miteinander mischen lassen: Gase, Wasser und Alkohol, Zement, Sand, Kies und Baustahl zu Beton. Und selbst wenn es Löslichkeitsgrenzen gibt wie bei Zucker und Salz mit Wasser, kann man weitgehend selbst bestimmen, wie süß oder gesalzen man seine Getränke und Speisen zu sich nehmen möchte.
Abb. 8: Farbmischungen herzustellen ist ein Kinderspiel
Stoffmischungen zu trennen ist schwieriger. Alle Trennverfahren nutzen dabei Unterschiede in den Eigenschaften der Mischungsbestandteile. Man benutzt für heterogene und homogene Mischungen unterschiedliche Trennverfahren. Eine Übersicht über verschiedene Verfahren geben die Abbildungen 9 und 10. Dabei ist auch angegeben, welche Stoffeigenschaft zur Trennung benutzt wird; in dieser sollten sich die zu trennenden Stoffe unterscheiden.
Abb. 9: Gebräuchliche Trennverfahren bei heterogenen Mischungen
Abb. 10: Gebräuchliche Trennverfahren bei homogenen Mischungen
Das Beispiel mit der Siedetemperatur des Wassers zeigte, dass Reinstoffe charakteristische, unveränderliche Eigenschaften aufweisen. Mit diesen lassen sie sich eindeutig von allen anderen Stoffen unterscheiden. Und erst wenn man sie so rein wie möglich hergestellt hat, kann man sie miteinander mischen, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen, die die einzelnen Reinstoffe für sich nicht besitzen.
Zum Weiterlesen:
→ Eigene Charaktere – Stoffe und ihre Eigenschaften
→ Modelle und Aggregatzustände
→ Hurtig und geschwind – die Teilchenbewegung
Modelle und Aggregatzustände
Was ist ein Modell? Eine Puppe, ein Modellflugzeug oder ein Flaschenschiff – eine vom Menschen gemachte Abbildung der Wirklichkeit.
Ein weit verbreiteter Fehler in der Chemie, anderen Wissenschaften und im Alltag ist, die Vorstellungen oder Modelle, die man sich von Gegenständen macht, mit der Realität gleichzusetzen.
1.Ein Auto oder ein Mensch (Abb. 1) auf einem Foto oder in einem Film ist nicht die Person oder der Wagen selbst, sondern nur ein Bild, eben ein Modell: Im Allgemeinen stark verkleinert, manchmal vergrößert, jedenfalls nur zweidimensional. Trotzdem – Fotos wirken überzeugend.
2.Wohl niemand wird einen Globus mit der Erde selbst verwechseln. Als Darstellung für die annähernde Kugelform der Erde ist er durchaus brauchbar. Auch der Begriff ‚Erdachse‘ lässt sich an ihm gut erklären. Unbrauchbar ist er dagegen, wenn man sich in den Ferien die schönsten Wanderwege aussuchen will; dazu kann man eine Wanderkarte heranziehen. Dem Modell können Eigenschaften mitgegeben werden, die in Wirklichkeit gar nicht oder doch nicht so vorhanden sind: So werden benachbarte Staaten häufig unterschiedlich koloriert und die nur gedachten Ländergrenzen als Linien dargestellt.
3.Modelleisenbahnen können dem Original zum Verwechseln ähnlich sehen. Trotzdem wird niemand behaupten, Modelllok und reale Lok seien identisch. Und kaum ein Vater wird seinen Dreijährigen an sein kompliziertes Modell heranlassen, sondern ihm ein viel gröberes, aber robustes aus Holz oder Plastik zum Spielen geben. Für diesen Zweck ist das einfache Modell vollkommen brauchbar (Abb. 2).
Fazit: Modelle sind weder gut noch schlecht, sondern nur mehr oder weniger brauchbar als Abbildung der Realität.
Das gilt auch für die Atommodelle, die in diesem Buch nacheinander verwendet werden und die aufeinander aufbauen.
Abb. 1: Das Foto gibt die Züge von Königin Elisabeth II. naturgetreu wieder
Abb. 2: Vereinfachtes Modell einer Eisenbahn
1.Das Kugelmodell. Brauchbar ist es zum Verständnis der drei Aggregatzustände und ihrer Übergänge auf der Grundlage der einfachen thermischen Teilchenbewegung. Unbrauchbar ist es dagegen zur Erklärung der chemischen Bindungen (Abb. 3).
2.Das Kern-Hülle-Modell. Es ist geeignet, um die Durchlässigkeit der Materie für radioaktive Strahlung zu erklären. Es ist unbrauchbar für ein differenziertes Verständnis der periodisch anwachsenden Größen der Atome, der chemischen Bindungen und hier vor allem der Wertigkeiten verschiedener Atome. Warum ist z.B. die Formel eines Wassermoleküls H2O, eines Methanmoleküls CH4, die des Kohlenstoffdioxids aber CO2?
3.Das Schalenmodell in Anlehnung an Bohr. In Analogie zum Modell des Sonnensystems ist es gut geeignet für die Beschreibung der steigenden Atomradien innerhalb einer Elementfamilie. Es erklärt aber nicht, wann eine Schale abgeschlossen sein soll, dass das Wasserstoffatom Kugelform besitzt und vieles mehr.
4.Das Kugel Wolkenmodell. Es unterliegt keinem der unter 1.-3. genannten Widersprüche und ist noch einigermaßen anschaulich. Leider bietet es keine Erklärung für das gesamte Periodensystem der Elemente (PSF). Das schwierige ‚Orbitalmodell‘ sollte höheren Chemiekursen vorbehalten sein.
Abb. 3: Kugelmodell am Beispiel des Glukosemoleküls
Wir leben mit ihnen – die drei Aggregatzustände
Wir tanken sie richtig, die frische Luft. Nach starkem Schwitzen benötigt unser Körper dringend Flüssigkeitsnachschub; sonst würde das Blut zu dickflüssig. Die Festigkeit der Knochen hält uns aufrecht.
Die Mehrzahl der Stoffe kann in allen drei Aggregatzuständen – fest, flüssig, gasförmig – vorkommen. Welcher Aggregatzustand gerade vorliegt, hängt neben den Eigenheiten der Substanz von Temperatur und äußerem Druck ab. Jeder dieser drei Zustände hat seine charakteristischen Eigenschaften:
Als Feststoff besitzt eine Substanz die größte Dichte – sie liegt etwa 5-10% höher als die der jeweiligen Flüssigkeit. Im Idealfall haben die festen Körper natürliche, regelmäßige Formen mit mehreren Oberflächen. Ohne eine äußere Kraft behalten Festkörper ihre Form stets bei.
Die wichtigste Ausnahme bei der Dichte ist das Wasser: Das Eis schwimmt an der Oberfläche und sinkt nicht nach unten, weil seine Dichte kleiner ist. Darauf wird später noch genauer eingegangen.
Flüssigkeiten passen sich jeder Gefäßform an – in einer Flasche, Kanne oder Tasse. Sie fließen bis zum tiefsten Punkt, den sie erreichen können (Abb. 4). Das sieht man, wenn sich Regenwasser in Pfützen ansammelt oder wenn man Saft in ein Glas schüttet. Das weiß man von Bächen und Flüssen: Ihre Endstationen sind die Meere, manchmal Binnenseen. Flüssigkeiten (Abb. 5) besitzen immer eine Oberfläche, die sie von der Umgebung wie der Luft trennt. Nur wegen dieser Oberfläche kann man sie erkennen, wenn sie farblos sind.
Abb. 4: Wasser fließt immer zum tiefsten Punkt
Abb. 5: Die Milch befindet sich unten im Glas, passt sich dessen Form an und besitzt eine Oberfläche
Gase weisen die weitaus niedrigsten Dichten auf. Diese sind bis zu tausendmal kleiner als die der Feststoffe. Man kann sie stark komprimieren. Das nutzt man beim Aufpumpen eines Fahrradreifens wie auch beim Verdichten des Kraftstoff-Luft-Gemisches in einem Verbrennungsmotor. Sie verteilen sich vollständig und gleichmäßig in jedem zu Verfügung stehenden Raum. Zudem besitzen sie keine Oberfläche – die Erdatmosphäre geht praktisch kontinuierlich in das Vakuum des Weltalls über (Abb. 6). Wegen der fehlenden Oberfläche sind farblose Gase unsichtbar.
Abb. 6: Die Lufthülle der Erde besitzt keine abgrenzende Oberfläche
Das Kugelmodell der Teilchen
In der Chemie arbeitet und denkt man viel mit und in Modellen. Eines der wichtigsten ist das Teilchenmodell. Die einfachste Vorstellung, die man sich von den Teilchen macht, ist, dass sie kugelförmig sind. Diese Annahme lässt sich vorbildlich zur Erklärung der Aggregatzustände anwenden. ‚Se aggregare‘ heißt im Lateinischen ‚sich anschließen‘. Dann bedeutet ‚Aggregatzustand‘ ganz anschaulich, in welcher Art und Weise sich diese Teilchen einander anschließen: Den beobachtbaren und messbaren Eigenschaften lassen sich Modelle der Teilchen zuordnen, die sich so weit wie möglich oder gewünscht entsprechen. Die Abbildungen 7, 8 und 9 sollen dies für die drei verschiedenen Aggregatzustände verdeutlichen. Die hier gewählte Darstellung der Teilchen als Kugeln lässt natürlich viele Fragen offen, beispielsweise wie und warum die Teilchen zusammengehalten werden. Als einfaches Modell ist es aber ausreichend, um sich eine erste Vorstellung von der Anordnung und Beweglichkeit der Teilchen in den drei Aggregatzuständen machen zu können.
Abb. 7: Vergleich der Eigenschaften von Feststoffen mit dem Teilchenmodell
Abb. 8:Vergleich der Eigenschaften von Flüssigkeiten mit dem Teilchenmodell
Abb. 9: Vergleich der Eigenschaften von Gasen mit dem Teilchenmodell
Zum Weiterlesen:
→ Auch die Atome sind nicht mehr die alten
→ Das Ende der alten Physik – das Zwiebelschalenmodell
→ Wolkige Kugeln – das Kugelwolkenmodell der Atome
Hurtig und geschwind – die Teilchenbewegung
Dass Materie nicht immer und überall, aber doch ziemlich oft in Bewegung ist, lässt sich bei flüssigen und festen Stoffen direkt beobachten. Die Beispiele sind bekannt. Wasser eines Baches, Flusses (Abb. 1) oder aus der Leitung fließt wie flüssiges Eisen in die tiefstmögliche Lage (Abb. 2). Demselben Gesetz gehorchen Lawinen oder Steinschläge. Die Bewegung von vielen Gasen lässt sich nur indirekt feststellen, weil die meisten Gase farblos sind. Die Bewegung von Blättern, Zweigen und Ästen lässt aber Rückschlüsse auf die Windstärke, also auf eine Luftbewegung zu.
Abb. 1: Bei einem Gebirgsfluss ist das Fließen des Wassers leicht zu erkennen
Abb. 2: Roheisen fließt aus dem Hochofen
Dass auch die Teilchen selbst in steter Bewegung sind, lässt sich ohne teure Geräte wie Elektronenmikroskope nur indirekt erschließen und am ehesten bei Gasen und Flüssigkeiten feststellen. Der Duft eines Parfüms oder Rasierwassers verfliegt in einem geschlossenen Raum ebenso wie unangenehmer Geruch, wenn man das Fenster öffnet.
Gibt man zwei oder mehr Gase zusammen, so gleichen sich ihre Konzentrationen nach genügender Zeit vollständig aus, sie durchdringen sich gegenseitig. Da sie aus Teilchen bestehen, müssen es diese sein, die wandern: von oben nach unten und umgekehrt (Abb. 3). Ähnliches läuft beim Gasaustausch zwischen dem Blut und der Luft in den Lungenbläschen aufgrund des Konzentrationsunterschiedes ab. Diese Diffusion kann man auch bei Flüssigkeiten beobachten (Abb. 4). Selbst wenn man seinen Kaffee mit dem Zuckerwürfel nicht umrührt, schmeckt er nach einiger Zeit gleichmäßig süß. Die Teezubereitung mit dem Beutel folgt dem gleichen Prinzip.
Abb. 3: Bei der Diffusion wandern Teilchen von oben nach unten, aber auch von unten nach oben
Abb. 4: Modell von Lösevorgang und Diffusion eines Feststoffes in einer Flüssigkeit
Eine spezielle Art der Diffusion ist die Osmose. Halb durchlässige Membranen wie die von Organismen verhindern eine freie Diffusion. Sie lassen nur die kleinen Teilchen des Lösemittels durch, nicht aber größere gelöste. Ein Ei ohne Schale quillt darum auf, wenn man es in reines Wasser legt: Der Verdünnungseffekt ist nur durch ‚Einwandern‘ der Wasserteilchen in das Ei möglich (Abb. 5). Dem gleichen Prinzip einer einseitigen Diffusion folgt die Dialyse, die Blutwäsche bei Nierenkranken.
Abb. 5: Die halb durchlässige Eihaut lässt nur Wasserteilchen durch, nicht die Teilchen gelöster Stoffe
Die Teilchenbewegung ist auch für die Existenz unserer ausgedehnten Atmosphäre verantwortlich. Mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten zwischen 400-500 m/s ist sie noch um einiges schneller als der Schall. Die Teilchen der Luft ‚wehren‘ sich damit mit gewissem Erfolg gegen die Erdanziehung. Erst in ca. 5500 m Höhe ist der Luftdruck auf die Hälfte gesunken.
Ein erster großer Schritt zum Zusammenwachsen von Physik und Chemie war es, als Mitte des 19. Jahrhunderts einige Physiker die Existenz von Teilchen akzeptierten und ihre Bewegung mit den Begriffen Temperatur und Wärme verknüpften. Es war ein Riesenerfolg, dass sie mit relativ wenigen Grundannahmen und Gesetzen der Mechanik die experimentell eindeutig gesicherten Kenntnisse über das Verhalten von Gasen theoretisch ableiten konnten. Das hatte und hat bis heute Konsequenzen.
Wir wissen, dass sich Zucker in heißem Wasser schneller löst als in kaltem und dass Wäsche im Wäschetrockner oder bei hohen Außentemperaturen schneller trocknet als bei niedrigen. Man darf annehmen, dass die Teilchen bei hohen Temperaturen schneller sind als bei niedrigen oder genauer: dass sie bei höherer Temperatur eine größere Bewegungsenergie besitzen.
Es ist diese Energie, die Gasen erlaubt, ein bestimmtes Volumen einzunehmen oder ihren Druck auszuüben. Der Gasdruck kommt dabei durch die Stöße der Teilchen auf die Gefäßwand zustande. Druck bzw. Volumen eines Gases steigen gleichmäßig mit der Temperatur an (Abb. 6) und nehmen mit ihr ab. (Wer einen ‚heißen Reifen‘ fährt, darf sich über höheren Reifendruck während und kurz nach der Fahrt nicht wundem.)
Abb. 6: Die Volumenzunahme mit der Temperatur im Teilchenmodell
Beginnt man bei 0°C mit einem festen Gasvolumen und steigert man allmählich die Temperatur, so beobachtet man mit jedem Grad eine Volumen- bzw. Druckzunahme um 1/273 der Ausgangswerte. Im Idealfall findet man die doppelten Werte für Druck bzw. Volumen bei +273 °C, eine Halbierung der Ausgangswerte bei rund -137 °C, eine Verringerung auf ein Viertel bei -68 °C und eine weitere lineare Abnahme mit sinkender Temperatur. Aus diesen Beobachtungen folgt, dass es für alle Stoffe eine niedrigste Temperatur geben muss, die nicht mehr unterschritten werden kann: den absoluten Nullpunkt bei ca. -273 °C. Bei ihm ist jede Wärmebewegung der Partikel erloschen, der Gasdruck gleich null. Damit kommt man zur absoluten oder KELVIN-Temperaturskala. Man behält die Einteilung der Celsiusskala bei und nennt die -273 °C null Kelvin – 0K. In dieser Skala schmilzt Eis bei 273 K und siedet bei 373 K.
Viele weitere Erscheinungen in der Natur sind temperaturabhängig: das Wachstum von Pflanzen, die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen, die elektrische Leitfähigkeit und die Dichte. Man kann mit Heißluftballons fahren, weil gerade bei Gasen die Dichte stark mit der Temperatur sinkt (Abb. 7).
Abb. 7: Heißluftballons steigen auf, weil heiße Luft eine geringere Dichte hat als kalte
Auch die Wärme als Energieform lässt sich in diesem Modell veranschaulichen. Dass sie nicht dasselbe sein kann wie ‚Temperatur‘, leuchtet ein. Man braucht länger, d.h. mehr Energie, wenn man nicht zwei, sondern zehn Liter Wasser zum Kochen bringen will. In dem größeren Volumen sind mehr Teilchen enthalten. Anders gesagt: Mehr Teilchen bedeuten größeren Wärmeinhalt. Dieser hängt natürlich nach allem Gesagten auch von der Temperatur und damit der Bewegungsenergie der Teilchen ab. Und vom jeweiligen Aggregatzustand und den Übergängen zwischen ihnen: Denn Schmelzen und Erstarren sowie Verdampfen und Kondensieren haben auch etwas mit Wärme zu tun. Die Schmelzwärme von Eis nutzt man aus, wenn man Speisen und Getränke ohne sonstige Kühlung kalt halten will (Abb. 8). Um das Eis zu schmelzen, muss es Schmelzwärme aufnehmen. Diese entzieht sie der Umgebung, die entsprechend abgekühlt wird. Die Verdampfungswärme von Flüssigkeiten kann man ähnlich anwenden. Wer einen kühlen Kopf bewahren will, reibt sich Stirn und Schläfen mit Kölnischwasser ein, welches relativ viel Alkohol enthält. Damit der Alkohol verdampfen kann, benötigt er Verdampfungswärme, die er der Haut entzieht und diese so abkühlt. Und die Haut erwärmt sich nach dem Bad oder Duschen am langsamsten, wenn man sie nicht abtrocknet.
Abb. 8: Schmelzendes Eis hält das Obst länger kühl als gleich kaltes Wasser
Es gibt eine Reihe weiterer Erscheinungen, die nahe legen, dass zwischen den Teilchen je nach Stoff mehr oder minder starke Kräfte wirken, die sie im Feststoff und der Flüssigkeit zusammenhalten. Schon um ein Streichholz zu zerbrechen oder ein Stück Pappe zu zerschneiden, muss man Energie aufbringen. Die Siedetemperaturen der verschiedenen Stoffe sind ein Maßstab für den Zusammenhalt zwischen ihren Teilchen. Denn erst beim Sieden trennt man sie vollständig voneinander. Die Spanne der Siedetemperaturen liegt zwischen 4 K oder -269°C beim Helium und etwa 6000 K bzw. rund 5s700°C beim Wolfram, dem Metall der Glühfäden in elektrischen Lampen. Daraus kann man folgern, dass die Anziehungskräfte zwischen den Helium-Teilchen viel schwächer als zwischen den Wolfram-Teilchen sind.
Zum Weiterlesen:
→ „Stoffeigenschaften“
→ Modelle und Aggregatzustände
→ Die physikalischen Grundlagen des Periodensystems
Auch die Atome sind nicht mehr die alten
Wir haben weiter oben erfahren, dass ‚Atom‘ ‚das Unteilbare‘ bedeutet. Mit dem zugrunde liegenden Kugelmodell gibt es jedoch keine brauchbare Erklärung für den Zusammenhalt der Atome in Feststoffen und Flüssigkeiten. Wieder, wie bei den ersten Atomvorstellungen, brachte der Rückgriff auf alte Erfahrungen zusammen mit neuen Ideen den Durchbruch.
Abb. 1: Blitze sind die sichtbaren Zeichen von Entladungsvorgängen, wenn sich durch ‚Luftreibung‘ große Ladungsmengen getrennt haben
Abb. 2: Beim Frisieren laden sich Kamm und Haare entgegengesetzt auf und ziehen sich daher an
Abb. 3: Ein ‚geladener‘ Bernstein zieht einen Papierstreifen an
Dann fand der Engländer J. J. Thomson das negative Elektron als Bestandteil der gesamten Materie. Mit ihm kann man ein erstes Modell für die elektrische Aufladung entwerfen. Offenbar binden verschiedene Materialien die Elektronen unterschiedlich stark an sich; diese gehen von einem Stoff auf den anderen über. Der eine erwirbt damit einen Überschuss an negativer Ladung und erscheint damit auch nach außen negativ geladen; der andere erleidet einen gleich großen Elektronenverlust und erscheint daher nach außen hin positiv geladen (Abb. 4). Die elektrische Kraft wirkt, wie die Schwerkraft, ohne direkten Kontakt zwischen den geladenen Körpern: Der Kamm aus Abbildung 2 zieht die Haare schon aus einer gewissen Entfernung an. Für spätere Betrachtungen ist zudem wichtig, dass ein geladener Körper imstande ist, die Elektronen in einem anderen ohne Berührung zu verschieben (Abb. 5).
Abb. 4: Verschiedene Stoffe besitzen unterschiedliche Bindungskräfte für Elektronen und ziehen sich nach deren teilweiser Übertragung gegenseitig an
Von Natur aus sind Stoffe nach außen hin nicht geladen – elektrisch neutral also, wie es sich bei Atomen stets erwiesen hatte. Diese neutralen Atome aber mussten nach aller Erfahrung die negativ geladenen Elektronen enthalten. Wo genau befindet sich dann die zum Ladungsausgleich nötige positive Ladung?
Abb. 5: Allein die Annäherung eines geladenen Körpers bewirkt eine Ladungsverschiebung in einem anderen
Die Antwort kam aus einer nur scheinbar anderen Ecke der Physik. Der Franzose H. Becquerel stieß 1896 auf einen völlig neuen Effekt: die ‚Uranstrahlen‘ oder Radioaktivität. Pierre Curie, ein Mitarbeiter von Becquerel, und etwa zeitgleich der neuseeländisch-britische Physiker E. Rutherford entdeckten in späteren Experimenten, dass die natürliche Radioaktivität aus drei verschiedenen Teilen besteht, die sich in einem elektrischen (oder magnetischen) Feld unterschiedlich verhalten (Abb. 6). Der erste Teil wird von der negativen Elektrode angezogen, ist also selbst elektrisch positiv geladen, und zwar mit dem doppelten Ladungsbetrag der Elektronen. Den zweiten Teil zieht es zur positiven Elektrode, es zeigte sich, dass er aus besonders schnellen Elektronen besteht. Den dritten Teil zieht es weder zur positiven noch zur negativen Elektrode. Also ist er elektrisch neutral. Nach den ersten drei Buchstaben des griechischen Alphabets – Alpha, Beta, Gamma – taufte man die drei unterschiedlichen Teile α-Strahlen oder α-Teilchen, ß-Strahlen oder ß-Teilchen und γ-Strahlen.
Abb. 6: Die Ablenkung radioaktiver Strahlen durch statische Elektrizität
Die Physiker hatten neue Untersuchungsinstrumente für die Materie bzw. die Atome gefunden. Sie erbrachten eine revolutionär neue Ansicht von den Atomen – sie konnten nicht die kompakten Kugeln sein, wie man sie sich seit Dalton vorgestellt hatte. Auch der Begriff ‚elementar‘ ließ sich für Atome nicht mehr halten: Sie bestehen aus noch ‚elementareren‘, noch kleineren Bausteinen.
Rutherford führte 1909 eines der berühmtesten physikalischen Experimente durch: Er ließ α-Strahlen eine hauchdünne – kaum 1000 Atome ‚dicke‘ – Goldfolie durchtreten (Abb. 7) und erlebte eine Überraschung. Zwar durchquerten die meisten Alpha-Teilchen die Folie geradlinig. Sie trafen aber nicht auf einem einzigen Punkt auf: Der Fleck auf dem Schirm bzw. dem Film war größer als erwartet; einige wenige Teilchen zeigten ganz erhebliche Abweichungen von der geraden Flugrichtung bis hin zur kompletten Umkehr (Abb. 8). Die Auswertung dieser Versuche führte zur Aufstellung des erwähnten Kern-Hülle-Modells mit der Vorstellung eines nahezu leeren Atoms (Abb. 9). Die Elektronen laufen auf Kreisbahnen mit beliebigem Durchmesser um den Kern. Nur mit der Annahme eines derart aufgebauten Atoms lässt sich das Verhalten der a Teilchen verstehen. Ein Atom ist also zweigeteilt. Der winzige, positiv geladene Atomkern hat einen Durchmesser von weniger als des ganzen Atoms, enthält jedoch fast die gesamte Atommasse – mehr als 99,94 %. In der Hülle schwirren die leichten Elektronen herum (Abb. 9).
Abb. 7: Schema des Rutherford-Versuchs. Einige α-Teilchen werden mehr oder weniger stark abgelenkt
Abb. 8: Die α-Teilchen werden nur durch nahen Vorbeiflug an den Atomkernen abgelenkt und bei einem ‚Volltreffer‘ reflektiert
Abb. 9: Das einfachste Kern-Hülle-Modell der Atome. Die Größenverhältnisse stimmen nicht
Zur Veranschaulichung: Erhöht man in Gedanken die Größe eines Atoms auf die eines Fußballstadions, rund 200 m, hat der Atomkern einen Durchmesser im Millimeter- bis Zentimeterbereich (Abb. 10). Die Elektronen sind etwa um das Tausendfache kleiner als die Kerne. Man müsste sie unter dem Mikroskop suchen; ihre Größe liegt in diesem Modell bei 2 Tausendstel Millimetern oder 2 Mikrometern. Es ist eine schwierige Vorstellung, dass ein Atom, und damit auch die Materie, fast aus nichts besteht.
Abb. 10: Selbst bei einer ‚Vergrößerung‘ um mehr als das Billionenfache sind die Atomkerne kaum und die Elektronen gar nicht zu erkennen
Abb. 11: Vergleichende Übersicht über die Bausteine der Atome
Zum Weiterlesen:
→ Modelle – Modelle und Aggregatzustände
→ Das Ende der alten Physik – das Zwiebelschalenmodell
→ Wolkige Kugeln – das Kugelwolkenmodell der Atome





























