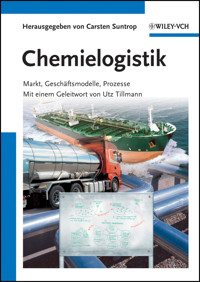
Chemielogistik E-Book
84,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Chemielogistik bedeutet mehr als nur Lager- und Transportlogistik. In Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz hat die Branche hohe Anforderungen zu erfüllen. Transportaufwand und Anspruch an eine spezifische Verteilung werden immer komplexer. Die Chemielogistik muss sich den wachsenden Herausforderungen der modernen globalisierten Welt stellen.
Diesen Ansprüchen begegnen die Autoren, ausnahmslos Spezialisten in der Chemielogistik, mit intelligenten Investitionsmodellen - die Ideen und Ansätze zur gezielten Weiterentwicklung der Branche erstrecken sich dabei auf die Bereiche:
- Markt und Wettbewerb, dem Chemielogistiker in besonderem Maße ausgesetzt sind
- Unternehmensführung, wo die Geschäftsmodelle zwischen Standortlogistikern, Speziallogistikern und Konzernlogistikern erheblich differieren
- Prozess- und IT-Bereich, der von den hohen und speziellen Anforderungen der Chemieindustrie geprägt ist
Herausgegeben von einem führenden Experten der Chemielogistik bietet das vorliegende Buch Praktikern die ideale Hilfestellung, eigene Prozesse in der Strategie- und Unternehmensentwicklung mit neuen Ideen anzureichern.
Mit aktuellen Interviews aus der Industrie (Bayer MaterialScience Customer Service GmbH, A.C.P. Logistics GmbH, Dachser GmbH & Co. KG)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Contents
Cover
Half Title page
Title page
Copyright page
Geleitwort
Vorwort
Liste der Autoren
Abkürzungsverzeichnis
Teil I: Einleitung
Chapter 1: Chemielogistik im Kontext allgemeiner logistischer Anforderungen
1.1 Ausgangssituation der chemischen Industrie
1.2 Sicherheit in der Transportlogistik
1.3 Sicherheitsmaßnahmen in der Gefahrgutlogistik
1.4 Zusammenfassung
Literatur
Teil II: Marktentwicklungen
Chapter 2: Marktentwicklungen und Trends
2.1 Marktteilnehmer, Marktstrukturen und Entwicklung
2.2 Clusterbildung
Literatur
Chapter 3: Geschäftsstrategien in der Chemielogistik
3.1 Einleitung
3.2 Grundlagen
3.3 Marktsituation Chemielogistik
3.4 Entwicklungsszenarien der Geschäftsmodelle in der Chemielogistik
3.5 Fazit
Literatur
Chapter 4: Verkehrsinfrastruktur in Zentral- und Osteuropa – Herausforderungen aus Sicht der chemischen Industrie und Logistikdienstleister
4.1 Einleitung
4.2 Forschungsfokus und methodische Vorgehensweise
4.3 Verkehrsinfrastrukturelle Herausforderungen in Zentral- und Osteuropa aus Sicht der chemischen Industrie und des Logistiksektors
4.4 Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und deren Rahmenbedingungen in Zentral- und Osteuropa
Literatur
Chapter 5: Logistikanforderungen des Chemieparkmanagers
5.1 Einleitung
5.2 Standortrelevante Entwicklungen der deutschen Chemieindustrie
5.3 Wie lässt sich logistische Komplexität an Chemiestandorten managen?
5.4 Fazit und Ausblick
Teil III: Geschäftsmodelle
Chapter 6: Wertschöpfungspartnerschaften für Stückgüter in der Chemielogistik
6.1 Logistik in der chemischen Industrie – Möglichkeiten für Wertschöpfungspartnerschaften im Bereich handling-bedürftiger Stückgüter
6.2 Geschäftsmodelle – bewusste Auswahl strategischer Aktivitäten von Logistikdienstleistern
6.3 Marktbedingungen in der Chemiebranche – wirtschaftliches und logistisches Profil handling-bedürftiger Stückgüter
6.4 Geschäftsmodelle von Spezialisten für handling-bedürftige Stückgüter – Fallbeispiel Dachser Chem-Logistics
6.5 Fazit – vielversprechende Outsourcing-Möglichkeiten für die chemische Industrie
Literatur
Chapter 7: Integrierte Gefahrstofflogistik an Chemie- und Pharmastandorten
7.1 Standortlogistik an Chemiestandorten
7.2 Geschäftsmodell: Kosten- und Qualitätsvorteile durch integrierte Gefahrstofflogistik
7.3 Fazit und Ausblick
Chapter 8: Das Integrierte Geschäftsmodell der Chemielogistik
8.1 Ausgangslage
8.2 Trends und Anforderungen in der Chemielogistik
8.3 Spezielle Positionierung entlang der Supply Chain der Kunden
8.4 Geschäftsmodell als integrative Gesamtlösung – ein Fazit
8.5 Integratives Geschäftsmodell in der Praxis
8.6 Ausblick
Chapter 9: Erfolg durch die Vernetzung unterschiedlicher Logistikdienstleistungen
9.1 Das Geschäftsmodell der Hoyer-Gruppe
9.2 Chemielogistik
9.3 Praxisbeispiele
9.4 Hoyer-Aktivitäten im Wachstumsmarkt AdBlue
9.5 Bedeutung der IT-Vernetzung mit den Kunden
9.6 Die Sicherheits- und Servicekultur der Hoyer-Gruppe
9.7 Weitere Geschäftsbereiche von Hoyer
9.8 Die Terminalaktivitäten der Hoyer-Gruppe und das System des kombinierten Verkehrs
9.9 Das Erfolgsmodell IBC: Komplettangebote für unterschiedliche Branchen
9.10 Unternehmensphilosophie: Ein Epilog
Chapter 10: Nachhaltige Chemie-Hub-Netzwerke – Merkmale zur differenzierten Geschäftsentwicklung
10.1 Anforderungen an die Chemielogistik aus Kundensicht
10.2 Herausforderungen und Marktentwicklungen in der Chemielogistik
10.3 Das Geschäftsmodell der nachhaltigen Chemie-Hub-Netzwerke
10.4 Erfolgsfaktoren und Differenzierungsmerkmale des nachhaltigen Chemie-Hub-Netzwerkes
10.5 Praxisbeispiele für maßgeschneiderte Kundenlösungen
10.6 Zusammenfassendes Fazit
Chapter 11: Standortlogistik für die chemische Industrie
11.1 Einleitung
11.2 Chemielogistik und Standortlogistik
11.3 Anforderungen an Logistikdienstleister in der Standortlogistik
11.4 Wie kann ein Logistikdienstleister diesen Herausforderungen begegnen?
11.5 Innovation in der Chemielogistik
11.6 Fazit und Ausblick
Teil IV: Prozesse und IT
Chapter 12: Innovatives Prozessmodell für die Chemielogistik
12.1 Der Wunsch: Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen
12.2 Problemaspekte der Ausgangssituation
12.3 Das Prozessinnovationsprojekt in der Chemielogistik
12.4 Das Organisationsverständnis und Menschenbild hinter dem strategieorientierten Innovations- und Transformationsansatz
12.5 Der wirkungsvolle und strategieorientierte Innovations- und Transformationsansatz im Detail
12.6 Fazit
Literatur
Chapter 13: Managen von Dienstleistern in der Chemielogistik – Von der Auswahl des optimalen Dienstleisters bis zur Gestaltung der Schnittstellen im Alltagsgeschäft
13.1 Einleitung
13.2 Market Screening: Potenzielle Dienstleister auswählen
13.3 Der Auswahlprozess
13.4 Managen der Schnittstellen
13.5 Monitoring/Performance-Analyse und regelmäßige Feedbackgespräche
13.6 Fazit
Chapter 14: Logistik-Geschäftsprozess-Integration von IT-Systemen
14.1 Vorbemerkung
14.2 Serviceorientierte Architekturen (SOA)
14.3 Diskussion der Umsetzbarkeit im Bereich Logistik für die Prozessindustrie (Chemie, Pharma, Logistik)
14.4 Zusammenfassung
14.5 Fazit
Chapter 15: Innovative Prozessmodellierung und ihre IT-Umsetzung in der Chemielogistik – Vom Praxisprozess zur IT-Lösung
15.1 Besonderheiten der Chemielogistik
15.2 Das Prozessmodell – Logistikprozesse transparent machen und effizient steuern
15.3 Umsetzung des Prozessmodells in eine leistungsfähige IT-Lösung
15.4 Fazit und Ausblick
15.5 Zusammenfassung
Teil V: Fazit und Ausblick
Chapter 16: Tendenzen im Chemielogistikmarkt
Index
Chemielogistik
Herausgegeben vonCarsten Suntrop
Beachten Sie bitte auchweitere interessanteTitel zu diesem Thema
Kiesel, J.
Dictionary of Logistics and Supply Chain Management/Fachwörterbuch Logistik und Supply Chain Management
English–German/Deutsch–Englisch
2008
Softcover
ISBN: 978-3-89578-312-8
Papageorgiou, L., Georgiadis, M. (Hrsg.)
Process Systems Engineering
Volume 3: Supply Chain Optimization
2008
Hardcover
ISBN: 978-3-527-31693-9
Papageorgiou, L., Georgiadis, M. (Hrsg.)
Process Systems Engineering
Volume 4: Supply Chain Optimization
2008
Hardcover
978-3-527-31906-0
Morris, P., Pinto, J. K. (Hrsg.)
The Wiley Guide to Project Technology, Supply Chain, and Procurement Management
2007
Softcover
ISBN: 978-0-470-22682-7
Storhas, W. (Hrsg.)
Bioverfahrensentwicklung
2011
Hardcover
ISBN: 978-3-527-32899-4
Herausgeber
Prof. Dr. Carsten SuntropGrimmelshausenstr. 1450996 Köln
Cover
Die Fotografie des Tankers, die Teil des Coverbildes ist, wurde von der GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.
1. Auflage 2011
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Informationder Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2011 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Cover Design Adam Design, Weinheim
ISBN: 978-3-527-32531-3
ePDF ISBN: 978-3-527-63425-5
oBook ISBN: 978-3-527-63423-1
ePub ISBN: 978-3-527-63424-8
Mobi ISBN: 978-3-527-63426-2
Geleitwort
Parallel zu dem Strukturwandel in der chemischen Industrie hat sich auch der Markt für den Transport von Chemikalien in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Viele Dienstleistungen, die die Chemieunternehmen in der Vergangenheit selbst erbrachten, sind inzwischen ausgegliedert und auf Spezialisten übertragen. Auch das Leistungsspektrum der Chemielogistik hat sich verändert: Heute erwarten die Chemieunternehmen von ihren Logistikdienstleistern über den Gütertransporte hinaus zunehmend komplette Logistiklösungen, die sowohl den speziellen Produkten als auch den häufig komplexen Liefer- und Versorgungsketten gerecht werden. Natürlich müssen sich die Chemielogistikfirmen an die veränderten Bedürfnisse einer immer flexibler werdenden Beschaffung, Produktion und Versorgung anpassen. Priorität hat das sichere und reibungslose Funktionieren der gesamten Liefer- und Versorgungskette.
Dementsprechend stellen Chemieunternehmen bei Sicherheit, Qualität, Umwelt- und Gesundheitsschutz hohe Anforderungen an ihre Logistik-Partner. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es in der Chemiebranche das Programm Verantwortliches Handeln - Responsible Care. Ziel ist die eigenverantwortliche Verbesserung der Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltstandards – unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen. Die stetige Optimierung der Sicherheit beim Transport von Chemikalien ist für alle Beteiligten von herausragender Bedeutung.
Dieses Buch greift die für die Chemielogistik relevanten Themen umfassend auf. Verkehrswissenschaftliche, betriebswirtschaftliche und technische Aspekte werden gleichermaßen beleuchtet. Damit gibt das Buch zahlreiche Anregungen für eine Fortentwicklung dieses komplexen und hochaktuellen Wirtschaftszweigs sowie für die Diskussion zwischen allen Beteiligten.
Ich wünsche dem Buch zahlreiche Leser.
Dr. Utz TillmannVerband der Chemischen Industrie e.V.
Vorwort
Der Logistikmarkt öffnete sich im letzten Jahrzehnt durch die Konzentration der chemischen Industrie auf ihre Kernkompetenzen, Infrastrukturservices werden outgesourced oder verkauft. Dadurch entstehen zusätzliche von einem Chemieunternehmen abhängige (innerhalb des Konzerns oder eigentumsrechtlich zugehörige) und unabhängige (an Dritte verkaufte) Chemielogistikdienstleister. Der Markt der Chemielogistik ist durch hohe Markteintrittsbarrieren gekennzeichnet, da hohe Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz ein spezifisches Wissen erfordern und ebenso eine spezifische Infrastruktur benötigt wird. Die Chemielogistik ist durch einen mittelständischen Charakter mit Spezialwissen geprägt. Die Diversifikation der chemischen Industrie spiegelt sich im diversifizierten Markt der Chemielogistik wider – von Pharmalogistik mit Good Manufacturing Practice Anforderungen über verpackte und flüssige Ware bis hin zu hochsensiblen Produkten wie Peroxide oder unkritischen Produkten wie Polymere. Die Diversifikation impliziert auf Seiten des Chemielogistikanbieters in den meisten Fällen eine Spezialisierung und die Herausforderung der Kontraktlogistik, bei denen das chemische Unternehmen über einen längeren Zeitraum mit dem Chemielogistiker zusammenarbeitet. Der Transportaufwand und der Anspruch an eine spezifische, komplexe Distribution sind durch die vielfältigen, integrierten, globalen chemischen Ketten sehr hoch.
Logistik bedeutet in der chemischen Industrie nicht nur Lager- und Straßentransportlogistik, sondern insbesondere auch die direkte Vernetzung von Standorten und Betrieben über Pipelines und die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsträger (Binnen-/Seeschiff, Bahn, Straße) im Multi-Modal-Bereich. Die Logistik und Supply Chain innerhalb der chemischen Industrie hat sich innerhalb der letzten 8–10 Jahre zumindest ebenso stark verändert wie sich die Konzernlandschaft der Chemie selber verändert hat. Die Chemieunternehmen vermeiden Investitionen in die Chemielogistik und suchen Partner für intelligente Investitionsmodelle.
Die vorliegenden Entwicklungen und die aktuellen Projekterfahrungen zeigen die Notwendigkeit auf, der Chemielogistik sowohl im Umfeld der Logistik als auch im Umfeld der Infrastrukturservices der chemischen Industrie einen größeren Stellenwert einzuräumen. Die Herausforderungen der und die Anforderungen an die Chemielogistik sind überdurchschnittlich gestiegen. Dadurch entstehen Aufrufe zur Entwicklung von Ideen und Lösungen auf unterschiedlichen Ebenen:
1) Markt- und Wettbewerbsebene: Konsolidierungstendenzen setzen eine Kenntnis des Marktes (Marktteilnehmer, Markteigenschaften) und der Marktentwicklung voraus, intelligente Geschäftsstrategien sind für die Marktteilnehmer sehr unterschiedlich, Marktanteile werden neu verteilt.
2) Unternehmensebene: Kostendruck und Servicementalität bedingen auf der Ebene des gesamten Chemielogistikunternehmens weitreichende Veränderungsmaßnahmen, Geschäftsmodelle differieren zwischen Standortlogistikern, Speziallogistikern und Konzernlogistikern erheblich.
3) Prozess- und IT-Ebene: Die Kunden der chemischen Industrie setzen höhere und andere Anforderungen als andere Branchen, die Differenzierung zwischen Standard- und Expertenprozessen wird auch zur Senkung der Kosten notwendig, eingefahrene Konzernprozesse werden vom Kunden aufgebrochen, Benchmarks der Wettbewerber erhöhen den Druck auf die Prozessoptimierung, der IT-Standard der chemischen Industrie ist SAP und damit auch Vorgabe für die Chemielogistik, existierende IT-Lösungen sind nur unzureichend prozessorientiert und werden von den Logistikunternehmen weiterentwickelt, andere Lösungen der Logistikkonzerne können den Logistik-IT-Markt beleben.
Die aufgezeigten, teilweise aktuellen Handlungszwänge machen deutlich, wie groß der Weiterentwicklungsbedarf dieser Branche ist. Die Struktur dieses Buches lehnt sich an diese drei Ebenen an. In jedem Abschnitt erläutern Experten der Chemielogistik Ideen und Ansätze zur gezielten Weiterentwicklung dieser Branche. Dieses Buch der Chemielogistik soll zum einen ein Ansatz sein, die Lücke in der Logistikliteratur zu schließen und der Chemielogistik einen entsprechenden Stellenwert zu verschaffen. Zum anderen soll es den Praktikern eine Hilfe sein, eigene Strategie- und Unternehmensentwicklungsprozesse mit neuen Ideen anzureichern.
Ein großer Dank gebührt allen Experten der Chemielogistik, die zur Entstehung und Veröffentlichung dieses Werkes beigetragen haben.
März 2010
Carsten Suntrop
Liste der Autoren
Steffen BauerLehnkering Holding GmbHSchifferstraße 2647059 DuisburgDeutschland
Marcus BenderSchulte Bender & PartnerUnternehmensberater Logistik-Systemintegration-BeschaffungHüfferstraße 2248149 MünsterDeutschland
Hans-Jörg BertschiBertschi AGHutmattstraße 225724 DürrenäschSchweiz
Gerd ClemensChemion Logistik GmbHCHEMPARK LeverkusenKaiser-Wilhelm-Allee, Gebäude X651368 LeverkusenDeutschland
Christian W. FlotzingerFH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbHLogistikum.researchWehrgrabengasse 1–34400 SteyrÖsterreich
Rolf Dietmar GrapFH AachenFachbereich WirtschaftswissenschaftenEupener Straße 7052066 AachenDeutschland
Ernst GrigatCHEMPARK LeverkusenKaiser-Wilhelm-Allee51368 LeverkusenDeutschland
Frank GümmerChemion Logistik GmbHCHEMPARK LeverkusenKaiser-Wilhelm-Allee, Gebäude X651368 LeverkusenDeutschland
Andreas Hardt(ehemals Chemion Logistik GmbH)Dechant-Miebach-Weg 4540764 LangenfeldDeutschland
Klaus HeepInfraserv GmbH & Co. Höchst KGIndustriepark HöchstGebäude C 77065926 Frankfurt am MainDeutschland
Lothar HinterlangChemion Logistik GmbHCHEMPARK LeverkusenKaiser-Wilhelm-Allee, Gebäude X651368 LeverkusenDeutschland
Hannelore Hofmann-ProkopczykFH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbHLogistikum.resarchWehrgrabengasse 1–34400 SteyrÖsterreich
Christian KilleFraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCSNordostpark 9390411 NürnbergDeutschland
Thomas KruppEuropäische Fachhochschule Rhein/ErftKaiserstraße 650321 BrühlDeutschland
Cord MatthiesBearing Point Marktentwicklung und TrendsC. Melottestraat 141560 HoeilaartBelgien
Birte MilnickelForeign Trade Compliance CoordinatorDachser GmbH & Co. KGMemminger Str. 14087439 KemptenDeutschland
Bernhard MuhlerBludau & MuhlerOhmstraße 6460598 FrankfurtDeutschland
Dennis MulaliRütgers ChemTrade GmbHVarziner Straße 4947138 DuisburgDeutschland
Ortwin NastHoyer GmbH Internationale FachspeditionWendenstraße 414–42420537 HamburgDeutschland
Karl-Heinz OellerMalik Management Zentrum St. GallenGeltenwilenstraße 186901 St. GallenSchweiz
Jochen SchmidtInfraserv Logistic GmbHIndustriepark HöchstGebäude K 80165926 Frankfurt am MainDeutschland
Kerstin SeegerEuropäische Fachhochschule Rhein/ErftKaiserstraße 650321 BrühlDeutschland
Fritz StarklFH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbHResearch Center SteyrWehrgrabengasse 1–34400 SteyrÖsterreich
Carsten SuntropCMC2 GmbH Consulting for Managers in Chemical IndustriesBüro Rhein-Main GebietZiegelhüttenweg 5460598 Frankfurt am MainDeutschland
Abkürzungsverzeichnis
2PLSecond Party Logistics Provider3PLThird Party Logistics Provider4PLFourth Party Logistics ProviderADNAccord européen relativ au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigationEuropäischen Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf BinnenwasserstraßenADNRAccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure RhinEuropäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem RheinADRAccord européen relatif au transport international merchandises Dangereuses par RouteEuropäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der StraßeAEOAuthorized Economic OperatorZertifikat, das Zuverlässigkeit in der internationalen Lieferkette bescheinigt, besonders in Bezug auf Sicherheitsrichtlinien und zollrechtliche VorgabenAPOAdvanced Planner and OptimizerASFINAGAutobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs- AktiengesellschaftBAGBundesamt für GüterverkehrBImschGBundes-ImmissionsschutzgesetzBMVITBundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie/ÖsterreichCEECentral and Eastern EuropeCeficConseil Européen de l’Industrie ChimiqueVerband der Europäischen chemischen IndustrieCIDXChemical Industry Data ExchangeCOTIFConvention relative aux transports internationaux ferroviairesÜbereinkommen über den internationalen EisenbahnverkehrCPFRCollaborative Planning Forecasting ReplenishmentDINDeutsches Institut für NormungDSLVDeutscher Speditions- und Logistikverband e. V.EAIEnterprise Application IntegrationEBAEisenbahn-BundesamtECOSOCEconomic and Social CouncilWirtschafts- und Sozialrat der Vereinten NationenECTAEuropean Chemicals Transport AssociationEDIElectronic Data InterchangeENEuropäische NormEPCAEuropean PetroChemicals AssociationERPEnterprise Resource PlanningPlanung der Verwendung von UnternehmensressourcenERTMSEuropean Rail Traffic Management SystemEUEuropean UnionEuropäische UnionFTLFull Truck LoadGbVGefahrgutbeauftragtenverordnungGGBefGGesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeförderungsgesetz)GGVSEBGefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und BinnenschifffahrtGGVSeeGefahrgutverordnung SeeGMPGood Manufacturing PracticeGSPGood Storage PracticeGSM-RGlobal System for Mobile Communications – RailwayMobilfunksystem nach dem weltweit dominierenden Funkstandard GSMIBCIntermediate Bulk ContainerWürfelförmiger Behälter für Transport und Lagerung flüssiger und rieselfähiger StoffeICAOInternational Civil Aviation OrganizationInternationalen Zivil-Luftfahrt-OrganisationICAO-TITechnical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by AirTechnischen Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im LuftverkehrIATAInternational Air Transport AssociationInternationale Verband der LuftfahrtgesellschaftenIATA-DGRInternational Air Transport Association – Dangerous Goods RegulationGefahrgutvorschriften für den LuftverkehrIMDG-CodeInternational Maritime Dangerous Goods CodeInternationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit SeeschiffenIMOInternational Maritime OrganizationInternationale SeeschifffahrtsorganisationISOInternational Organization for StandardizationInternationale Organisation für NormungKEPKurier, Express und Paket/PostKfzKraftfahrzeugKPIKey Performance IndicatorKVPKontinuierlicher VerbesserungsprozessLCDLiquid Crystal DisplayFlüssigkristallbildschirmLESLogistics Execution SystemLLPLead Logistics Provider3PL- oder 4PL-LogistikdienstleisterLTLLess Than Truck LoadLuftVGLuftverkehrsgesetzLuftVOLuftverkehrsordnungLkwLastkraftwagenM & AMergers and AcquisitionsFusionenMio.MillionenMrd.MilliardenNAFTANorth American Free Trade AgreementNordamerikanisches FreihandelsabkommenÖAMTCÖsterreichische Automobil-, Motorrad- und Touring ClubPkwPersonenkraftwagenPPPPublic Private PartnershipRIDRèglement concernant le transport international ferroviaire des merchandises dangereusesOrdnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GüterSCMSupply Chain ManagementLieferkettenmanagementSOAService-oriented architectureServiceorientierte ArchitekturSQASSafety and Quality Assessment SystemSicherheits- und Qualitäts-BewertungssystemSWOTstrengths, weaknesses, opportunities, threatsStärken, Schwächen, Chancen, RisikenTEUTwenty-Foot Equivalent Unit20-Fuß-EinheittkmTonnenkilometerTSITechnische Spezifikationen InteroperabilitätUNECEUnited Nations Economic Commission for Europeeuropäische Wirtschaftkommission der Vereinten NationenUNOUnited Nations OrganizationOrganisation der Vereinten NationenUSAUnited States of AmericaVereinigte Staaten von AmerikaVANValue Added NetworkVCHVerband ChemiehandelVCIVerband der chemischen Industrie e. V.VCÖVerkehrsclub ÖsterreichVMIVendor Managed InventoryWZ 2003Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003WZ 2008Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008ZKRZentralkommission für die RheinschifffahrtTeil I
Einleitung
Chapter 1
Chemielogistik im Kontext allgemeiner logistischer Anforderungen
Rolf Dietmar Grap, Birte Milnikel
1.1Ausgangssituation der chemischen Industrie
Was ist eigentlich Logistik? Und warum ist Logistik in der Chemie – in der chemischen Industrie, um es genauer zu sagen – warum also ist Chemielogistik etwas Besonderes, so dass man ein Buch darüber schreibt und was ist so besonders? Zur Beantwortung dieser Fragen werden zuerst die wesentlichen Merkmale der Branche aufgezeigt.
1.1.1Abgrenzung der chemischen Industrie
Der Brockhaus schreibt zum Begriff „chemische Industrien“: „…im weiteren Sinne diejenige Industrien, die sich ausschließlich oder vorwiegend mit der Umwandlung von natürlichen und mit der Herstellung von synthetischen Rohstoffen befassen“ [1]. Das Interesse der Unternehmen in der Chemie besteht also sowohl darin Naturstoffe zu ersetzen, wie es beispielsweise durch Kunststoffe gelungen ist, als auch neue Stoffe zu schaffen, welche es vorher noch nicht gab. Als Beispiel seien Flüssigkristalle genannt, die in LCD eingesetzt werden [2, S. 13].
Die vielseitigen Möglichkeiten chemische Produkte zu klassifizieren machen deutlich, dass eine Abgrenzung der „Chemie“ von anderen Branchen schwierig ist. Besonders problematisch ist, dass es lange Zeit keine weltweit anerkannte Abgrenzung der chemischen von anderen Industrien gab. Internationale statistische Vergleiche waren deshalb nicht immer aussagekräftig. Erschwerend kam hinzu, dass die Abgrenzungen über die Jahre hinweg auch noch Änderungen unterlagen [2, S. 13].
An mittlerweile entwickelten internationalen und europäischen Klassifikationssystemen orientiert sich auch die deutsche Klassifikation der Wirtschaftszweige, die kurz WZ genannt wird. Vergleicht man hierbei die aktuelle Ausgabe von 2008 mit der letzten Version WZ 2003, sie sind ausschnittweise in Abbildung 1.1 dargestellt, so wird die chemische Industrie jeweils deutlich von der Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie von der Gummi- und Kunststoffindustrie abgegrenzt. Die Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse wurde 2003 noch zu einer Untergruppe der chemischen Industrie gerechnet. Seit 2008 wird sie jedoch als eigener Wirtschaftszweig geführt. Nimmt man Daten des VCI, kommt noch hinzu, dass er zwar für die Gliederung der Sparten die Unterpositionen der WZ nutzt, sie jedoch anders gruppiert [3].
Abb. 1.1 Gegenüberstellung von Klassifikationsmöglichkeiten chemischer Erzeugnisse.
1.1.2Bedeutung der chemischen Industrie
In Deutschland „ist die Chemie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige“ [4, S. 5]. Mit 173,6 Mrd. € betrug ihr Anteil am Umsatz des verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2007 etwa 10% (hinter der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Elektrobranche) [4, S. 5 ff.]. Weiterhin ist die chemische Industrie in Deutschland eine sehr exportstarke Branche: 2007 machten chemische Erzeugnisse im Wert von 125 Mrd.€ 13,9% der Gesamtexporte Deutschlands aus. Höhere Exportanteile konnten nur Kfz, Kfz-Teile und Maschinen aufweisen [5].
Rund 7% der Weltmarktanteile entfielen 2007 auf die deutsche Chemiebranche. Damit ist sie nach den USA, China und Japan die viertgrößte Chemienation der Welt. In Europa ist sie Spitzenreiter. Der wachsende internationale Handel, die Schaffung eines EU-Binnenmarktes und die Öffnung Osteuropas tragen zu einem seit Jahren steigenden Handelsvolumen bei [4, S. 3 ff.].
Asien gewinnt auf dem weltweiten Chemiemarkt zunehmend an Bedeutung und die dortigen Unternehmen nehmen den Chemieproduzenten Europas und der NAFTA Marktanteile ab (Abbildung 1.2). Der Wettbewerb auf dem globalen Chemiemarkt nimmt also zu und veranlasst europäische Unternehmen dazu, neue Wege zu suchen. Wichtig wird in diesem Zusammenhang vor allem der Logistikbereich [6].
Abb. 1.2 Wachstum der asiatischen Märkte für die chemische Industrie. In Anlehnung an [7].
Dies gilt besonders für die exportstarke deutsche Chemieindustrie: Ihr „wirtschaftlicher Erfolg in Deutschland hängt deshalb auch von einer wettbewerbsfähigen, kostengünstigen und nachhaltigen Logistik ab.“ [8, S. 36]
1.1.3Marktstrukturen der chemischen Industrie
Neben der quantitativen Seite gilt es auch noch eine qualitative zu betrachten: „Es erscheint müßig zu sein, diesen Einfluss in Zahlen auszudrücken, denn im Grunde ist die heutige Wirtschaft ohne chemische Industrie und ihre Produkte nicht mehr vorstellbar.“ Insgesamt stellt die chemische Industrie über 30 000 unterschiedliche Produkte her [4, S. 6].
Und: „Sie steht am Anfang der Wertschöpfungskette und stellt innovative Produkte für nachfolgende Branchen bereit, zum Beispiel für so dynamische Bereiche wie die Elektrotechnik und die Elektronikindustrie, die Automobil- und die Papierindustrie.“ [9]
So lieferte die chemische Industrie 2007 circa 25% ihrer Erzeugnisse an Industriezweige wie Kunststoffverarbeiter, den Fahrzeugbau oder die Bauwirtschaft, gefolgt von der Möbel-, Papier- und Bekleidungsindustrie sowie anderen Branchen. Weitere 15% der hergestellten Produkte gehen als Arznei-, Körperpflege- oder Waschmittel, Lacke, Farben, Klebstoffe oder andere Endprodukte direkt an den privaten Konsumenten. Etwa 4% der Produktion werden von Dienstleistungsbranchen abgenommen. Mit einem Anteil von 56% ist allerdings die chemische Industrie selbst ihr größter Abnehmer. Der Grund hierfür ist in der hohen Fertigungstiefe innerhalb der Chemiebranche zu finden. Als Beispiel sei Naphtha genannt, das zunächst im Steamcracker zu Propylen und anschließend zu Polypropylen verarbeitet wird. Erst nach der Hinzugabe verschiedener Zusatzstoffe entsteht der Kunststoff, den die Kunststoffindustrie nutzen kann [4, S. 6 und 8, S. 49].
Daher verwundert es nicht, dass die chemische Industrie selbst ihr wichtigster Lieferant ist. Zusätzlich werden auch Rohstoffe als Vorleistungen benötigt, wobei zu beachten ist, dass die von der eigenen Branche gelieferten Erzeugnisse nicht mitzählen. „Rohstoffe sind nichtchemische Substanzen, die von anderen Industrien […] bezogen und in chemische Produkte umgewandelt werden“ [2, S. 130].
Der bedeutendste Rohstofflieferant der chemischen Industrie ist die Mineralölindustrie [4, S. 6]. Andere Branchen liefern Mineralien sowie Strom, Gas und Maschinen, die ebenfalls als Vorleistungen in die Produktion eingehen. Letztlich benötigt auch die chemische Industrie Dienstleistungen, um beispielsweise Entsorgungen oder Transporte abzuwickeln [10].
1.1.4Logistik
Für den Begriff „Logistik“ existiert weder im deutschen noch im internationalen Sprachgebrauch eine einheitliche Definition. Dabei wird diese Vokabel historisch gesehen schon seit Jahrhunderten verwendet und zwar im militärischen Zusammenhang. Unter Militärlogistik verstand man alle Tätigkeiten, die der Truppenversorgung dienten [11].
In den 1950er Jahren übernahm man den Begriff „Logistik“ in die Betriebswirtschaftslehre. Seitdem wurde er fortlaufend weiter interpretiert, so dass er heute auf drei verschiedenen Ebenen verstanden wird [12, S. 127–132]:
Auf der untersten Ebene umfasst „Logistik“ alle betrieblichen Funktionen, die für die Verfügbarkeit von Gütern sorgen. Dabei ist die Zielsetzung, das richtige Produkt in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität zum richtigen Preis am richtigen Ort bereitzustellen. „Um dieses Ziel zu erfüllen, erbringt die klassische Logistik insbesondere Lager-, Transport- und Umschlagsleistungen.“ [13]
Auf der mittleren Ebene bezeichnet Logistik einen unternehmensstrategischen Gestaltungsprozess. Hierbei erstreckt sich die Logistik über die Funktionsbereiche Beschaffung, Produktion, Distribution und die Entsorgung. Unter dem Gesichtspunkt des Prozessmanagements sind diese Bereiche integriert zu betrachten, wobei auch Lieferanten und Kunden einzubeziehen sind (Abbildung 1.3). Darüber hinaus werden gemäß dem Fließprinzip sowohl der Güter- als auch der Informationsfluss betrachtet.
Abb. 1.3 Zuordnung der Logistikteilbereiche zu den betrieblichen Funktionen. In Anlehnung an [14, S. 7].
Auf der obersten Ebene verbirgt sich hinter der Logistik die unternehmensübergreifende Integration von Abläufen, deren Gestaltung häufig mit dem Begriff Supply-Chain-Management (SCM) umschrieben wird. Hierbei steht die Marktorientierung im Vordergrund: Um den Kundennutzen zu erhöhen, werden immer mehr unternehmensübergreifende Prozessketten aufgebaut. Dies geschieht in Form von horizontalen Kooperationen, die wegen immer geringerer Fertigungstiefen erforderlich werden.
Die fortwährende Weiterentwicklung des Begriffs hängt mit der zunehmenden Bedeutung der Logistik zusammen. Folgende Gründe führten zu diesem Wandel [12, S. 128 f.]:
die zunehmende Komplexität wirtschaftlicher Prozesse,die wachsende internationale Arbeitsteilung bei allen wirtschaftlichen Prozessen,Wettbewerbsintensivierung in bisher geschlossenen Märkten,Verkürzung der Innovationszyklen, insbesondere bei der Produktentwicklung undÖkologische Anforderungen an die Leistungsfähigkeit logistischer Systeme.1.1.5Transport- und Lagerlogistik
Auf allen Verständnisebenen zum Begriff Logistik geht es im Kern jedoch weiterhin um Transportleistungen. „Der Transport ist neben der Lagerung die wesentliche physikalische Logistikleistung“ [15, S. 28]. Obwohl Transporte in der Philosophie der Lean Production als Verschwendung herausgestellt werden, haben sie eine wertschöpfende Bedeutung dann, wenn ein Produkt am Ort seiner Herstellung einen geringeren Wert besitzt als dort, wo der Kunde das Produkt benötigt. Somit kann der Wert eines Produktes durch den Transport durchaus erhöht werden [16].
Die Transportlogistik als Teilbereich der Logistik erstreckt sich über alle ihre Funktionsbereiche und hat die Aufgabe der „Planung und Durchführung von Maßnahmen zur optimalen Gestaltung des Transportes bei der Wahl der Transportmittel, Transportwege, Beladung und Entladung, Übergabe u. ä.“ [17]
Lagerungen, die eine Veränderung des Gutes beabsichtigen, fallen nicht in den Bereich der Lagerlogistik, da es sich bei ihnen um einen Produktionsvorgang handelt. Lagerleistungen werden somit zur reinen Zeitüberbrückung benötigt. Die Aufgabe der Lagerlogistik ist es somit, optimierende Maßnahmen zur Standortwahl, zur Gestaltung der Lagersysteme, zur Lagerorganisation und Lagertechnik zu planen und durchzuführen [17, 18].
Betrachtet man ein Unternehmen als System, so ist es einerseits integriert in übergeordnete Systeme wie die Volks- und Weltwirtschaft. Andererseits besteht es aus Subsystemen, zu denen Transport, Umschlag, Lagerung, Verpackung, Kommissionierung, Information und Kommunikation gehören. Die Elemente eines Systems sowie die Systeme und Subsysteme selbst stehen in Wechselwirkung zueinander [12, S. 130 und 19].
So kann beispielsweise ein Transportsystem für Gefahrgüter1) durch fünf Elemente beschrieben werden (Abbildung 1.4) [20, S. 35 ff.]:
Abb. 1.4 Gliederung möglicher Verkehrsmittel nach Verkehrsträgern. In Anlehnung an [20, S. 35. f.].
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie sich ein Transport letzten Endes gestaltet. Tatsächlich spricht man dann von Transportketten: „Gefährliche Güter werden in Transportketten befördert, die Transportsysteme unterschiedlicher Ausprägung und damit Komplexität darstellen“ [20, S. 37].
Für Lagersysteme, in denen Gefahrstoffe eingelagert, ausgelagert und transportiert werden müssen, können vier Systemelemente definiert werden:
Wie im Transportsystem gibt es eine Strömungsgröße. Im Falle des Lagersystems ist es der Gefahrstoff.Wieder ist das Personal ein wesentliches Element. Hierzu zählen neben den operativen Mitarbeitern auch Lagerverwaltungsangestellte, die administrative und dispositive Aufgaben wahrnehmen.Ein weiteres Element sind die festen Lagereinrichtungen, zu denen nicht nur die Lagergebäude, sondern auch die Lagermittel gehören.Das letzte Element eines Lagersystems für Gefahrgüter sind die Fördermittel, also lagerspezifische Transportfahrzeuge.1.1.6Gefahrgüter und Gefahrstoffe
Gefahrgüter und Gefahrstoffe sind keine Synonyme. Zwischen Gefahrgütern und Gefahrstoffen besteht aus juristischer Sicht ein großer Unterschied: Von gefährlichen Gütern spricht man beim Transport, wohingegen von gefährlichen Stoffen bei der Lagerung die Rede ist. Dabei sind gefährliche Güter (Synonym: Gefahrgüter) laut Gesetz solche „Stoffe und Gegenstände, von denen auf Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können“ [21]. Die Begriffsdifferenzierung rührt von der ungleichen Entwicklung der Gesetzesvorschriften her. Während der Transport gefährlicher Güter im Gefahrgutbeförderungsgesetz geregelt ist, richtet sich die Lagerung gefährlicher Stoffe (zu der allerdings die transportbedingte Zwischenlagerung – wie in Abschnitt 1.1.6.1 beschrieben – nicht gehört) größtenteils nach dem Chemikaliengesetz und der Gefahrstoffverordnung [20, S. 8]. Diese Rechtsnormen verfolgen unterschiedliche Schutzziele: Während bei der Beförderung von Gefahrgütern der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt vor akuten Gefahren an erster Stelle steht, so wird bei der Lagerung von Gefahrstoffen auch der Schutz vor Langzeitwirkungen berücksichtigt. Daher versteht das Chemikaliengesetz neben Stoffen mit akut gefährdenden Eigenschaften auch solche Substanzen als Gefahrstoff, die beispielsweise krebserzeugend oder erbgutverändernd sind. Somit ist jedes Gefahrgut auch gleichzeitig ein Gefahrstoff, aber nicht jeder Gefahrstoff muss als Gefahrgut klassifiziert werden [22, S. 548].
1.1.6.1 Beförderung von Gefahrgütern
Im Jahr 2007 wurden in Deutschland rund 4 Mrd. Tonnen Güter transportiert. Davon waren 395 Mio. Tonnen chemische Erzeugnisse. Etwa 40 % der transportierten Chemikalien wurden als Gefahrgut klassifiziert. Nach Schätzung des VCI verlud die chemische Industrie knapp 150 Mio. Tonnen der transportierten Chemieprodukte, wovon 60 Mio. Tonnen (also ebenfalls 40 %) Gefahrguttransporte waren.
Gefahrguttransporte werden fast ausschließlich von der chemischen Industrie und ihrem wichtigsten Lieferanten, der Mineralölindustrie, veranlasst. Der größte Teil am Transport gefährlicher Güter, nämlich über 70 %, betrifft die Beförderung von Mineralölerzeugnissen, die wichtige Rohstoffe für die Chemiebranche darstellen [23].
Ausgehend von ihren gefährdenden Eigenschaften oder ihren Zuständen werden Gefahrgüter in 13 Gefahrgutklassen eingeteilt (Abbildung 1.5). Besitzt ein Produkt mehrere gefährliche Eigenschaften, so geschieht die Einordnung in eine Gefahrgutklasse – und zwar nach der Hauptgefahr, die bei der Beförderung von dem Produkt ausgeht [20, S. 10].
Abb. 1.5 Gefahrgutklassen mit Beispielen. In Anlehnung an [24].
Im Gefahrgutrecht versteht man unter dem Begriff der Beförderung „nicht nur den Vorgang der Ortsveränderung, sondern auch die Übernahme und die Ablieferung des Gutes sowie zeitweilige Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, Vorbereitungs- und Abschlusshandlungen (Verpacken und Auspacken der Güter, Be- und Entladen), auch wenn diese Handlungen nicht vom Beförderer ausgeführt werden.“ [25] Das bedeutet, dass der Transport bereits mit der Auswahl der Verpackung beginnt und erst dann endet, wenn das Gut nach der Entladung wieder ausgepackt ist. Die Vorgänge sind in Abbildung 1.6 dargestellt.
Abb. 1.6 Reichweite des Beförderungsbegriffs im Gefahrgutrecht. An Anlehnung an [22, S. 551].
Von einem zeitweiligen Aufenthalt spricht man, wenn das Gefahrgut abgestellt werden muss, weil die Beförderungsart (lose Schüttung, Tanktransport oder Ähnliches) oder das Verkehrsmittel gewechselt wird oder aber ein anderer Grund vorliegt [22, S. 551].
1.1.6.2 Besonderheiten in Chemieparks
Es gibt allerdings auch Transporte, die nicht unter das Gefahrgutrecht fallen. Die Anwendung des Gefahrgutbeförderungsgesetzes schließt Transporte auf abgeschlossenem Betriebsgelände nicht mit ein. Chemieparks stellen ein solches abgeschlossenes Gelände dar, weil das Sicherheitsmanagement der Betreibergesellschaften nur kontrollierten Zugang ermöglicht [26, S. 74 f.]. Transporte innerhalb von Chemieparks gelten also nicht als Gefahrguttransporte.
1.1.7Entstehung von Chemieparks
Wegen der engen Verflechtung der chemischen Produkte untereinander bestanden in der chemischen Industrie lange Zeit große, diversifizierte Konzerne mit vielen Geschäftsbereichen, die somit einen eigenen meist regionalen Verbund bildeten. 1990 begann jedoch eine Neustrukturierung auf globaler Ebene, mit der auch die erwähnte Ausgliederung der Pharmazie einherging (Abschnitt 1.1.1). Bis zum Jahr 1999 formierten sich 43% der chemischen Unternehmen durch Fusionen und Beteiligungen neu.
Ausschlaggebend für diesen Umbruch war eine neue Orientierung am Weltmarkt. Die Öffnung neuer Märkte wie Osteuropa oder China und der Zusammenschluss von Abnehmer- und Zuliefermärkten verstärkten den globalen Wettbewerb. Um hier zu bestehen, fingen die Unternehmen der chemischen Industrie an sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Gleichzeitig begann man die eigenen Wertschöpfungsketten zu straffen, damit die Kosten- und Effizienzvorteile des bisherigen Verbundsystems nicht verloren gingen [27, S. 43].
In diesem Spannungsfeld zwischen Globalisierung und lokaler Clusterbildung entstanden und entstehen – in Deutschland inzwischen über 40 – so genannte Chemieparks, die folgendes ermöglichen: „Die regionale Verbundproduktion verliert keineswegs an Bedeutung, sie wird nur in völlig neuer Weise integriert.“ [27, S. 47] Denn die Verbindungen, die früher innerhalb eines Konzernstandortes existierten, werden jetzt zwar zwischen verschiedenen Unternehmen jedoch weiter an einem Standort genutzt. Auf dem Gelände eines Chemieparks sind regelmäßig mehrere unabhängige Unternehmen der Chemiebranche tätig. Sie sind durch gemeinsame Wertschöpfungsketten gekennzeichnet und nutzen die vorhandene Infrastruktur [27, S. 48].
So gelingt es, dass sich die produzierenden Unternehmen voll auf die Herstellung chemischer Erzeugnisse konzentrieren können, während andere die für einen reibungslosen Ablauf in der Produktion notwendigen Unterstützungsleistungen erbringen. Zu den von Chemieparkbetreibern und anderen Dienstleistern übernommenen Supportprozessen können Sicherheitsmanagement, eine zuverlässige Energieversorgung, Werkstätten für Reparaturen, das Betreiben von Kläranlagen und die Übernahme der Abfallentsorgung, des Umweltschutz, des Arbeitsschutz sowie der Anlagensicherheit gehören [28 und 27, S. 48]. Damit ziehen die Chemieparks auch neue Unternehmen an, welche die Lücken, die an den Standorten dadurch entstehen, dass die traditionellen Konzerne Betriebe in andere Länder verlagern, teilweise ausgleichen.
Eine typische Standortdienstleistung ist Logistik. Dabei ist es wichtig, dass der Chemiepark über eine gute Anbindung an die restliche Infrastruktur verfügt. Von den deutschen Chemieparks sind über 40% an Pipelines angeschlossen und gut ein Drittel besitzt eine Anlegestelle für See- oder Binnenschiffe. Einen Bahnanschluss gibt es fast überall und die Möglichkeit zu Transporten via Lkw ist selbstverständlich. Für die Transportlogistik bestehen in Chemieparks also gute Voraussetzungen [28].
1.1.8Entwicklung des Logistikmarktes in der Chemiebranche
Lange Zeit betrieben Chemieunternehmen ihre eigene Logistikinfrastruktur. Das bedeutet, dass sie Dienstleistungen wie Lagerung, interne Gütertransporte und die administrative Disposition eigenständig erbrachten. Lediglich im Bereich der externen Transporte wurden fremde Spediteure eingesetzt [29]. Dies hatte im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen war der Kostendruck in der Chemiebranche nicht so hoch wie in anderen Industriezweigen. Zum anderen werden gerade in der Chemielogistik besondere Anforderungen an Transport- und Lagersicherheit, das Equipment und die Qualifikation des Personals gestellt [30].
Im Zuge der Neustrukturierung gewinnt die Auslagerung von Logistikleistungen zunehmend an Bedeutung. Während in anderen Branchen Logistikdienstleister jedoch schon unternehmensübergreifende Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsplanung übernehmen, wurden in der chemischen Industrie bisher vielfach nur Teilleistungen wie Gefahrguthandling, Tanktransporte oder Silodienste fremdvergeben. Ein Wunsch nach verstärkter Auslagerung ist bei 55% der Chemieunternehmen allerdings vorhanden [30]. Nicht selten werden dazu die eigenen Logistikabteilungen als Tochtergesellschaften ausgegliedert. Diese gehören dann zwar eigentumsrechtlich zum Konzern, sind aber unternehmerisch eigenständig und bieten nicht nur der Muttergesellschaft, sondern auch anderen Unternehmen ihre Dienstleistungen an [29].
Somit nimmt die Konkurrenz auf dem Logistikdienstleistungsmarkt zu, was zur Erweiterung des Leistungsangebots führt. Zusätzlich zur Durchführung übertragener Aufgaben kann sich das Leistungsspektrum um die Phasen der Kontrolle und Planung der übernommenen Funktionen erweitern. Diese müssen sich nicht länger auf den Transport beschränken, sie können auf die Bereiche Verpackung und Lagerung ausgedehnt werden bis hin zum Bestandsmanagement oder der kompletten Auftragsabwicklung. Abbildung 1.7 verdeutlicht diese Entwicklung [15, S. 153 f.].
Abb. 1.7 Entwicklung des Leistungsspektrums von Logistikdienstleistern. In Anlehung an [15, S. 154].
Übernimmt ein Logistikdienstleister für ein Unternehmen all diese Teilfunktionen und erbringt Zusatzleistungen wie Beratung oder Sendungsverfolgung, so spricht man von Kontraktlogistik, sofern vertraglich eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart ist [14, S. 47 f.].
Dieses Geschäftsmodell wird vereinzelt auch für Chemielogistik angeboten, ist dort aber bisher noch weniger stark verbreitet. Da aber damit gerechnet wird, dass sich der Auslagerungstrend auch in der Chemiebranche fortsetzen wird, ist die Konsequenz für Logistikdienstleister „sich in Zukunft diesen Anforderungen zu stellen, um kompetent umfassende Kontraktlogistikleistungen in der Chemie offerieren zu können.“ [31] Hierzu sind seitens der Logistikdienstleister nicht nur umfangreiche Managementkompetenzen nötig, sondern auch fachliches Spezialwissen. Letzterem kommt auf Grund der hohen Sicherheitsansprüche eine besondere Bedeutung zu [31].
1.2Sicherheit in der Transportlogistik
Das Thema Sicherheit steht im Mittelpunkt aller transportlogistischen Aktivitäten, „da die Sicherheit bei der Beförderung und die Distribution von Chemikalien für die chemische Industrie von elementarer Bedeutung sind.“ [32] Dies gilt insbesondere für die Beförderung von Gefahrgütern, deren Risiken im Folgenden betrachtet werden. Eine analoge Risikobetrachtung kann auch für den sensiblen Umgang mit Gefahrstoffen bei der Lagerung vorgenommen werden.
Risiken bestehen beim Transport von Chemikalien und vor allem von Gefahrgütern nicht nur im Verlust oder in der Beschädigung der transportierten Güter. In höherem Maße als beim Transport der meisten anderen Güter sind Menschen, Tiere und Umwelt bei der Freisetzung von Chemikalien gefährdet. Daher werden gerade in der Gefahrgutlogistik vorhandene Risiken, seien es terroristische Angriffe oder Transportunfälle, wie sie jeweils in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden, besonders ernst genommen [33, S. 97].
1.2.1Risiken durch vorsätzliches Handeln
In Bezug auf terroristische Aktivitäten sind Angriffe von außen und Sabotage durch Innentäter zu differenzieren.
Risiken durch Terrorismus sind in der Gefahrgutlogistik nicht zu unterschätzen, weil „grundsätzlich die Gefahr gegeben ist, dass Aggressoren Gefahrgüter entweder als direkte Waffe einsetzen oder als Diebesgut für den Einsatz bei späteren Anschlägen nutzen.“ [33, S. 97] Dass gefährliche Güter von Terroristen entwendet und zu Anschlagszwecken missbraucht werden können, ist offensichtlich und in der Vergangenheit auch schon geschehen: So raste zum Beispiel bei einem Anschlag auf Djerba im April 2002 ein Terrorist in einem Lkw, der mit rund 5000 Litern Flüssiggas gefüllt war, gegen eine Synagoge. Der Tankwagen explodierte, wodurch 21 Menschen starben [34].
Die Gefahr lauert aber auch innerhalb der Unternehmen. Innentäter können eigene Mitarbeiter, Fremdfirmen oder andere sich durchaus befugt auf dem Werksgelände aufhaltende Personen sein, die einen Anschlag verüben oder Beihilfe zu einem Anschlag leisten [35]. Sie besitzen nicht nur auf Grund ihrer Nähe zur Einrichtung besondere Möglichkeiten zu solchen Taten, sondern auch, weil sie mit den betrieblichen Abläufen und Sicherheitssystemen bestens vertraut sein können. Eigene Mitarbeiter stellen als potenzielle Innentäter dann ein Sicherheitsrisiko dar, wenn [36]
Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen,fremde Nachrichtendienste die Person werben oder erpressen oderZweifel an der demokratischen Denkhaltung bestehen.Denkbar ist aber auch Sabotage ohne terroristischen Hintergrund. So könnte ein verärgerter oder gekündigter Mitarbeiter Verkehrsmittel oder Behälter manipulieren, um einen Unfall hervorzurufen und das Unternehmen mit negativen Schlagzeilen in Verruf zu bringen.
1.2.2Risiken durch ungeplante Ereignisse
“Eine Serie von Unfällen mit gefährlichen Transportgütern 1987 machte auf diesen sensiblen Transportbereich besonders negativ aufmerksam.“ [37] Der bisher schwerste solcher Unfälle ereignete sich im hessischen Herborn: In Folge von Bremsversagen kippte ein Tanklaster mit 33 000 Litern Benzin um, wobei der Tank aufriss. Wenige Minuten nachdem das Benzin in ein Eiscafé und die Kanalisation gelaufen war, entzündete es sich und explodierte. Dabei brach das Eiscafé zusammen und zwölf weitere Häuser brannten aus. Dieser Unfall forderte sechs Todesopfer und 40 Schwerverletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von umgerechnet 25 Mio. Euro [38].
Häufig führen nicht einmal Verstöße gegen die Gefahrgutvorschriften, sondern allein gegen die Verkehrsvorschriften zu solchen Unfällen [39, S. 9–15]. Allerdings haben sich von 1997 bis 2007 die Gefahrgutunfälle auf der Straße nahezu halbiert [40].
Auch im Eisenbahnbetrieb kann es zu schwerwiegenden Transportunfällen mit Gefahrgütern kommen, wie im Juni 2009 der Vorfall im italienischen Viareggio gezeigt hat: Dort entgleisten in Folge eines Achsbruchs vier Kesselwagen eines Zuges, die mit jeweils 30 000 Liter Flüssiggas beladen waren. Einer der entgleisten Tankwagen explodierte. 14 Menschen starben, mehr als 30 sind zum Teil schwer verletzt worden und zwei Häuser brannten vollständig nieder [41].
Auch der Schiffstransport ist keineswegs risikofrei: Am 16. April 1947 beispielsweise detonierten rund 8500 Tonnen Ammoniumnitrat an Bord eines Schiffes im Hafen von Texas City. 581 Tote waren die Folge.
Lediglich bei den bisherigen Luftfahrtunfällen wird von keinem berichtet, der durch Gefahrgut verursacht oder nennenswert verschlimmert wurde.
Insgesamt muss man feststellen: „Immer wiederkehrende, aufsehenerregende Gefahrgutunfälle haben die kritische Haltung der Öffentlichkeit gegenüber Gefahrguttransporten gefestigt“ [33, S. 97].
Die wichtigsten Gemeingüter, die durch Gefahrgüter geschädigt werden können, sind Luft, Wasser und Boden. Problematisch ist, dass die Beeinträchtigungen von Erdreich und Wasser mit Gefahrstoffen nicht nur zu einer Schädigung von Pflanzen und Tieren führen kann, sondern dass diese über die Nahrungsaufnahme auch in den menschlichen Organismus gelangen [42, S. 49 ff.]. Sachschädigung entsteht vor allem dann, wenn Gefahrgüter explodieren, denn „eine schlagartige Verbrennung erzeugt eine Druckwelle, so daß zu der zerstörerischen Wirkung der Verbrennung noch das zusätzliche Schadensrisiko durch die Druckwelle kommt.“ [42, S. 39]
1.3Sicherheitsmaßnahmen in der Gefahrgutlogistik
Jedes Unternehmen befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Kundenanforderungen und den eigenen wirtschaftlichen Zielen. In der Gefahrgutlogistik kommt noch eine weitere Kraft hinzu: die Sicherheitsanforderungen. Um die in Abschnitt 1.2 herausgearbeiteten Risiken zu reduzieren, werden Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen ergriffen: Einerseits trägt der öffentliche Bereich, vor allem durch gesetzliche Auflagen, zur Risikoreduzierung bei, andererseits müssen die Betriebe ihre Sorgfaltspflicht wahrnehmen und selber Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu erhöhen [22, S. 549].
1.3.1Maßnahmen zur Risikoreduzierung durch den öffentlichen Bereich
Das Ziel der Gesetze liegt darin, die Rahmenbedingungen für einen ausreichenden Schutz aller am Gefahrguttransport Beteiligten und Unbeteiligten zu schaffen.
Weil der Welthandel mit gefährlichen Gütern zunimmt, bestehen Bestrebungen, Gefahrgutvorschriften global zu harmonisieren. Daher erscheinen mittlerweile alle zwei Jahre die UN-Empfehlungen zum Transport gefährlicher Güter, erarbeitet vom UN-Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen (ECOSOC). Dieses Empfehlungswerk gilt weltweit und verkehrsträgerübergreifend [43]. Neben allgemeinen Bestimmungen nimmt es die Einteilung in Gefahrgutklassen vor. Zusätzlich sind die am häufigsten beförderten Gefahrgüter in der so genannten UN-Liste aufgeführt. Dort erhält jedes Gut eine eindeutige UN-Nummer. Zusätzlich sind Sekundärgefahren, weitere besondere Eigenschaften sowie die vorgeschriebene Verpackung aufgeführt. Darüber hinaus werden konkrete Angaben zur Transportdurchführung gemacht. Die Umsetzung der UN-Empfehlung geschieht nach Verkehrsträgern differenziert (Abbildung 1.8).
Abb. 1.8 Gefahrgutvorschriften im Überblick.
Da die Verkehrsträger Seeschifffahrt und Luftfahrt in der Regel grenzüberschreitend eingesetzt werden, besteht hier ein besonderes, weltweites Harmonisierungsbedürfnis. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) entwickelte Empfehlungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Seeschiffsverkehr, die sie vor allem im IMDG-Code regelt [44]. Im Luftfahrtbereich arbeiten Experten der Internationalen Zivil-Luftfahrt-Organisation (ICAO) und des Internationalen Verbands der Luftfahrtgesellschaften (IATA) zusammen an der Erstellung der Technischen Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr (ICAO-TI), die anschließend in der IATA-Gefahrgutverordnung (IATA-DGR) sachlich identisch übernommen wird.
Für den Straßenverkehr erarbeitete die europäische Wirtschaftkommission der Vereinten Nationen (UNECE) 1957 das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) [45, S. 3]. Mittlerweile haben 45 Nationen, darunter alle EU-Staaten, das Übereinkommen unterzeichnet, das dem Aufbau nach im Wesentlichen den UN-Empfehlungen entspricht [46].
Für den Schienenverkehr wurde analog die Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) entwickelt. Sie findet sich als Anhang im Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), das bis heute insgesamt 43 Staaten – auch außerhalb Europas – unterschrieben.
In relativ kurzen Abständen „machen technische Entwicklungen und die Dynamik der weltweiten Logistik Detailanpassungen der Sicherheitsvorschriften immer wieder erforderlich.“ [47] Daher werden ADR und RID laufend weiterentwickelt und erscheinen derzeit alle zwei Jahre in einer neuen Version.
Der Verkehrsträger Binnenschifffahrt wurde mit dem Europäischen Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) in den 60er Jahren durch die UNECE geregelt. Bis heute haben 14 Staaten dieses Abkommen unterzeichnet. Auf der Basis des ADN entwickelte die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) im Jahre 1970 ein Abkommen, das explizit für den Rhein Gültigkeit besitzt (ADNR) [44].
Damit die beschriebenen Vorschriften auch in der Bundesrepublik Deutschland Rechtskraft entfalten, wurde 1975 das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG) erlassen. Es handelt sich um ein verkehrsträgerübergreifendes Gesetz und enthält damit nur allgemeine Regelungen zu Geltungsbereich, Legaldefinitionen, Aufgaben, Zuständigkeiten und Überwachungsbestimmungen [33, S. 49]. „Das Gesetz dient als Grundlage für ein möglichst einheitliches Vorschriftenwerk und stellt damit einen wesentlichen Beitrag zur Transportsicherheit […] dar.“ [44] Spezifische Einzelregelungen befinden sich in separaten Verordnungen. Bis 2002 existierten insgesamt vier Gefahrgutverordnungen, je eine für die Straße, die Bahn, die Binnenschifffahrt und die See. Nach Strukturreformen von ADR und RID entstand 2009 schließlich die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). Daneben besteht die Gefahrgutverordnung See (GGVSee) separat weiter. Eine entsprechende Verordnung für den Luftverkehr ist in Deutschland nie erlassen worden. Betroffene Unternehmen müssen relevante Gefahrgutinformationen dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und der Luftverkehrsordnung (LuftVO) entnehmen.
Weil die große Zahl an komplexen Gefahrgutvorschriften, die im Betrieb an vielen Stellen zu beachten sind, die Unternehmen bei ihrer Umsetzung oft überfordern, verpflichtet die so genannte Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) solche Unternehmen, die Gefahrgüter herstellen, handeln oder befördern dazu, in ihre Aufbauorganisationen einen Gefahrgutbeauftragten zu integrieren [45, S. 26]. Der Gefahrgutbeauftragte dient als organisatorische Gestaltungshilfe sowie Überwachungs- und Beratungsorgan [48, S. 20].
Für die Überwachung sind auf Bundesebene zwei Organisationen zuständig: das Bundesamt für Güterfernverkehr (BAG) auf der Straße und das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Abgesehen von diesen beiden Organisationen ist die Überwachungsaufgabe Ländersache. Überwiegend ist es der Fall, dass die Polizei für die Gefahrgutkontrolle auf Straßen und Wasserwegen zuständig ist und Vorgänge innerhalb der Betriebe in den Verantwortungsbereich von Arbeitsschutzbehörden und Gewerbeaufsicht fallen [49].
Auf Sabotagemöglichkeiten reagiert die Bundesregierung mit dem vorbeugenden personellen Sabotageschutz im Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Mögliche Saboteure sollen dadurch von vornherein von sicherheitsempfindlichen Positionen ferngehalten werden. Hierzu findet eine vom Staat durchgeführte Sicherheitsüberprüfung von Personen statt, die solche Stellen besetzen, um mögliche Sicherheitsrisiken (Abschnitt 1.2.1) aufzudecken. Gleichzeitig wird von den Unternehmen für Güter mit besonders hohem Gefährdungspotenzial der Entwurf eines Sicherungsplans jeweils in den Kapiteln 1.10 des ADR und RID verlangt. „Mit der Einarbeitung des Kapitels ‘Security’ in die UN-Empfehlungen und in das ADR 2005 hat der Gesetzgeber das Ziel ausdrücklich so formuliert, dass das Risiko des Missbrauches gefährlicher Güter für terroristische Zwecke, durch die Personen, Güter oder die Umwelt gefährdet werden können, zu minimieren ist.“ [50]
1.3.2Maßnahmen zur Risikoreduzierung durch Unternehmen
Dem Begriff „Chemie“ haftet seit jeher neben den positiven Aspekten wie Fortschritt und Heilung auch ein negatives Image an, da er häufig mit Gesundheitsschädigung, Verseuchung, Vernichtung und Gefahr assoziiert wird. „Es gibt heute kaum mehr ein Problem, bei dem nicht zunächst die chemische Industrie in die Schußlinie geriete – sei es Waldsterben, Nitrat im Grundwasser, schmutzige Flüsse oder Schwermetall im Fleisch.“ [2, S. 300] Um diesem negativen Ansehen entgegenzuwirken ist bis heute das Sicherheitsbewusstsein der Chemieproduzenten besonders ausgeprägt und sie ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, die meist über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Dies trifft auch auf die Beförderung zu.
“Um Risiken von Unfällen zu minimieren und negative Berichte in den Medien zu vermeiden, wurden komplexe Logistikprozesse von Unternehmen länger als in anderen Branchen innerhalb des Konzerns, d. h. in Eigenleistung, erbracht.“ [51] Mit der zunehmenden Ausgliederung von Logistikdienstleistungen, geben die Verlader nun auch die Haftung ab. Das bedeutet, dass sie an sich nur für Folgen haften, die durch Verletzung ihrer eigenen Pflichten, etwa beim fehlerhaften Beladen, entstehen. Für Pflichtverletzungen des Beförderers, wenn beispielsweise ein Fahrzeug Mängel aufweist und es dadurch zu einem Unfall kommt, haftet nicht das verladende Unternehmen. Dennoch werfen Gefahrguttransportunfälle ein schlechtes Licht auf den Auftraggeber des Transports. Dies kann zukünftige Aufträge und letztlich auch die Existenz des Unternehmens gefährden. Daher wird von Gefahrgutlogistikern erwartet, dass auch sie zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen eigene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen [33, S. 9–10 und 20, S. 2].
Die wesentliche Komponente bei der Gewährleistung der Sicherheit sind die Mitarbeiter. Motiviertes und gut geschultes Personal trägt dazu bei, Transportrisiken zu begrenzen. Daher sollten Anreizsysteme vorhanden sein, welche die Motivation erhöhen, und Schulungen durchgeführt werden, um den Kenntnisstand der Mitarbeiter zu verbessern und aktuell zu halten [48, S. 20].
Um die Abläufe der Gefahrgutbeförderung sicher zu gestalten, gibt es mittlerweile für jeden Abschnitt der Beförderung, also auch für die Be- und Entladung, technische Hilfsmittel, die ständig weiterentwickelt werden. Einige der wichtigsten Techniken betreffen dabei die Ladungssicherung und die Verkehrsmittel selber.
Auch Informations- und Kommunikationssysteme können im Gefahrgutbereich sinnvoll eingesetzt werden. Besonders erwähnenswert sind dabei Telematiksysteme, von denen die meisten eine umfassende Lösung zur Sendungsverfolgung, zum Fuhrparkmanagement und zum Auftragsmanagement bieten.
“Einheitliche Qualitätssicherungs- und Beurteilungssysteme der Gefahrgutverlader […] beabsichtigen eine Standardisierung der Sicherheitsaspekte und -anforderungen. Den Gefahrgutspeditionen ist […] daher auch die Implementierung eines systematischen Qualitätsmanagements, dessen Schwerpunkt u. a. auch auf Sicherheitsaspekten liegen sollte, zu empfehlen.“ [33, S. 112 f.]
Eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ist für die meisten Gefahrguttransporteure selbstverständlich [33, S. 219–220]. Nötig wäre jedoch eine ergänzende Zertifizierung SQAS. SQAS ist ein Sicherheits- und Qualitäts-Bewertungssystem, das von dem Verband der Europäischen chemischen Industrie (Cefic) entwickelt wurde. Die SQAS-Bewertung zeigt auf, in welchem Maße Sicherheitsaspekte umgesetzt werden.
1.4Zusammenfassung
Die sachlichen Anforderungen an die Planung und Integration der Logistik in die Wertschöpfungskette unterscheiden sich in der Chemie nicht wesentlich von denen in anderen rohstofforientierten Branchen. Das Besondere liegt in den Gefahren, die von vielen chemischen Produkten ausgehen können und die damit einerseits alle mit der Logistik befassten Personen in ein komplexes Regelwerk einbinden, welches eine hohe Qualifikation und Sorgfalt bei der Arbeit erfordert, andererseits aber die Prozesse verlangsamt und aufwändiger werden lässt.
Literatur
1 Brockhaus (1997) Die Enzyklopädie. Leipzig: Brockhaus, (20. Aufl., Band 4), S. 436.
2 Amecke, H.-B. (1987) Chemiewirtschaft im Überblick: Produkte, Märkte, Strukturen. Weinheim: VCH.
3 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2008) Chemiewirtschaft in Zahlen. Informationsbroschüre. Frankfurt am Main: VCI, S. 10.
4 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2008) Chemische Industrie kurz gefasst. Informationsbroschüre. Frankfurt am Main: VCI.
5 Bundesagentur für Außenwirtschaft (2008) Wirtschaftsdaten kompakt: Bundesrepublik Deutschland. Köln: Bundesagentur für Außenwirtschaft, S. 3.
6 McKinnon, A. (2004) Supply Chain Excellence in the European Chemical Industry: Results of the EPCA-Cefic Supply Chain Excellence Think Tank Sessions. Brüssel: EPCA – The European Petrochemical Association.
7 Conseil Européen de l'Industrie Chimique (2009) Facts and Figures: The European chemical industry in a worldwide perspective. In: Cefic: http://www.cefic.be/factsandfigures/, Januar 2009, abgelesen am 28.07.2009.
8 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2008): VCI-Jahresbericht: Fakten Analysen Perspektiven Chemie. Informationsbroschüre. Frankfurt am Main: VCI, S. 10.
9 Löbbe, K. (2004) Die europäische Chemieindustrie: Bedeutung, Struktur und Entwicklungsperspektiven. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, S. 3.
10 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2008) Fakten und Standpunkte: Die chemische Industrie in der Wertschöpfungskette. In: VCI: http://www.vci.de/Presse/Fakten_und_Standpunkte/, Juli 2008, abgelesen am 28.07.2008.
11 Klaus, P., Krieger, W. (2000): Logistik. In: Klaus, P., Krieger, W. (Hrsg.): Gabler Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden: Gabler, S. 311.
12 Stabenau, H. (2000) Entwicklung und Stand der Logistik. In: Klaus, P., Krieger, W. (Hrsg.): Gabler Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse. Wiesbaden: Gabler.
13 Engelhardt, P. (2002) Industrielle Geschäftsprozesse: Industriekaufleute. Berlin: Cornelsen, S. 24.
14 Vahrenkamp, R. (2005) Logistik: Management und Strategien. 5. vollst. überarb. und erw. Aufl. München: Oldenbourg.
15 Fortmann, K.-M., Kallweit, A. (2007) Logistik. 2. aktualis. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 28.
16 Arendt, F. (2002) Innovative IT-Konzepte für die Logistik: Ein generisches Datenmodell für die Unterstützung der operativen Kooperation in der Transportlogistik. Bremen: ISL, S. 20.
17 Ehrmann, H. (1999) Logistik. 2., überarb. Aufl. Ludwigshafen am Rhein: Kiehl, S. 28.
18 Klaus, P., Krieger, W. (2000) Lagerleistungen. In: Klaus, P., Krieger, W. (Hrsg.): Gabler Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse. Wiesbaden: Gabler, S. 260.
19 Delfmann, W. (2000) Kernelemente der Logistikkonzeption. In: Klaus, P., Krieger, W. (Hrsg.): Gabler Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse. Wiesbaden: Gabler, S. 322–326.
20 Söder, J. (1996) Risikomanagement in der Gefahrgutlogistik. (Diss.) Wiesbaden: Gabler.
21 GGBefG idF v. 31.10.2006 § 2 Abs. I.
22 Arnold, D. et al. (Hrsg.) (2008) Handbuch Logistik. 3. Aufl. Berlin: Springer.
23 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2009):Fakten und Standpunkte: Transport von Chemikalien in der chemischen Industrie. In: VCI: http://www.vci.de/Presse/Fakten_und_Standpunkte/, Juni 2009, abgelesen am 28.07.2009.
24 Oberschelp, H. (1993) Gefahrgut-Management: Leitfaden für Unternehmensführung. Hamburg: Storck, S. 13 f.
25 GGBefG idF v. 31.10.2006 § 2 Abs. II.
26 Müggenborg, H.-J. (2004) Chemieparks unter der Lupe: Gefahrgutbeförderung im Industriepark. Chemie Technik33 (8) S. 74 f.
27 Rehfeld, D. et al. (2004) Chemische Industrie: Neuorientierung, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. München und Mering: Hampp.
28 Juszak, K.-D. (2009) Chemieparks und -standorte in Deutschland: Pressemitteilung von Klaus-Dieter Juszak, anlässlich der ACHEMA 2009 in Frankfurt am 12.05.2009.
29 Suntrop, C. (2006) Geschäftsmodelle in der Chemielogistik: Geschäftsmodell und Einschätzung des Marktes Chemielogistik (Teil 1). CHEManager16, S. 8.
30 Fuchs, U. (2008) Zögerliche Auslagerung. In: Deutsche Verkehrszeitung 15.05.2008, S. 8 f.
31 Stözle, W., Tyssen, C. (2008) Logistikdienstleister benötigen Spezialwissen: Herausforderungen und Chancen der Kontraktlogistik in der chemischen Industrie. CHEManager6, S. 38.
32 Heid, A. (2007) Die Chemie muss stimmen: Verbandsgeschäft und aktive Lobbyarbeit. Gefahrgut Profi17 (2), S. 6–8.
33 Helf, A. (2005): Entscheidungsorientiertes Speditionsmarketing dargestellt am Beispiel des Marktes für Gefahrgut-Logistik. Taunusstein: Driesen.
34 Alexander, D. (2005) Urlaubszentren werden zu Schlachtfeldern. Die Welt165, S. 3.
35 Jochum, C. (2006) Schutz von Chemieanlagen als Teil eines integrierten Sicherheitskonzepts: Fachvortrag anlässlich der 1. Sicherheitskonferenz Future Security in Karlsruhe am 04.07.2006 In: http://www.vvs.fraunhofer.de/de/downloads/future-security/Jochum.pdf, abgelesen am 28.07.2009.
36 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2008) Leitfaden zum vorbeugenden personellen Sabotageschutz im nichtöffentlichen Bereich. Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, S. 14.
37 Ridder, K. (2007) Der Gefahrgut-Fahrer: Fahrer-Stoffliste, Tunnelregelung, Bußgelder. 20. Ausg. Landsberg: ecomed (Stand ADR 2007), S. 287.
38 Ridder, K. (2005) Herborn hat vieles verändert. Der Gefahrgut-Beauftragte16 (1), S. 9.
39 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bundesamt für Güterverkehr (2005) 5. Lagebild Gefahrgut. In: www.bag.bund.de, S. 9–15, abgelesen am 28.07.2009.
40 Verband der Chemischen Industrie e. V. (2008) Auf einen Blick Umwelt – Gesundheit – Sicherheit: Daten der chemischen Industrie 2008. Informationsbroschüre. Frankfurt am Main: VCI, S. 5.
41 Straub, D. (2009) Inferno in Viareggio. Frankfurter Rundschau 1.7.2009, S. 39.
42 Gutzeit, S. et al. (1995) Fahrzeugführer und Gefahrgut-Transport: Die besonderen Anforderungen an die Fahrzeugführer nach Rn. 10315 GGVS/ADR. 3., überarb. Aufl. Fischer (Stand: 1. Oktober 1995).
43 Huster, F. (2006) Durch das Dickicht: Wie sich Wirtschaft und Zeichnerstaaten eine Bresche durch den Regulariendschungel eines UN-Gremiums bahnen. Gefahrgut Profi16 (1), S. 14–16.
44 Ridder, K. (2004) Einführung in das Gefahrgutrecht. Technische Mitteilungen1, S. 39–48.
45 Becker, H.W. (2000) Der Gefahrgutbeauftragte: Anforderungen, Systematik, Rechtsvorschriften ; eine praktische Anleitung für Gefahrgutbeauftragte mit besonderer Berücksichtigung der GGV-Straße. Köln: Heymanns.
46 United Nations (2008) ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Good by Road: Volume I. New York: United Nations, S. VI–XI.
47 Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V. (2008): Jahresbericht 2007. Bonn: DSLV, S. 25.
48 Goldmann, B. et al. (1995) Die Organisation von Gefahrguttransporten aus Sicht der produzierenden Industrie. Köln: Gutke.
49 Ridder, K., Wiederhold, P. (1992) Gefahrgutüberwachung: Leitfaden für Polizei, Gewerbeaufsicht und Gefahrgutbeauftragte. 2., aktualis. und erw. Aufl. Landsberg/Lech: ecomed, 1992, S. 18 f.
50 Walther, L. (2007) Terrorismus – nein danke! Sicherung von Gefahrguttransporten in der Mineralölwirtschaft. Gefahrgut Profi15 (5), S. 32–35.
51 Hardt, A. (2007) Geschäftsmodell Kontraktlogistik: Herausforderung für Dienstleister in der Chemieindustrie. Gefahrgut Profi17 (1), S. 9–10.
1 Gefahrgüter sind ein häufiges Transportgut der chemischen Industrie; zur Definition vgl. Abschnitt 1.1.6 Gefahrgüter und Gefahrstoffe.
Teil II
Marktentwicklungen
Chapter 2
Marktentwicklungen und Trends
Cord Matthies
2.1Marktteilnehmer, Marktstrukturen und Entwicklung
2.1.1Strukturen, Trends und Business-Modelle von marktführenden Logistikunternehmen
Der Logistikmarkt der Chemie hat sich im letzten Jahrzehnt stark entwickelt, getrieben durch einige zeitgleich ablaufende Entwicklungen. Zum Ersten die Konzentration der chemischen Industrie auf ihre Kernkompetenzen, zum Zweiten die Entwicklung von Logistikunternehmen weit über ihre klassischen Tätigkeitsfelder hinweg, vom 2PL (Transport oder Lagerhaltung) über 3PL (Kontraktlogistik) und 4PL (Broker/Forwarder) zum Full-Service-Anbieter, zum Dritten die schnelle und im Vergleich zu anderen Branchen recht homogene Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken mit SAP als Quasi-Standard, zum Vierten die rasante Entwicklung der Distributoren und Trader denen in vielen Fällen die Chemiekonzerne das Geschäft der kleinen Mengen übertragen haben und schließlich zum Fünften die Spezialisierung einzelner Produktionsstandorte innerhalb eines großregionalen Produktionsnetzwerkes für das spezialisierte Logistikpartner die Lieferung europaweit übernehmen.
Dabei sind Besonderheiten der chemischen Industrie zu beachten, die ebenso für deren Logistikdienstleister gelten: Chemische Produkte sind oft Gefahrgut und müssen auch seitens der Logistiker so behandelt werden. Der Logistiker ist dabei oft ein Aushängeschild des Chemiekonzerns. Ebenso sind die Betriebsmittel oft dediziertes Equipment, so wie auch die Apparate der Chemie selber.
In der Logistikindustrie hat in den letzten Jahren eine starke Konsolidierung stattgefunden, die in der Entwicklung großer, global agierender logistischer Konzerne resultiert hat. Beispiele dafür sind der Erwerb von Schenker durch die Deutsche Bahn oder die Akquisition von DHL und Danzas durch die deutsche Post. DSV und Wincanton durch die Übernahme von ABX und P&O Transeuropean kritische Masse erreicht und auch Géodis, TDG und Norbert Dentressangle haben durch große Akquisitionen erfolgreiche Wachstumsstrategien gefahren. Wiederum andere Konzerne haben sich erfolgreich zu globalen Konzernen entwickelt ohne andere Branchengrößen zu übernehmen, wie z. B. Kühne & Nagel sowie ein Großteil der asiatischen Logistikkonzerne.
Das Segment der Chemielogistik kann man als wesentlich weniger konsolidiert betrachten, was sicherlich unter anderem daran liegt, dass Chemieunternehmen selber meist relativ spezialisiert sind und die Branche gegenüber Outsidern wenig konsolidiert erscheint. Jedem, der in der Chemie zuhause ist, ist bekannt dass viele Produktmärkte regional nur eine begrenzte Zahl Anbieter kennen. Da in der Chemie die Produkte oft die Werkstoffe von Anlagen, Transportgeräten und Lagern bestimmen oder alternativ ein Produkt mit einem anderen kontaminiert werden kann, ist die Forderung der Chemiefirmen nach „Dedicated Assets“ ihrer Logistiker nur verständlich, die Chemie muss eben stimmen. Die Marktnischen der Logistiker sind dementsprechend oft ähnlich spezialisiert wie die ihrer Kunden. Man findet so zum Beispiel Logistikunternehmen, die sich auf Tanktransporte von Flüssigkeiten spezialisiert haben, andere haben sich auf Flüssigtransporte per Container spezialisiert, wieder andere auf Schüttgüter im Silotankzug, auf Bahn-Flüssigtransporte usw. Des Weiteren kann eine Spezialisierung auf beispielsweise Flüssigtanktransporte weitere Untergruppen nach sich ziehen, wie Petrochemie, Säuren, Peroxide, Lebensmittel die eine Dedizierung der Assets erfordern.
Auf Grund dedizierter Transportmittel und der Gefahrgutbestimmungen ist oft nur ein Hintransport von Fracht an den Bestimmungsort möglich. Ein Rücktransport mit einer anderen Fracht ist nur in seltenen Fällen möglich und auch dann meist nur nach einer intensiven Reinigung des Frachtraumes. Dieser Aufwand lohnt sich oft nicht.
Die Situation sieht bei standardisiert konfektionierten Gütern natürlich grundlegend anders aus (z. B. palettierte Sackware, Octabins, Container, IBC), in diesen Fällen gelten Gefahrgutbestimmungen und die Dedizierung des Gebindes weiter, die Dedizierung des Transportmittels ist jedoch aufgehoben.
Da die meisten Chemieunternehmen ihre Produktströme europaweit oder global managen, ziehen ihre Logistikdienstleister oft nach. Die Marktführer agieren inzwischen teils global, meist europaweit. Diejenigen, die dies nicht tun, werden marginalisiert. Unter anderem auf Grund dieser Spezialisierung ist die landbasierte Chemielogistik deutlich geprägt von spezialisierten Firmen mit oft nicht mehr als 250–500 Mitarbeitern. Die marktführenden Logistikunternehmen entsprechen der klassischen deutschen Definition des Mittelstandes. Einige dürften durchaus als „Hidden Champions“ gelten. Daneben ist der Markt auch sehr stark geprägt von Firmen, die der EU-Definition von Kleinunternehmen entsprechen (weniger als 250 Mitarbeiter).





























