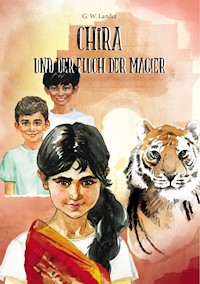
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Chira, klug, vorwitzig, voller Ideen und Übermut, hält sich für ein ganz normales Mädchen. Ihre Adoptivmutter sieht das anders. Sie ist mit ihren Nerven am Ende. Chira soll ihren Klassenlehrer nach Indien begleiten, um den Ernst des Lebens kennenzulernen. Chira ist begeistert. Sie kennt nur ein Ziel. Sie will ihre Eltern suchen, die sie vor zwölf Jahren zur Adoption freigegeben haben. Sie ahnt nicht worauf sie sich einlässt. Indiens vier große Magier erwarten sie. Chira und ihr verlorener Zwillingsbruder sind der Schlüssel in deren Kampf um die Macht. Damit stürzt Chira in eine ungeheuerliche Geschichte. Sie kämpft gegen Bestien, Dorfbewohner und Magier. An ihrer Seite ein Freund und ein Bruder, der erst überzeugt werden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Clara, für Klaus und für Sophia
Clara und Klaus haben dieses Buch als Erste gelesen
Sophia braucht dafür noch ein bisschen Zeit
Die wesentlichen Personen
Robert und Amélie Picot:
Chiras Adoptiveltern
Amah:
Chiras Kinderfrau
Chira Picot:
Adoptivkind indischer Abstammung, 12 Jahre alt
Frederik:
Chiras bester Freund und Nachbar, 14 Jahre alt
Janik Beukelaer:
Frederiks Vater, Bauer
Kulfi:
Ein junger Diener des Orankor
Orankor (erscheint auch als Jamal):
Maharadscha und Magier
Sycophanx:
Hexe, Mutter des Orankor
Glover:
Ein weißer Handschuh, der fliegen kann
Bagha:
Magier mit der Tiergestalt eines Tigers
Mrs. Scoot:
Magierin mit der Tiergestalt eines Bandicoots
(ein großes pelziges Nagetier aus der Familie der Ratten)
Jadoo:
Magier mit der Tiergestalt eines Flugfuchses
(ein Fledertier, ähnlich einer Schoßhündchen-großen Fledermaus)
Anand:
Verwalter
Mr. Bruce:
Chiras Klassenlehrer
Mrs. Ross
Schuldirektorin
Ashvamukhi:
Geist, Herr der Tiere und Wälder
Arun:
Chiras blinder Zwillingsbruder
Kulfi:
Aruns bester Freund, 14 Jahre alt
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Prolog
Diese Geschichte wäre nie geschrieben worden, hätten Robert und Amélie Picot die Warnungen ihres Katers verstanden.
Die Picots lebten in einem efeuüberwachsenen Haus in der Avenue des Etangs. Sie konnten zufrieden sein. Doch das waren sie nicht. Ihr sehnlichster Wunsch – ein Haus voll Kindergelächter – blieb unerfüllt. Deshalb beschlossen sie, ein Kind zu adoptieren.
Die Damen der belgischen Adoptions-Agenturen lächelten müde. »Wissen Sie, wie viele Menschen auf unseren Wartelisten stehen? Das dauert Jahre!«.
Robert und Amélie stöhnten.
Als nur wenige Wochen später das Telefon läutete und eine Stimme fragte: »Könnten Sie sich vorstellen, ein indisches Kind zu adoptieren?«, hätten die Picots misstrauisch werden sollen. Doch ihre Freude war groß. Sie stellten keine Fragen.
»Das Mädchen ist drei Monate alt und heißt Chira.«
Den Picots war es gleichgültig woher das Kind kam. Selbst als sie die Vertragsbedingungen unterschrieben, die bestimmten, dass Chira niemals nach Indien zurückkehren dürfe, läuteten keine Alarmglocken.
Ihr Kater hätte ihnen erzählen können welche Gerüchte er in der Nachbarschaft gehört hatte. Vielleicht wäre später manches anders gekommen.
Stattdessen füllten die Picots seitenweise Formulare aus. Robert beantragte Visa für die Reise nach Indien. Die Agentur empfahl ein indisches Kindermädchen. Gerne wären sie bei der Suche behilflich. Amélie hastete von Geschäft zu Geschäft, um all das zu besorgen, wovon sie überzeugt war, dass ein Säugling es benötigte.
Als Robert und Amélie endlich den Flug nach Bombay antraten, strahlten die beiden vor Glück.
Kapitel 1
In Amahs indischem Billigkoffer befanden sich zwei ausgewaschene Saris, jeder fünf Meter lang, mit dazu passender Bluse, ein Stück Kernseife der Marke Luxus, in der so viel Sand enthalten war, dass auch ein Warzenschwein sauber geworden wäre, und die hübschesten Plastikschlappen, die sie in ihrem sonnenverbrannten Dorf hatte erstehen können. Eingewickelt in den vielen Stoff befanden sich auch drei Fläschchen. Alles in allem wog der Koffer exakt sechs Kilogramm.
Der Zollbeamte musterte die kleine, rundliche Inderin mit einem Blick, der empörte Missbilligung, aber auch eine Prise Langeweile und Hinterhältigkeit enthielt. Zunächst konnte er in dem altmodischen Pappkoffer nichts entdecken, was sein Einschreiten gerechtfertigt hätte – keine goldenen Armreifen, die hier geschmuggelt wurden. Doch dann – die Fläschchen. Wusste er’s doch! Seine Schweinchen-Augen blitzten auf.
Lange sollte sich seine großporige Nase an die Wirkung des stechenden Zimtöls erinnern.
Allerdings brachte Amah weit mehr mit, als sich so ein Zollbeamtenkopf vorzustellen vermochte. Gewichtlose Dinge, die schwer wogen; Geschichten, Sagen, Märchen, mit denen eine ganze Kindheit gefüllt werden konnte. Das war schließlich die Aufgabe, für die sie die Reise nach Brüssel angetreten hatte. Außerdem achtundvierzig Küchenunwesen – Dämonen, wie Amah sie nannte. Die hatte sie nicht freiwillig mitgenommen. Insgesamt waren es eher zweiundsechzig. Vorausgesetzt, man zählte die Dämonen hinzu, die zuständig waren für das Verfilzen von Kinderhaaren, das Verstecken von Socken und Handschuhen, und die schwarzen Flecken, die das Bügeleisen auf die Wäsche spuckte.
Doch Amah brachte, wie jede Inderin, die Etwas auf sich hielt, eine ganze Waffenkammer an Bannsprüchen mit. Diese sollten dafür sorgen, dass auch der Dämon, zuständig für die Verwechslung von Salz und Zucker, der Reisanbrennenlasser-Dämon und der, der Kuchen daran hinderte aufzugehen, in ihre Ecken verbannt wurden – meistens jedenfalls.
***
Seit Amah vor zwölf Jahren in das efeubewachsene Haus in der Avenue des Etangs gekommen war, hatte sie im Haushalt der Picots das Zepter übernommen. Robert und Amélie hatten Amah zu sich geholt, um den Säugling, den sie soeben adoptiert hatten, mit einem Hauch seiner alten Heimat zu umgeben. Amah umsorgte die damals winzige Chira wie das seltene Ei eines Einhorns.
Das Zimtöl verteilte sie großzügig. Es beeindruckte zwar keinen der Dämonen, dafür die Ameisen, die fortan einen großen Bogen um Amahs Reich machten. In der großen Küche, in der es eine verrußte, gemauerte Feuerstelle gab, die nur mehr selten genutzt wurde, schwang sie ihre Kochlöffel und zauberte Currys in den verschiedensten Farben und Schärfen mit denen sie die Familie verwöhnte. Dabei sprudelten aus ihr Geschichten.
An diesem Samstag saßen Chira und ihr bester Freund Frederik am Küchentisch. Wie so oft blieb Frederik zum Essen. Er hatte hier ein zweites zu Hause. Sein Hund vergrub soeben etwas Undefinierbares im Katzenklo. Chiras Kater hatte den Hundekorb besetzt und verfolgte dieses Tun mit Entrüstung und Verwunderung. Gleichzeitig attackierte Amah eine winzige, graue Fledermaus, die sich in die Küche verirrt hatte und dort an einem Holzbalken hing.
»Meine Küche«, schnaufte Amah entrüstet und ließ ihren Besen sinken.
Frederik sah Chira an, als ob sie Abhilfe schaffen könnte.
»Fürchtest du dich vielleicht vor dem armen Tier, Amah?«, fragte Chira. Ungeduldig zog sie den Träger ihrer Latzhose zurück auf ihre Schulter. »Es fliegt von selbst hinaus, so ungemütlich, wie du es ihm machst. Erzähl lieber deine Geschichte weiter. Wie war das jetzt mit dem König? Wozu hat er die Köpfe seiner Opfer gekocht? Was wollte er damit?«
Für einen kurzen Moment unterbrach Amah ihr Gefuchtel. Lange genug für Chira, etwas zu murmeln, wobei sie kaum die Lippen bewegte. Es schien, als hätte die Fledermaus sie verstanden. Anstandslos flüchtete sie ins Freie. Nicht ohne vorher das Fensterbrett zu beschmutzen – ein Zeichen ihres Protests.
»Seit wann sprichst du Fledermaus?«, gähnte der Kater. Chira zog es vor so zu tun, als hätte sie ihn nicht gehört. Sie wusste, für die Ohren der anderen hatte er miaut.
Amah schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf. Ihr dicker Haarknoten hüpfte dabei in die Höhe wie ein erschreckter Siebenschläfer. Vereinzelte graue Strähnen lösten sich in ihrem Nacken. Ihre klugen Knopfaugen musterten Chira und Frederik, die ihre Ellbogen auf den Küchentisch gestützt hatten.
»Der König tat es für Kroni. Erinnerst du dich noch an Kroni, den Dämon, in dem ein Feuer wütete, das ihn so unendlich durstig machte, dass er Tag und Nacht trinken musste?«
Chira nickte. Rasch beugte sie sich zu Frederik, blinzelte und seufzte, »Amah und ihre Dämonen.«
Sie angelte nach ihrer Schultasche, die halb offen auf dem Boden lag, und packte Hefte und Bücher auf den Tisch.
Amahs buschige Augenbrauen zuckten. Ihre Erzählung nahm Fahrt auf. »Orankor, der Maharadscha, Magier und König der Rajputen, wollte mächtiger werden als alle anderen Könige. Vor allem aber wollte er der mächtigste unter den vier großen Magiern Indiens werden. Im Turm seines Sommerpalastes standen Destillierkolben und große Kupferkessel. Dort siedete er Menschenköpfe, bis deren Ängste und Freuden … was sag ich da?«, Amah seufzte, »all ihre Gedanken sich in der Brühe aufgelöst hatten. Diese Suppe war der Preis, den der Dämon verlangte, um Orankor zu helfen. Mit dieser Brühe wurde sein Durst für eine Weile gestillt.« Amah schleckte an ihrem Kochlöffel.
»Es stank erbärmlich«, fuhr sie fort. »Geier umkreisten den Turm. An sie verfütterte Orankor die Fleischreste seiner Opfer.« Amah wedelte mit der Hand vor ihrer Nase, als ob sie Fliegen verscheuchen wollte. »Die Knochen vergrub er in Ameisenhaufen, bis sie abgenagt waren und weiß leuchteten. Das Mehl aus diesen Knochen und Reis, den er seinen Untertanen abtrotzte, mischte er in den Mörtel jeder seiner neuen Verteidigungsmauern. Dieses Rezept sollte seinen Palast uneinnehmbar machen.«
»Ist ihm das gelungen?«, fragte Frederik.
Chira betrachtete ihren Nachbarn und besten Freund. Auf ihren Wangen erschienen freche Grübchen. Frederik! Technische Dinge saugte er auf wie ein Schwamm. Dabei war er ein lausiger Schüler, der den Unterricht hauptsächlich zum Schlafen nutzte. Doch wenn Amah Geschichten aus ihrer Heimat erzählte, lauschte er derart gespannt, dass er sogar seinen Hunger vergaß. Geradezu ein Wunder, denn Frederik futterte, was das Zeug hielt; ein schlaksiger Junge, mit spitzen Knien, spindeldürr wie ein Besenstiel. Amahs Welt begeisterte ihn. Das war die Welt der Krieger und Geister, der mächtigen Götter und zaubernden Magier. Hier wimmelte es von geschmückten Kriegselefanten, Wassernymphen, prachtvollen Burgen und Palästen.
Chira beugte sich über die Bücher, die sie auf dem Tisch ausgebreitet hatte. »Das ist doch nur eine von Amahs Geschichten«, erklärte sie patzig.
Unwirsch wirbelte Amah herum. Chira zog den Kopf ein. »Und wie ihm das gelungen ist. Der Palast steht noch heute, soviel ich weiß«, behauptete sie. Ihre Stimme klang bitter.
Über das Küchenbrett gebeugt hackte sie auf die dort liegenden Zwiebeln ein, als hätten diese sie gekränkt. Schweigend schabte sie danach ihre Opfer in eine Pfanne mit brutzelnder Butter. Chiras Mundwinkel zuckten.
»Magst du nicht lieber die Geschichte von der Ranee erzählen, die in einen Tiger verwandelt wurde? Ich könnte den Tiger machen«, warf Frederik ein. Er mochte es nicht, wenn Amah und Chira gleichzeitig die Stirn runzelten. Doch Amah schien ihre Geschichte vergessen zu haben. Sie schnipselte das Gemüse, maß den Reis ab, schüttete ihn ins Wasser und schwieg.
»Wo spielt denn deine Geschichte?«, wollte Chira wissen, ohne den Kopf von ihren Schulbüchern zu heben.
»Im Königreich Meera«, schnappte Amah. Einsilbig rührte sie in dem Topf, aus dem der Duft indischer Gewürze aufstieg und die Küche füllte.
»Bestens. Wenn ich groß bin, fahre ich dorthin und schau mir das an.« Chiras Augen blitzten, während sie am Zipfel ihres langen dunkelbraunen Zopfs kaute. »Dann werden wir ja sehen, ob der Palast noch steht.«
Frederik gab ihr einen Tritt unter dem Tisch.
»Erzähl doch weiter«, bettelte er. Chira streckte ihm die Zunge heraus.
Da mischte sich Frederiks Vater ein, der an der Tür stand und zugehört hatte. »Was erzählst du denn schon wieder für Schauergeschichten, du alte Hexe?« Janik war gekommen, um seinen Sohn Frederik abzuholen. »Sind das vielleicht Kindergeschichten?«
»Kinder?«, empörte sich Amah. »Hast du vergessen, dass dein Sohn bereits vierzehn ist, du alter Dummkopf? Von wegen Schauergeschichten? Ihr hier in Brüssel interessiert euch ja vielleicht mehr für eure Gärten als eure Vorfahren. Aber dort, wo ich herkomme, wissen wir genau Bescheid darüber, was die Alten erlebt haben, selbst wenn es schon dreihundert Jahre her ist. Maul also nicht rum. Setz dich lieber hin und iss mit. Es ist genug da.«
»Vorfahren! Hmm, großartige Vorfahren sind das. Aber was soll man schon erwarten von einem Land voller Wilder. Meinetwegen, erzähl nur. Das ist immer noch besser als unser Fernsehprogramm«, brummte Janik. Er fühlte sich trotz all der Jahre, die er Amah kannte unwohl beim Anblick ihrer dunklen Haut, die ihn an Karamell erinnerte.
»Wilde?«, fragte Chira, die den Kopf hob. »Du weißt wohl gar nichts über Indien? Vergiss nicht, es ist auch das Land, aus dem ich komme.«
Ungehalten legte sie ihre Hefte zur Seite, um Platz für Amahs Töpfe zu machen.
»Wilde! Ich träum wohl«, brummte sie leise.
Frederik grunzte. Es war schon schwierig genug, Chira und Amah auseinanderzuhalten. Er warf seinem Vater einen warnenden Blick zu. Janik zog sich einen Sessel heran, ließ sich darauf fallen und verschränkte seine kräftigen Bauernhände über dem Bauch.
Einen Moment schien Amah unschlüssig, dann nahm sie ihren Faden wieder auf. »Ich weiß zwar nicht so viel wie unsere Chira, aber eines weiß ich mit Sicherheit: Mit Geschichten kenne ich mich aus. Und was ich den Kindern heute erzählen wollte, hat sich genauso abgespielt. Ge–nauso! Denn so haben es meine Ahnen von Generation zu Generation ihren Kindern erzählt.«
Dabei stellte sie den Topf derart heftig auf den Tisch, dass Chira das Besteck klirren hörte.
»Irgendwo streicht Orankor heute noch herum«, schnaubte Amah, »denn Ruhe hat er bestimmt keine gefunden. Wir Wilde wissen jedenfalls, dass es nichts Gutes bringt, über Magier zu lästern. Man kann nie wissen, in welcher Form sie uns begegnen und wie sie sich dann rächen.« Dabei wuschelte sie Frederiks blonden Schopf.
»Das glaubt jemand?«, fragte Janik. »Für wie bescheuert hältst du uns?«
»Unterbrich mich nicht,« sagte sie. »Hör einfach zu. Magier sterben nicht. Sie werden höchstens kraftlos. Dann setzen sie alles daran, ihre magischen Kräfte zurückzuerlangen.«
»Woher willst du das wissen?«
Amah warf ihm einen Blick zu, der durch ihn durchging und in weiter Ferne etwas wahrnahm, was keiner sonst am Tisch verstand.
Janik Adamsapfel zuckte. Er zog die Schultern hoch, langte nach dem Topf und schöpfte einen großen Löffel duftendes Curry auf seinen Reis. Chira bemerkte wie seine Hand zitterte. Doch bereits nach dem ersten Bissen glitt ein entspanntes Leuchten über sein bärtiges Gesicht.
»Wenn ich einen Magier erkennen kann, dann…« Weiter kam Frederik nicht.
»Dann flüchtest du besser so schnell du kannst!«, sagte Amah.
»Kann man sie überhaupt erkennen?«, fragte Chira.
»Wozu willst du das wissen?« schnappte Amah. »Es sind doch nur meine D-ä-m-o-n-e-n«, dabei verdrehte sie die Augen genauso, wie Chira es getan hatte. »Aber ja. Man kann sie erkennen.«
»Wie?«
»Jedenfalls nicht an einfachen Dingen, wie gelben Augen oder Krallen anstelle von Fingernägeln. Nein, die Magier von denen ich spreche sind Räuber, Ausbeuter. Wie Spinnen saugen sie Menschen ihre Kraft aus. Dabei ist ihre liebste Beute – Kinder.«
»Da bin ich ja beruhigt«, warf Janik mit vollem Mund ein.
Ohne mit der Wimper zu zucken fuhr Amah fort, »Am ehesten erkennt man sie noch an ihrer Stimme. Wenn man diese einmal gehört hat, vergisst man es nie wieder.« Sie sprach die Worte ungewohnt langsam aus.
»Ihre Stimme«, sagte sie, »klingt wie eine quietschende Maschine. Sie ist scharf und rau. Sie krächzt. Sie knirscht. Sie schnarrt. Sie donnert.«
»Im Ernst? Alles gleichzeitig?«. Chiras zweifelnder Blick blieb an Amahs linkem Ohr hängen. Zumindest an der Stelle an der ein Ohr sein sollte. Stattdessen wuchs dort ein kleiner verkrüppelter Hautlappen.
Janik schnaufte kurz, blickte an die Decke, als ob dort ein seltenes Insekt darauf wartete, untersucht zu werden.
Chiras Gedanken wanderten.
Sie kannte die bunte Welt ihrer Amah mit all den Märchen und Dramen und den vielen Göttern, die sich die Mühe machten eine Gestalt anzunehmen, damit die Menschen sie verstehen und anbeten konnten. Ihnen konnte Amah ihre Sorgen vortragen und ihre Hilfe erbitten.
Chira war es gewohnt, dass Amah die Götter auch dann zu Hilfe rief, wenn Chira nicht in die Badewanne oder nicht ins Bett wollte. Sie kannte jeden von Amahs Dämonen, mit denen sie drohte, wenn gar nichts anderes mehr half.
Sie verstand Amah besser als jeder andere. Sie kannte ihr Schweigen und ihren Ärger. Sie hatte viel Zeit in Amahs massigen Armen und an ihrer weichen Brust verbracht. Amah hatte sie mit fremdartigen Melodien in den Schlaf gesungen und ihr von ihrer Sehnsucht nach Indiens Musik der Nacht erzählt; Grillen, die sie in den Schlaf sangen und sie alle Sorgen des Tages vergessen ließen; Eulenschwalme, die Wache hielten und die Schlafenden mit ihrem »Hey du!« warnten.
»Bist du schon einmal einem wirklichen Magier begegnet?«, fragte sie jetzt.
Amah schien die Frage nicht gehört zu haben. Sie massierte das Stückchen knorpeliger Haut, das sie anstelle eines Ohrs hatte. Das tat sie manchmal, auch wenn sie Chiras langes dunkelbraunes Haar bürstete, bis es im Licht glänzte. Durch sie wusste Chira über Indien, das Land, in dem sie geboren worden war, fast so gut Bescheid, als wäre sie dort aufgewachsen. Nun ja, zumindest über den Landstrich, aus dem Amah kam. Denn in der Zwischenzeit wusste Chira auch, dass Indien aus vielen unterschiedlichen Ländern bestand, mit eigenen Geschichten und eigenen Sprachen.
Die Geschichte des Magiers Orankor jedoch hörte auch Chira zum ersten Mal.
»Was hat der Maharadscha denn mit all den Haaren gemacht, Amah?« Chira kümmerte nur noch die Geschichte. Die Geier hatten die Haare doch sicher nicht gefressen.
Es dauerte einen Moment bis Amah antwortete. Sie schien aus einer anderen Welt zurückzukehren.
»Gut, dass du fragst, Kleines. Die Haare verwendete der Maharadscha, um die Polster seiner Audienzhalle zu füllen. Bei ihm waren die Grenzen zwischen Gut und Böse längst verschwommen. Wann immer sich ein Minister auf einem der Polster niederließ, erinnerte sich Orankor an die Verzweiflung derjenigen, denen er die Haare geraubt hatte.«
»Sacrebleu, gute Frau, das wird ja immer grausiger«, protestierte Janik erneut, diesmal mit vollem Mund. »Es mag ja sein, dass ihr eure Ahnen verehrt, aber da kann einem ja der Appetit vergehen.« Das hinderte ihn aber keineswegs daran, sich noch eine Portion auf den Teller zu schöpfen.
»Komm schon, Amah«, sagte Chira jetzt verschmitzt, »ich muss nachher noch lernen, erzähl schon. Mir vergeht der Appetit sicher nicht.«
Kapitel 2
Und Amah erzählte.
»Es war Naamkar, das Fest an dem die Zwillinge der Kronprinzessin ihre Namen erhalten sollten.
Der Sommerpalast war seit Mitternacht auf den Beinen. Es wurde geputzt, gekocht, gebacken. Die Diener schwitzten. Nur Kulfi, klein, schlau, entwischte dem strengen Hofmeister. Er kannte jeden Winkel des verschachtelten Palasts. Ein Mauervorsprung unter der Kuppel des großen Turms war seine neueste Entdeckung. Noch gähnte der Raum unter ihm in dunkler Stille. Es stank. Doch Gestank machte Kulfi nichts aus. Genüsslich streckte er seine Beine aus, verschränkte die Arme unter dem Kopf und grunzte glücklich. Schlaf. Luxus.
»Du schon wieder!«. Die Stimme des Maharadschas fuhr Kulfi bis in die innersten Eingeweide. Er sah sich bereits bis zum Hals in Sand eingegraben, einem langsamen Tod preisgegeben.
Orankor, Fürst der Rajputen, einer der vier großen Magier Indiens strich tief unter Kulfis Versteck durch das Turmzimmer.
»Du musst dich entscheiden«, zischelte eine zweite Stimme.
»Hör auf zu zischen, Mutter«.
Orankors Mutter? War das die Hexe Sycophanx von der die Menschen erzählten?
Sie krächzte, »Glaubst du wirklich, dass Güte, Großzügigkeit und – die Götter mögen es verhüten – am Ende gar Liebe dich zu einem großen Herrscher machen? Alles Bandwurmweisheiten, um Schwächlinge wie dich noch mehr zu schwächen«. Ihre Stimme klang wie das Pfeifen eines Teekessels.
Kulfi wagte kaum zu atmen. Längst zwängten sich Sonnenstrahlen durch die geschnitzten Steingitter der Fenster. Sie spielten mit den gemalten Figuren an der Kuppel und ließen sie tanzen.
Unbeirrt säuselte die Hexe weiter: »Deine eigene Familie hintergeht dich. Willst du das hinnehmen?«
Kulfi hörte Orankors wütendes Schnaufen.
Sycophanx fuhr fort, »Es ist doch nur ein kleiner Schritt zur absoluten Macht; Alles was du dafür brauchst, ist der Drachendolch. Er gibt dir die Macht über die anderen Magier und über Indiens Menschen«.
Sie zischte weiter, »Nicht einmal das Kabinett der Weltkommission für Magie in London kann dich danach bremsen. Der Dolch untersteht dem Gesetz der Weltenschlange Naga, dem ältesten Gesetz in diesem Land.«
Orankor stieß er ein so mächtiges Brummen aus, dass der Mauervorsprung auf dem Kulfi lag zitterte.
»Wie stellst du dir das vor?«, fragte er gereizt. Wie soll ich Jadoo, Bagha und Mrs. Scoot überlisten? Die sitzen doch auf dem Drachendolch wie Hühner auf ihrem Ei«.
»Es gibt uns doch nur für die Menschen«, äffte die Hexe die Magier nach. »Das ist unser Pakt; unser Auftrag. Nur dazu gibt es uns!«
Orankor dröhnte, »Menschen. Dieses Ungeziefer von Bauern, Leibeigenen, Untertanen. Mein Vieh ist wertvoller als dieses Pack. Vermehrt sich wie Flöhe. Die Steuern soll ich senken. Den Handel fördern. Die Karawanen schützen. Spinner!«
Gerne hätte Kulfi über den Rand des Mauervorsprungs geblickt. Stattdessen drückte er sich noch enger an die Wand.
»Ach Kroni, Kroni alter teuflischer Freund, hilf«, rief die Mutter den Dämon zu Hilfe. Sie winselte, »Wo bleibt deine satanische Ferse? Was für einen Schlappschwanz habe ich geboren«.
Jetzt hielt Kulfi es nicht mehr aus. Was er sah, sollte ihn ein Leben lang begleiten. Unter ihm kauerte ein Wesen mit großen gelben Zähnen, grauer Haut und zottigen, dünnen Haaren. Ein Urzeitkrokodil mit nur einem Auge. Die faltigen Hände erinnerten ihn an Vogelkrallen. Es hatte seine Arme ausgebreitet. Aus den Ritzen des Mauerwerks strömten Bhootas; böse, fratzengesichtige Geister. Sie glitten unter Orankors reich bestickten Rock, in seine Ärmel.
»Hier, mit ihrer Hilfe wird es dir gelingen«.
Jetzt verstand Kulfi woher der Gestank kam. Er entströmte einem Kupferkessel. Ein gelegentlich auftauchendes Gesicht drückte Orankors Mutter mit dem blauen Nagel ihres Daumens zurück in die blubbernde Suppe.
Danach herrschte Stille.
Kulfi war wie erstarrt. Er atmete tief. Dann aber schrak er auf. Er musste hier raus. Die Magier warnen. Sobald er ganz sicher war, dass er alleine war, zwängte er sich ins Freie und rannte.
Er rannte durch verschlungene Gänge, über kleine Höfe, Treppen hinauf und hinunter. Er sprang die Stufen hoch, die zu den Räumen der Magier führten. Er hörte die Rufe nicht. Er sah die Geier nicht. Er spürte das Seitenstechen nicht.
Zu spät!
Die Räume der Magier waren verwüstet. Nur einer der bestickten Seidenpölster zuckte auffallend. Dort fand er Glover.
Glover; den Sekretär, Butler, Oberhaupt des Haushalts der Magier. Glover; den weißen Handschuh, in dem eine unsichtbare Hand versteckt war. Glover, der ein Herz für den Diener Kulfi hatte und der durch die Luft schwamm, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre.
»Lass uns die Magier finden«. Kulfi verstaute den verletzten Glover unter seiner Weste und lief los. Außer Atem erreichte er den Hof der Audienzhalle.
Dort stand Orankor, den Drachendolch in der Hand. Die Kronprinzessin kniete vor ihm.
Er donnerte, »Dieser Dolch gibt mir die Macht und ist mein Zeuge. Ich verfluche dich und alle deine Nachkommen. Blind sollt ihr auf dem Bauch kriechen und zertreten werden.«
Mrs. Scoot kam angerannt – zu spät – wie immer. Sie schrie, »Orankor, du maßloses Ungeheuer! Du hast den Schwur, den du uns und dem Rat gegeben hast, gebrochen. Verräter! Nie wieder wirst du einer von uns sein. Ich habe meinen Segen noch nicht ausgesprochen. Höre! Wenn es diesen Zwillingen oder deren Nachfahren gelingt, die Prüfungen Nagas zu bestehen, wird dein Fluch für immer aufgehoben. Dreihundert Jahre ist dafür Zeit. Erst dann hast du gewonnen. Bis dahin aber verlierst du jeden Tag mehr von deiner Kraft«.
Vor den Augen aller verwandelte sie sich in ein Bandicoot. Eine der großen indischen Ratten. Sie sprang und biss Orankors Hand. Der Drachendolch flog. Er glitzerte in der Sonne. Die Gäste hielten erschreckt den Atem an. Im Fallen bohrte sich dieser Dolch in das Herz von Orankors einzigem Sohn. Der Maharadscha jaulte auf wie ein verwundeter Bär.
Jadoo, der zweite der Magier, nahm die Zwillinge an sich und flog in der Gestalt eines riesigen Flughundes über die Burgmauern.
Bagha, der Dritte im Bund, verwandelte sich in einen Tiger und bildete die Nachhut.
Übrig blieb nur eine kleine Schlange, die im Mauerwerk verschwand«.
***
Amah beendete ihre Erzählung mit einem tiefen Seufzer. Einen Augenblick lang rührte sich niemand in der großen Küche.
Als Janik aufstand, wankte er. Seine kräftigen Hände hielten sich an der Tischkante fest. Mit einem Gemurmel, das so klang wie »Saperlipopette« stapfte er zur Küchentür. Dort bedeutete er seinem Sohn Frederik mit dem Kinn, er solle mitkommen. Frederik schüttelte sich, als ob ihm kalt wäre.
Da fragte Chiras glockenhelle Stimme: »Und was geschah danach? Was ist mit Kulfi passiert?«
»Er wurde sehr alt, Liebes. Als er starb, hinterließ er diese Geschichte und Glover seinem Sohn, und der wiederum seinem Sohn. Sie alle hießen Kulfi.« Amah klapperte mit den Töpfen. Sie schrubbte mit einer Verbissenheit, als ob sie damit die Schrecken der Vergangenheit auslöschen könnte.
Bei ihr wusste keiner so genau, was Märchen und was eine wahre Geschichte war.
Kapitel 3
Etwa zur gleichen Zeit als Amah ihre Töpfe polierte, schlich Bagha lautlos durch das Unterholz der indischen Wälder. Keiner wäre auf die Idee gekommen, dass in diesem gestreiften Fell einer der großen Magier Indiens steckte. Keiner außer Anand, der hier in den Bergen eine Pfefferfarm betrieb.
Bald hatte Bagha sein Ziel erreicht. In aller Ruhe beobachtete er Anand.
»Wie lange dauert denn das noch?«, brummte dieser. Seine Katze strich ihm um die Beine. Die Erntehelferinnen kicherten, während er zappelnd darauf wartete, dass sie die schweren Körbe auf ihre Köpfe hievten.
»Unglaublich, was die Zeit vertrödeln können.«
Baghas Ohren zuckten belustigt. Er blinzelte gegen die untergehende Sonne. In Kürze würde sie hinter den Felsen verschwinden. Knapp eine Viertelstunde später war es dunkel. Er wusste so gut wie Anand, dass dies keine gute Zeit war, um ungeschützt im Freien zu sein.
Anand hätte ihn mit dem Zweig, an dem er bisher genagt hatte, berühren können, so nahe hatte sich Bagha herangeschlichen. Doch Anand bemerkte ihn nicht. Stattdessen wedelte er mit dem Zweig, als ob er eine Schar Gänse vor sich hertreiben wollte.
»Elendes Geschnatter.«
Bei jedem Schritt, wehten die bunten Saris um die Beine der Mädchen. Es waren Soliga – Ureinwohner. Schönheiten! Hier dicht bei den Wolken, in den indischen Bergen, lebten sie unter Adlern wie Königinnen.
Bagha folgte ihnen in Zeitlupe. Seine Schwanzspitze zuckte. Schönheiten? Nicht für Anand, den krummen Hund.
»Um nichts besser als diese verflixten Elefanten! Saublöde Viecher!«, maulte der ›krumme Hund‹ Genannte jetzt.
Wieder einmal, hatten die Dickhäuter das Tor zu Anands Farm eingetreten. Danach war die Herde seelenruhig den Weg zum Teich gestapft.
»Hundert Jahre alter Trampelpfad? Das ist mein Teich! Stur, stur, stur!«, hörte Bagha ihn grummeln.
Die zierlichen, nackten Füße der Mädchen berührten kaum den Boden.
»Acchi Sham – Guten Abend!«, zwitscherte eine nach der anderen, während sie durch das verbogene Tor schlüpften. Danach stemmte Anand seine Schulter dagegen. Er war klein. Krummbeinig. Er fluchte leise. Immer wieder warf er sein ganzes Gewicht gegen das schwere Eisen.
Baghas Schnauze kräuselte sich.
Als der Riegel endlich ins Schloss glitt, war es bereits stockdunkel.
Anand hastete nicht nur, nein, er rannte zurück zum Haus. Hinter ihm wirbelten die Blätter auf. Ein Eulenschwalm verfehlte knapp seinen Kopf. Der Vogel schrie sein »Hey du«, bevor er ins Dickicht flatterte.
»Hey du mich auch …«, fauchte Anand dem Vogel nach.
Der Tiger schloss seine goldgelben Augen.
Anands Schlüssel klapperten auf der Suche nach dem Schlüsselloch. Als die Türe hinter ihm ins Schloss fiel, kroch Bagha näher. Durch das vergitterte Fenster hatte er Anand fest im Blick.
Der goss sich ein Glas Wasser ein, trank es in einem Zug aus, schenkte nach und seufzte laut; »Ich werde doch nicht alt? Was ist denn los mit mir?«
Die Mädchen hatten nicht nur geerntet, sondern auch Reis und Linsencurry gekocht. Der krumme Hund drehte den Reis zu mundgerechten Bällchen. Abwechselnd verschwand ein Bällchen, dann ein Löffel Curry in seinem Mund. Zwischendurch gab’s einen Schluck Wasser.
»Ich bin ein weiser Mann. Ich kann lesen, schreiben, sogar rechnen«, schmatzte er und schniefte, »… Gottgefällig!«
Baghas Barthaare zitterten. Er schmunzelte. Diese Rede kannte er. Leise äffte er Anand nach.
»Ich muss ja niemandem auf die Nase binden, wie heilfroh ich bin, dass die Götter sich in ihre Tempel zurückgezogen haben. Nicht wie früher, als jedes verflixte Dorf behaupten konnte, dass ein Gott in irgendeiner Gestalt gerade dort ein Wunder vollbracht, es von einem Dämon oder einem Teufel befreit hatte.«
Anand rührte in seinen Linsen. »Dämon! Als ob diese Einfaltspinsel wüssten, was ein Dämon ist. Nein, und nochmals Nein! Götter haben nicht herumzustreunen. Sie haben eine einzige Aufgabe – Wünsche zu erfüllen.«
Bagha wusste, jetzt sollte ein »Khattamm!« folgen, was so viel hieß wie »… und Schluss!«
Doch heute blieb Anand sein Reisbällchen im Hals stecken. Er schnappte nach Luft. Er räusperte sich. Schließlich röchelte er, als ob er am Ertrinken wäre.
Seine Katze war mit ohrenbetäubendem Gekreisch durch das Gitter des Fensters geschossen. Ihr Schwanz glich den Borsten einer Flaschenbürste. Wild pfauchte sie die Finsternis vor dem Fenster an. Auch Anands Haare hatten sich aufgestellt.
Bagha gab seine Deckung auf. »Ich wette auf deinen süßen Hintern, dass dir das gerade nicht gefallen hat, du selbstgefälliges Dummchen«, lachte er. Das klang, als ob jemand in ein Blechrohr hustete.
Die Katze hatte ihren 120 Kilo schweren Verwandten erst im letzten Augenblick bemerkt und war mit einem zirkusreifen Salto geflüchtet.
»Ist schon recht. Fürchte dich nur«, kicherte Bagha.
Anand war den Reis in seinem Hals losgeworden. Er brüllte, »Hast du noch nicht genug? Glaubst du, ich weiß nicht, dass du dich da draußen herumtreibst. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ein für alle Mal, ich habe nichts, hörst du, nichts damit zu tun.«
Bagha grunzte laut. Dann strich er um das Haus und pieselte in aller Ruhe an die Hausecken und Büsche.
»Nur zur Erinnerung! Angsthasen!«, grinste er, bevor er sich auf den Weg zu seinem eigentlichen Ziel machte.
***
Lautlos folgte Bagha einem lautstarken Keuchen. Dem Bandicoot, bereitete der Anstieg zum Tempel sichtlich Schwierigkeiten.
Sacht setzte er eine Pfote auf dessen Rücken. »Huckepack gefällig?«
»BAGHA!« quietschte das Bandicoot. »Altes Schlitzohr! Musst du dich immer so anschleichen? Jedes Mal erschrecke ich fast zu Tode. Willst du, dass mich der Schlag trifft?«
»Anschleichen? Ich?« kicherte Bagha. Wer kämpft sich denn hier durch den Dschungel wie ein altes Dampfross, liebe Mrs. Scoot? Kein Wunder, dass du mich nicht hören kannst. Na komm schon: Sei friedlich! Huckepack?«
Einen Augenblick später, schaukelte ein rundliches Fellbündel auf Baghas Rücken wie auf einem Elefanten.
»Sag mal, weißt du, warum wir uns so beeilen sollen? Was wird das – das jährliche Treffen, der längst nicht mehr großen Magier?«
»Keine Ahnung. Aber, wenn Jadoo meint, es wäre dringend, ist es das wohl«, seufzte Bagha.
»Das will ich auch hoffen. Mehr als einmal im Jahr klettere ich die zweihundertachtundfünfzig Stufen sicher nicht hinauf.«
»Darum wiegst du auch so viel wie ein kleiner Sandsack, meine Gute.«
»Hast du gerade etwas Unhöfliches gesagt? Du bist doch auch nicht mehr der Schnellste, oder?«
Baghas Lachen kam so unerwartet, dass Mrs. Scoot fast heruntergepurzelt wäre.
Der Tempel thronte auf dem höchsten Gipfel der umliegenden Berge, die zum Teil zweitausend Meter hoch in den Himmel wuchsen. Die vielen Steinstufen mussten Pilger erklimmen, um den Göttern ihre Wünsche vorzutragen. Doch jetzt um diese Zeit war der Tempel leer. Fast.
Müde wedelte der Tempeljunge mit seinem Reisbesen über die noch sonnenwarmen Steinplatten.
Bagha kauerte auf einem Dachvorsprung und lauschte den Gedanken des Jungen.
Der konnte es kaum erwarten, dass der letzte Priester ging. Dann wurde das schwere Holztor geschlossen. Die Öllampen würden bis zum Morgen brennen. Und er würde sich blitzartig auf seine dünne Matratze fallen lassen. Obwohl … vielleicht könnte er heute doch wieder die Glöckchen läuten. Streng verboten. Der Priester, wenn er es hörte, würde ihm morgen mit dem Besen eine überziehen. Aber das war es wert.
Im Gehen strich der Junge über die Wand mit ihren in Stein gemeißelten Menschen. Manche saßen im Kreis um ein Feuer. Andere schleppten ein Reh. Wieder andere versteckten sich hinter einem Busch. Hinter ihnen öffnete sich der Eingang zu einer Höhle, in der er den Kopf einer riesigen Schlange sah. Diese Menschen erzählten eine Geschichte. Doch niemand, auch kein Priester, wollte ihm sagen, welche. Nun ja, er hatte Zeit. Irgendwann würde er schon erfahren, was die Steine erzählten.
Schwere Säulen stützten die Granitbalken rund um den Tempelhof. Auf ihnen ruhte das Dach der schattigen Laubengänge. Untertags beteten oder schliefen hier die Pilger. Darüber erhob sich eine weitere Galerie. Hierher durften nur die Priester.
Als der Junge eingeschlafen war und Stille im Tempel herrschte, bewegte sich etwas, das wie eine Riesenfledermaus aussah. Mit dem Kopf nach unten, hing sie von einem Balken der oberen Galerie. Über dem weißen Hemd trug sie einen bestickten Rock und einen eleganten Umhang.
Dieses Etwas fischte nach einer Taschenuhr, klopfte daran und hielt es an sein Ohr. Schließlich streckte es einen Arm vor und blinzelte auf das Zifferblatt.
»Nur zu deiner Information«, sagte der Tiger, »wir sind nicht zu spät. Und du bist blind wie eine Fledermaus. Du brauchst also gar nicht auf die Uhr zu schauen.«
»Flugfuchs! Wie oft muss ich es noch sagen!«, seufzte Jadoo, der Magier. Wenn er nicht seine menschliche Gestalt innehatte, sah sein Kopf so fellig aus wie der eines Fuchses. Schwarze Knopfaugen. Spitze, durchsichtige Ohren. Manchmal, so wie jetzt, war er halb Mensch, halb Flugfuchs. »Es ist nicht zu fassen. Flugfuchs! F-l-u-g-f-u-c-h-s! Was ist denn daran so schwer zu merken? Hmm? Außerdem ist kurzsichtig noch lange nicht blind. Merk dir das.«
»Wo sind denn die Würstchen?« Mrs. Scoot schnüffelte in die Abendluft. »Du hast Würstchen, ich weiß es. Versuch erst gar nicht zu schwindeln.«
»Nix da Würstchen. Konzentrier dich! Es geht um ALLES. Deswegen habe ich euch zu mir gerufen.«
»Wozu das Drama? Wir sind ja schon da. Was gibt’s?«
Jadoo hüstelte. Er zögerte. Schließlich sagte er: »Das Junge kommt nach Indien!«
»Das Junge? Wovon redest du? Welches Junge? Könntest du bitte nicht in Rätseln sprechen«, murrte Bagha.
Mrs. Scoot seufzte hörbar. »Könnte es sein, dass du Chira meinst?«
Für einen langen Moment herrschte Stille.
»Chira? Wie kommst du ausgerechnet auf Chira?«, Baghas Nackenhaare hatten sich gesträubt. Sein Fell zuckte. Er schüttelte sich. Er setzte mehrmals zu einer Antwort an. Dann grollte er, dass die Säulen erbebten.
»Sag, dass das nicht dein Ernst ist. Du hast sie hergeholt? Obwohl du weißt, wie gefährlich das ist?«
»Was soll ich denn sonst tun? Außerdem ist sie noch gar nicht hier«, wehrte Jadoo ab.
»Wenn ich richtig rechne, sind die dreihundert Jahre bald um. Das ist unsere letzte Chance«, warf Mrs. Scoot ein.
»Letzte Chance? Na und? Wie wär’s, wenn wir uns einfach damit abfinden, dass wir machtlose Magier geworden sind! Wir kommen an den Dolch nicht heran. Ein Murmeltier im Winter hat mehr Energie als wir«, seufzte Bagha.
»Du willst das Feld also Orankor überlassen? Der gibt nicht auf – das versichere ich dir. « Jadoo saß nun mit überkreuzten Beinen auf den warmen Steinplatten.
»Orankor? Der wird auch immer schwächer.« Bagha atmete heftig.
»Dafür umso grausamer und listiger. Das was ihn antreibt ist eine unbändige Wut. Genau was uns fehlt.«
»Macht doch was ihr wollt. Ich spiel da nicht mit.«
Damit verschwand Bagha. Lautlos.
Kapitel 4
Tagelang schien die Sonne, nur gelegentlich unterbrach ein kurzer Regenschauer die frühen Brüsseler Sommertage. In wenigen Wochen begannen die großen Ferien. Freiheit für Chira und Frederik. Ein dichter Teppich blau-purpurner Hasenglöckchen bedeckte den Waldboden des Hallerbos und verwandelte ihn in einen Märchenwald. Für dieses Jahr hatte Chira genug gelernt. Keine Prüfungen mehr. Jetzt kam die beste Zeit des Schuljahres. Preisverleihungen, Picknicks und die jährliche Science Fair, in der die Schüler ihre wissenschaftlichen Projekte vorstellten.
Wochenlang züchtete Chira Kartoffeln in einer großen finsteren Schuhschachtel. Deren Triebe mussten sich durch ein Labyrinth von Kartonstreifen zur einzigen Lichtquelle am Ende schlängeln. Ein kleines Loch. Damit bewies Chira, wie klug Pflanzen waren. Sie rochen das Licht.
Chira fand das unendlich langweilig.
Im Vorjahr hatte sie mit Frederiks Hilfe zwei Kröten gefangen und in einem alten Aquarium untergebracht. Am Boden, unter einer Glasplatte, sperrte sie Fliegen ein. Die Kröten entdeckten die fetten Brummer. Mit wilden Sprüngen gingen sie auf die Jagd. Doch an die Fliegen kamen sie nicht heran. Schließlich waren sie so gereizt, dass sie sich am Finger einer unvorsichtigen Lehrerin festbissen.
Im Jahr davor hatte Chira mühselig einen funktionierenden Vulkan gebaut. Mit allem Drum und Dran. Die Experimente ihrer Tischnachbarn waren dem nicht gewachsen. Sie brannten ab.
»Dieses Jahr will ich keinen Ärger«, hatte Maman geseufzt. Also entschied sich Chira für etwas Harmloses. Pflanzen konnten weder Feuer speien noch beißen. Hoffte sie wenigstens. Aber ganz tief drinnen dachte sie: Ist das langweilig! Kann mich bitte jemand erschießen?
Jetzt saß sie mit baumelnden Beinen auf Frederiks Werkbank. Um sie herum lagen die Teile seines zerlegten Mopeds. Mit gerunzelter Stirn nagte sie am Ende ihres langen Zopfes. Dabei las sie in einem zerfledderten Heft, das sie gelegentlich in alle Richtungen drehte: Moped-Reparatur-Anleitungen. Von Zeit zu Zeit schob sie sich den alten grauen Nachttopf, den sie wie einen Helm trug, aus der Stirn. Er war viel zu groß und rutschte immer wieder über ihre Augen. Auch die Hosenträger ihrer Latzhose hatten sich selbstständig gemacht. Mit dem Heft in der Hand suchte sie auf dem Tisch nach dem richtigen Teil.
»Das? Bist du sicher, Kitty?« Frederik betrachtete das Stück, das sie ihm reichte, als ob er es noch nie zuvor gesehen hätte. Frederiks Hund Bertie, ein borstiger grauer Riesenschnauzer, hob den Kopf und wackelte mit seinem Schwanzstummel. Also eigentlich wackelte der ganze Hund von der Körpermitte bis zu seinem Schwanzstummel.
»Klar doch. Nun mach schon!«, drängte Chira. Nur Frederik durfte sie Kitty nennen. Und das auch nur, wenn sie alleine waren.
Mit dem Moped trug Frederik früh morgens die Milch vom Hof seines Vaters aus. Es machte einen Höllenlärm. Mit dem Geknatter weckte er die gesamte Nachbarschaft. Die Kunden hatten schon gedroht, sich einen anderen Lieferanten zu suchen.
Aber das Ding, wie Chira das Moped nannte, widersetzte sich standhaft Frederiks Versuchen, es in ein leises Fahrzeug zu verwandeln.
»Das gibt’s doch nicht!«, schimpfte er, kratzte sich am Kopf und versetzte dem Ding einen Tritt. Aber je mehr er sich in den Ratgeber vertiefte, desto verwirrter wurde er.
Hier musste Chira helfen. Sie war zwölf, seine beste Freundin und klug.
»Zu klug«, sagte Frederiks Vater. Obwohl er Chira kannte, seit sie wenige Monate alt war, juckte ihn der Gegensatz zu seinem sommersprossigen Sohn mit dem wuscheligen blonden Schopf. Wenn Chira neben Frederik saß, fiel ihm der Unterschied noch mehr auf; lange dunkle Haare und eine Haut … ja also diese Haut: So sieht doch nur ein Brathuhn aus, dachte er. In den Jahren seines Soldatenlebens in Afrika hatte er Menschen mit tiefschwarzer Hautfarbe kennengelernt. Aber in dieses Bild passte Chira nicht. Wenn sie ihn mit ihren dunkelgrauen Augen musterte, wurde selbst einer alten Bulldogge wie ihm schummerig.
»Ist dir in letzter Zeit an Chira etwas aufgefallen?«, hatte er Frederik gefragt.
»Nö, was meinst du?«
»Na ja, findest du nicht, dass sie … ich meine … sie spricht schon viel mit Tieren, oder?«
»Du vielleicht nicht? Also ich schon. Oder sagt dir Bertie etwa nicht, wenn er Hunger hat?«
Janik wusste es nicht. Er hatte Zweifel. Vor lauter Zweifel juckte seine Nase. Ein schlechtes Zeichen.
Frederik bewunderte Chira. Er selbst hatte es nicht so mit der Schule. »Das, was mich interessiert, kann ich lesen. Es fragt mich ja keiner, wie lang ich dazu brauche, und du bist ja auch noch da!«, meinte er stets mit einem spitzbübischen Grinsen.
Einige Stunden später stand das Moped glänzend vor der Werkstatt. Frederik schwang sich auf sein Ding. Er startete es. Das Moped schnurrte wie ein Kätzchen. Er fuhr eine Runde und kam triumphierend zurück. Das Ding schnurrte immer noch. Kein Lärm. Kein Knattern. Ein Traum.
Jetzt war der Moment gekommen, auf den Chira gewartet hatte. »Und?« fragte sie. »Das Buch?«
Frederiks Augen glänzten. »Das Buch, meinst du?« Dann fügte er schmunzelnd hinzu: »Fertig! Großartige Geschichte! Fast noch besser als Amahs Geschichte neulich.«
Chira strahlte. Ein Jahr lang hatte sie mit Frederik geübt. Sie war stolz auf ihn. Sie war stolz auf sich selbst. Jules Verne wäre es auch gewesen. Frederik hatte zum ersten Mal freiwillig ein Buch gelesen: 20.000 Meilen unter dem Meer. Ganze sechshundertvierzig Seiten.
»Wir könnten ja …«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Frederik grinste.
»Das habe ich mir schon gedacht.« Er hatte eine Überraschung für seine Freundin. Die zog er jetzt unter der Werkbank hervor.
Chira lachte. »Perfekt!« Wenig später stand Kapitän Nemo, also Chira, auf dem Deck seines Schiffes. Ein Segel hatte Chiras Baumhaus kurzerhand in die Nautilus verwandelt. Frederik protestierte: »Die Nautilus ist ein Unterseeboot. So was hat keine Segel«. »Hat es doch. Es muss nämlich Luft holen, wie ein Wal. Und dann braucht es Segel«, knurrte Chira.
Einem Kapitän wurde nicht widersprochen. Das war Meuterei. Und Meuterer mussten selbstverständlich sterben. Zumindest gehörten sie bestraft.
Frederik flüchtete. Er versteckte sich hinter dem Mast. Dort wäre sein schlaksiger Körper tatsächlich fast verschwunden, wenn er nicht glucksend und kichernd den Kopf herausgestreckt hätte. Chira kniff die Augen zusammen. Mit ihrem Degen, einem alten Holzschwert aus Frederiks Werkstatt, jagte sie den Bösewicht. Sehr viel Platz war dafür nicht. Frederik kam ihr zuvor. Mit einem eleganten Satz sprang er über die Reling des segelnden Unterseebootes mitten ins Meer. Der Rasen war dafür gut genug. Wie ein Ertrinkender schlug er dort wild um sich. Er sah aus wie ein Käfer auf dem Rücken.
»Lach nicht!«, beschwerte er sich. »Ich kämpfe mit den Wellen.«
Da kam das Untier auch schon angerast. Ein Hai. Er umkreiste den Meuterer mit einem für Fische ganz untypischen Bellen. Frederik wälzte sich mit dem Tier, dem das auch noch zu gefallen schien, im Gras. Dann starb er einen würdigen Piratentod; Ketchup-blutig. Allerdings begleitete er seinen Tod mit spitzen Schreien. Sogar die Streifenhörnchen hoch oben auf der Rotbuche hielten inne und sahen dem Schauspiel gebannt zu. Es hätte ein wunderbarer Nachmittag werden können, wenn nicht …
Ja, wenn nicht Chiras Maman genau in diesem Augenblick nach Hause gekommen wäre. Ausgerechnet jetzt! Sie hörte Frederiks Schreie und stürzte in den Garten.
Zuerst sah sie nur das, was sie offenbar für Blut hielt. Entsetzt kniete sie sich neben den Jungen. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, legte sie ihm ihre schöne Jacke unter den Kopf.
»Chira, bist du verrückt geworden? Wie kannst du lachen? Komm sofort herunter und hilf mir«, rief sie.
Inzwischen gab sich Frederik größte Mühe, zu Ende zu sterben. Danach lag er mucksmäuschenstill auf dem Rücken und versuchte, nicht zu blinzeln.
Spätestens jetzt musste Maman doch merken, dass Frederiks Blut ungewöhnlich klebrig war. Aber da zitterten und rauschten die Büsche von Neuem. Es regnete Blüten und Äste. Der borstige Hai stürzte sich nun auf Maman. Völlig überrascht verlor sie das Gleichgewicht und fiel neben Frederik auf den Rücken. Um sie herum und über sie drüber tollte japsend Bertie. Sabbernd vor Freude schleckte er ihr Gesicht. Mamans kurzärmelige weiße Bluse glich in kürzester Zeit einem Tarnanzug.
Das blutrünstige Tier, aufgepeppt mit einer Haiflosse auf dem Rücken und Blüten im grauen Fell, hatte verdächtige Ähnlichkeit mit einem überglücklichen Riesenschnauzer.
Frederik öffnete die Augen und grinste. Die Haiflosse war ihm richtig gut gelungen.
Für beide Kinder war’s das dann. Wieder einmal. Hausarrest!
»Erwachsene sind echt komisch«, murrte Frederik. So wie die Post Päckchen verlor, verloren sie irgendwann, irgendwo ihren Sinn für Spaß und Freude.
Chiras Maman wirkte erschöpft. Seitdem Papa gestorben war, hatte sie wieder zu arbeiten begonnen. Sie reiste viel. Chira wusste, wie erfolgreich Maman verhandeln konnte. Nicht nur Amah verehrte Maman. Auch Handwerker, die sie um zwei Köpfe überragten, fraßen ihr geradezu aus der Hand. Chira fragte sich, ob es nicht gerade daran lag, dass Maman so zart und zerbrechlich schien und mit ihrem blonden Lockenkopf immer noch wie ein junges Mädchen aussah.
Doch Maman war zäh. Das große efeubewachsene Haus und den Garten mit seinen alten Bäumen aufzugeben, kam für sie nicht in Frage. In beiden steckten zu viele sonnige Erinnerungen, sagte sie.
Und Madame Amélie Picot war stur wie ein Maulesel, wenn es darum ging, wie sich Mädchen ihrer Meinung nach zu verhalten hatten.
»Kannst du dich nicht einmal wie ein ganz normales Mädchen benehmen«, schalt sie nun. »Noch so ein Blödsinn, und du kommst ins Internat.«
Chira hatte eine ungefähre Ahnung, was normale Mädchen taten. In ihrem Kasten verstaubten bunte Kleider, die Maman jedes Jahr anschleppte und die sich Chira hartnäckig weigerte gegen ihre geliebten Latzhosen einzutauschen. Was sonst noch? Kekse backen?
Dass sie Klassenbeste war und jedes Jahr ein Stipendium für die teure internationale Schule bekam, zählte das etwa nichts?
***
Das folgende Wochenende musste Chira bei Mrs. Ross verbringen.
»Kein Blödsinn mehr«, hatte Maman gesagt.
Mrs. Ross war die Direktorin der internationalen Schule in Brüssel, kurz ISB. Sie führte die Schule mit typisch britischem Verständnis: Ordnung, Fairness, viel Sport, unzähligen Wahlfächern und einem unerschütterlichen Glauben an die Förderung des winzigsten Talents und des beschränktesten Geistes. Sie und Maman kannten sich gut. Falsch! Die beiden kannten sich nicht nur gut, sie waren Freundinnen. Einfach peinlich!
Ihr Mann, Mr. Ross, bereits in Pension und hauptberuflich nur noch mit seinem preisgekrönten Border-Collie Arthur beschäftigt, gluckste vor Freude, als Chira aus dem Wagen stieg. »Willkommen, meine kleine Schachpartnerin. Was für eine Überraschung! Wollen wir gleich? Bleibst du übers Wochenende? Ross, du liebes altes Ross, habe ich das dir zu verdanken?«
»Nichts hast du mir zu verdanken, sie geht sofort hinauf ins Gästezimmer und bleibt dort«, erwiderte Mrs. Ross, während sie den Kofferraum ihres alten Fords ausräumte; Einkäufe, Schulaufgaben, Hundefutter. Sie entdeckte einen von Arthurs Bällen zwischen den Körben und warf ihn in Richtung der Buchsbäumchen, die die Einfahrt säumten. Arthur schnüffelte dem Ball kurz nach. Normalerweise hätte er sich mit Begeisterung darauf gestürzt. Heute hatte er Wichtigeres zu tun.
Mr. Ross legte einen Arm um Chiras Schultern. Ohne auf die Worte seiner Frau zu achten, sagte er schmunzelnd: »Das überlegen wir uns noch. Nicht wahr?«. Für einen kurzen Augenblick, hatte er die dicke Zigarre aus dem Mund genommen und die Asche in das Gebüsch geschnipst.
Arthur, der dermaßen mit dem Schwanz wedelte, dass er fast umfiel begann mit: »Hör mal …«
Chira kraulte ihn geistesabwesend hinter den Ohren. Ein kleines Zwicken in ihre Ferse – Arthur war ein Hütehund, er kannte sich aus bei Schafen – und sie sagte: »Du bist aber heute lästig. Lass dich anschauen. Was bist du denn so grün um die Schnauze?«
Als ob ein Hund grüngesichtig sein könnte, dachte Arthur genervt.
»Ich hab‹ Bauchweh, und jucken tut es auch. Kannst du denen das nicht sagen?«, bettelte er. Gleichzeitig rutschte er mit seinem Hinterteil über den Vorzimmerteppich, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
Chira verkündete: »Arthur hat Würmer!«
»Hat er nicht!«, empörte sich Mr. Ross. »Ross, du hast doch den Hund entwurmt?« Diesmal hatte er seine Zigarre fest im Mundwinkel eingeklemmt.
»Ich? Ist das vielleicht mein Hund? Fährt der mit mir zum Spezialisten nach Paris? Erste Klasse? Im teuren Hochgeschwindigkeitszug? Nur weil du meinst, er schaue etwas betrübt drein. Während ich mir mit gebrochener Hand ein Taxi nehmen muss. Ich glaube nicht. Also entwurm ihn gefälligst selbst.«
Mr. Ross war ganz aus dem Häuschen. »Du meinst wirklich, Chira Schätzchen? Würmer?«
»Ganz bestimmt!«
Arthur lächelte dankbar. Er lächelte tatsächlich. Er zog die Lefzen hoch und fletschte die Zähne.
»Ross, wo sind die Wurmtabletten?«, rief Mr. Ross über die Schulter. Er hatte noch nicht einmal daran gedacht, seiner Frau die Taschen abzunehmen. Er kramte in den Küchenschubladen. Die Brille saß auf seiner Stirn.
Mrs. Ross atmete tief ein. Sie verdrehte diesmal nicht die Augen. Schließlich waren sie nicht alleine.
Arthur bekam seine Tabletten. Danach legte er sich auf Chiras Füße. Mr. Ross starrte nachdenklich auf das Schachbrett. Er rieb sein stoppeliges Kinn. Von wegen Hausarrest im Gästezimmer. Er und seine junge Freundin verbrachten das gesamte Wochenende vor dem Schachbrett. Von Zeit zu Zeit wurden sie von Arthurs lautem Rülpsen und den Stinkbomben, die er genussvoll seinem Hinterteil entströmen ließ, unterbrochen. Die Wurmtabletten wirkten.
Ohne vom Schachbrett aufzusehen, meinte Mr. Ross: »Arthur! Benimm dich!«
Chira beobachtete die Rauchwolken und die Asche, die Mr. Ross verstreute.
Er konnte Chira beim Schach nichts mehr beibringen. Im Gegenteil. Er hatte sie im Verdacht, dass sie ihn gewinnen ließ. Um sie abzulenken, ließ er sich den Grund für ihren Besuch erklären.
»Wie schade, dass ich nicht dabei war … ein Hai, sagst du? Genial!«
Chira vermied es, an Maman zu denken. Sie vermied es überhaupt, an irgendetwas zu denken. Doch das gelang ihr nicht.
Sie war immer noch die Kleinste in ihrer Klasse, mit Schuhgröße einundvierzig! Peinlicher ging es kaum. Ihr widerspenstiger dunkler Zopf reichte ihr bis zum Po. Sie hatte Hamsterbacken und einen Speckpolster, der einem Robbenbaby alle Ehre gemacht hätte. Und einige ihrer Schulkameraden verziehen ihr nicht, dass sie Klassenbeste war, regelmäßig, in allen Fächern, außer Musik und Turnen.
»In-di-scher Fett-mops. In-di-scher Fett-mops«, sangen Marie und Hélène, sobald sie sicher waren, dass Mr. Bruce, der Klassenlehrer, sie nicht hören konnte.
Wenigstens trag ich kein so lächerliches Ding – Büstenhalter – ha! dachte Chira schaudernd, als sie zu Bett ging. Ein Kontrollblick in den Spiegel. Da war nichts. Alles flach. Pott-hässlich! Chiras Spiegelbild zog eine Grimasse.
Im Bett verschränkte sie die Arme hinterm Kopf und starrte an die Decke.
Sie stellte sich vor, sie wäre in Indien. Indien, das Land ihrer leiblichen Eltern. Was waren das für Menschen, die ihr Kind in eine fremde Welt schickten? Warum hatten ihre Eltern das getan?
Sicher, weil ich ein Mädchen bin. Mädchen waren in Indien nichts wert, hatte Chira gelesen. Sie hatte überhaupt alles gelesen, was es über Indien zu wissen gab.
»Vielleicht waren es arme Menschen«, hatte Amah vorgeschlagen. Doch Chira wusste, dass es nicht daran liegen konnte.
Von wegen Wilde, erinnerte sie sich.
»Eines Tages werde ich dich finden«, sagte sie zu der Mutter, die sie nie gekannt hatte. »Eines Tages wirst du mir erklären müssen, warum ich nicht bei dir aufwachsen durfte.«
Wie jeden Abend schlief sie mit dem Gedanken an ihre indischen Eltern ein.
Kapitel 5
Die neue Woche begann Chira mit dem festen Vorsatz, ein ganz normales Mädchen zu sein. Was immer das sein sollte. Dass Maman daran dachte, sie wegzugeben, sie ins Internat zu schicken, flößte ihr Angst ein.
Doch es kam anders.
Bereits am Mittwoch gondelte sie in einer Badewanne Richtung Schule. Über ihr schwebte ein schillernder Baldachin smaragdgrüner Buchenblätter. Die verbliebenen Regentropfen funkelten wie Kristalle in der Sonne. Die Badewanne schaukelte auf der Ladefläche von Frederiks Anhänger. Vielmehr sie rutschte. Ihre massigen Löwenfüße quietschten auf dem schlüpfrigen Boden. Die mitreisenden Ferkel quietschten ebenfalls; aufgeregt, erwartungsvoll.
Normalerweise dauerte die Fahrt vom Hof bis zur nächsten Weide nur kurz. Jetzt ruckelten sie bereits seit einer halben Stunde von einem Ende Brüssels zum anderen.
»Ausgerechnet heute!«, seufzte Chira. Ausgerechnet heute musste der Schulbus ausfallen. Ausgerechnet heute, wo sie nicht zu spät kommen durfte und Maman wieder einmal nicht zu Hause war. Sie sah auf die Uhr und seufzte noch einmal.
Frederik fuhr den Traktor mitsamt dem Anhänger, der Badewanne und den Ferkeln auf einer Bundestraße durch den Forêt de Soignes. Führerschein hatte er keinen.
Ihm kam es gar nicht in den Sinn, Kitty im Stich zu lassen. Er war schließlich schon vierzehn; ein Mann! Gelegentlich wenigstens. Und von einem der Außenbezirke, die die Stadt in einem großen Ring umgaben, in einen anderen zu fahren, war ja nun wirklich keine Kunst.
»Wie weit ist es denn noch?«, fragten die Ferkel. Chira tat so, als hätte sie nichts gehört. Dass sie die Sprache der Tiere verstand, verdrängte sie, so gut es ging. Es war nicht nur lästig, es war so wie vieles andere auch – peinlich! Trotzdem spottete sie mit perfekt verstellter Stimme: »Wie weit ist es denn noch?«
Frederik fragte über die Schulter: »Ist was Kitty?«
»Nein, nein, alles in Ordnung.«
Den Ferkeln gelang es, das Ende von Chiras Zopf zu erwischen. Sie zogen daran. Chira zog dagegen. Sie fauchte: »Beruhigt Euch. Wir sind fast da.«
Die Ferkel beruhigten sich nicht. Zumindest nicht genug.
Die Brüsseler internationale Schule lag im Park eines Schlösschens auf einem Hügel. Früher musste dies ein dichter Wald gewesen sein, so sagte zumindest der französische Name Boitsfort. Während die umliegenden Teiche reich an Fischen waren, denn die Flamen nannten diesen Teil Watermaal.
Der Pförtner an der Einfahrt kam beim Anblick des Traktors ungehalten aus seinem Häuschen. Abweisend wedelte er mit beiden Armen. Frederik musste anhalten, doch Chira streckte ihren Kopf über den Rand der Wanne und rief dem Pförtner zu: »Bonjour, Monsieur Joseph, c’est moi. Wie geht es Ihrem Hund?«
»Aaah, Mademoiselle Chira, Sie sind’s. Meinem Hund? Hervorragend! Sie haben sein Leben gerettet. Ohne Sie wäre er an den Knöpfen erstickt. Der arme Kerl.«
Ohne zu zögern, lief er zurück zu seinem Häuschen. Der Balken ging hoch.
»Geht doch«, triumphierte Chira.
Spätestens hier hätte Frederik auf seine innere Stimme hören sollen. Stattdessen schüttelte er den Kopf: »Knöpfe? Was für Knöpfe?«
Der Traktor tuckerte mitsamt dem Anhänger auf der steilen Auffahrt zum kleinen Kasteel Te Bolaer, dem Zentrum der Schule. Er hatte die Kurven bis zum großen Parkplatz fast geschafft. Fast! Der Motor stotterte.
»Das gibt’s doch nicht! Komm schon …« Frederik gab Gas. Ein Ruck. Die Ferkel schlitterten in ein Eck. Die Badewanne stieß heftig gegen die Ladeklappe. Chira seufzte. Noch ein Ruck. Frederik beschimpfte seinen Traktor mit Worten, die ein Vierzehnjähriger nicht benutzen sollte. Ein Ruck. Ein Stoß.
Die Ladeklappe des Anhängers hatte es satt, von der Badewanne geboxt zu werden. Sie klappte scheppernd herunter.
Einen Augenblick lang passierte gar nichts.
Chira versuchte, der Wanne zu entkommen. Zu spät! Die Badewanne verlor den Halt. Chira klammerte sich fest. Die Wanne kippte von der Ladefläche auf die noch regennasse Straße. Dort warf sie als Erstes ihre Vorderbeine ab.
Frederik kamen die Tränen, als er die abgebrochenen Löwenfüße sah, die er gerade erst repariert hatte. Gleich darauf folgten die Hinterfüße. Auf dem Bauch, funkensprühend, gewann sie an Fahrt.
Die schwarze Limousine, die ihr entgegenkam, war wie immer viel zu schnell. Die Badewanne pfiff direkt auf sie zu. Hinter der Windschutzscheibe starrte der Chauffeur auf das Geschoss wie ein aus der Winterruhe aufgeschreckter Dachs. Sein Schnurrbart – Marke graue Bürste – stellte sich auf.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















