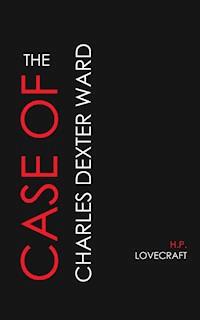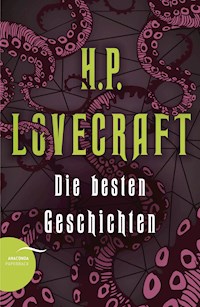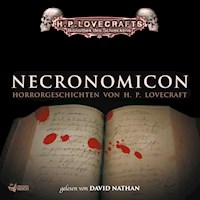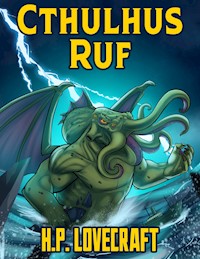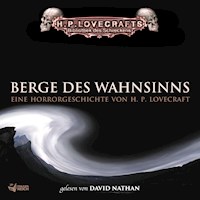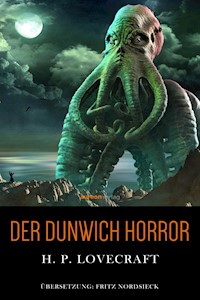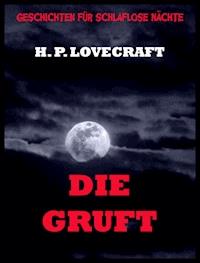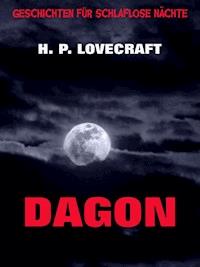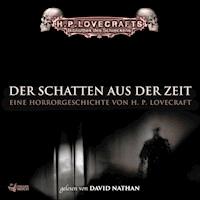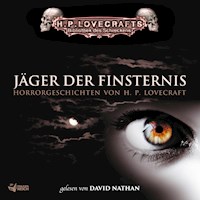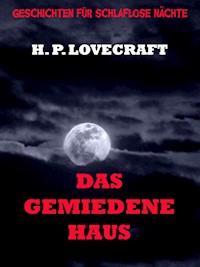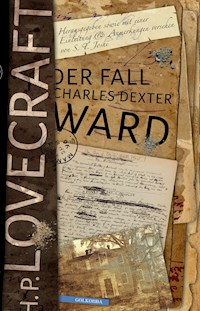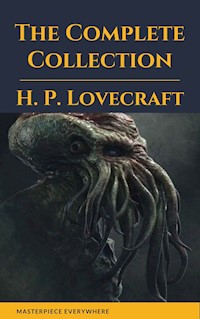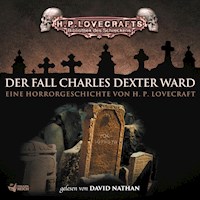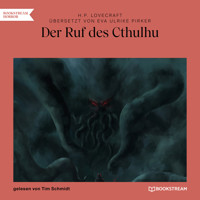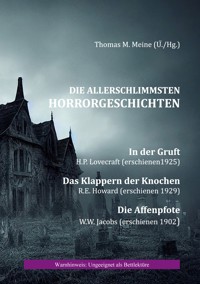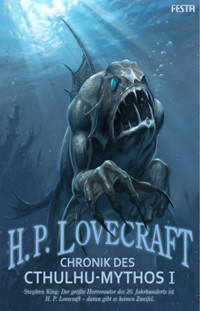
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stephen King: "Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft – daran gibt es keinen Zweifel." Diese Chronik in zwei Bänden vereint erstmals die vollständigen Werke Lovecrafts zum Cthulhu-Mythos – neben allen Kurzgeschichten auch die berühmten Novellen wie BERGE DES WAHNSINNS, DER SCHATTEN ÜBER INNSMOUTH oder DER FALL CHARLES DEXTER WARD. Mit einer Einleitung und ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Werken von Dr. Marco Frenschkowski. Clive Barker: "Lovecrafts Werk bildet die Grundlage des modernen Horrors." Markus Heitz: "Die zahlreichen Geschichten rund um den Cthulhu-Mythos beinhalten für mich bis heute enorme Kraft und Wirkung." Michel Houellebecq: "Wir beginnen gerade erst, Lovecrafts Werk richtig einzuordnen, auf gleicher Ebene oder sogar höher als das von Edgar Allan Poe. Auf jeden Fall als ein absolut einzigartiges." Michael Chabon: "BERGE DES WAHNSINNS ist eine der großartigsten Novellen der Amerikanischen Literatur. Durch sie habe ich erstmals begriffen, welche Wirkung Literatur haben kann." Eine Festa Originalausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Band I
Mit einem Vorwort und Erläuterungen
von Marco Frenschkowski
Vorwort
H. P. Lovecrafts »Cthulhu-Mythos« ist ein stabiler Baustein der fantastischen Welten des 20. und 21. Jahrhunderts. Zwar stammt dieser Begriff nicht vom Autor selbst, und er wirft auch einige Probleme auf: Cthulhu ist keineswegs die Zentralgestalt der Lovecraftschen Mythen, und überhaupt lässt sich nur begrenzt von einer zusammenhängenden Mythologie sprechen, als wäre diese ein kohärentes gedankliches System oder auch nur ein festes Figureninventar. Es lässt sich aber doch sofort sehen, was damit gemeint ist, wenn wir also etwas vage und in Ermangelung eines besseren Begriffs vom »Cthulhu-Mythos« sprechen. Im Schatten der Erzählungen H. P. Lovecrafts ist eine ganze Literatur entstanden, die ihre typischen Konstanten hat. Nicht nur tauchen bestimmte Dämonen, Götter, verbotene Bücher, böse Kulte, halbmenschliche Zwischenwesen, änigmatische Orte und monströse Ereignisse immer wieder auf. Das ist sozusagen nur die Außenseite, und viele Autoren haben nur diese Außenseite nachgeahmt. Der eigentliche Charme der Erzählungen Lovecrafts liegt aber in ihrer Leidenschaft, das Einbrechen von etwas Fremdem, Mythischem, Unheimlichem, Gewaltigem, Grausigem in eine vertraute, »nahe« Lebenswelt zu schildern. Das gelingt ihm oft besser als allen seinen Nachahmern, und das ist die »Innenseite« des Cthulhu-Mythos.
Die mythischen Züge in den Erzählungen dieses Bandes sind kein bloßes Beiwerk und schon gar keine beliebig verwendbaren Versatzstücke: Sie sind Bausteine eines ästhetischen Universums, einer Welt, die sich von anderen literarischen Welten radikal unterscheidet. Die Lovecraftsche Mythologie ist ein autarkes System, das durchaus mit Imaginationen wie der Tolkien-Welt oder der Star Trek-Welt verglichen werden kann. Allerdings ist Lovecrafts Mythologie keine Fantasy und auch keine SF, und viel weniger um Kohärenz bemüht. Das unterscheidet sie (wohltuend, würden manche sagen) von den zahlreichen Tolkien-Epigonen, die sich darin üben, Zwergen-, Elben- und Zauberernamen zu erfinden und diese in immer neuen Konflikten zwischen imaginativen Völkern mit wenig divergierenden Besonderheiten anzusiedeln. Insbesondere: Fantasy will im Anderen, im Fremden, das Eigene entdecken. Die Konflikte der Fantasy drehen sich letztlich genauso wie die der menschlichen Welt um Liebe, Erfolg, Erwachsenwerden, Konkurrenz, Macht, Ruhm und Ehre, Sex, Tod, die Themen des Menschseins. Die »Fremdheit« einer Fantasywelt ist in gewisser Hinsicht eine Maske: wir tragen diese Maske, um das Eigene verfremdet wiederzufinden und (vielleicht) neu sehen zu lernen. Fantasy kann große Literatur sein, aber sie ist etwas völlig anderes als das, was bei Lovecraft geschieht (obwohl Lovecraft auch einige Geschichten geschrieben hat, die stärkere Berührungen zur Fantasy haben, aber um diese geht es in diesem Band nicht).
Die artifiziellen Mythologien Lovecrafts haben eine völlig andere Absicht und entspannen eine völlig andere Ästhetik. Ihr Thema ist der Kosmos in seiner Fremdheit, das Abgründige als das, was der Mensch in seinen vertrauten Denkkategorien nicht begreifen kann, das Unheimliche als das Gegenteil des Heimeligen und Vertrauten. Darum kann der »Cthulhu-Mythos« gerade nicht kohärent sein, sondern besteht wesentlich in Anspielungen, die seine ästhetische Funktion prägen. Lovecrafts düstere, szientistische, an menschlichen Beziehungen und ihren Verwicklungen gänzlich uninteressierte (daher z. B. auch unerotische) Kunst spricht andere Teile unserer Persönlichkeit an als es Fantasy oder auch Mainstreamliteratur tut, und sie spricht vielleicht auch andere Menschen an. Lovecraft ist ein Autor unheimlicher Fantastik – genauer gesagt: Er ist für viele der Autor des Unheimlichen. Stephen King hat einmal gesagt, nach Lovecraft gäbe es in diesem Genre nur zwei Arten von Autoren: solche, die versuchten, zu schreiben wie HPL (wie ihn Amerikaner gerne abkürzen), also ihn nachzuahmen, und solche, die versuchten, nicht wie er zu schreiben. Es gab an Auflagenhöhe erfolgreichere unheimliche Autoren im 20. Jahrhundert – aber keinen, der in einem solchem Maße wie Lovecraft zu einer fast selbstverständlichen Referenzgröße des Genres geworden ist. Der Cthulhu-Mythos ist dabei eine wichtige Facette in seinem Werk.
Dabei ist Lovecraft kein Schriftsteller unserer unmittelbaren Gegenwart. 1890 in Neuengland geboren, hat er dort auch (bis auf zwei Jahre in New York) fast sein ganzes Leben verbracht und ist 1937 gestorben. Seine literarischen Ideale lagen im 18. Jahrhundert (nicht etwa im 19.), was für heutige Lesegewohnheiten befremdlich ist. Sein Markt waren die Pulpzeitschriften der amerikanischen Unterhaltungsliteratur, mit denen er einen ständigen Kampf um literarische Standards führte und die seine Geschichten gerne gnadenlos »modernisiert« und gekürzt hätten. Glücklicherweise hat Lovecraft aber auf die Wünsche seines Publikums keinerlei Rücksicht genommen, und ist so zum großen Klassiker des Unheimlichen im 20. Jahrhundert geworden, so wie es Edgar Allan Poe im 19. Jahrhundert war. Gerade als »erratischer Block«, als Fremdkörper in der Literatur, wurde Lovecraft nicht nur interessant, sondern auch zur bleibenden Herausforderung.
Und die bekannteste Spielart der Lovecraftschen Geschichten sind nun jene, die mit unserem etwas vagen Begriff »Cthulhu-Mythos« genannt wurden. Sie sind vielfach vernetzt: Tatsächlich hat man gesagt, dass alle Erzählungen des Cthulhu-Mythos als Kapitel eines einzigen großen Romans gelesen werden könnten. Vor allem aber sind sie verbunden durch ihre Leidenschaft für das Dunkle, Grausige, ihre Neugier.
Lovecrafts Stil ist wegen seiner Liebe für klingende Adjektive oft gerügt worden, aber er ist doch von erheblicher erzählerischer Raffinesse, vor allem in Hinsicht auf seine Erzählperspektive. Seine Ich-Erzähler (1. Person Singular ist häufig) wehren sich gegen ihre eigene Erkenntnis: Sie versuchen sozusagen noch einige Zeit, sich etwas vorzumachen, ehe sie von ihrer eigenen Erkenntnis des Schrecklichen überwältigt werden. Auch Erzählungen, die in 3. Person Singular geschrieben sind, setzen diesen Prozess der zögernden Einsicht um. Ein weiteres Stilmittel ist die Mehrdimensionalität des Unheimlichen: In der »Story« verbergen sich zahlreichen Andeutungen, die noch sehr viel Weitergehendes suggerieren als tatsächlich erzählt wird. Auf diese Feinheiten wird man oft erst bei einem zweiten und dritten Lesen aufmerksam.
Ist Lovecrafts Mythologie religiös? Sie ist es natürlich nicht in einem flachen und offensichtlichen Sinn. Lovecrafts Universum hat keinen guten Gott (und auch keinen bösen, denn Azathoth ist etwas anderes). Dennoch ist Lovecrafts Leidenschaft für das »Ganze«, für die Stellung des Menschen im Kosmos (ohne jeden New-Age-Kitsch) im Kern religiös, wie schon seinen Zeitgenossen auffiel und wie es etwa sein Freund Robert Bloch deutlich ausgedrückt hat. Daneben tritt die Verfremdung vieler traditioneller Motive. Robert M. Price hat schon vor Langem darauf hingewiesen, dass Lovecrafts »Götter« eigentlich Aliens sind. Man könnte Lovecraft insofern auch irgendwie in der Ahnenreihe der Präastronautik verordnen, etwa im Sinn eines Charles Hoy Fort (1874–1932), dessen Bücher er jedoch erst ab März 1927 kennenlernte. Allerdings hat er diese Ideen nur als literarische Vehikel benutzt und sich immer energisch von denen losgesagt, die ihm etwa okkulte oder fantastische Weltbilder unterstellen wollten: In seinem persönlichen Denken war Lovecraft dem wissenschaftlichen Positivismus und Historismus des 19. Jahrhunderts verpflichtet, zugleich den neuen Entdeckungen am Beginn des 20. (Relativitätstheorie u.ä.), die er mit Faszination zur Kenntnis nahm, und lehnte jedes metaphysische Weltbild ab. In religiösen Fragen war er Atheist (kein Agnostiker).
Lovecrafts »Große Alte« und »Tiefe Wesen« (und wie sie sonst noch heißen) sind in diesem Sinn wirkliche »aliens« – völlig fremd, anders, sie sprengen die Grenzen dessen, was mit menschlicher Sprache ausgedrückt werden kann (das wird vielleicht am deutlichsten in ›The Colour Out of Space‹). Und so brechen sie in die heimelige Welt des vertrauten Neuengland ein. Diese zeichnet Lovecraft mit liebevollen Details und absoluter Realitätsnähe (z. B. existieren die meisten in Lovecrafts Erzählungen genannten Häuser wirklich). Dieser Kontrast zwischen »Nähe« und »Ferne«, »Vertrautem« und »Anderem« macht Lovecraft zu einem kosmischen Regionalschriftsteller, wenn wir eine paradoxe Begrifflichkeit wagen dürfen. Lovecrafts Obsession (bis zur Monomanie) ist Erkenntnis (nicht einfach Wissen). Seine Helden sind keine Actionfiguren, sondern Forscher, die mit einer unbezähmbaren Neugier selbst ihr eigenes Verderben in Kauf nehmen, um das Unbekannte zu erkunden. Dabei sind sie aber zugleich oft hilflos, ja eigentümlich gelähmt angesichts des Schrecklichen, das sie miterleben. In diesen Figuren spiegelt sich auch etwas von Lovecrafts Persönlichkeit. Dennoch passiert nicht wenig in diesen Geschichten, und Spannung ist ihnen nicht abzusprechen. Die Spannung kommt aber nicht aus menschlichen Beziehungsproblemen (die allenfalls am Rande eine Rolle spielen), sondern aus der Begegnung mit dem Fremden, Unerklärlichen, dem Grausigen und Monströsen.
In einem seiner zahlreichen Gedichte (eine zweisprachige kommentierte Gesamtausgabe ist 2008–2011 bei Edition Fantasia erschienen) schreibt Lovecraft:
»Can seeing intellect contented lie
Within the confines of our tiny race,
When overhead yawns wide the starry sky
Pregnant with secrets of unfathom´d space?«
(Phaëton, 1918).
Das ist sozusagen der Gestus, die Grundhaltung der Lovecraftschen Erzählungen. Durch den Schrecken hindurch meldet sich die Neugier zu Wort, und hinter dem Abscheulichen steht die Faszination, hinter dem Grauen das Staunen.
Die Vorworte zu den Einzeltexten im vorliegenden Band erschienen zuerst in der von mir, Joachim Körber und Uli Kohnle 1999–2001 herausgegebenen und inzwischen vergriffenen kommentierten Gesamtausgabe der Erzählungen Lovecrafts (Band 1–5 der mittlerweile 13 Bände umfassenden »großen« Gesamtausgabe Lovecrafts, von der weitere Bände in Planung sind). Sie wurden jedoch für diese Ausgabe überarbeitet und zum Teil erheblich verbessert, auch im Licht der explosiv weiterwachsenden Lovecraftforschung der USA. Ihr Zweck ist dabei nicht unbedingt wissenschaftlicher Art: Sie wollen nicht eine scheinbare literaturwissenschaftliche Objektivität erzeugen oder Ähnliches, sondern das Vergnügen an den Geschichten, die Lust an ihrer Welt durch konkrete Hintergrundinformationen vertiefen.
Marco Frenschkowski
Januar 2011
Vorwort zu »Dagon«
Mitte 1917 war Lovecraft allmählich literarisch erwachsen geworden. Einen bürgerlichen Brotberuf hatte er nicht (und sollte ihn nie haben), aber aus der Lethargie seiner späten Jugend war er erwacht, hatte in der Welt des Amateurjournalismus viele Freunde gefunden (Menschen, die nicht für Geld, sondern nur um eines literarischen Ideals willen schrieben; der damals übliche Begriff »Amateure« ist insofern irreführend). Vor allem: Lovecraft hatte sein Thema gefunden: das Unheimliche, das Schreckliche. Freilich befindet er sich stilistisch noch in einer Phase des Experimentierens. E. A. Poe ist sein großes Vorbild (in der folgenden Erzählung noch deutlich zu spüren), aber er hat auch bereits Mut zu Eigenem.
Die Erzählung ›Dagon‹ wurde wohl im Juli 1917 niedergeschrieben, mitten im 1. Weltkrieg, den Lovecraft aus der Distanz seines geliebten Neuengland wahrnahm (gerne wäre er Soldat geworden). Einige Vorkenntnisse sind wie immer bei Lovecraft erforderlich, um die Geschichte mit Verständnis lesen zu können. Dagon ist eine Gestalt des Alten Testaments, ein Gott der Philister (vor allem 1. Sam. 5; 1. Chron. 10). Da der Name an das hebräische Wort für »Fisch« anklingt (dag), wurde dieser Gott bei den Kirchenvätern gerne als fischgestaltig angesehen (in Wahrheit kommt der Name allerdings von einem kanaanäischen Wort dagan »Getreide«). Ein Gott der Meerestiefen, selbst fischgestaltig und mit einem Kult, der seit Urzeiten tot ist – das hat Lovecrafts Fantasie beschäftigt.
›Dagon‹ gilt mit Recht als ein frühes kleines Meisterwerk. Später hat Lovecraft in mehreren Essays einige Ideen dieser Geschichte verteidigt, z. B. den leblosen, monotonen Charakter des Ozeanbodens (im Gegensatz zum Boden in Küstennähe), sowie die Möglichkeit, dass große Landmassen unter dem Meer versinken und auch wieder auftauchen können (also das Atlantismotiv). Da Lovecraft meist keine sehr hohe Meinung vom Wert seiner Texte hatte und sein eigener schärfster Kritiker war, ist diese Verteidigung von ›Dagon‹ gegen Angriffe von Gegnern auffällig.
Im wichtigsten dieser Essays (›In Defense of Dagon‹, 1921) schreibt Lovecraft u. a.: »Die Romantik beruft sich auf das Gefühl, der Realismus auf den reinen Verstand; aber beide ignorieren die Imagination, welche isolierte Eindrücke in prachtvolle Muster webt und seltsame Beziehungen und Assoziationen zwischen den Objekten der sichtbaren und unsichtbaren Natur findet. Die Fantasie existiert, um die Bedürfnisse der Imagination zu befriedigen, aber da Imagination so viel seltener ist als Emotion und analytischer Verstand, folgt es von selbst, dass dieser literarische Typ wenig verbreitet ist und nur wenige anspricht. Imaginative Künstler gab es nur wenige und sie haben nie Anerkennung gefunden. Blake wird schmerzlich unterschätzt. Poe wäre nie verstanden worden, hätten sich nicht die Franzosen die Mühe gemacht, ihn aufzuwerten und zu interpretieren. Dunsany wurde nichts als Kälte oder lauwarmes Lob entgegengebracht. Und neun von zehn Menschen haben nicht einmal gehört von Ambrose Bierce, dem größten Erzähler, den Amerika – abgesehen von Poe – je besaß. Der imaginative Schriftsteller widmet sich der Kunst in ihrem essenziellen Sinn. Es ist nicht sein Geschäft, eine hübsche Kleinigkeit für Kinder zu produzieren, eine nützliche Moral aufzuzeigen, oberflächlich »erhebendes« Zeug für den verspäteten Viktorianer zusammenzubrauen oder unlösbare menschliche Probleme didaktisch aufzuwärmen. Er ist ein Maler der Stimmungen und Bilder des Geistes – die sich entziehenden Träume und Fantasien fängt er ein und baut er aus – er ist ein Reisender in jene unbekannten Länder, die nur selten durch den Schleier des Tatsächlichen hindurch erblickt werden, und nur von dem wahrhaft Empfänglichen. [...] Er kann alle Stimmungen aufnehmen, seien sie licht oder dunkel. »Gesundheit« und »Nützlichkeit« sind ihm fremde Worte. Er spiegelt die Strahlen, die auf ihn fallen, fragt aber nicht nach ihrem Ursprung. Er ist nicht »praktisch« – armer Kerl – und manchmal stirbt er in Armut; schließlich leben alle seine Freunde in der Stadt des Niemals [»city of never«] im Land des Sonnenuntergangs, oder in den antiken Felsentempeln von Mykenae oder den Höhlen und Katakomben von Ägypten und Meroë. [...] Nun liegt es mir fern, mich selbst für einen solchen imaginativen Künstler zu halten. Es ist mein Privileg, aus dem Abgrund der Mittelmäßigkeit heraus zu bewundern, und im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten nachzuahmen. Doch kann das, was ich über imaginative Literatur gesagt habe, erklären, was ich mühsam und mit wenig Erfolg zu erreichen versuche.« Diese Sätze sind Lovecrafts Poetologie in nuce. Sie zeigen, wie reflektiert er als Erzähler vorging.
›Dagon‹ erschien zuerst in der kleinen Zeitschrift The Vagrant, November 1919, dann in Weird Tales, Oktober 1923 (und noch einmal Januar 1936). Das Thema der unheimlichen Meerestiefen hat Lovecraft wenig später in ›The Temple‹ und anderen Geschichten wieder aufgenommen, auch solchen des Cthulhu Mythos (vor allen in ›The Call of Cthulhu‹ selbst, weiter unten in diesem Band).
Man kann die Geschichte wenn man will als suizidale, kulturkritische Fantasie lesen: Aus dem Meer, aus der »Tiefe« kommt etwas, das das normale Leben als nicht mehr möglich erscheinen lässt. Für uns aber ist sie ein kreativer Beginn für die Entfaltung einer eigenen Mythologie, die sich dann freilich in ganz anderen Bahnen entwickelte. Das wird etwa bei einem Vergleich mit ›The Call of Cthulhu‹ deutlich. Die Tiefe des Meeres ist natürlich auch ein Symbolraum: ein Ort, an dem die Gesetze der menschlichen Zivilisation nicht gelten, wo uns das »ganz andere« begegnen kann, zugleich ein Sinnbild für die »trockengelegten« Tiefen und Abgründe der Seele. Und genau davon handelt ›Dagon‹.
Dagon
Ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung, denn heute Nacht werde ich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ohne einen Penny und am Ende des Vorrats der Droge, welche allein mein Leben erträglich macht, kann ich die Pein nicht länger erdulden; ich werde mich aus diesem Mansardenfenster auf die schmutzige Straße darunter stürzen. Leite aus meiner Morphiumabhängigkeit nicht ab, ich sei ein Schwächling oder degeneriert. Wenn du diese hastig hingekritzelten Seiten gelesen hast, magst du zwar erahnen, aber nie gänzlich begreifen, warum ich das Vergessen oder den Tod suchen muss.
Es war auf einer der offensten und am wenigsten befahrenen Stellen des weiten Pazifik, dass der Dampfer, für den ich als Frachtaufseher verantwortlich war, einem deutschen Kaperschiff zur Beute fiel. Der Große Krieg hatte erst jüngst seinen Anfang genommen, und die Seestreitkräfte der Deutschen waren noch nicht so völlig aufgerieben, wie sie es später sein sollten; daher wurde unser Schiff als rechtmäßige Beute betrachtet, während wir von der Mannschaft mit all dem Anstand und der Rücksicht behandelt wurden, die uns als kriegsgefangenen Matrosen zustand. Tatsächlich war die Aufsicht unserer Wächter so großzügig, dass es mir fünf Tage nach unserer Gefangennahme gelang zu entkommen – allein in einem kleinen Boot, das versehen war mit Wasser und Vorräten für eine geraume Zeit.
Als ich endlich frei und Wind und Wellen ausgesetzt war, hatte ich nur eine vage Ahnung von meiner Position. Ich bin nie ein fähiger Navigator gewesen und konnte anhand des Standes von Sonne und Sternen lediglich ungefähr feststellen, dass ich mich südlich des Äquators befand. Von Längengraden verstand ich nichts, und keine Insel und kein Küstenstreifen waren in Sicht. Das Wetter blieb gut, und ungezählte Tage trieb ich ziellos unter der brennenden Sonne umher und wartete darauf, dass entweder ein Schiff käme oder ich an die Küste eines bewohnten Landes getrieben würde. Doch weder Schiff noch Land tauchten auf, und ich begann an meiner Einsamkeit auf der wogenden Weite ungebrochenen Blaus zu verzweifeln.
Die Änderung trat ein, während ich schlief. Die Einzelheiten werde ich nie kennen, denn mein Schlummer war zwar unruhig und geplagt von Träumen, wurde aber dennoch nicht gestört. Als ich schließlich erwachte, bemerkte ich, dass ich in eine schleimige Fläche höllisch schwarzen Sumpflandes gesogen worden war, das sich um mich in eintönigen Wellen erstreckte, so weit mein Blick reichte, und auf dem in einiger Entfernung mein Boot gestrandet lag.
Obgleich man wohl meinen würde, meine erste Empfindung sei die des Erstaunens über eine so wundersame und unerwartete Verwandlung meiner Umgebung gewesen, war ich in Wirklichkeit eher entsetzt als verdutzt, denn in der Luft und im vermodernden Erdreich lag etwas Finsteres, das mich bis ins Mark erschaudern ließ. Die Gegend war voller verwesender Fische und anderer nicht zu beschreibender Dinge, die ich aus dem widerlichen Schlamm der unendlichen Ebene herausragen sah. Vielleicht sollte ich nicht darauf hoffen, mit bloßen Worten die unaussprechliche Scheußlichkeit vermitteln zu können, die in einer solchen absoluten Stille und Unermesslichkeit liegt. Es gab nichts zu hören, und man sah nichts außer einer gewaltigen Ausdehnung schwarzen Schleims; und doch lastete diese völlige Lautlosigkeit und die Einförmigkeit der Umgebung mit ekelerregender Furcht auf mir.
Die Sonne flammte aus einem Himmel herab, der mir in seiner wolkenlosen Grausamkeit beinahe schwarz erschien, als spiegle er den tiefschwarzen Morast unter meinen Füßen wider. Als ich in das gestrandete Boot kroch, wurde mir klar, dass nur eine Theorie meine Lage erklären konnte: Durch ein beispielloses vulkanisches Aufbäumen musste ein Teil des Meeresbodens an die Oberfläche gestiegen sein, wodurch Regionen ans Licht kamen, die seit unzähligen Jahrmillionen unter unermesslichen Wassermassen verborgen gewesen waren. So groß war die Ausdehnung des unter mir erstandenen neuen Landes, dass ich nicht das leiseste Geräusch des brandenden Meeres ausmachen konnte, so sehr ich meine Ohren auch anstrengen mochte. Ebenso wenig gab es irgendwelche Seevögel, die von den toten Wesen zehrten.
Mehrere Stunden saß ich grübelnd und brütend im Boot, das auf der Seite lag und ein wenig Schatten spendete, während die Sonne über das Himmelszelt zog. Im Laufe des Tages verlor der Boden ein wenig von seiner Klebrigkeit, und er schien in kurzer Zeit genügend zu trocknen, um sich darauf fortbewegen zu können. In jener Nacht schlief ich nur wenig, und am nächsten Tag machte ich mir ein Bündel mit Nahrung und Wasser zurecht und bereitete mich auf eine Reise über das Land vor, auf der Suche nach dem verschwundenen Meer und einer möglichen Rettung.
Am dritten Morgen fand ich den Erdboden trocken genug, um ohne Mühe darauf gehen zu können. Der Gestank der Fische trieb mich fast in den Wahnsinn, doch war ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt und ich machte mich tapfer auf, ein unbekanntes Ziel zu erreichen. Den ganzen Tag kämpfte ich mich vorwärts nach Westen, geleitet von einem weit entfernten Hügel, der sich höher als alles andere über die ausgedehnte Wüstenei erhob.
In der Nacht lagerte ich, und am folgenden Tag wanderte ich weiter in Richtung des Hügels, wenngleich dieser kaum näher zu sein schien als zu dem Zeitpunkt, da ich ihn zum ersten Mal erblickt hatte. Am vierten Abend erreichte ich den Fuß des Hügels, der sich als viel höher herausstellte, als er aus der Entfernung erschienen war, und ein dazwischen liegendes Tal grenzte ihn scharf von der übrigen Oberfläche ab. Zu müde zum Aufstieg, schlief ich im Schatten des Hügels.
Ich weiß nicht, weshalb meine Träume in jener Nacht so wild waren; doch noch ehe der abnehmende und fantastisch gekrümmte Mond sich weit über der östlichen Ebene erhoben hatte, erwachte ich in kaltem Schweiß und beschloss, nicht weiterzuschlafen. Die Visionen, die ich erlebt hatte, waren zu viel, als dass ich sie hätte erneut ertragen können. Und im Schein des Mondes erkannte ich, wie unklug es von mir gewesen war, bei Tag zu wandern. Ohne die Glut der sengenden Sonne hätte meine Reise mich weniger Kraft gekostet, und tatsächlich fühlte ich mich nun dazu bereit, den Aufstieg vorzunehmen, der mich bei Sonnenuntergang noch so abgeschreckt hatte. Ich ergriff mein Bündel und machte mich auf zum Kamm der Anhöhe.
Ich habe gesagt, dass die ungebrochene Eintönigkeit der dahinwogenden Ebene ein Quell vagen Entsetzens für mich war; doch ich glaube, mein Entsetzen war größer, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen Seite in einen unermesslichen Abgrund oder Felskrater hinabstarrte, dessen schwarze Winkel der Mond nicht erleuchten konnte, weil er noch nicht hoch genug am Himmel stand. Ich hatte das Gefühl, am Rande der Welt zu stehen und in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht zu spähen. In meinem Entsetzen erinnerte ich mich merkwürdigerweise an das Verlorene Paradies und Satans schrecklichen Aufstieg durch das ungeformte Reich der Finsternis.
Als der Mond höher am Himmel stand, konnte ich erkennen, dass die Flanken des Tales nicht ganz so senkrecht abfielen, wie ich angenommen hatte. Felsvorsprünge boten leidlich gute Fußstützen beim Abstieg, während nach ein paar Hundert Metern der Abhang allmählich weniger steil verlief. Getrieben von einem Impuls, den ich nicht näher erklären kann, kletterte ich mit viel Mühe den Fels hinunter, kam auf dem sanfteren Abhang zum Stehen und blickte in den stygischen Abgrund, wohin noch kein Licht gedrungen war.
Sogleich wurde meine Aufmerksamkeit von einem gewaltigen und einzigartigen Gegenstand auf dem gegenüberliegenden Hang gefesselt, der sich ungefähr hundert Meter vor mir steil erhob; einem Gegenstand, der im Licht des aufsteigenden Mondes weißlich schimmerte. Schon bald machte ich mir klar, dass es sich dabei lediglich um ein gigantisches Stück Stein handelte; doch seine Konturen und seine Lage konnten nicht das Werk der Natur sein. Eine nähere Betrachtung erfüllte mich mit Empfindungen, denen ich keinen Ausdruck verleihen kann, denn trotz seiner enormen Größe und seines Standortes in einem Krater, der am Boden des Meeres geklafft hatte, seit die Welt jung war, erkannte ich ohne Zweifel, dass dieser sonderbare Gegenstand ein wohlgeformter Monolith war, dessen gewaltige Masse die Kunstfertigkeit und vielleicht auch die Verehrung lebender und denkender Geschöpfe erlebt hatte.
Verwirrt und verängstigt, obschon nicht ohne den gewissen Kitzel eines Wissenschaftlers oder Archäologen zu verspüren, untersuchte ich meine Umgebung etwas näher. Der Mond, der sich nun dem Zenit näherte, schien unheimlich und lebhaft auf die sich türmenden Steilhänge, die den Abgrund umsäumten, und offenbarte, dass ein breites Gewässer über den Boden strömte, welches sich in beiden Richtungen dem Blick entzog und mir fast an den Füßen leckte, als ich auf dem Hang stand. Auf der anderen Seite des Abgrundes umspülten die kleinen Wellen den Fuß des zyklopischen Monolithen, auf dessen Oberfläche ich nun sowohl Inschriften als auch krude Skulpturen erkennen konnte. Die Schrift bestand aus hieroglyphischen Zeichen, die mir nicht bekannt waren und nichts glichen, was ich je in Büchern gesehen hatte. Zum größten Teil bestanden sie aus vereinfachten Sinnbildern des Meeres wie etwa Fischen, Aalen, Kraken, Krustentieren, Mollusken, Walen und so weiter. Einige Schriftzeichen stellten offensichtlich Meerestiere dar, die der heutigen Welt nicht bekannt sind, deren verwesende Leiber ich aber auf der aus dem Meer erstandenen Oberfläche gesehen hatte.
Es waren jedoch die gemeißelten Bildwerke, die mich am meisten in ihren Bann zogen. Über das dazwischen liegende Gewässer hinweg war wegen ihrer gewaltigen Größe eine Reihe von Flachreliefs zu sehen, deren Anblick den Neid eines Doré erregt hätte. Ich glaube, diese Dinge sollten Menschen darstellen – zumindest eine gewisse Art von Menschen, wenngleich die Geschöpfe gezeigt wurden, wie sie sich Fischen ähnlich im Wasser einer Meeresgrotte tummelten oder einen monolithischen Schrein anbeteten, der ebenfalls unter Wasser zu sein schien. Von ihren Gesichtern und Gestalten wage ich nicht, im Einzelnen zu sprechen, denn die bloße Erinnerung daran raubt mir den Verstand. Grotesk und die Fantasie eines Poe oder Bulwer übertreffend, wirkten ihre groben Umrisse verdammt menschlich, trotz der Schwimmhäute an Händen und Füßen, bestürzend großer und schwammähnlicher Lippen, glasiger, hervortretender Augen und weiterer Eigenheiten, an die ich mich nicht erinnern möchte. Merkwürdigerweise schienen sie völlig unproportioniert gegenüber dem landschaftlichen Hintergrund gemeißelt zu sein, denn eine der Kreaturen wurde bei der Tötung eines Wals gezeigt, der kaum größer als sie selbst war. Ich bemerkte also wie gesagt ihre groteske Gestalt und sonderbare Größe, doch entschied ich, es müsse sich um die fantastischen Götter eines primitiven Stammes von Fischern oder Seefahrern handeln; eines Stammes, dessen letzter Abkömmling lange vor dem ersten Ahnen des Piltdown-Menschen oder Neandertalers von der Erde verschwunden war. Voller Ehrfurcht über diesen unerwarteten Blick in eine Vergangenheit, die das Fassungsvermögen des kühnsten Anthropologen weit hinter sich ließ, stand ich sinnend da, während der Mond einen merkwürdigen Widerschein auf den stillen Kanal vor mir warf.
Dann plötzlich sah ich es. Mit nur einem leichten Schäumen des Wassers, das seinen Aufstieg an die Oberfläche kennzeichnete, glitt das Ding über dem finstren Gewässer in mein Blickfeld. Gewaltig wie Polyphemos und widerwärtig wie ein riesiges Ungeheuer aus einem Albtraum schoss es den Monolithen hoch, um den es seine gigantischen, schuppenbedeckten Arme schlang, während es sein scheußliches Haupt neigte und rhythmische Laute ausstieß. Ich glaube, in diesem Augenblick wurde ich wahnsinnig.
Von meiner panischen Flucht über Abhang und Klippe und meiner fieberhaften Reise zurück zum gestrandeten Boot weiß ich nur noch wenig. Ich glaube, ich sang sehr viel und lachte sonderbar, wenn ich nicht mehr singen konnte. Ich habe undeutliche Erinnerungen an einen großen Sturm, einige Zeit nachdem ich das Boot erreicht hatte; jedenfalls hörte ich Donnerschläge und andere Geräusche, welche die Natur nur im Zorne von sich gibt.
Als ich aus den Schatten erwachte, befand ich mich in einem Krankenhaus in San Francisco, wohin mich der Kapitän des amerikanischen Schiffes gebracht hatte, das mich in meinem Boot mitten auf dem Ozean aufgelesen hatte. In meinem Delirium habe ich viel gesprochen, aber man schenkte meinen Worten nur geringe Aufmerksamkeit. Von einer aufgetauchten Insel im Pazifik wussten meine Retter nichts, und ich erachtete es nicht für nötig, sie von etwas überzeugen zu wollen, das sie nicht glauben würden. Einmal suchte ich einen berühmten Völkerkundler auf und amüsierte ihn mit sonderbaren Fragen über Dagon, den antiken Fischgott der Philister, doch erkannte ich bald, dass er hoffnungslos konventionell geprägt war, und bedrängte ihn nicht mit weiteren Fragen.
Des Nachts, besonders wenn der Mond gekrümmt und im Abnehmen begriffen ist, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch verschaffte die Droge mir nur flüchtige Erleichterung und riss mich als hoffnungslosen Sklaven in ihre Klauen. Und nun, da ich kurz davorstehe, alldem ein Ende zu machen, habe ich einen ausführlichen Bericht zur Mahnung oder zum höhnischen Vergnügen meiner Mitmenschen geschrieben.
Ich stelle mir häufig die Frage, ob es nicht alles nur ein Schemen war – ein bloßer Fiebertraum, als ich nach meiner Flucht von dem deutschen Kriegsschiff mit einem Sonnenstich und fantasierend im offenen Boot lag. Dies frage ich mich, doch jedes Mal taucht zur Antwort eine entsetzlich lebhafte Vision auf. Ich kann nicht an die tiefe See denken, ohne über die namenlosen Dinge zu erschaudern, die vielleicht gerade in diesem Augenblick auf ihrem schleimigen Grund kriechen und zappeln, um ihre uralten Steingötzen zu verehren und ihre abscheulichen Abbilder in unterseeische Obelisken aus wasserumspültem Granit zu kratzen. Ich träume von dem Tag, da sie aus den Wogen steigen werden, um mit ihren stinkenden Krallen eine kümmerliche, vom Krieg geschwächte Menschheit hinabzureißen – dem Tag, da alles Land untergehen und der dunkle Meeresgrund inmitten eines allumfassenden Pandämoniums heraufsteigen wird.
Das Ende ist nahe. Ich höre ein Geräusch an der Tür, als drücke ein gewaltiger, glitschiger Leib dagegen. Es soll mich nicht finden. Gott, diese Hand! Das Fenster! Das Fenster!
Vorwort zu »Nyarlathotep«
Auch ›Nyarlathotep‹ (wohl im Herbst 1920 verfasst) geht auf einen Traum Lovecrafts zurück, dessen genaues Datum wir leider nicht wissen. »Der erste Abschnitt wurde niedergeschrieben, noch bevor ich völlig aufgewacht war« (Brief an Rheinhart Kleiner vom 14. Dezember 1920). Trotz dieser tiefen Verwurzelung im Unbewussten des Autors ist das Prosagedicht ›Nyarlathotep‹ eine der eindrücklichsten Parabeln Lovecrafts auf den Niedergang der Zivilisation und in vieler Hinsicht ein Schlüsseltext zu seinem Werk.
Das Vorbild des wandernden Illusionisten und Wissenschaftlers »Nyarlathotep« ist vielleicht der exzentrische kroatische Physiker Nikola Tesla (1856–1943) gewesen, auf den Lovecraft schon im Jahr 1900 aufmerksam geworden war – als Tesla behauptete, Signale einer Zivilisation vom Mars empfangen zu haben. Tesla war ein bedeutender Erfinder (u. a. des Tesla-Transformators und des Drehstrommotors; er ist in manchem der Vater des Radios), aber auch ein geschäftstüchtiger Showman, der unter anderem behauptete, »Todesstrahlen« erfunden zu haben, mit denen man die ganze Erde in Schutt und Asche legen könne. Einem kleinen Kreis ergebener Anhänger galt er zeitweise als Verkörperung einer außerirdischen Intelligenz. Man muss auch an die abstrusen elektrischen Fantasieobjekte in den oft nur wenige Minuten langen Science Fiction-Filmen der Jahre zwischen 1900 und 1920 denken, um das zeitgeschichtliche Kolorit des Textes zu verstehen, welches direkt in Lovecrafts Kindheit in Providence führt.
Interessant ist weiter, dass Lovecraft auch den Namen Nyarlathotep (der wohl ein afrikanisches Element Nyarlat- mit der bekannten ägyptischen Endung -hotep verbinden soll) zuerst in diesem Traum gehört haben will. Gedruckt zuerst United Amateur, November 1920, erschien das Prosagedicht zu Lovecrafts Lebzeiten nicht in einer Publikation mit größerer Auflage.
Die Querverbindungen zu anderen Texten Lovecrafts sind zum Teil etwas mühsam zu entdecken (vor allem zu dem Roman ›The Dream-Quest of Unknown Kadath‹ und zu dem faszinierenden Gedicht ›Nyarlathotep‹ aus dem Zyklus ›Fungi from Yuggoth‹), aber dann sehr aufschlussreich. Nyarlathotep bringt das Ende der Zivilisation durch einen Akt der Erleuchtung. Das Zerbröckeln der abendländischen Kultur (von Lovecraft in eindrücklichen Bildern eingefangen), die apokalyptische Stimmung, der Übergang zwischen »Realität« und Vision werden durch den Psychopompen Nyarlathotep schließlich zu einer Konfrontation mit der Mitte der Universums. Dort aber lebt kein sinnverheißender »Gott«, sondern das amorphe Chaos Azathoth (dessen Bedeutung in diesem Sinn dann erst in der späten Novelle ›The Haunter of the Dark‹ ganz deutlich wird).
Nyarlathotep
Nyarlathotep ... das kriechende Chaos ... Ich bin der letzte ... Ich werde es der lauschenden Leere verkünden ...
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann es begann, doch es ist Monate her. Die allgemeine Anspannung war schrecklich. Zu einer Zeit politischen, gesellschaftlichen Umbruchs trat noch eine sonderbare und lauernde Vorahnung von einer abscheulichen, fassbaren Gefahr, einer ausgedehnten und allumfassenden Gefahr, wie man sie sich nur in den schrecklichsten Nachtgespinsten vorzustellen vermag. Ich weiß noch, dass die Menschen mit bleichen, sorgenvollen Gesichtern umhergingen und Warnungen und Prophezeiungen wisperten, die niemand bewusst zu wiederholen oder sich auch nur einzugestehen traute, dass er sie überhaupt vernommen hatte. Ein ungeheuerliches Schuldgefühl lastete auf dem Land, und aus den Abgründen zwischen den Sternen tasteten eisige Ströme, die die Menschen an dunklen und einsamen Orten erschaudern ließen. Es gab eine dämonische Veränderung in der Abfolge der Jahreszeiten – die herbstliche Hitze hielt entsetzlich lange an, und alle spürten, dass die Welt und vielleicht sogar das Universum nicht länger der Kontrolle der bekannten Götter oder Mächte unterlag, sondern der von Göttern oder Mächten, die unbekannt waren.
Und das war der Zeitpunkt, als Nyarlathotep aus Ägypten kam. Wer er war, konnte niemand sagen, doch er stammte aus altem, verwurzelten Geschlecht und sah aus wie ein Pharao. Die Fellachen knieten nieder, wenn sie ihm begegneten, doch einen Grund dafür konnten sie nicht angeben. Er behauptete, aus der Finsternis von siebenundzwanzig Jahrhunderten auferstanden zu sein und dass er Botschaften von Orten vernommen habe, die nicht von dieser Welt seien. In die Länder der Zivilisation kam Nyarlathotep, dunkelhäutig, schlank und finster, und stets erwarb er seltsame Instrumente aus Glas und Metall und setzte diese zu Instrumenten zusammen, die noch seltsamer waren.
Er sprach viel von den Lehren der Elektrizität und der Psychologie und er gab öffentliche Kostproben seiner Macht, die seine Zuschauer sprachlos zurückließen und dennoch dafür sorgten, dass sein Ruhm ins Unermessliche anwuchs. Die Menschen rieten einander, sich Nyarlathotep anzusehen, und dann erschauderten sie. Und wohin Nyarlathotep auch kam, waren Ruhe und Frieden dahin, denn die frühen Morgenstunden wurden von albtraumhaften Schreien zerrissen. Niemals zuvor hatten die Schreie solcher Angstträume ein offenkundiges Problem dargestellt, doch nun wünschten die weisen Männer geradezu, sie könnten den Schlaf in den frühen Morgenstunden verbieten, damit das grausige Gekreisch der Städte den fahlen, mitleidsvollen Mond nicht mehr stören möge, wenn er auf den unter Brücken hindurchfließenden grünen Gewässern schimmert und auf alten Kirchtürmen, die vor einem blassen Himmel vor sich hin bröckeln.
Ich erinnere mich daran, als Nyarlathotep in meine Stadt kam – die große, die alte, die abscheuliche Stadt ungezählter Verbrechen. Mein Freund hatte mir von ihm erzählt, von der eindringlichen Faszination und Verlockung seiner Offenbarungen, und ich brannte vor Eifer, seine tiefsten Geheimnisse zu erkunden. Mein Freund sagte, sie seien grausiger und beeindruckender als alles, das ich mir in meinen heftigsten Fieberfantasien auch nur vorzustellen vermag. Was dann in dem verdunkelten Raum auf die Leinwand projiziert wurde, war eine Prophezeiung von Dingen, die außer Nyarlathotep alleine niemand zu verkünden wagte, und im Sprühen seiner Funken wurde von den Menschen das genommen, was nie zuvor von ihnen genommen worden war und sich nur in den Augen offenbarte. Und von überall hörte ich Andeutungen, dass diejenigen, die Nyarlathotep kennen, Dinge erblicken, die für andere unsichtbar bleiben.
Es war im heißen Herbst, dass ich mit der aufgeregten Menge durch die Nacht zog, um Nyarlathotep zu sehen – durch die stickige Nacht, eine endlose Treppe hinauf in einen Raum, in dem man kaum Luft bekam. Und als Schatten auf der Leinwand sah ich verhüllte Gestalten inmitten von Ruinen, und gelbe, bösartige Gesichter, die hinter umgestürzten Gedenksteinen hervorspähten. Und ich schaute zu, wie die Welt gegen die Finsternis focht, gegen die Wellen der Vernichtung aus dem äußersten Weltraum, wirbelnd, schäumend und kämpfend rund herum um die dunkler werdende, abkühlende Sonne. Dann begann das wundersame Funkenspiel über den Köpfen der Betrachter, und allen standen die Haare zu Berge, weil Schatten, die grotesker waren als ich sie zu beschreiben vermag, hervorströmten und sich auf die Köpfe kauerten. Und als ich, gefasster und mit mehr wissenschaftlichem Interesse als die anderen, etwas zitternd einen Protest murmelte über »Täuschung« und »statische Elektrizität«, jagte Nyarlathotep uns alle hinaus, die schwindelerregenden Stufen hinab auf die feuchten, heißen, einsamen mitternächtlichen Straßen. Ich schrie laut, dass ich keine Angst hätte, dass ich niemals Angst haben werde, und andere schrien zum Trost mit mir. Wir schworen einander, dass die Stadt nach wie vor genau dieselbe sei und immer noch lebendig; und als dann die elektrischen Lichter zu verlöschen begannen, verfluchten wir wieder und wieder die Stromgesellschaft und lachten über die merkwürdigen Grimassen, die wir dabei zogen.
Ich glaube, wir spürten, dass etwas vom grünlichen Monde herabwirkte, denn als wir uns auf sein Licht verlassen mussten, nahmen wir unwillkürlich Marschformation ein und schienen unser Ziel genau zu kennen, obwohl wir nicht einmal wagten, daran zu denken. Als wir aufs Straßenpflaster hinabschauten, bemerkten wir, dass die Steinplatten lose und vom Gras durchbrochen waren. Es war kaum noch eine rostige Eisenschiene zu finden, die den Verlauf der Straßenbahn anzeigte. Und dann wieder sahen wir einen Straßenbahnwagen, einsam, ohne Fensterscheiben, verfallen, beinahe auf der Seite liegend. Als wir zum Horizont spähten, konnten wir den dritten Turm am Fluss nicht finden, und stellten fest, dass die Silhouette des zweiten Turmes oben an der Spitze zerfetzt war. Wir formierten uns jetzt zu schmalen Gruppen, von denen jede anscheinend in eine andere Richtung gezerrt wurde. Eine verschwand links in einer engen Gasse, hinterließ bloß den Widerhall eines entsetzlichen Stöhnens. Eine zweite marschierte in den von Unkraut überwucherten Eingang zu einer U-Bahn-Station hinein und heulte mit irrem Lachen.
Mein eigener Trupp wurde aufs offene Land hinausgetrieben, und schon bald verspürte ich ein Frösteln, das nicht von dieser heißen Herbstnacht verursacht wurde, denn während wir ins dunkle Moor hineinschritten, zeigte sich um uns her das höllische Mondglitzern des unheilvollen Schnees. Unberührter, rätselhafter Schnee, der nur in eine Richtung geweht wurde, hin zu einer Schlucht, die durch die sie umgebenden glitzernden Wände in noch tieferes Schwarz getaucht wurde. Der so kümmerlich wirkende Trupp trottete schlafwandlerisch in diese Schlucht hinein. Ich zögerte, blieb zurück, denn der schwarze Spalt in dem grün beleuchteten Schnee jagte mir grässliche Angst ein und ich glaubte, das Echo eines beunruhigenden Klagens zu hören, als meine Begleiter verschwanden. Meine Widerstandskraft war jedoch gering. Als hätten mich die, die vorangegangen waren, weitergelockt, schwebte ich geradezu zwischen den gewaltigen Schneedriften umher, zitternd und voller Furcht, immer weiter in den lichtlosen Strudel des Unvorstellbaren.
Schreiendes Bewusstsein, fiebernder Stumpfsinn – nur die Götter, die dort verweilten, können es erklären. Ein ausgemergelter, empfindsamer Schatten ringelt sich in Händen, die keine Hände sind, wirbelt blindlings vorbei an grausigen Mitternächten verwesender Schöpfung, die Leichen toter Welten, bedeckt mit Geschwüren, die einstmals Städte gewesen sind. Leichenhauswinde, die an den bleichen Sternen entlangstreifen und sie flackern lassen. Hinter den Welten undeutliche Spukgestalten monströser Dinge: halb sichtbare Säulen von lästerlichen Tempeln, die auf unbeschreiblichen Felsen unter dem All ruhen und hinaufreichen bis in den schwindelerregenden luftleeren Raum über den Sphären von Licht und Finsternis. Und durch dieses widerwärtige Grab des Universums dröhnt das gedämpfte, in den Wahnsinn treibende Schlagen von Trommeln und das dünne, monotone Wimmern blasphemischer Flöten aus unfassbaren, unerleuchteten Kammern jenseits der Zeit. Zu diesem abscheulichen Getrommel und Gepfeife tanzen langsam, unbeholfen und grotesk die gigantischen, düsteren, allerletzten Götter der blinden, stummen, blöden Scheusale, deren Seele Nyarlathotep ist.
Vorwort zu »Stadt ohne Namen« (The Nameless City)
Diese auf einem Traum Lovecrafts beruhende Erzählung stammt vom Januar 1921 und erschien noch im November des gleichen Jahres in der amateurjournalistischen Zeitschrift The Wolverine 11 (danach erst wieder 1936 in den halbprofessionellen Fanciful Tales 1/1; mehrere große Magazine hatten den Text abgelehnt). Einöden, Wüsten, leere Räume haben es Lovecraft immer angetan. Sie sind Gegenpole zur heimeligen, überschaubaren Welt der Zivilisation. Der »Epikuräer des Schreckens« (ein Begriff aus Lovecrafts Erzählung ›The Picture in the House‹), den Lovecraft immer ganz autobiografisch nach seinen eigenen Interessen und Vorlieben gestaltet, sucht in der Einöde des südlichen Arabien die Konfrontation mit dem dunklen Geheimnis, mit den Relikten einer anderen Welt, die dem Menschen die Relativität seiner Standpunkte und Werte vor Augen führt. Der Erzähler ist hier, wie fast immer bei Lovecraft, ein Einzelgänger, ein Suchender, der mehr findet, als er gesucht hat, und den Preis seines verbotenen Wissens zahlen muss. Autobiografische Bezüge liegen wie gesagt auf der Hand, obwohl Lovecraft sich große Reisen nie leisten konnte (nur in den USA und Kanada ging er, wann immer er konnte, auf Spurensuche nach der Vergangenheit).
Die extremen Unwahrscheinlichkeiten und Inkonsequenzen von ›The Nameless City‹ werden nur verständlich, wenn der fundamentale Traumcharakter der Geschichte in Erinnerung bleibt. Von den arabischen Überlieferungen über untergangene Städte wusste Lovecraft einmal aus den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, die ihm seit seiner frühesten Kindheit vertraut waren, aber auch aus den vielen Nachschlagewerken, die er sammelte, so namentlich seiner geerbten 24-bändigen Encyclopaedia Britannica (9. Aufl., Chicago 1896), einer wichtigen Quelle seiner mannigfaltigen Bildung. In seinem literarischen Notizbuch (›Commonplace Book‹) hat sich Lovecraft lange Passagen über das vorislamische Arabien und seine Geschichte abgeschrieben. Von Irem (eigentlich südarabisch Iram), der Stadt der Säulen, redet schon der Koran (Sura 89, 6); bei den arabischen Historikern (Masudi, IV, 88ff. ed. C. Barbier de Meynard etc.) wird ihr Geschick dann ausführlich erzählt: Ihr König wollte eine Stadt bauen, die schöner als das Paradies sei; eben Irem. Dieses – Inbegriff menschlicher Hybris – aber wird von einem Sandsturm völlig vernichtet. Die »namenlose Stadt« selbst ist nun aber nicht dieses Irem der arabischen Sage, sondern ein prähistorischer, auch von der Sage vergessener Ort, wo vielleicht schon (wie die Geschichte erzählt) die Bewohner Irems namenlosem Grauen gegenüberstanden. Lovecraft bemüht sich also, die Örtlichkeiten der Sage und des Mythos an Fremdartigkeit und Alter noch einmal zu transzendieren (man beachte auch die evokative Funktion der Namenlosigkeit).
Zwar ist die Idee, in einer Ruinenstadt in der Wüste hätten archaische Monstren überlebt, in den Pulp-Magazinen sehr verbreitet – so greifen Edmond Hamilton, in ›The Monster-God of Mamurth‹ (Weird Tales, August 1926), oder Clark Ashton Smith, ›The Vaults of Yoh-Vombis‹ (Weird Tales, Mai 1932) diese Idee wenig später auf –, aber Lovecraft schafft daraus etwas sehr Eigenes, nicht zuletzt durch eine unerreichte sprachliche Verdichtung und Sublimierung, die das Interesse des Lesers ganz auf die Atmosphäre und die Fremdartigkeit der reptilischen Überlebenden unter dem Boden der Wüstenstadt lenkt (was dabei aus dem menschlichen Beobachter wird, ist geradezu gleichgültig).
›The Nameless City‹ enthält eine ganze Reihe von literarischen Anspielungen, die hier nicht vollständig erklärt werden können. Die ›Image du Monde‹ ist ein realer altfranzösischer Text des 13. Jahrhunderts. Das Gleiche gilt für den spätantiken oder frühbyzantinischen Damascius (der aber mit dem großen Neuplatoniker gleichen Namens wohl nicht identisch ist: deshalb bei Lovecraft »apokryph«), welcher dem Vernehmen nach Bücher »Über Wunderbare Geschichten«, »Über Dämonen«, »Über Totenerscheinungen« und »Über rätselhafte Erscheinungen« schrieb (nichts davon ist erhalten). Hauptquelle für diesen Mirabilienautor (sc. Sammler kurioser und rätselhafter Geschichten) ist die sogenannte Bibliothek des Patriarchen Photios, Codex 130 (von Lovecraft in seinem ›Commonplace Book‹, Nr. 121 zitiert).
Die Worte Lord Dunsanys entstammen dem Schlusssatz einer Erzählung dieses großen irischen Fantastikautors ›The Probable Adventure of the Three Literary Men‹ (in: The Book of Wonder, 1912). Die Lektüre dieser Geschichte soll den Traum Lovecrafts ausgelöst haben, dem sich ›The Nameless City‹ verdankt, wie der Autor mehrfach Freunden geschrieben hat.
Die rätselhaften Sätze über Afrasiab (König von Turan), der mit dämonischen Begleitern den Oxus (den heutigen Amu-Darja) hinabtreibt, stammen aus Edgar Allan Poes Kurzgeschichte ›The Premature Burial‹ sowie letztlich aus Firdausis Shahname (dem persischen Nationalepos). Und so weiter ...
Das Verifizieren von Lovecrafts Anspielungen hat sich zu einer eigenen kleinen Wissenschaft entwickelt, die sich in einer reichen Sekundärliteratur niedergeschlagen hat. Eine ganz eigene Karriere sollte der Zweizeiler »That is not dead which can eternal lie / And with strange aeons even death may die« des »verrückten Arabers Abdul Alhazred« machen. Diesen Namen hatte ein Freund der Familie Lovecraft gegeben, als dieser in kindlichem Alter die Märchen aus Tausendundeiner Nacht nachspielte; man sieht den Zug augenzwinkernder Autobiografie. Korrektes Arabisch ist das übrigens nicht; der Name müsste Abd al-Hazred oder Abdul Hazred heißen. Doch Lovecraft hatte nur oberflächliche Kenntnisse der Sprache. Von dem legendären Buch, welchem diese Zeilen entstammen (dem Necronomicon), ist dann zuerst in ›The Hound‹ die Rede.
›The Nameless City‹ bleibt interessant als Keimzelle späterer und größerer literarischer Schöpfungen Lovecrafts, wobei vor allem an den Roman ›At the Mountains of Madness‹ zu denken ist. Für Lovecrafts hier erst im Entstehen begriffene Mythologie bleibt wichtig, dass diese nicht nur Wesen, sondern auch Orte umfasst, mythische Räume, die keineswegs alle in der Ferne liegen, sondern im Gegenteil meistens vor der Haustür des Autors. Aber diesen mythischen Orten werden wir in diesem Band noch ausführlich begegnen.
Stadt ohne Namen
Als ich mich der Stadt ohne Namen näherte, wusste ich, dass sie verflucht ist. Ich reiste im Mondschein durch ein ausgedörrtes und grässliches Tal, und in der Ferne sah ich die Stadt schaurig aus den Dünen ragen, so, wie Leichenteile aus einem hastig geschaufelten Grab ragen mögen. Die zeitzerfressenen Steine dieser altersbleichen Überlebenden der Sintflut, dieser Ururahnin der ältesten der Pyramiden, verhießen Furcht – und eine unsichtbare Aura stieß mich ab und gebot mir, vor diesen uralten und Unheil drohenden Geheimnissen zu fliehen, die kein Mensch je erschauen sollte und die auch kein Mensch außer mir jemals zu erschauen wagte.
Tief im Inneren der Arabischen Wüste liegt die Stadt ohne Namen, verfallen und stumm, ihre niedrigen Mauern beinah versunken im Sand nie gezählter Zeitalter. So muss es bereits gewesen sein, ehe der Grundstein zu Memphis gelegt wurde, und als die Ziegel Babylons noch nicht gebrannt waren. Keine Legende ist alt genug, um ihr einen Namen zu geben oder eine Erinnerung daran zu wahren, dass jemals Leben in ihr herrschte; doch wird an Lagerfeuern über sie geflüstert und von greisen Frauen in den Zelten der Scheichs über sie geraunt, sodass sämtliche Stämme sie meiden, ohne genau zu wissen, weshalb. Dieser Ort war es, von dem Abdul Alhazred, der wahnsinnige Dichter, in den Nächten träumte, ehe er seinen rätselvollen Zweizeiler sang:
Es ist nicht tot, was ewig liegt,
Und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt.
Ich hätte wissen müssen, dass die Araber guten Grund hatten, diesen Ort zu meiden, jene Stadt ohne Namen, von der seltsame Geschichten erzählt werden, die aber noch nie ein lebender Mensch gesehen hat, und dennoch setzte ich mich darüber hinweg und zog mit meinem Kamel in die unbetretene Öde hinaus. Nur ich allein habe sie gesehen, und deshalb ist kein anderes Gesicht so abscheulich von Angst gezeichnet wie das meine; deshalb zittert kein anderer Mensch so erbärmlich wie ich, wenn der Nachtwind an den Fensterläden rüttelt. Als ich sie in der schrecklichen Stille endlosen Schlafes erreichte, sah sie mir kühl unter den Strahlen eines kalten Mondes inmitten der Wüstenhitze entgegen. Und als ich ihren Blick erwiderte, vergaß ich meinen Triumph über ihre Entdeckung und stieg von meinem Kamel ab, um auf die Morgendämmerung zu warten.
Ich harrte Stunden aus, bis sich der Osten endlich grau färbte und die Sterne verblassten, und das Grau zu einem zartroten Leuchten wurde, umsäumt von Gold. Ich hörte ein Seufzen und sah, wie ein Sandsturm zwischen den uralten Steinen aufstieg, wenngleich der Himmel klar war und der endlose Wüstenraum ruhig. Dann erhob sich unvermittelt der grelle Rand der Sonne über dem fernen Horizont der Wüste, flirrend hinter dem kleinen, davonziehenden Sandsturm, und in meinem fiebrigen Zustand glaubte ich, aus irgendeiner unendlichen Tiefe eine Musik metallener Instrumente heraufschallen zu hören, um die glühende Scheibe zu grüßen, so wie Memnon sie von den Ufern des Nils aus begrüßt. Meine Ohren hallten und meine Fantasie stand in Flammen, als ich mein Kamel langsam über den Sand zu dem schweigenden Ort führte; jener Stätte, die von allen lebenden Menschen nur ich allein erblickte.
Ziellos wanderte ich inmitten der formlosen Grundmauern von Häusern und Plätzen umher, ohne auf ein einziges in Stein gemeißeltes Zeugnis oder eine Inschrift zu stoßen, die von den Menschen kündete, die diese Stadt vor so langer Zeit erbaut und bewohnt hatten – falls es denn Menschen waren. Das sagenhafte Alter des Ortes war unerträglich, und ich sehnte mich danach, ein Schriftzeichen oder ein künstlerisches Werk zu finden, die bewiesen, dass diese Stadt tatsächlich von Menschenhand erbaut worden war, denn die Ruinen wiesen gewisse Größenverhältnisse und Ausmaße auf, die mir nicht behagten.
Ich trug eine Menge an Gerätschaften mit mir und führte zahlreiche Ausgrabungen in den verwitterten Bauten durch; doch kam ich nur langsam voran und entdeckte nichts von Belang. Als die Nacht und der Mond wiederkehrten, setzte ein kalter Wind ein, der neue Furcht mit sich brachte, sodass ich es nicht wagte, noch länger in der Stadt zu bleiben. Als ich die alten Mauern verließ, um mich schlafen zu legen, entstand hinter mir ein kleiner, seufzender Sandsturm und fegte über die grauen Steine, obwohl der Mond hell leuchtete und über der Wüste ansonsten alles ruhig lag.
Genau bei Tagesanbruch erwachte ich aus einer Abfolge schrecklicher Träume und meine Ohren dröhnten wie von dem Schall metallischer Instrumente. Ich sah die Sonne rötlich durch die letzten Verwehungen eines kleinen Sandsturms äugen, der über der Stadt ohne Namen hing, während die übrige Landschaft völlig ruhig schien. Abermals wagte ich mich zwischen die brütenden Ruinen, die sich unter den Dünen abhoben wie ein Zyklop unter einem Tuch, und grub wiederum vergebens nach den Überresten einer verschollenen Rasse. Gegen Mittag legte ich eine Rast ein und am Nachmittag verbrachte ich viel Zeit damit, den Mauern und den ehemaligen Straßen und den Umrissen der fast entschwundenen Gebäude nachzuspüren. Ich erkannte, dass die Stadt in der Tat einst gewaltige Dimensionen aufgewiesen hatte, und fragte mich, woher diese Größe gerührt haben mochte. Ich malte mir die ganze Pracht einer Epoche aus, die so lange zurücklag, dass die Chaldäer sich ihrer nicht entsannen, und dachte an die Stadt Sarnath, die Verdammte, die sich im Lande Mnar erhoben hatte, als die Menschheit noch jung war, und an Ib, die aus grauem Stein gehauen worden war, bevor das Menschengeschlecht erstand.
Ganz unverhofft stieß ich auf eine Stelle, wo das Grundgestein durch den Sand brach und einen niederen Felshang bildete; und hier traf mein Blick erfreut auf etwas, das weitere Spuren jener vorsintflutlichen Rasse verhieß. Grob in die Vorderflanke des Felsens hineingehauen, boten sich unverkennbar Fassaden diverser kleiner, niedriger Felsenhäuser oder Tempel dar. Ihre Innenräume mochten womöglich mannigfache Geheimnisse aus Zeitaltern bewahrt haben, die so weit zurücklagen, dass sie sich jeder Datierung entzogen, obgleich Sandstürme längst schon alle Bildhauerarbeiten, die vielleicht einst die Außenwände bedeckten, getilgt hatten.
Die vielen dunklen Öffnungen in meiner Nähe waren alle sehr niedrig und vom Sand verstopft, doch ich schaufelte eine davon mit dem Spaten frei und kroch hindurch, in der Faust eine Fackel, um jedwedes Geheimnis zu erhellen, das sich hier möglicherweise verbarg. Sobald ich ins Innere vorgedrungen war, erkannte ich, dass die Höhle wirklich einen Tempel darstellte und deutliche Spuren jener Rasse aufwies, die hier gelebt und ihre Riten vollzogen hatte, ehe die Wüste eine Wüste ward. Primitive Altäre, Säulen und Nischen, alle sonderbar niedrig angelegt, fehlten nicht; und obwohl ich keine Skulpturen und Fresken sah, gab es doch zahlreiche eigentümliche Steine, die mit künstlichen Mitteln zu symbolischen Objekten gestaltet worden waren.
Die geringe Höhe der ausgehauenen Kammer war überaus befremdlich, denn ich konnte kaum aufrecht knien, und doch war ihre Ausdehnung so groß, dass meine Fackel immer nur einen Teil vor mir enthüllte. In einigen der entlegeneren Winkel überrann mich ein sonderbarer Schauder, denn manche Altäre und Steine ließen an vergessene Riten furchtbarer, abstoßender und unerklärlicher Art denken und weckten die Überlegung in mir, welche Sorte Mensch einen solchen Tempel geschaffen und benutzt haben könnte. Sobald ich alles gesehen hatte, was der Ort enthielt, kroch ich wieder nach draußen, begierig darauf, herauszufinden, was die übrigen Tempel wohl noch preiszugeben hatten.
Die Nacht war jetzt nah, und doch vertrieben die greifbaren Dinge, die ich gesehen hatte, die Furcht, und meine Neugier siegte. Deshalb floh ich nicht vor den langen Schatten, die das Mondlicht warf und die mich mit Angst erfüllt hatten, als ich die Stadt ohne Namen zum ersten Mal erblickt hatte. Im Zwielicht schaufelte ich die nächste Öffnung frei, kroch mit einer frischen Fackel hinein und fand weitere fragwürdige Steine und Symbole vor, jedoch nichts von größerer Aussagekraft als im ersten Tempel. Der Innenraum war ebenso niedrig, aber viel schmaler, und er endete in einem winzigen Durchgang, der mit rätselhaften und kryptischen Schreinen verstellt war. Ich schaute mir diese Schreine gerade genauer an, als das Heulen des Windes und meines Kamels die Stille durchfuhren und mich hinausriefen, um zu ergründen, was das Tier so verängstigte.
Der Mond strahlte hell über den urtümlichen Ruinen und beleuchtete eine dichte Sandwolke, die scheinbar von einem heftigen, aber abflauenden Wind aus irgendeiner Ecke der Felsflanke vor mir aufgewirbelt wurde. Ich wusste, dass es dieser kalte sandkörnige Wind war, der das Kamel aus der Ruhe gebracht hatte, und wollte es gerade an eine besser geschützte Stelle führen, als ich zufällig aufblickte und sah, dass oberhalb der Felszinnen gar kein Wind blies. Dies verblüffte mich und weckte neue Furcht in mir, doch sogleich entsann ich mich der plötzlich aufspringenden Winde an diesem Ort, die ich bereits bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gesehen und gehört hatte, und tat es als natürliche Erscheinung ab. Ich kam zu dem Schluss, dass der Wind aus dem Spalt irgendeiner Felshöhle dringen müsse, und beobachtete den tanzenden Sand, um ihn zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen; kurz darauf erkannte ich, dass er der schwarzen Öffnung eines Tempels weitab südlich von mir entwich, die aus meiner Entfernung schon fast nicht mehr zu sehen war.
Ich stemmte mich gegen die erstickende Sandwolke und stapfte auf diesen Tempel zu, der beim Näherkommen größer aufragte als die anderen und einen Eingang aufwies, der weit weniger mit verbackenem Sand gefüllt war. Ich wäre hineingestiegen, hätte nicht die fürchterliche Macht des eisigen Windes beinahe meine Fackel zum Erlöschen gebracht. Er brauste dämonisch aus der dunklen Pforte heraus und seufzte schaurig, als er den Sand verwehte und zwischen den unheimlichen Ruinen verteilte. Bald wurde er schwächer und der Sand kam mehr und mehr zur Ruhe, bis er sich schließlich wieder gelegt hatte; doch etwas Beseeltes schien zwischen den geisterhaften Steinen der Stadt umzugehen, und als ich den Mond ansah, schien er zu zittern, als spiegelte er sich in bewegten Wassern. Ich empfand mehr Furcht als ich in Worte fassen kann, doch nicht genug, dass es mein Verlangen gedämpft hätte, in den Genuss des Entdeckens zu kommen; und kaum war der Wind restlos erstorben, überschritt ich die Schwelle zu jener dunklen Kammer, aus der er gedrungen war.
Wie ich schon von außen vermutet hatte, war dieser Tempel größer als die beiden, die ich bereits besucht hatte; und er war vermutlich eine von der Natur geschaffene Höhle, da er Winde aus unterweltlichen Gefilden gebar. Hier in seinem Innern konnte ich bequem aufrecht stehen, doch wie ich erkannte, waren die Steine und Altäre ebenso niedrig wie die in den anderen Tempeln. An den Wänden und der Decke gewahrte ich erstmals einige Spuren der Malkunst der alten Rasse, eigentümlich gekrümmte Farbstriche, die nahezu verblichen oder abgeblättert waren; und an zweien der Altäre erblickte ich mit wachsender Erregung eine Reihe kunstvoll ausgeführter, krummliniger Steinmeißelungen. Als ich meine Fackel hob, kam es mir vor, als sei die Form der Höhlendecke zu ebenmäßig, um natürlichen Ursprungs zu sein, und ich fragte mich, was die prähistorischen Steinmetze wohl zuerst bearbeitet hatten. Ihre technischen Fähigkeiten mussten immens gewesen sein.
Dann enthüllte mir ein helles Aufflackern der unwirklichen Flamme das, wonach ich gesucht hatte: eine Öffnung zu jenen entlegenen Abgründen, aus denen der plötzliche Wind hervorgebraust war. Mir wurde schwach, als ich erkannte, dass es sich um eine kleine und fraglos künstlich angelegte Pforte handelte, die in den natürlichen Fels gehauen war.
Ich schob meine Fackel hindurch und erblickte einen schwarzen Tunnel, dessen Decke sich niedrig über einer unebenen Flucht winziger, zahlreicher und abschüssiger Stufen wölbte. Ich werde diese Stufen auf ewig in meinen Träumen sehen, denn ich erfuhr bald, was sie bedeuteten. In jenem Augenblick wusste ich kaum, ob ich sie als Stufen oder als bloße Felssprossen bezeichnen sollte, die da steil hinabführten. Mein Hirn schwirrte vor wahnwitzigen Gedanken, und die Worte und Warnungen arabischer Seher schienen über die Wüste hinweg aus den Ländern, die der Mensch kennt, bis hin zur Stadt ohne Namen, die kein Mensch zu kennen wagt, zu dringen. Dennoch zögerte ich nur einen Moment lang, bevor ich durch das Portal vordrang und vorsichtig den steilen Schacht hinabzuklettern begann, rücklings und mit den Füßen voran, wie auf einer Leiter.
Allenfalls in den furchtbaren Trugbildern des Drogenrauschs oder Fieberwahns vermag irgendein Mensch, einen solchen Abstieg zu erleben wie ich. Der enge Schacht führte endlos hinab wie ein beängstigender, verhexter Brunnen, und die Fackel, die ich über den Kopf hielt, erhellte kaum die unbekannten Tiefen, denen ich entgegenkroch. Ich verlor jedes Zeitgefühl und vergaß, auf meine Uhr zu sehen, obwohl ich Angst verspürte, wenn ich an die Strecke dachte, die ich vermutlich zurücklegte. Richtung und Gefälle meines Abstiegs variierten; und einmal gelangte ich an einen langen, niedrigen, waagerechten Stollen, über dessen felsigen Untergrund ich mich bäuchlings schlängeln musste, mit den Füßen voran und die Fackel auf Armeslänge hinter den Kopf haltend. Die Höhe reichte nicht aus, um auch nur zu knien. Danach folgten weitere steile Stufen, und ich krabbelte noch immer endlos nach unten, als meine glimmende Fackel erlosch. Ich glaube, ich bemerkte es zunächst gar nicht, denn als es mir auffiel, hielt ich die Fackel nach wie vor über mich, so als brenne sie immer noch. Offenbar war ich arg aus dem seelischen Lot gebracht durch meinen Drang zum Außergewöhnlichen und Unbekannten, der mich durch die Welt wandern ließ als Jäger ferner, alter, verbotener Stätten.
Im Dunkeln blitzten vor meinem inneren Auge Bruchstücke meines gehüteten Wissens dämonischer Gelehrtheit auf; Zitate von Alhazred, dem wahnsinnigen Araber, Absätze aus den apokryphen Albträumen des Damascius und ruchlose Zeilen aus dem fiebergeborenen Image du Monde von Gauthier de Metz. Ich sagte sonderbare Auszüge auf und wisperte von Afrasiab und den Dämonen, die mit ihm den Oxus hinabtrieben; später sang ich wieder und wieder einen Satz aus einer der Erzählungen Lord Dunsanys vor mich hin – »Die echoleere Schwärze des Orkus«. Einmal, als der Abstieg aberwitzig steil wurde, leierte ich etwas aus Thomas Moores Dichtungen herunter, bis die Furcht mich abhielt, noch mehr davon wiederzugeben:
Ein Pfuhl voll Finsternis, tiefschwarz
Als sei’s ein Tiegel, darin Gifte kochen
Aus Blumen, im Mondlicht von Hexen gebrochen.
Ins Dunkel spähend, ob ich fände
Den Weg hinab, bohrte mein Blick
Sich in den Schlund und fiel direkt
Auf steile, glitschig glatte Wände
Welche mit zähem Schleim bedeckt,
Pechfinster, wie auch jener Schlick
Der an des Totenozeans Ufern leckt.
Zeit besaß keine Bedeutung mehr für mich, als meine Füße wieder ebenen Boden erspürten und ich mich an einem Ort befand, der nur wenig höher war als die Räume in den beiden kleineren Tempeln, die nun so unermesslich weit über mir lagen. Stehen konnte ich nicht, aber doch aufrecht knien, und in der Finsternis rutschte und kroch ich aufs Geratewohl mal hier-, mal dorthin. Bald wurde mir klar, dass ich mich in einem engen Gang befand, an dessen Wänden sich Holzkästen reihten, die mit Glasfronten versehen waren. Dass ich an diesem paläozoischen und unterweltlichen Ort Dinge wie poliertes Holz und Glas ertastete, ließ mich erschaudern angesichts der Andeutungen, die darin lagen. Die Kästen standen anscheinend in regelmäßigen Abständen entlang der beiden Seitenwände des Gangs, und sie waren länglich gebaut und waagerecht gelagert, wodurch sie nach Form und Größe schauderhaft an Särge gemahnten. Als ich zwecks weiterer Untersuchungen probierte, zwei oder drei davon zu verrücken, bemerkte ich, dass sie fest verankert waren.
Wie ich erkannte, besaß der Gang eine beträchtliche Länge, und ich kroch auf allen vieren in geducktem Lauf voran, was grauenvoll gewirkt hätte, wäre es in der Schwärze beobachtet worden; dabei wechselte ich ab und an von einer Seite zur anderen, um meine Umgebung zu ertasten und mich zu vergewissern, dass die Wände und Kastenreihen sich weiter dahinzogen. Der Mensch ist das visuelle Denken so sehr gewöhnt, dass ich die Finsternis fast vergaß und mir den endlosen Korridor aus Holz und Glas in seiner niedrigen Einförmigkeit so lebhaft vorstellte, als könnten meine Augen ihn sehen. Und dann, in einem Augenblick unbeschreiblicher Erregung, sah ich ihn wirklich.
Wann genau meine Vorstellung zu realem Sehen wurde, kann ich nicht sagen; doch von vorne wuchs allmählich ein Glühen heran, und mit einem Mal erkannte ich, dass ich die düsteren Umrisse des Korridors und der Kästen erblickte, enthüllt von irgendeiner unbekannten unterirdischen Phosphoreszenz. Eine kurze Weile lang sah alles genau so aus, wie ich es mir ausgemalt hatte, denn das Glühen war sehr schwach; doch als ich unwillkürlich weiter voran auf das stärkere Licht zurobbte, wurde mir klar, dass meine Vorstellung nur sehr ungenau gewesen war. Diese Halle war kein rudimentäres Relikt wie die Tempel der Stadt weit über mir, sondern ein Monument der großartigsten und exotischsten Kunst. Üppige, lebendige und kühn-fantastische Ornamente und Bildnisse ergaben eine geschlossene Anordnung von Wandmalereien, deren Linien und Farben nicht zu beschreiben sind. Die Gehäuse der Kästen bestanden aus einem sonderbaren goldfarbenen Holz, ihre Vorderseiten hingegen aus erlesenem Glas, und sie enthielten die mumifizierten Hüllen von Lebewesen, deren Groteskheit die aberwitzigsten Träume der Menschen überboten.