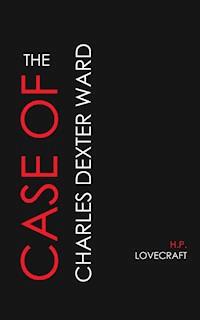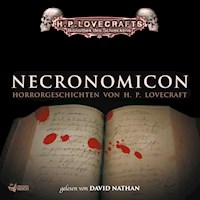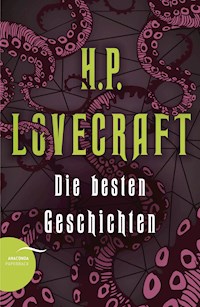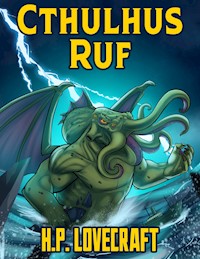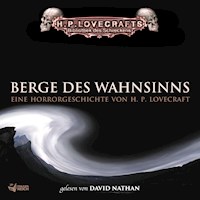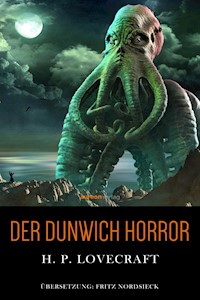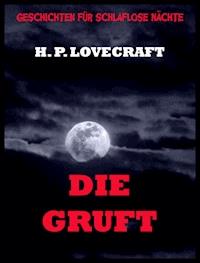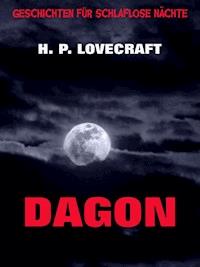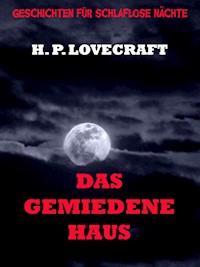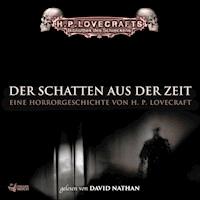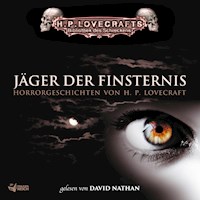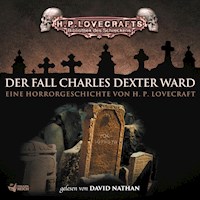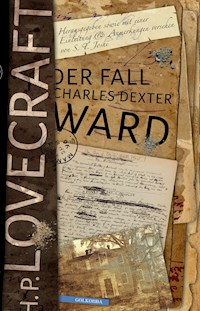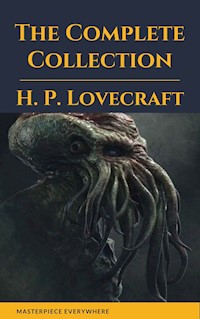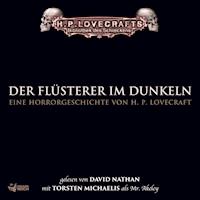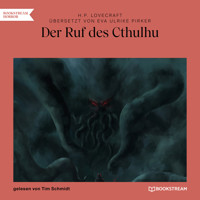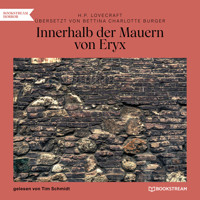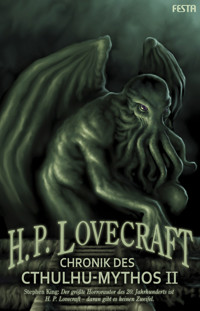
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stephen King: "Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft – daran gibt es keinen Zweifel." Diese Chronik in zwei Bänden vereint erstmals die vollständigen Werke Lovecrafts zum Cthulhu-Mythos – neben allen Kurzgeschichten auch die berühmten Novellen. Mit einer Einleitung und ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Werken von Dr. Marco Frenschkowski. Clive Barker: "Lovecrafts Werk bildet die Grundlage des modernen Horrors." Markus Heitz: "Die zahlreichen Geschichten rund um den Cthulhu-Mythos beinhalten für mich bis heute enorme Kraft und Wirkung." Michel Houellebecq: "Wir beginnen gerade erst, Lovecrafts Werk richtig einzuordnen, auf gleicher Ebene oder sogar höher als das von Edgar Allan Poe. Auf jeden Fall als ein absolut einzigartiges." Michael Chabon: "BERGE DES WAHNSINNS ist eine der großartigsten Novellen der Amerikanischen Literatur. Durch sie habe ich erstmals begriffen, welche Wirkung Literatur haben kann." Eine Festa Originalausgabe, Großformat Paperback 13,5 x 21 cm, Umschlag in Lederoptik, circa 500 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Band II
Mit einem Vorwort und Erläuterungen
von Marco Frenschkowski
Vorwort
Mit Band II unserer Sammlung der »Cthulhu-Mythos«-Geschichten des amerikanischen Meisters unheimlicher Literatur H. P. Lovecraft (1890–1937) erreichen wir den Höhepunkt seines literarischen Schaffens, mit vielen jener Erzählungen, die den literarischen Ruhm des Schriftstellers bis heute lebendig erhalten haben. Lovecraft weiß jetzt, was er sagen will, und wie er es sagen will. Er hat die Edgar Allan Poe- und Lord Dunsany-Imitationen seiner Jugend überwunden und seine eigene Sprache gefunden. Mit einer Mischung aus Präzision, evokativer und visionärer Vorstellungskraft, einem sicheren Blick für das Erschreckende und Unheimliche, das Fantastische und Imaginative, schafft er Erzählungen, die längst zu Klassikern der modernen amerikanischen Literatur geworden sind.
In einem deutschsprachigen Kontext muss dieser amerikanische Hintergrund mitgehört werden, um Lovecraft nicht zu karikieren. Lovecraft starb nach einem Leben, das er bis auf zwei Jahre in New York in seinem heimischen Providence, Rhode Island zugebracht hatte, einer alten Hafenstadt mit einem für die USA sehr ausgeprägten Geschichtsbewusstsein. Ein Einsiedler war er entgegen früher Legende keineswegs; er hatte eine Familie, ein soziales Umfeld und zahlreiche Freunde, auch wenn er mit vielen nur Briefkontakt pflegen konnte – aber mehr aus finanziellen als anderen Gründen. Einige Zeit lang war er verheiratet und er wollte durchaus als Autor bekannt sein und gelesen werden.
Sein Leben lang war er bestrebt, als distinguierter Gentleman britischer Abstammung wahrgenommen zu werden, zu dessen breiten Interessen eben auch das Grausige, das Monströse und Abgründige gehörten – neben Literatur und den Naturwissenschaften, Geschichte und Mythologie, Architektur und Astronomie. Dieses Leben eines unabhängigen Gentlemans hat er in gewissem Maße tatsächlich geführt – um den Preis äußerer Armut und radikaler Hingabe an seine schriftstellerische Arbeit. An die Stelle eines bürgerlichen Brotberufs tritt ein Leben der entfesselten Vorstellungskraft. Seine Fantasie destilliert aus seinem geliebten Neuengland das Unheimliche und Monströse heraus und gestaltet es zu Erzählungen von fiebriger Intensität, die sich mit einer erstaunlichen Präzision der Visualisierung verbindet. Dabei hat er immer genau jene Geschichten geschrieben, die er schreiben wollte: Kompromisse gegenüber einem wie auch immer beschaffenen Publikumsgeschmack waren ihm ein Abscheu. Daher ist sein Erzählen immer in hohem Maße authentisch und bei aller Kuriosität der Themen und manchen literarischen Insider-Jokes doch keineswegs ein austauschbares literarisches Spiel. Lovecrafts Imagination stellt sich großen Themen (der Mensch im Kosmos, der Verfall der Zivilisation, Identitätsdiffusion und Identitätssuche), auch wenn dies im überraschenden Medium der Horrorgeschichte geschieht. Er hat dezidiert eine eigen Philosophie und Ästhetik und will auch als zivilisationskritischer Denker gehört werden, auch wenn er diese Gedanken in die Geschichte nichtmenschlicher Kulturen verpackt.
Die ungeheure Vorstellungskraft seiner Prosa wirkt unmittelbar bis heute, aber viele soziale, kulturelle und wissenschaftliche Rahmenbedingungen seiner Texte haben sich stärker verändert, als es dem deutschen Leser vielleicht auf Anhieb bewusst wird. Die Freude am Lesen der folgenden Texte, die schiere Faszination angesichts der Fremdheit der lovecraftschen Welten hängt ganz wesentlich davon ab, sich auf das neuenglische bzw. amerikanische Ambiente der 1920er, 1930er Jahre einzulassen. Es hilft, sich auf einer Karte und alten Bildern ein Gefühl für dieses Ambiente zu verschaffen. Lovecrafts Erzählungen leben ja gerade aus einem Kontrast zwischen der präzisen Schilderung des realen Neuengland und dem suggestiven Einbruch des Fremden, des ganz Anderen, des Monströsen.
Sind Lovecrafts Mythosgeschichten aber nicht einfach doch nur »Monsterstories«? Nun, ein Monster mündet immer dann nach einiger Zeit in narrative Langeweile, wenn seine einzige Bedeutung die Bedrohung unserer physischen Existenz ist. Lovecrafts fremde Wesen sind von ganz anderer Art. Ihre Bedrohlichkeit ist nicht einfach eine »Gefährlichkeit«. Lovecrafts Aliens greifen nach unserer Identität: Und das macht ihre Faszination und ihr Grauen aus. Sie tun dies in zweifacher Weise: Einmal, indem sie die Geschichte der Menschheit auf der Erde zu einer Episode zusammenschrumpfen lassen. Lovecrafts monströse Wesen in diesem Sinn sind narzisstische Kränkungen: Glück und Erfolg der Menschen haben im Kosmos keine Bedeutung. Es ist immer ein wenig »Wind aus den Weiten des Alls« in Lovecrafts Erzählungen. Cthulhu und Yog-Sothoth spiegeln hierin Lovecrafts eigene Philosophie.
Dies ist jedoch nur eine Seite der Sache. Wie es in ›The Shadow Over Innsmouth‹ wohl am deutlichsten wird, geht es auch um den veränderten Blick, den Leserinnen und Leser auf sich selbst gewinnen. Die verstörende Frage »Wer bin ich?«, wie sie der namenlose Ich-Erzähler in ›The Shadow Over Innsmouth‹ zu spüren bekommt, überträgt sich auf die Lesenden. In anderen Erzählungen liegt dieses Thema nicht so deutlich zutage, aber es ist immer vorhanden. Lovecrafts Protagonisten sind oft, aber nicht immer, vereinzelte, einsame Menschen, weniger durch ihr Naturell, sondern eher durch das Wissen, das ihnen oft zufällig zuteil geworden ist. Ihr Wissen um die dunkle Seite des Universums trennt sie von ihren Mitmenschen. Es gelingt Lovecraft mit erheblichem erzählerischem Raffinement, diesen Blickwinkel einzufangen und literarisch zu gestalten.
Es sollte dennoch deutlich gesagt werden, dass die folgenden Erzählungen mit ihrem mythischen Szenario nur einen Teil von Lovecrafts Erzählwerk ausmachen. Zusammen mit Band I liegen die Mythosgeschichten Lovecrafts im eigentlichen Sinn hier nun gesammelt und mit kommentierenden Einführungen versehen in zwei Bänden vor. Sie sind zwar wie gesagt nur ein Teil des Prosawerkes Lovecrafts (um von seinen Gedichten, Theaterstücken und Essays zu schweigen), aber ohne Frage der Teil, der bis heute am meisten fasziniert. Die einführenden Essays sind überarbeitete und verbesserte Fassungen des Kommentarteils der Gesammelten Werke Lovecrafts, die seit 1999 im Verlag Edition Phantasia erscheinen (bisher 13 Bände; vollständige kommentierte Ausgabe aller Schriften Lovecrafts).
Das Unheimliche bei Lovecraft ist ein intelligentes Vergnügen, es sucht Leser und Leserinnen, die den vielfachen Vernetzungen der Erzählungen, den zahllosen Insider-Jokes, den Anspielungen auf klassische und literarische Mythen nachspüren. Das Spiel der fantastischen Entgrenzung der Wirklichkeit wird bei Lovecraft zu einer Evokation des Fremden im Kosmos und in uns selbst. Das ist keine kleine Sache, und trotz des augenzwinkernden Humors in den vielen Anspielungen Lovecrafts (den Lesende oft erst nach mehrmaliger Lektüre des Gesamtwerkes wahrnehmen) bringt er etwas zur Sprache, was tiefere Töne anspricht. Lovecrafts leidenschaftliche Neugier (sichtbar etwa in der obsessiven Suche von Robert Blake in ›The Haunter of the Dark‹), sein Interesse an den Wissenschaften, an der Geschichte (vor allem der britischen und antiken), an Mythologien und Folklore, an Kulten und Religionen, am Kosmos als Ganzen, lebt eben auch in seinen Geschichten, so fantastisch sie sein mögen. Und gar nicht so selten springt dieser Funke auf Leserinnen und Leser über.
Marco Frenschkowski
Leipzig, den 20. Mai 2011
Vorwort zu »Berge des Wahnsinns« (At the Mountains of Madness)
›At the Mountains of Madness‹ (geschrieben Februar/März 1931) war Lovecrafts dritter und letzter Roman, nach dem Fantasy-Roman ›The Dream-Quest of Unknown Kadath‹ (1927) und dem großen historischen Horrorroman ›The Case of Charles Dexter Ward‹ (geschrieben ebenfalls 1927). In gewisser Hinsicht ist ›At the Mountains of Madness‹ Lovecrafts einziger wirklich zum Zweck der Publikation verfasster und geplanter Roman, da sowohl die idiosynkratische und mäandrierende Fantasyerzählung ›Dream-Quest of Unknown Kadath‹ wie auch ›The Case of Charles Dexter Ward‹ zu Lebzeiten Lovecrafts nicht publiziert wurden, und Lovecraft dazu auch keine besonderen Anstrengungen übernahm. Am Erscheinen von ›At the Mountains of Madness‹ lag ihm dagegen viel. Der Titel entstammt offenbar einer Passagen aus der Erzählung ›The Hashish Man‹ (in ›A Dreamer’s Tales‹, London 1910) von Lord Dunsany (»And we came at last to those ivory hills that are named the Mountains of Madness ...«), obwohl Lovecraft das meines Wissens nicht explizit sagt.
Die gewaltige Evokation der antarktischen Eiswüste als eines Ortes von vorzeitlichem Grauen verfehlt auch heute ihre Wirkung nicht. Manche Liebhaber des Genres halten ›At the Mountains of Madness‹ für Lovecrafts besten Text, dessen schiere visionäre Intensität ein Panorama der Erdgeschichte zeichnet, vor dem die Menschheitsgeschichte zu einer bloßen Episode zusammenschrumpft. Natürlich ist es eine verfremdete Erdgeschichte, in der unerwartete Schrecken lauern, aber sie wird eng an alles angebunden, was zu Lovecrafts Lebzeiten über die tatsächliche geologische und paläontologische Geschichte der Erde bekannt war. Die Horrormotive früherer Erzählungen sind hier in einen Science Fiction-Rahmen integriert; dazu später.
Lovecraft hatte sich schon ab etwa 1900 intensiv für die Antarktis interessiert und war über den jeweils letzten Stand ihrer Erschließung immer bestens im Bilde. 1899 hatte der Norweger Carsten Egebert Borchgrevink als erster ein dauerhaftes Lager auf antarktischem Festland errichtet; 1901–1904 folgten dann die deutsche »Gauß-Expedition« und die britische »Discovery-Expedition« (mit R. F. Scott). Am 14.12.1911 und am 18.1.1912 hatten dann Roald Amundsen und Robert F. Scott den Südpol erreicht. Lovecraft füllte Anfang des Jahrhunderts diverse Schulhefte mit Nacherzählungen der großen Antarktisexpeditionen des 19. Jahrhunderts. Das Erreichen des Südpols war dabei eine Leidenschaft, die ihre Wurzeln noch im 18. Jahrhundert hatte (Captain James Cook war daran 1772–74 gescheitert), und Engländer und Amerikaner haben später gleichermaßen um dieses Ziel gekämpft. Eine Kenntnis der großen Expeditionen (Charles Wilkes, James Clark Ross, Robert F. Scott etc.) setzt Lovecraft bei seinen Lesern als selbstverständlich voraus. 1928–1930 waren die Jahre der ersten Antarktisexpedition von Richard Evelyn Byrd (1888–1957), der durch seinen Nordpolarflug 1926 bereits weltberühmt geworden war; es folgten in späteren Jahren weitere Antarktisexpeditionen. Vielleicht war diese Expedition der unmittelbare Auslöser der Erzählung Lovecrafts (in der ja wie bei Byrd Flugzeuge eine große Rolle spielen).
Es ist nicht unwichtig, dass ›At the Mountains of Madness‹ eine Expedition schildert: Ausführlich werden Vorbereitung, Finanzierung, wissenschaftliche Organisation, technische Ausrüstung, Zusammensetzung des Mannschaft etc. berichtet. Lovecraft hatte ganz offensichtlich alles gelesen, was er über solche Themen in die Finger bekommen konnte. (Ähnlich steht in seiner Kurzgeschichte ›Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family‹ von 1920 eine Afrikaexpedition – wenn auch des 18. Jahrhunderts – mit grausigen Konsequenzen im Hintergrund, aber Lovecrafts Leidenschaft für Details war seit diesem frühen Text noch enorm gewachsen).
Die Forschungsreise wird zur Metapher des suchenden, fragenden, die Vergangenheit durchforstenden Geistes in seiner Konfrontation mit dem Unbekannten. Sicher drückt sich darin auch Lovecrafts Sehnsucht aus, doch einmal Teil eines akademischen Establishments zu sein, das solche Expeditionen ausführen kann – ein Wunsch, der durch sein Unvermögen, eine Collegeausbildung zu absolvieren, unmöglich gemacht wurde; Lovecraft bewegte sich aber Zeit seines Lebens im Umfeld der Brown University, besuchte zahlreiche ihrer öffentlichen Vorträge und lebte zuletzt in einem Haus als Mieter, das der Universität gehörte, nur wenige Schritte von ihren Bibliotheken entfernt. Man kann diese Suche auch als eine Art Bewusstseinserweiterung verstehen, natürlich nicht in einem esoterischen Sinn, bei dem es um Lebensgewinn geht, sondern gerade umgekehrt im verstörenden Sinn der unheimlichen Fantastik, die den Menschen aus seinen gewohnten Bahnen herausreißt. Diese Suche beginnt für den Erzähler William Dyer nicht erst in der Antarktis: Das Necronomicon ist ihm nicht fremd.
›At the Mountains of Madness‹ gewinnt aus den symbolischen Tiefendimensionen der Landschaft und der Expedition auch menschliche Qualität und Größe: Hier ist von Gelehrten die Rede, die wirklich wissen wollen, deren Leben sich ganz um ein solches Wissenwollen dreht. Lake und Atwood nehmen dabei ein böses Ende, der Student Danforth wird verrückt, und der Erzähler William Dyer (die volle Namensform nur in der Novelle ›The Shadow Out of Time‹) bleibt auch seelisch nicht unbeschädigt. Das ist die Wirkung wahren Wissens in Lovecrafts Universum. Man beachte auch, dass Lovecraft sich durchaus recht gut in die praktischen Schwierigkeiten der Arbeit in einem Expeditionsteam hineindenken konnte; der Realismus der Erzählung ist in dieser Hinsicht erstaunlich. Aber natürlich steht im Hintergrund immer einer weitere und größere Suche. Der suchende Geist findet in der Vergangenheit nicht nur seine eigenen Wurzeln, sondern auch das, was seine Existenz bedroht und in seiner Gültigkeit in Frage stellt: Das ist ein steter Grundgedanke von Lovecrafts Erzählwerk.
Begonnen wurde der Roman am 24. Februar 1931, abgeschlossen am 22. März desselben Jahres (wie oft, hat Lovecraft die Daten auf seinem Manuskript notiert). Wenn Lovecraft einen Plot klar entwickelt hatte, konnte er sehr schnell arbeiten. Das Abtippen des langen Textes mit der Schreibmaschine (Lovecraft schrieb grundsätzlich zuerst mit der Hand) schob er einige Zeit vor sich her und beendete diese von ihm extrem verabscheute mechanische Arbeit am 1. Mai. Am nächsten Tag gönnte er sich dann einen verdienten Urlaub und fuhr in einer 36-stündigen Busfahrt in den Süden der USA, über Washington, Richmond und andere Städte nach Charleston, das er schon einmal im Vorjahr besucht hatte und über das er dann auch einen langen Reisebericht zu Papier brachte.
Dem Genre nach ist ›At the Mountains of Madness‹ Science Fiction; in der Sorgfalt der biologischen, geologischen und technischen Details sogar »Hard Science Fiction«. Diese Entwicklung fort vom atmosphärischen Horror zur visionären, wenn auch nicht weniger »schrecklichen« SF ist eine Grundtendenz im späteren Werk unseres Schriftstellers etwa ab Ende der 20er-Jahre.
Die Zwischenstellung zwischen zwei Genres hat die Erzählungen dann leider schwer verkäuflich gemacht. Längst war die Zeitschrift Weird Tales (die seit 1923 existierte) Lovecrafts Hauptabsatzmarkt geworden, aber ihr Herausgeber Farnsworth Wright lehnte den Text Mitte Juni 1931 als zu lang, zu handlungsarm und kaum für mehrere Ausgaben teilbar ab. Dies war ein schwerer Schlag für Lovecraft. Fast zur gleichen Zeit lehnte dann auch der angesehene Verlag G. P. Putnam’s Sons einen Auswahlband mit seinen Kurzgeschichten ab, der schon in greifbare Nähe gerückt schien. Einige ältere Texte, die Lovecraft im April 1931 an Harry Bates, den Herausgeber von Strange Tales (als neues Zeitschriftenprojekt damals in der Planungsphase), geschickt hatte, wurden dort ebenfalls nicht angenommen. Lovecraft war ganz im Gegensatz zu der stoisch-ästhetizistischen Attitüde, die er an Tag legte, außerordentlich verletzbar und hat sich diese drei Ablehnungen in kurzer Zeit sehr zu Herzen genommen. Er war darin sicher kein Profi; Autoren wie August Derleth oder Robert E. Howard haben ihre Texte in solchen Fällen einfach an die nächste Zeitschrift geschickt bzw. später wieder neu bei Weird Tales eingereicht (Derleth bis zu zehnmal, wie es das Gerücht will). Lovecraft war dazu nicht imstande. Eine im Juni angefangene Erzählung konnte er nicht weiterschreiben, als die Nachricht der Ablehnung bei ihm eintraf (sie ist verschollen), und lange Monate war sein kreatives Talent wie gelähmt (zumal auch Lovecrafts Freunde mit ›At the Mountains of Madness‹ offenbar wenig anfangen konnten). Erst November/Dezember 1931 versuchte er sich wieder an einem größeren Projekt, ›The Shadow over Innsmouth‹ (später in diesem Band).
Was die Publikation von ›At the Mountains of Madness‹ betraf, so ergab sich erst September 1935 etwas: Ein junger Literaturagent namens Julius Schwartz (1915–2004) hatte Kontakt zu dem Herausgeber von Astounding Science Fiction, F. Orline Tremaine, der diese später legendäre Zeitschrift seit ihrer Übernahme durch Street and Smith Publications Mitte 1933 zusammen mit Desmond Hall zur wichtigsten Stimme für amerikanische Science Fiction gemacht hatte (John Campbell wurde erst im Mai 1938 Herausgeber, als der Ruf von Astounding schon gefestigt war). Schwartz fragte Lovecraft nach einem Text, einigte sich rasch mit Tremaine (der den Roman offenbar gar nicht gelesen hatte, sondern Schwartz und Lovecrafts literarischen Fähigkeiten vertraute), und es kam zu einem Vertragsabschluss über 350 Dollar, von denen Schwartz 35 Dollar als Agentenprämie erhielt. Auch 315 Dollar waren für Lovecraft (der seine wöchentlichen Ausgaben durch eiserne Sparsamkeit auf 15 Dollar heruntergeschraubt hatte und sich seit 1928 keinen neuen Anzug mehr hatte leisten können) eine beträchtliche Menge Geld, zumal Tremaine kurz darauf auch ›The Shadow Out of Time‹ für 280 Dollar kaufte. Das zusammen war die größte Summe, die Lovecraft jemals verdient hat. Um sein kreatives Selbstbewusstsein aufzubauen, war es freilich zu spät. ›At the Mountains of Madness‹ erschien in einem Umfeld von Science-Fiction-Erzählungen in Astounding Stories 16, 6–17, 2 in drei Teilen (Februar, März und April 1936), genau ein Jahr vor Lovecrafts frühem Tod.
Blicken wir noch auf einige Details des Romans. Lovecraft hat es geliebt, seine Texte nicht nur mit seinen eigenen Erzählungen, sondern auch mit denen der großen Klassiker unheimlicher Literatur vielfach zu verzahnen. Den Namen des Ich-Erzählers unseres Romans, William Dyer, erfahren wir zum Beispiel nur aus ›The Shadow Out of Time‹. Wir sind dem zweiten Stilmittel schon in ›The Dunwich Horror‹ begegnet, wo es vor allem um direkte und explizite Berührungen mit Arthur Machen ging. In ›At the Mountain of Madness‹ ist es nun Edgar Allan Poe (1809–1849), dessen melancholisches, visionäres Angesicht immer wieder zwischen den Zeilen hindurchscheint. Lovecraft hatte Poe schon als Kind gelesen und ihn seitdem für Amerikas bedeutendsten Autor gehalten, wobei man nicht nur an die Kurzgeschichten denken darf, sondern vor allem an die Lyrik und in geringerem Maße auch an Poes zahlreiche in Deutschland nur wenig bekannte Essays. In einem Brief an Bernard Austin Dwyer vom 3. März 1927, in dem er viel über seine frühen kindlichen Interessen mitteilt, schreibt Lovecraft: »Dann traf mich wie ein Blitz EDGAR ALLAN POE! Das war mein Absturz, und im Alter von acht Jahren sah ich, wie sich das blaue Firmament von Argos und Sizilien durch die miasmatischen Ausdünstungen des Grabes verdunkelte!«
Im gleichen Jahr (1898) versuchte Lovecraft bereits, Poes Prosastil nachzuahmen, nachdem er zuvor ganz in einer Welt klassischer englischer Lyrik und arabischer und antiker Folklore und Mythologie gelebt hatte. Edgar Allan Poe und Alexander Pope blieben die beiden von Lovecraft am meisten verehrten Schriftsteller, obwohl zeitweise der Einfluss Dunsanys auf sein tatsächliches Werk größer war. In ›At the Mountains of Madness‹ wird Poe eine unübertroffene, wenn auch durchaus dezente Reverenz erwiesen. Lovecraft ist kein Anfänger mehr und er ahmt nicht mehr nach. Aber er erlaubt sich Anspielungen, intertextuelle Referenzen, die den Leser mit hineinnehmen in die gleiche literarische Binnenwelt, in der auch Lovecraft selbst gelebt hat. Schon zu Beginn, anlässlich der ersten Schilderung der antarktischen Berge, kommen den Betrachtern der Miskatonic-Expedition Poes Zeilen über den Berg Yaanek in den Sinn, wie sie sich in dem Gedicht ›Ulalume‹ von 1847 finden, das Poe aus einer Grundidee von Elizabeth Oakes Smith heraus entwickelt hatte. Dass Poes Berg »Yaanek« tatsächlich Mount Erebus sein muss, wie Lovecraft argumentiert, ist ganz richtig; in der Arktis waren zu Poes Lebzeiten keine Vulkane bekannt, während Mount Erebus 1840 entdeckt worden war. Poe hatte sich ja wie Lovecraft brennend für die Erforschung der Antarktis interessiert. Wie Poe auf den Namen »Yaanek« kommt, ist bis heute nicht bekannt; immerhin wird Lovecraft in der wissenschaftlichen Poe-Literatur als Entdecker der wahren Identität des Berges aufgeführt, etwa in dem zur Zeit umfassendsten Kommentar zu Poes Gedichten von Thomas Ollive Mabbott. Mehrfach wird Poes Roman Arthur Gordon Pym (Lovecraft kürzt den Buchtitel ab) genannt, sodass ›At the Mountains of Madness‹ nicht nur zu einem Prätext, sondern in gewisser Hinsicht zu einer Hommage, ja fast zu einer Art Fortführung von Poes Roman wird. An eine eigentliche Fortsetzung der Handlung – wie sie Jules Verne in Le Sphinx des Glaces (zuerst: Magasin d’Education et de Récreation, 1. Januar – 15. Dezember 1897) versucht hatte – ist aber nicht zu denken. Vor allem ist es das rätselhafte »Tekeli-li!«, das bei Lovecraft zum Fragment einer verschollenen Sprache wird, zu einem letzten Nachhall der Pfeiftöne, welche die Alten Wesen von sich gaben, nachgeäfft von denen, die erst ihre Sklaven waren und dann ihr Untergang wurden. (Tatsächlich ist »Tekeli; or The Siege of Montgatz« der Name eines Theaterstückes, in dem Poes Mutter Eliza Poe öfters auftrat, aber das wird Lovecraft vielleicht gar nicht gewusst haben). Diese Art, einzelne Bausteine aus Poe zu verfremden, hat einen besonderen ästhetischen Reiz, zumal Lovecraft Poe noch einmal mystifiziert, indem suggeriert wird, dieser habe Zugang zu einer besonderen, okkulten Quelle über die Antarktis gehabt. Poe ist mit den Worten »Reynolds! Reynolds! Lord help my poor Soul« auf den Lippen am 7. Oktober 1849 gestorben, aber ob er damit wirklich den berühmten Antarktis-Forscher Jeremiah N. Reynolds (1799–1858) gemeint hat, ist wohl eher fraglich.
Eine auffällige intertextuelle Vernetzung liegt auch mit der Novelle ›The Whisperer in Darkness‹ vor, dessen Protagonist als der »so unheimlich gelehrte Volkskundler Wilmarth« zitiert wird (»that unpleasantly erudite folklorist« im Original). Die Krustazeen vom Yuggoth tauchen beiläufig in der Gesamtvision der Erdgeschichte auf, die sich vor dem Auge des Lesers aufrollt. Nur in einem einzigen Text hat Lovecraft noch weiter ausholend eine ganze Geschichte der Erde in Vergangenheit und Zukunft entfaltet (›The Shadow Out of Time‹).
Wer ›At the Mountains of Madness‹ liest, wird kaum der Versuchung widerstehen können, die Lokalitäten auf einer Landkarte nachzuschlagen. Wichtiger ist eine gute Kenntnis der Erdgeschichte, wobei Lovecrafts Datierung der paläontologischen Epochen nicht ganz den heute üblichen entspricht (doch sind die Abweichungen für die Handlung unerheblich). Auffällig ist gerade hier Lovecrafts immenses Bemühen um absolute naturwissenschaftliche Präzision. Alfred Wegeners Kontinentalverschiebung spielt eine entscheidende Rolle, daneben auch die (damals) neuesten Ergebnisse der Paläozoologie, Paläobotanik und Ingenieurwissenschaft. Kaum je in der fantastischen Literatur (tatsächlich fällt mir kein wirklich vergleichbares Beispiel ein) sind die Monster einer Erzählung mit solchem anatomischem Detail, mit einer solchen Exaktheit des Seziertisches beschrieben worden. Diese Obsesssion sowohl in Sachen Präzision als auch in Sachen Suggestion ist ja schon bei früheren Erzählungen Lovecrafts zu beobachten, etwa in ›Pickman’s Model‹ (1926). Sie ist ein Grundkennzeichen der Lovecraftschen Ästhetik. Selbst Admiral Richard Byrds Entdeckung während der genannten Expedition 1928–1930, dass die Antarktis nicht aus drei, sondern nur aus einer einzigen Landmasse besteht, wird in die Handlung eingebaut. Byrd hatte am 29. November 1929 als erster Mensch den Südpol in einem Flugzeug überquert. Der McMurdo-Sound (wo die »Miskatonic Antarctic Expedition« ihren Landeplatz hat) befindet sich gegenüber der Ross’schen Eisbarriere, nicht weit entfernt von der Stelle, wo Byrd sein erstes Lager aufgeschlagen hatte.
›At the Mountains of Madness‹ ist die Vision der Geschichte einer ganzen Zivilisation, von ihren mythischen Wurzeln über die Zeit ihrer kulturellen Blüte, durch ihre Jahre (Jahrmillionen!) des Konflikts und der Kriege bis zu ihrem Verfall und ihrer schließlichen Vernichtung durch ihre eigenen leichtsinnig geschaffenen Sklaven, die amorphen Shoggothen. Aus einer Horrorgeschichte wird hier nicht nur Science Fiction, sondern vielmehr Kulturkritik, eine Spenglersche Schau auf das »Ganze« kultureller Entwicklung. Aus anfänglichem Abscheu vor den Alten Wesen wächst Sympathie und Identifikation; dies ist eine der wenigen Passagen, wo Lovecraft immens pathetisch wird (»Was immer sie waren … sie waren Menschen«). Man beachte auch das kleine, feine Detail, dass die Vorfahren der Menschen in unserem Roman von den Alten Wesen als Nahrungsergänzung und Spielzeug (eine Art äffische Unterhalter) geschaffen wurden: Auch hier hat sich eine Schöpfung der Alten Wesen verselbstständigt.
Vieles wäre interpretationswürdig: Die Geschlechtslosigkeit der Alten Wesen (die sich pflanzlich vermehren) hält ihre Kultur von allen jenen Komplikationen frei, welche nach Lovecrafts Auffassung der menschlichen nur geschadet haben … In einer früheren Phase ihrer Geschichte (auf einem anderen Planeten) haben sie eine Phase technischer Zivilisation mit zahlreichen Maschinen durchlaufen, sich davon aber als einer ästhetisch unbefriedigenden Existenzweise wieder abgewandt: Die Alten Wesen sind hier ganz Träger von Lovecrafts eigenen kulturellen Idealen (wie das dann in ›The Shadow Out of Time‹ noch deutlicher wird). Lovecraft war tief davon überzeugt, dass Technik keine kulturelle Errungenschaft ist, sondern allenfalls das Leben bequemer macht. Wissenschaft und Kunst füllen das Leben der Alten Wesen in den Jahren der Blüte ihrer Zivilisation: Und das ist Lovecrafts eigenes Kulturideal.
In der theosophischen Tradition (mit der sich Lovecraft in ›The Call of Cthulhu‹ intensiv auseinandergesetzt hatte) ist der Nordpol »heiliges Land«, auf dem einst die frühesten Bewohner unseres Planeten gelebt haben, der Südpol dagegen »böses« Territorium, Ort eines nie näher beschriebenen Schreckens (darauf kann hier nicht näher eingegangen werden). Lovecrafts Kenntnis der theosophischen Literatur war nicht sehr tiefgehend. Die mythologiegeschichtlichen Anspielungen treten in ›At the Mountains of Madness‹ jedoch eher in den Hintergrund. Immerhin gibt es an einer Stelle eine lange Liste verschollener mythologischer Länder: »Atlantis und Lemuria, Commorium und Uzuldaroum und Olathoë im Land Lomar (…), Valusia, R’lyeh, Ib im Lande Mnar und die Namenlose Stadt in Arabia Deserta«. Lovecraft spielt hier auf das Erzählwerk seines Freundes und Schriftstellerkollegen Clark Ashton Smith an, dessen Fantasie Commorium und Uzuldaroum entsprungen sind und der auch über Atlantis, Lemuria und Valusia ganze Zyklen von Erzählungen verfasst hat. Smiths »Tsathoggua« wird öfters erwähnt. R’lyeh, Ib, Olathoë und die Namenlose Stadt sind Lovecrafts eigene Schöpfungen aus früheren Erzählungen. Auch das Necronomicon taucht wieder auf, ein wenig versatzstückhaft (warum hat der Paläontologe Lake es gelesen?), denn eine wirkliche Funktion hat es hier nicht.
»Etwas beklemmend Roerichartiges« lag über den Bergen des Wahnsinns mit ihren (zuerst natürlich nicht als solchen erkannten) Gebäuderesten. Nicholas Roerich (1874–1947) ist in der Tat eine weitere wesentliche Inspiration unseres Textes (sechsmal wird er genannt). Der russische Maler – ein früher Lehrer Chagalls – war Ende 1920 (im Gefolge der Revolution) von Russland in die USA geflohen und fand in New York breite Aufmerksamkeit. Roerich war nicht nur Maler, sondern auch Bühnenbildner, Schriftsteller, Okkultist, Weltreisender und energisch am Thema Verständigung der Völker und Kulturen interessiert. Anfang 1929 war er wegen dieses Einsatzes offiziell von der Universität Paris für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden (den dann aber F. B. Kellogg erhielt). Mehrere Expeditionen führten ihn nach Zentralasien, von wo er Kultgegenstände, Bücher und vor allem Anregungen für seine Kunst mitbrachte. Während er in frühen Jahren eher Themen aus russischer Folklore dargestellt hat, ist sein reifes Werk völlig beherrscht von einer übermächtigen Faszination durch die Berge und Glaubenswelten Zentralasiens. Die schneebedeckten Berge des Himalaja, die Götter und Legenden Tibets sind sein Thema, in immer neuen Variationen, in der Darstellung räumlicher Weite, mit einer starken Aufmerksamkeit für die Farben und Eindrücke des Himmels und der Landschaft. Roerich ist Symbolist und Landschaftsmaler; seine spirituellen Wurzeln liegen ganz in der religiösen Welt Tibets und Nordindiens, als deren Botschafter er sich sah. Dabei ist seine Sichtweise diejenige der klassischen Theosophie; seine Frau war die russische Übersetzerin von Helena Petrovna Blavatskys Secret Doctrine. Seine zahlreichen Bücher (die Lovecraft aber wohl nicht gelesen hatte) sind voll der merkwürdigsten Legenden über Tibet. Lovecraft scheint Roerich nie persönlich kennengelernt zu haben, aber im Mai 1930 besuchte er zum ersten Mal mit Frank Belknap Long das Roerich-Museum in New York, welches diesem schon zu Lebzeiten an der Ecke 103rd Street und Riverside Drive eingerichtet worden war. Dieses Museum befindet sich heute 317 West 107th. Street und ist in der Tat ein New Yorker Geheimtip. (Seit 1993 gibt es auch in Moskau ein sehenswertes Roerich-Museum).
Lovecrafts letzter Brief (den er nicht mehr zu Ende schreiben konnte, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und der nach seinem Tod auf seinem Schreibtisch gefunden wurde) an seinen alten Freund und Weggefährten James F. Morton (datiert: »Der alte Hügel, März 1937«) endet mit einer Evokation Roerichs: »Besser als die Surrealisten ist der gute alte Nick Roerich, dessen Hütte an der Ecke Riverside Drive und 103. Straße eines meiner Heiligtümer in der Peststadt ist. Etwas in seiner Art, mit Perspektive und Atmosphäre umzugehen, suggeriert mir andere Dimensionen und fremde Arten des Seins – oder zumindest den Zugang zu solchen. Solche fantastischen bearbeiteten Felsen in einsamen wüsten Gebirgszügen – jene ominösen, zerklüfteten Felsgipfel, die wirkten, als könnten sie einen ansehen – und vor allem jene merkwürdigen würfelförmigen Gebäude, die da an Steilabhängen haften und sich hin zu den verbotenen nadelspitzen Berggipfeln hinaufziehen!«.
Dies sind tatsächlich, abgesehen von ein paar Notizen im Krankenhaus, die letzten Worte, die Lovecraft zu Papier gebracht hat. Die Begegnung mit Roerichs Kunst war für den Schriftsteller offenbar eine genuine mystische Erfahrung. Mehrere Bildbände erlauben dem Interessiertem auch ohne Reise zu den Museen, Roerichs bemerkenswerte Kunst kennenzulernen. Diese ist nicht unheimlich, sehr wohl aber voll subtiler Suggestion.
In einem anderen Brief (vom 31. Oktober 1936 an E. Hoffmann Price) erklärt Lovecraft, warum er keine Horrorgeschichten im heimeligen Süden der USA ansiedeln könne: »… denn für mich verbindet sich nur das Kalte in höchstem Maße mit dem Bösen, Schrecklichen, und mit dem Tod. (…) Der Norden (und die Antarktis) mit seiner quälenden Kälte und seinen langen Nächten schreitenden Todes sind für mich die Epitome all dessen, was dem Menschen und dem Leben feindlich ist …« Die arktische Kälte wird zur Metapher für einen lebensfeindlichen Kosmos, in dem Kultur, Kunst und Wissenschaft (als das, was das Leben lebenswert macht – nach Lovecraft) nur begrenzt überleben können.
Die Geschichte des englischen Textes von ›At the Mountains of Madness‹ ist verwickelt und kann hier nicht beschrieben werden. Der Erstdruck war vom Herausgeber bearbeitet und um etwa 1000 Worte gekürzt worden, die in späteren Ausgaben dann teilweise wieder eingefügt worden sind. Die Fachliteratur zu unserem Text ist sehr reich.
Dem fiktionalen Wortlaut nach will ›At the Mountains of Madness‹ abschrecken bzw. vor einer weiteren Erforschung der Antarktis warnen. Natürlich ist der tatsächliche Effekt genau gegenteilig. Der Schrecken wird verschluckt von Faszination und Neugier. »Es wäre tragisch, ließe sich jemand ausgerechnet durch die Warnung, die ihn abschrecken soll, in jenes Todes- und Schreckensreich locken«. Das ist ein Satz von eigentümlicher Ambivalenz, der zugleich symbolisch für die ganze »dunkle Fantastik« stehen kann. Gesetzt der Fall, dies wäre ein authentischer Bericht – wer ließe sich davon abhalten, sobald als möglich Nachforschungen anzustellen? Die »Warnung« ist hier ein Mittel, unsere Neugier anzustacheln. Was einmal einer großartigen Zivilisation den Untergang bereitet hat, lauert noch heute. Es sind die versklavten Kräfte einer unzügelbaren Natur, die uns nicht weniger bedrohen. Lovecrafts letzter Roman ist also im Kern Zivilisationskritik. Ob er darin Plausibilität erreicht, ist an dieser Stelle nicht zu diskutieren.
Berge des Wahnsinns
I
Ich muss mein Schweigen brechen, weil Männer der Wissenschaft sich geweigert haben, meinem Rat zu folgen, ohne das Nötige zu wissen. Nur mit größtem Widerwillen lege ich die Gründe dar, aus denen ich mich gegen die geplante Invasion der Antarktis stelle – gegen die damit einhergehende Fossilienjagd und das übermäßige Anbohren und Abschmelzen der uralten Eiskappen. Und ich zögere umso mehr, als meine Warnung auf taube Ohren stoßen könnte.
Unvermeidlich werden Zweifel an den Tatsachen aufkommen, die ich enthüllen werde; doch ließe ich all das aus, was fantastisch und unglaubhaft erscheinen wird, so bliebe nichts mehr übrig. Die bislang zurückgehaltenen Fotografien, gewöhnliche Aufnahmen wie auch Luftbilder, werden zu meinen Gunsten sprechen, denn sie sind erschreckend deutlich und aussagekräftig. Gleichwohl wird man ihre Echtheit anfechten, wenn man bedenkt, was geschickte Fälschung alles zu erreichen vermag. Ganz sicher wird man die Tuschezeichnungen als offensichtlichen Betrug brandmarken, ungeachtet ihrer sonderbaren Technik, die Kunstsachverständigen auffällt und Anlass zum Grübeln geben sollte.
Letzten Endes muss ich mich auf die Urteilskraft und das Renommee der wenigen führenden Köpfe der Wissenschaft verlassen, deren Denken einerseits unabhängig genug ist, um mein Beweismaterial anhand seiner schrecklichen Überzeugungskraft und auch im Lichte gewisser urzeitlicher und überaus erstaunlicher Sagenkreise zu beurteilen; und die andererseits genügend Einfluss besitzen, um die Zunft der Wissenschaftler generell von jedem übereilten und allzu ehrgeizigen Forschungsvorhaben im Reich jener Berge des Wahnsinns abzuhalten. Es ist ein Unglück, dass vergleichsweise unbekannte Männer wie ich selbst und meine Kollegen, die nur mit einer kleinen Universität in Verbindung stehen, wenig Aussicht haben, wirkungsvoll Gehör zu finden, wenn es um Angelegenheiten äußerst bizarrer oder umstrittener Natur geht.
Zu unseren Ungunsten spricht zudem, dass wir genau genommen keine Spezialisten auf jenen Fachgebieten sind, um die es letztendlich geht. Meine Aufgabe als Geologe und Leiter der Expedition der Miscatonic University bestand ausschließlich in der Gewinnung tiefer Gesteins- und Bodenproben aus verschiedenen Teilen des antarktischen Kontinents, unterstützt durch den bemerkenswerten Bohrer, den Professor Frank H. Pabodie aus unserem Fachbereich für Ingenieurwesen entwickelt hatte. Ich hegte keineswegs den Wunsch, Pionierarbeit auf anderem Gebiet als diesem zu leisten. Allerdings hoffte ich, dass der Einsatz dieses neuartigen technischen Gerätes an verschiedenen Punkten entlang bereits zuvor erforschten Routen Material zutage fördern würde, die herkömmlichen Methoden bisher unerreichbar blieben.
Pabodies Bohrgerät war, wie die Öffentlichkeit bereits aus unseren Berichten weiß, einzigartig und revolutionär, da es leicht und tragbar war und das gewöhnliche artesische Bohrverfahren dergestalt mit dem Prinzip des kleineren runden Gesteinsbohrers verband, dass man sich in kurzer Zeit durch Schichten wechselnder Härte vorarbeiten konnte. Der stählerne Bohrkopf, das Gelenkbohrgestänge, der Benzinmotor, der zerlegbare hölzerne Bohrturm, die Sprengausrüstung, die Seile, der Schneckenbohrer zum Auswurf des Bohrschutts sowie die Rohrteilstücke für Bohrlöcher von zwölf Zentimetern Durchmesser und bis zu dreihundert Metern Tiefe bedeuteten mit allem notwendigen Zubehör keine größere Last als drei mit jeweils sieben Hunden bespannte Schlitten befördern konnten. Erreicht wurde dies durch die ausgeklügelte Aluminiumlegierung, aus der die meisten der Metallteile gefertigt waren. Vier große Dornier-Flugzeuge, konstruiert eigens für die enormen Flughöhen, die im antarktischen Hochland notwendig sind, und ausgestattet mit zusätzlichen, von Pabodie ersonnenen Treibstoffwärme- und Schnellstart-Vorrichtungen, konnten unsere gesamte Expedition von einem Basislager am Rande der großen Packeisgrenze zu verschiedenen geeigneten Punkten im Binnenland befördern, und von dort aus würde uns ein ausreichendes Kontingent an Schlittenhunden weiterbringen.
Wir beabsichtigten, ein so großes Terrain zu erschließen, wie es uns ein ganzer antarktischer Sommer gestatten würde – oder, falls unbedingt nötig, auch ein längerer Zeitraum. Hauptsächlich wollten wir in den Gebirgszügen und im Tafelland südlich des Ross-Meeres arbeiten; Regionen, die in unterschiedlichem Ausmaß von Shackleton, Amundsen, Scott und Byrd erforscht worden waren. Mittels häufiger Stützpunktwechsel mithilfe der Flugzeuge und über genügend große Entfernungen hinweg, um geologisch von Belang zu sein, erwarteten wir, dem Boden eine nie dagewesene Menge an Material abzugewinnen – vor allem den präkambrischen Formationen, die bis dahin nur eine karge Auswahl antarktischer Proben hergegeben hatten. Ebenso wollten wir eine größtmögliche Vielfalt an Proben aus den oberen fossilienhaltigen Gesteinslagen holen, da die Urgeschichte des Lebens in diesem unwirtlichen Reich des Eises und des Todes von höchster Bedeutung für die Kenntnis der Erdvergangenheit ist. Dass der antarktische Kontinent einstmals eine gemäßigte und sogar tropische Klimazone war, mit einer reichen Pflanzen- und Tierwelt, von der nur die Flechten, Meerestiere, Arachniden und Pinguine des Nordrandes überdauert haben, ist allgemein bekannt. Wir hatten die Hoffnung, dieses Wissen erweitern, spezifizieren und vertiefen zu können. Sollte eine einfache Bohrung Hinweise auf Fossilien ergeben, wollten wir das Loch durch Sprengung vergrößern, um Proben von geeigneter Größe und Beschaffenheit zu erhalten.
Unsere Bohrungen, deren Tiefe jeweils davon abhing, welche Hinweise die oberen Gesteins- oder Bodenschichten hergaben, sollten sich auf freie oder annähernd freiliegende Stellen beschränken – wobei es sich unweigerlich um Gebirgshänge und -kämme handeln musste, da die tieferen Landebenen unter einer bis zu eineinhalb Kilometer dicken, massiven Eisdecke liegen. Wir hatten zu wenig Zeit, um uns durch starke Schichten bloßen Eises hindurchzubohren, obwohl Pabodie eine Methode ersonnen hatte, die vorsah, Kupferelektroden in eine Vielzahl dicht nebeneinandergesetzter Bohrlöcher zu versenken und begrenzte Eismengen mittels elektrischen Stroms aus einem benzinbetriebenen Dynamo wegzuschmelzen. Ebendiese Methode – die wir auf einer Expedition wie der unseren nur versuchsweise anwenden konnten – gedenkt die geplante Starkweather-Moore-Expedition einzusetzen, ungeachtet der Warnungen, die ich seit unserer Rückkehr aus der Antarktis erhoben habe.
Die Öffentlichkeit kennt die Einzelheiten der Miskatonic-Expedition durch unsere regelmäßigen Funkberichte an den Arkham Advertiser und an Associated Press sowie durch später erschienene Zeitungsbeiträge von Pabodie und mir. Unsere Mannschaft zählte vier Angestellte der Universität – Pabodie, Lake vom Fachbereich Biologie, den Physiker Atwood, der zugleich Meteorologe war, und mich, den Vertreter der Geologie und offiziellen Expeditionsleiter – außerdem sechzehn Hilfskräfte: sieben graduierte Studenten der Miskatonic University sowie neun qualifizierte Mechaniker. Von diesen Sechzehn waren zwölf ausgebildete Piloten, die bis auf zwei von ihnen zudem hervorragende Funker waren. Acht von ihnen beherrschten die Navigation mittels Kompass und Sextant, was auch für Pabodie, Atwood und mich galt. Darüber hinaus waren selbstverständlich unsere beiden Schiffe – ehemalige Walfänger, deren Holzrümpfe für Fahrten ins Eismeer verstärkt und die zusätzlich mit dampfgetriebenen Hilfsmotoren ausgestattet worden waren – vollzählig bemannt.
Die Nathaniel-Derby-Pickman-Stiftung, unterstützt durch einige wenige Sonderzuwendungen, finanzierte die Expedition; daher waren unsere Vorbereitungen überaus gründlich, wenn sie auch wenig öffentliches Interesse erhielten. Die Hunde, die Schlitten, die Maschinen, das Lagerzubehör und unsere in Einzelteile zerlegten fünf Flugzeuge wurden in Boston übergeben, und dort belud man auch unsere Schiffe. Wir waren glänzend ausgerüstet für unser besonderes Vorhaben, und in allen Belangen des Nachschubs, Proviants, Transports und Lagerbaus profitierten wir von den hervorragenden Erfahrungen zahlreicher und überaus brillanter Vorgänger aus jüngster Zeit. Gerade die ungewöhnlich große Zahl und Berühmtheit dieser Vorgänger bewirkten, dass unsere eigene Expedition – groß angelegt wie sie war – in der weiten Welt so wenig Beachtung fand.
Wie die Zeitungen berichteten, stachen wir am 2. September 1930 vom Bostoner Hafen aus in See, segelten gemächlich die Küste hinab und durch den Panamakanal, legten in Samoa und Hobart, Tasmanien, an, wo wir letzte Vorräte aufnahmen. Kein Mitglied unserer Expedition war je zuvor in polaren Gefilden gewesen, daher verließen wir uns ganz auf unsere Schiffsführer – J. B. Douglas, der die Brigg Arkham befehligte und das Oberkommando über unsere Zweier-Flotte besaß, sowie Georg Thorfinnssen, den Kapitän der Bark Miskatonic – beides altgediente Waljäger in antarktischen Gewässern.
Je weiter wir den bewohnten Teil der Welt hinter uns ließen, desto tiefer sank im Norden die Sonne und desto länger stand sie mit jedem Tag über dem Horizont. Auf etwa 62° südlicher Breite sichteten wir unsere ersten Eisberge – tafelförmige Objekte mit lotrechten Seitenflächen –, und kurz bevor wir den Polarkreis erreichten, den wir am 20. Oktober unter Begehung der entsprechenden wunderlichen Seemannsbräuche überquerten, plagten wir uns beträchtlich mit einem Eisfeld. Die sinkenden Temperaturen machten mir nach unserer langen Reise durch die Tropen sehr zu schaffen, doch angesichts der weit schlimmeren Unbilden, die uns noch bevorstanden, versuchte ich mich dagegen abzuhärten. Häufig wurde ich von den seltsamen atmosphärischen Erscheinungen in Bann gezogen; unter anderem einer verblüffend lebensechten Luftspiegelung – der ersten, die ich je erblickte –, wobei ferne Bergformationen sich in die Zinnen unvorstellbarer kosmischer Schlösser verwandelten.
Wir bahnten uns den Weg durch das Eis, das zum Glück weder weitflächig noch dicht gepackt war, bis wir bei 67° südlicher Breite, 175° nördlicher Länge wieder offene Gewässer erreichten. Am Morgen des 26. Oktober schimmerte im Süden ein starker Landblink auf, und noch vor der Mittagsstunde erfasste uns alle eine prickelnde Erregung, als wir eine gewaltige, hoch aufragende und schneegekrönte Bergkette sahen, die sich vor uns ausbreitete und bald über unser gesamtes Blickfeld erstreckte. Endlich waren wir einem Außenposten des großen unbekannten Kontinents und seiner geheimnisvollen Welt eisigen Todes begegnet. Offenbar handelte es sich bei diesen Gipfeln um die von Ross entdeckten Admirality-Berge, und unsere Aufgabe bestand nun darin, Kap Adare zu umrunden und entlang der Ostküste von Victoria-Land bis zur Position unseres geplanten Stützpunkts zu segeln, der auf 77° 9’ südlicher Breite am Ufer des McMurdo-Sunds, zu Füßen des Vulkanes Erebus, errichtet werden sollte.
Der letzte Teil der Reise war eindrucksvoll und beflügelte die Fantasie. Mächtige kahle Gipfel türmten sich geheimnisvoll drohend ohne Unterbrechung im Westen auf, während die tief stehende nördliche Mittagssonne oder die noch niedrigere, den Horizont streifende südliche Mitternachtssonne ihre diesigen roten Strahlen über die weißen Schneefelder ergossen, über bläuliche Eisflächen und Wasserrinnen und über die schwarzen Flecken nackter Granithänge. Um die öden Bergkämme fegten in Abständen wütende Stöße des furchtbaren antarktischen Windes, in dessen Heulen ich zuweilen vage Andeutungen eines wilden, halb wahrnehmbaren melodischen Pfeifens mit einem großen Tonumfang heraushörte und das mir aus irgendeiner unterbewussten Erinnerung heraus beunruhigend und irgendwie sogar furchterregend vorkam. Etwas an dieser Szenerie gemahnte mich an die seltsamen und verstörenden asiatischen Gemälde von Nicholas Roerich und an die noch seltsameren und noch verstörenderen Beschreibungen der von bösen Sagen umrankten Hochebene von Leng, die in dem gefürchteten Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul Alhazred enthalten sind. Ich sollte es noch bereuen, jemals einen Blick in dieses monströse Buch aus der Universitätsbibliothek geworfen zu haben.
Am 7. November, der westliche Gebirgszug war zeitweise außer Sicht geraten, passierten wir die Franklin-Insel, und am folgenden Tag erblickten wir vor uns auf der Ross-Insel die Kegel des Mount Erebus und des Mount Terror, und dahinter die lang gezogenen Kämme der Parry-Berge. Gen Osten erstreckte sich jetzt die niedrige, weiße Linie der großen Eisbarriere, die senkrecht bis zu einer Höhe von sechzig Metern emporstrebte, gleich den Felsklippen von Quebec, und das Ende der Seefahrt in südlicher Richtung markierte. Nachmittags liefen wir in den McMurdo-Sund ein und ankerten vor der Küste leeseits des rauchenden Mount Erebus. Der von Schlacke bedeckte Gipfel ragte gut dreitausendfünfhundert Meter vor dem östlichen Firmament auf wie ein japanischer Holzschnitt des heiligen Fudschijama, während dahinter die weiße, geisterhafte Erhebung des Mount Terror emporwuchs, fast dreitausend Meter hoch und heute als Vulkan erloschen.
In Abständen stieß Erebus Rauchschwaden aus, und einer der Studenten – ein brillanter junger Bursche namens Danforth – wies auf lavaartige Krusten an dem schneebedeckten Abhang hin und bemerkte, dass dieser Berg, der 1840 entdeckt worden war, zweifellos Edgar Allan Poes dichterische Einbildung inspiriert habe, als jener sieben Jahre später schrieb:
… die Laven, die ruhelos fließen
Den Yaneek hinab in schwefligen Strömen
Und die in die Eiswelt des Pols sich ergießen –
Die ächzen, während sie dem Berg Yaneek entströmen,
Um sich am nördlichen Pol zu ergießen.
Danforth war ein großer Liebhaber bizarrer Literatur und sprach viel über Poe. Ich interessierte mich selbst dafür, weil Poes einzige lange Erzählung – der verstörende und rätselhafte Arthur Gordon Pym – teilweise in der Antarktis spielt.
Auf der öden Küste und der hochragenden Eisbarriere im Hintergrund kreischten Myriaden grotesker Pinguine und schlugen mit ihren Stummelflügeln, während sich im Wasser fette Seehunde tummelten, die umherschwammen oder über große Schollen langsam treibenden Eises robbten.
Mit Hilfe kleiner Boote gelang es uns kurz nach Mitternacht am Morgen des 9. November unter schwierigen Bedingungen, auf der Ross-Insel an Land zu gehen. Dabei spannten wir von jedem der beiden Schiffe ein Tau und trafen Vorbereitungen, um mittels einer Behelfskonstruktion aus Hosenbojen Vorräte und Ausrüstungen überzusetzen.
Unsere ersten Schritte auf antarktischem Boden wurden von erregenden und vielfältigen Empfindungen begleitet, obwohl uns an genau dieser Stelle bereits die Expeditionen von Scott und Shackleton vorausgegangen waren. Unser Lager auf der Eisküste unter dem Vulkanhang sollte nur vorläufig sein, das Hauptquartier sollte an Bord der Arkham bleiben. Wir brachten alle unsere Bohrgeräte an Land, ebenso die Hunde, Schlitten, Zelte, Proviantkisten und Treibstoffvorräte, die Anlage für die Schmelzversuche, die Kameras für normale Aufnahmen und für Luftbilder, die Flugzeugteile und anderes Ausrüstungsmaterial, einschließlich drei kleine, tragbare Funkgeräte – zusätzlich zu jenen in den Flugzeugen –, die in der Lage waren, die Verbindung zur Funkzentrale auf der Arkham von jedem Teil des antarktischen Kontinents zu halten, den wir erreichen würden. Die große Funkanlage des Schiffes, die unseren Kontakt zur Außenwelt gewährleistete, sollte Pressemitteilungen an die leistungsstarke Sende- und Empfangsstation des Arkham Advertiser auf Kingsport Head in Massachusetts durchgeben. Wir hofften, unsere Arbeit in einem einzigen antarktischen Sommer abschließen zu können; doch falls sich dies nicht bewerkstelligen ließ, würden wir auf der Arkham überwintern und noch vor dem Zufrieren des Seewegs die Miskatonic nach Norden senden, um Vorräte für einen weiteren Sommer zu beschaffen.
Ich brauche nicht zu wiederholen, was über unsere ersten Arbeitsschritte bereits in den Zeitungen stand: unsere Besteigung des Mount Erebus; unsere erfolgreichen Mineralbohrungen an verschiedenen Punkten der Ross-Insel und die einzigartige Schnelligkeit, mit der Pabodies Erfindung dabei selbst massive Felsschichten überwand; die Erprobung der kleinen Schmelzausrüstung; unsere gefahrvolle Ersteigung der großen Eisbarriere mitsamt Schlitten und Vorräten – und schließlich die Montage fünf großer Flugzeuge im Lager auf der Barriere. Der Gesundheitszustand unserer an Land operierenden Gruppe – zwanzig Mann und fünfundfünfzig Alaska-Schlittenhunde – war gut, allerdings hatten wir bis dahin natürlich auch noch keine wirklich vernichtenden Temperaturen oder Sturmwinde erlebt. Die meiste Zeit zeigte das Thermometer Temperaturen zwischen -18° und -5° an, und solche Kältegrade waren wir von den Wintern in Neuengland gewöhnt. Das Lager auf der Barriere war auf mittlere Dauer angelegt und sollte als Nachschubdepot für Treibstoff, Proviant, Dynamit und anderen Bedarf dienen.
Vier unserer Flugzeuge genügten, um die eigentliche Forschungsausrüstung zu befördern, sodass wir die fünfte Maschine mit einem Piloten und zwei Mann aus der Schiffsbesatzung beim Depot zurückließen, damit man uns von der Arkham aus erreichen konnte, falls unsere Erkundungsflugzeuge alle verloren gingen. Später, wenn nicht mehr jede dieser Maschinen für den Transport unserer Gerätschaften benötigt wurden, wollten wir eine oder zwei davon für ständige Pendelflüge zwischen diesem Depot und einem dauerhaften Basislager auf dem neun- bis zwölfhundert Kilometer weiter südlich gelegenen großen Tafelland jenseits des Beardmore-Gletschers abstellen. Trotz der fast einmütigen Berichte über schreckliche Winde und Stürme, die von dem Plateau herabwehten, entschlossen wir uns, zugunsten von Wirtschaftlichkeit und Effizienz das Risiko einzugehen und keine Zwischendepots anzulegen.
Unsere Funkberichte zeugten von dem atemberaubenden, vierstündigen Nonstop-Flug unserer Staffel über hohes Schelfeis am 21. November. Im Westen ragten gewaltige Gipfel auf und die unermessliche Stille hallte vom Brummen unserer Motoren wider. Der Wind machte uns kaum zu schaffen, und die Funkkompasse brachten uns sicher durch das einzige dichte Nebelfeld, das wir durchflogen. Als sich zwischen dem 83. und 84. Breitengrad vor uns eine riesige Erhebung drohend auftürmte, wussten wir, dass wir den Beardmore-Gletscher erreicht hatten, den größten Talgletscher der Welt, und dass das eisbedeckte Meer nun einer unregelmäßigen, gebirgigen Küstenlinie wich. Schließlich drangen wir vollends in die weiße, seit Ewigkeiten tote Welt des äußersten Südens ein. Gerade als wir uns dessen bewusst wurden, sahen wir weitab im Osten den Gipfel des Mount Nansen zu seiner Höhe von fast fünftausend Metern aufragen.
Die erfolgreiche Errichtung des südlichen Stützpunktes oberhalb des Gletschers auf 86° 7’ südlicher Breite und 174° 23’ östlicher Länge sowie die ungeheuer schnellen und ergiebigen Bohrungen und Sprengungen an verschiedenen Punkten, zu denen uns unsere Schlittenfahrten und kurzen Erkundungsflüge führten, gehören bereits der Geschichte an; ebenso die schwierige und triumphale Besteigung des Mount Nansen durch Pabodie und zwei der Studenten – Gedney und Carroll – vom 13. bis 15. Dezember. Wir befanden uns knapp dreitausend Meter über dem Meeresspiegel, und als Probebohrungen an bestimmten Punkten nur vier Meter unter der Schnee- und Eisoberfläche auf festen Untergrund stießen, machten wir ausgiebigen Gebrauch von der kleinen Schmelzvorrichtung und brachten Bohrer und Dynamit an zahlreichen Stellen zum Einsatz, wo kein früherer Forscher es auch nur erträumt hätte, Mineralproben zu gewinnen. Die präkambrischen Granite und Beacon-Sandsteine, die wir auf diese Weise fanden, bestärkten uns im Glauben, dass dieses Tafelland homogen war mit der westwärts sich ausdehnenden Hauptmasse des Kontinents, sich jedoch von dessen östlichen Teilen unterhalb Südamerikas leicht unterschied – welche wir zu jenem Zeitpunkt für einen eigenständigen, kleineren Kontinent hielten, getrennt vom größeren durch eine Eisbrücke zwischen dem Ross-Meer und dem Weddell-Meer, eine Hypothese, die Byrd inzwischen allerdings widerlegt hat.
In manchen der Sandsteine, die wir durch Bohrungen sondiert und anschließend hervorgesprengt und ausgemeißelt hatten, entdeckten wir einige hochinteressante Spuren und Überreste von Fossilien; vornehmlich Farne, Algen, Trilobiten, Seelilien und molluske Formen wie zum Beispiel Lingulata und Gastropoda – denen im Zusammenhang mit der Urgeschichte dieses Gebiets allesamt beträchtliche Bedeutung zukam. Außerdem fanden wir einen sonderbaren dreieckigen, gekritzten Abdruck, dessen Durchmesser an der breitesten Stelle etwa dreißig Zentimeter betrug und den Lake aus drei verschiedenen, einem tiefen Sprengloch entnommenen Schieferbruchstücken zusammensetzte. Diese Bruchstücke stammten von einer Fundstelle, die westlich, in der Nähe des Queen-Alexandra-Gebirges, lag. Aus biologischer Sicht schien Lake ihre sonderbare Struktur außerordentlich rätselhaft und spannend zu finden, obwohl sie sich für meinen Geologenblick nicht wesentlich von den Riffelungen unterschied, die in Sedimentgesteinen recht häufig vorkommen. Da Schiefer nichts anderes ist als eine metamorphe Formation, die aus der Zusammenpressung einer Sedimentschicht hervorgeht, und da der dabei entstehende Druck seltsame Verzerrungen bei sämtlichen darin eingelagerten Strukturen hervorruft, war ich nicht besonders verwundert angesichts dieses Abdrucks.
Am 6. Januar 1931 überflogen Pabodie, Daniels, alle sechs Studenten, vier Mechaniker und ich selbst in zwei unserer großen Flugzeuge den Südpol, wobei uns ein plötzlicher Höhenwind, der sich glücklicherweise nicht zu einem richtigen Sturm auswuchs, zum Niedergehen zwang. Es war, wie die Zeitungen es nannten, einer von mehreren Erkundungsflügen, die dem Versuch dienten, neue Landschaftsmerkmale in Gebieten auszukundschaften, wohin frühere Entdecker nicht vorgedrungen waren. Unsere anfänglichen Flüge verliefen in dieser Hinsicht enttäuschend, wenngleich sie uns mit einigen großartigen Eindrücken von den überaus fantastischen und trügerischen Luftspiegelungen der Polargebiete belohnten, auf die wir während unserer Seereise bereits einen kleinen Vorgeschmack erhalten hatten. Weit entfernte Berge schwebten am Himmel wie verzauberte Städte und oft verschwamm die ganze weiße Welt unter dem magischen Schein der tief stehenden Mitternachtssonne zu einem goldenen, silbernen und scharlachroten Land dunsanianischer Träume und abenteuerlicher Verheißung. An bewölkten Tagen wurde das Fliegen ausgesprochen schwierig, weil dann allzu leicht der schneebedeckte Boden und der verschneite Himmel zu einer einzigen mystisch gleißenden Leere verschmolzen, in der keine sichtbare Horizontlinie beides voneinander trennte.
Endlich beschlossen wir, unseren ursprünglichen Plan durchzuführen und mit unseren vier Erkundungsmaschinen achthundert Kilometer weit nach Osten zu fliegen und ein neues Nebenlager an einer Stelle zu errichten, die auf dem kleineren Teilkontinent lag – davon gingen wir damals irrtümlich noch aus. Dort gewonnene geologische Proben würden zu Vergleichszwecken nützlich sein. Unser guter Gesundheitszustand hielt an – Limonensaft glich unsere einseitige Ernährung mit Konservenkost und Pökelfleisch hinreichend aus und dank Temperaturen, die -10° selten unterschritten, konnten wir meistens auf die dicksten Pelze verzichten. Jetzt herrschte Hochsommer, und wenn wir zügig und umsichtig vorgingen, mochte es uns gelingen, die Arbeiten bis zum März abzuschließen und um eine ermüdende Überwinterung während der langen antarktischen Nacht herumzukommen. Mehrfach brachen von Westen her wütende Sturmwinde über uns herein, doch überstanden wir sie unbeschadet, dank Atwoods Geschick, aus schweren Schneeblöcken behelfsmäßige Flugzeugunterstände und Windbrecher zu errichten und die wichtigsten Lagergebäude mit Schnee zu verstärken. Dass wir bisher so viel Glück und Erfolg gehabt hatten, war fast schon unheimlich.
Die Außenwelt war natürlich über unsere Forschungen unterrichtet und erfuhr auch von Lakes befremdlichem und hartnäckigem Beharren auf einer Exkursion in westlicher – oder eher nordwestlicher – Richtung, ehe wir endgültig in das neue Basislager umziehen würden. Anscheinend hatte er lange, und mit halsstarriger Kühnheit, über jenen dreieckigen, gekritzten Abdruck im Schiefer nachgegrübelt und dabei in Bezug auf dessen Beschaffenheit und erdgeschichtlichen Zeitraum gewisse Unstimmigkeiten hineingelesen, die seine Neugier aufs Höchste anstachelten und den Wunsch in ihm weckten, weitere Bohrungen und Sprengungen im Gebiet jener westwärts verlaufenden Formation vorzunehmen, zu der die zutage geförderten Bruchstücke offensichtlich gehörten. Er war der merkwürdig festen Überzeugung, dass der Abdruck von irgendeinem massigen, unbekannten und absolut unklassifizierbaren Organismus mit einem erstaunlich hohen Evolutionsgrad stammte, obzwar das Gestein, das ihn beherbergt hatte, einem so unendlich alten Erdzeitalter angehörte – dem Kambrium, wenn nicht sogar Präkambrium –, dass nicht nur das Vorhandensein hochentwickelten, sondern überhaupt alles Lebens oberhalb des Stadiums der Einzeller oder bestenfalls der Trilobiten mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen war. Diese Bruchstücke samt ihrem rätselhaften Abdruck mussten zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Jahre alt sein.
II
Die Öffentlichkeit reagierte mit Interesse und Fantasie auf unsere Funkberichte über Lakes Abflug nach Nordwesten in Gefilde, die bisher nie eines Menschen Fuß berührt oder menschliche Vorstellung ermessen hatten. Seine abenteuerlichen Hoffnungen auf eine Umschreibung der gesamten biologischen und geologischen Wissenschaften ließen wir dabei unerwähnt. Seine vorausgegangene Schlittenexpedition zu Testbohrzwecken, die er mit Pabodie und fünf anderen vom 11. bis zum 18. Januar unternahm, hatte mehr und mehr des urzeitlichen Schiefers zutage gefördert – leider wurde die Reise vom Verlust zweier Schlittenhunde überschattet, die bei der Überquerung einer der großen Druckwulste im Eis ums Leben kamen – und die einzigartige Fülle offenkundig fossiler Spuren in dieser unvorstellbar alten geologischen Schicht erweckte sogar mein Interesse. Dennoch, diese Abdrücke stammten von sehr primitiven Lebensformen und hatten wenig Rätselhaftes an sich, bis auf die Tatsache, dass überhaupt Spuren von Leben in Gesteinsschichten vorkamen, die derart ins Präkambrium zu verweisen schienen. Ich vermochte daher, noch immer keinen vernünftigen Sinn in Lakes Forderung nach einer Unterbrechung unseres auf Zeitersparnis ausgerichteten Programms zu erkennen – einer Unterbrechung, die den Einsatz sämtlicher vier Flugzeuge, vieler Männer und der gesamten technischen Ausrüstung der Expedition erforderte.
Letztendlich unterband ich das Vorhaben nicht, entschied mich jedoch selbst gegen die Teilnahme an dem nordwestlichen Vorstoß, so ungern Lake auch auf mein geologisches Fachwissen verzichtete. Während er unterwegs war, wollte ich mit Pabodie und fünf Männern im Lager bleiben und abschließende Vorkehrungen für dessen Verlegung nach Osten treffen. Zur Vorbereitung dieser Verlegung war eines der Flugzeuge im Einsatz gewesen, um vom McMurdo-Sund einen reichlichen Treibstoffvorrat heranzuschaffen; doch dies konnte vorübergehend unterbrochen werden. Ich behielt einen Schlitten und neun Hunde für uns zurück, da es unklug gewesen wäre, in einer völlig unbewohnten Welt äonenalten Todes auch nur zeitweilig ohne Beförderungsmöglichkeit zu bleiben.
Lakes Sonderexpedition ins Unbekannte gab, wie man sich erinnern wird, mithilfe der Kurzwellensender an Bord der Flugzeuge ihre eigenen Berichte durch; diese wurden von unserem Funkgerät im Südlager und gleichzeitig von der Arkham am McMurdo-Sund aufgefangen, die sie anschließend an die Außenwelt weitergab. Lakes Mannschaft flog am 22. Januar um vier Uhr morgens los, und nur zwei Stunden später erreichte uns der erste Funkbericht, in dem Lake mitteilte, an einer knapp fünfhundert Kilometer von uns entfernten Stelle zwischengelandet zu sein und damit begonnen zu haben, in bescheidenem Umfang Eis abzuschmelzen und Bohrungen vorzunehmen. Sechs Stunden später meldete eine zweite und überaus erregte Funkbotschaft, man habe in emsiger, fieberhafter Arbeit einen Schacht von geringer Tiefe gebohrt und ausgesprengt und sei als Krönung des Ganzen auf Schieferbruchstücke gestoßen, die fast ebensolche rätselhaften Abdrücke aufwiesen wie jener erste Fund.
Drei Stunden später meldete ein kurzer Funkspruch, dass die Flugzeuge inmitten eines heftigen, beißenden Sturmes erneut starten würden. Als ich mit einem Protest gegen weitere Waghalsigkeiten antwortete, erwiderte Lake knapp, dass seine neuen Proben jedes Risiko rechtfertigten. Mir wurde klar, dass seine Erregung ihn bis zur Meuterei treiben würde und dass ich nichts unternehmen konnte, um diese leichtsinnige Gefährdung unserer Expedition zu verhindern. Zugleich war es erschreckend, sich vorzustellen, wie Lake tiefer und tiefer in jene trügerische und unheilvolle weiße Unendlichkeit der Stürme und unergründeten Geheimnisse vordrang, die sich beinahe zweitausendfünfhundert Kilometer weit bis zum halb bekannten, halb vermuteten Küstenstreifen von Queen-Mary- und Knox-Land erstreckte.
Dann, nach vielleicht weiteren eineinhalb Stunden, erreichte uns jene doppelt aufgeregte Meldung aus Lakes in der Luft befindlicher Maschine, die meine Vorbehalte fast ins Gegenteil verkehrte und mich wünschen ließ, ich hätte mich ihm angeschlossen:
»22.05 Uhr. Unterwegs. Schneesturm überstanden, voraus Gebirgskette gesichtet, höher als alle bisher entdeckten. Vielleicht so hoch wie der Himalaja, die Plateauhöhe einberechnet. Vermutlich auf Breite 76° 15’, Länge 113° 10’ Ost. Reicht zu beiden Seiten so weit man blicken kann. Glauben zwei rauchende Bergkegel zu erkennen. Alle Gipfel schwarz und schneefrei. Von dorther wehender Sturm behindert Navigation.«
Ab jetzt hockten Pabodie, die Männer und ich mit angehaltenem Atem neben dem Funkempfänger. Der Gedanke an diesen titanischen, über tausend Kilometer entfernten Gebirgswall erregte unsere ganze Abenteuerlust; und wir waren begeistert, dass unserer Expedition, wenn schon nicht uns persönlich, diese Entdeckung zu verdanken war.
Nach einer halben Stunde meldete sich Lake erneut:
»Moultons Maschine zu Landung auf Plateau im Vorgebirge gezwungen, aber niemand verletzt und Reparatur vielleicht möglich. Werden wichtigste Ladung für Rückflug oder nötigenfalls Weiterflug auf übrige drei Maschinen verteilen, augenblicklich jedoch keine größeren Flüge vonnöten. Gebirge übertrifft alles Vorstellbare. Werde in Carrolls Maschine ohne allen Ballast auf Erkundungsflug gehen.
Könnt euch so etwas einfach nicht vorstellen. Höchste Gipfel müssen zehntausend Meter übertreffen. Everest aus dem Rennen. Atwood will Höhe mit Winkelmesser ermitteln, während Carroll und ich aufsteigen. Vermutlich im Irrtum bezüglich Kegeln, denn Formationen anscheinend geschichtet. Vielleicht präkambrischer Schiefer vermischt mit anderen Schichten. Gipfelumrisse seltsam – regelmäßige Ansammlungen von Quadern an höchsten Spitzen. Fantastisch anzusehen im rotgoldenen Licht der tief stehenden Sonne. Wie geheimnisvolles Traumland oder Tor zu verbotener Welt nie erschauter Wunder. Wünschte, ihr wäret hier, um mit eigenen Augen zu sehen.«
Obwohl es eigentlich Schlafenszeit war, dachte nicht einer von uns Zuhörern auch nur einen Moment lang daran, sich hinzulegen. Ganz ähnlich musste es sich am McMurdo-Sund verhalten, wo das Nachschubdepot und die Arkham Lakes Mitteilungen ebenfalls auffingen, denn Kapitän Douglas funkte allseits Glückwünsche zu der bedeutenden Entdeckung und Sherman, der Funker des Depots, schloss sich ihm an. Natürlich kam uns der Flugzeugschaden ungelegen, doch hofften wir, dass er sich leicht würde beheben lassen.
Dann, es war gegen 23.00 Uhr, traf Lakes nächster Funkspruch ein:
»Befinde mich mit Carroll über den höchsten Vorbergen. Scheuen bei diesem Wetter die richtig hohen Gipfel, nehmen sie uns aber später vor. Höhe zu gewinnen ist furchtbar mühsam und hier oben zu fliegen schwierig, aber lohnend. Hauptgebirgszug ziemlich kompakt, daher unmöglich, zu sehen, was dahinter liegt. Höchste Gipfel übertreffen Himalaja, wirken sehr eigentümlich. Gebirgskamm sieht nach präkambrischem Schiefer aus, mit deutlichen Spuren zahlreicher anderer aufgeworfener Schichten. Lag falsch bezüglich Vulkantätigkeit. Erstreckt sich zu beiden Seiten weiter als das Auge reicht. Oberhalb von etwa sechstausendfünfhundert Metern von Winden schneefrei gefegt.
Seltsame Gebilde an Hängen der höchsten Berge. Große, flache, quadratische Blöcke mit vollkommen senkrechten Seitenflächen und rechtwinklige Verläufe niedriger, lotrechter Mauern, ähnlich den an steilen Bergflanken klebenden alten asiatischen Burgen in Roerichs Gemälden. Von Weitem sehr eindrucksvoll. Flogen nah an einige heran, und Carroll glaubt, sie bestehen aus kleineren Einzelstücken, aber das sind wohl eher Verwitterungsspuren. Kanten meist abgebröckelt und rundgeschliffen, so als seien sie über Millionen von Jahren Stürmen und klimatischen Veränderungen ausgesetzt gewesen.
Teile davon, vor allem die oberen Abschnitte, scheinen aus hellerem Gestein als alle sichtbaren Schichten der eigentlichen Berghänge, daher augenscheinlich kristallinen Ursprungs. Dichtes Anfliegen offenbart zahlreiche Höhleneingänge, manche ungewöhnlich regelmäßig geformt, viereckig oder halbkreisförmig. Ihr müsst kommen und das erforschen. Glaube, Mauer direkt auf einer der Bergspitzen gesehen zu haben. Höhe scheint mindestens neun- bis zehntausend Meter zu betragen. Bin selbst auf sechstausenddreihundert Metern in höllischer, schneidender Kälte. Wind heult und pfeift durch Pässe und um Höhleneingänge, aber Fliegen bislang ohne Gefahr.«
Lake hielt uns noch eine weitere halbe Stunde lang unter einem Trommelfeuer seiner Eindrücke und teilte uns mit, dass er beabsichtige, einen der Gipfel zu Fuß zu ersteigen. Ich antwortete, ich würde zu ihm stoßen, sobald er ein Flugzeug schicken könne, und dass Pabodie und ich einen geeigneten Plan zur Treibstoffversorgung ausarbeiten – wo und wie wir angesichts der veränderten Expeditionsziele unsere Benzindepots anlegen sollten. Lakes Bohrungen wie auch seine Flugeinsätze würden einen großen Treibstoffvorrat für das Lager erforderlich machen, das er am Fuße der Berge aufschlagen wollte; und es war durchaus möglich, dass der Flug nach Osten gar nicht mehr stattfinden würde, zumindest nicht in diesem Sommer. Ich funkte in dieser Angelegenheit Kapitän Douglas an und bat ihn, mit dem einzelnen Hundegespann, das wir dort zurückgelassen hatten, so viel Treibstoff wie möglich aus den Schiffen auf die Eisbarriere zu bringen. Wir mussten auch eine direkte Luftbrücke über das unbekannte Gebiet zwischen Lakes Standort und dem McMurdo-Sund schaffen.
Später funkte Lake mich an, um mitzuteilen, dass er sich entschlossen habe, das Lager dort zu belassen, wo Moultons Flugzeug notgelandet war und wo dessen Reparatur bereits voranschritt. Die Eisdecke sei sehr dünn und ließe hie und da dunklen Untergrund durchscheinen, und er wolle vor Ort einige Bohrungen und Sprengungen ansetzen, ehe er irgendwelche Schlittenxpeditionen oder Bergbesteigungen in Angriff nehme. Er sprach von der unbeschreiblichen Erhabenheit der ganzen Szenerie und davon, welch eigentümliche Empfindungen es auslöse, sich im Windschatten riesiger, schweigender Gipfel zu befinden, deren Kämme emporragten wie eine himmelstürmende Mauer am Ende der Welt.
Atwoods Winkelmessungen hatten die Höhe der fünf mächtigsten Bergzinnen auf neuntausend bis zehntausendfünfhundert Meter berechnet. Die Schneefreiheit der höheren Lagen versetzte Lake ganz offenkundig in Sorge, denn sie sprach für das gelegentliche Aufkommen ungeheurer Orkane, deren Wut alles übertraf, was wir bisher kennengelernt hatten. Sein Lager lag wenig mehr als acht Kilometer vom Fuße der höheren, steil aufragenden Vorberge entfernt. Ich spürte geradezu einen Anflug unterbewusster Angst in seinen Worten – hinweggefunkt über eine mehr als tausend Kilometer weite Leere aus Eis –, als er darauf drängte, wir alle sollten uns beeilen, damit wir die fremdartige, neu entdeckte Gegend baldigst verlassen könnten. Jetzt wolle er sich erstmal schlafen legen, nach einem langen Tag geradezu beispiellos rastloser, antrengender und ergebnisreicher Arbeit.
Am Morgen führte ich eine Funkkonferenz mit Lake und Kapitän Douglas an ihren so weit voneinander entfernten Standorten. Wir beschlossen, dass eine von Lakes Maschinen zu meinem Lager fliegen sollte, um Pabodie, die fünf Männer und mich abzuholen und darüber hinaus so viel Treibstoff wie möglich mitzunehmen. Die Frage, was mit dem verbleibenden Treibstoff geschehen sollte, konnte nach unserer Entscheidung über einen östlichen Vorstoß auch noch in einigen Tagen entschieden werden, da Lakes Vorräte erst einmal ausreichten zur Beheizung des Lagers und für die Bohrungen. Letztlich würden die Vorräte des alten Südlagers neu aufgefüllt werden müssen, doch falls wir die Ostexpedition verschoben, würden wir es vor dem nächsten Sommer nicht mehr benötigen, außerdem musste Lake in der Zwischenzeit ein Flugzeug schicken, um eine direkte Luftlinien-Route zwischen seinen neu entdeckten Bergen und dem McMurdo-Sund zu finden.
Pabodie und ich trafen Vorbereitungen, um unser Lager für kürzere Zeit – oder falls nötig, auch für länger – dicht zu machen, je nachdem, worauf es hinauslief: Falls wir in der Antarktis überwinterten, würden wir wahrscheinlich direkt von Lakes Lager zur Arkham fliegen, ohne an diesen Ort zurückzukehren. Einige unserer kegelförmigen Zelte waren mit Blöcken aus Pressschnee befestigt worden, und wir beschlossen nun, diese Arbeiten zu Ende zu bringen und einen dauerhaften Stützpunkt zu schaffen. Da die Expedition reichlich über Zelte verfügte, hatte Lake in dieser Hinsicht alles dabei, was sein Lager benötigte, selbst wenn wir dazukamen. Ich funkte Lake, dass Pabodie und ich nach einem weiteren Arbeitstag und einer Nacht des Schlafs für den Flug nach Nordwesten bereit sein würden.