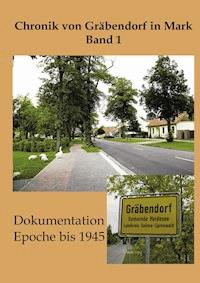
Chronik von Gräbendorf Band 1 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Transkription der handschriftlich in altdeutscher Sütterlin-Schrift aufgezeichneten Chronik von Gräbendorf, OT der Gemeinde Heidesee, bis 1945. Bearbeitung in den Jahren 1998 bis 2005 durch R. Kalisch, H. Marcks, F. Kerstan, S.+A. Bauer, A. Haug und L. Rintisch Die Zugehörigkeit zum Schenkenländchen mit der Stadt Teupitz und die Entwicklung von Gräbendorf als Angerdorf mit starker landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Prägung sowie der Einfluß des Jagdschlosses von Königs Wusterhausen ist interessant zu lesen. Die Originalchronik wurde handschriftlich von Rudolf Müller, später von Hermann Schmidt, geschrieben. Das geschichtlich wertvolle Chronikwerk hat mehrere Jahre unter den denkbar ungünstigsten Witterungsreinflüssen im Holzschuppen einer Familie gelegen und der Zustand war demzufolge erbärmlich, wie einige Bilder als Gesamtseite zeigen. Sie wurde im Jahr 2005 vom Schimmel befreit und neu eingebunden hoffentlich für viele Jahre erhalten. "Wenn ich es unternahm, die Geschichte des Ortes von Gräbendorf aus der Vor- und Jetztzeit zusammenzustellen, so geschah es in der Absicht, das Wenige was aus alter Zeit noch bekannt ist, zu sammeln und dadurch vor gänzlicher Vergessenheit zu bewahren."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
zur Drucklegung der Chronik von Gräbendorf
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Abdruck der Chronik die von Rudolf Müller, seines Zeichens "Kaufmann in Grä-bendorf, 1911 geschrieben wurde, nachdem er "Urkunden, flkten und Artikel aus Zeitungen eingesehen bzw. gesammelt hatte.
Er führte auch viele Gespräche mit älteren Einwohnern, die ihm ihre Geschichten erzählten.
Er Schildert in der Chronik ungeschminkt, wie entbehrungsreich, hart, oftmals grausam und selten gerecht das Leben unserer Vorfahren war.
Er schrieb in der Schrift, die er in der Schule gelernt hatte und die bis etwa 1938 in den deutschen Schulen gelehrt wurde. Eine Schrift, die heute nur noch wenige Menschen lesen können.
Als vor Jahren die Chronik in die Hände des Bürgermeisters von Gräbendorf, Herrn Franzel Kerstan, fiel, war sie durch den Zahn der Zeit stark dem Zerfall ausgesetzt und beschädigt. Das Papier war vergilbt und der Schimmelpilz nistete in dem Papier. Als Herr Kerstan merkte, was für einen Schatz er in den Händen hielt, suchte er sich Helfer, die der Sütterlinschrift mächtig waren. Er fand sie in zwei Gemeindemitgliedern: Frau Ruth Kalisch und Frau Helga Marcks.
Gemeinsam schafften sie 70 Seiten. Dann musste Herr Kerstan neue Helfer suchen, denn diese Arbeit war langwierig und mühsam. Er kam zu mir und bat um Hilfe. Vor zwei Jahren übernahm ich dann die Chronik von Herrn Kerstan. An meiner Seite stand meine Frau Anneliese, Frau Rintisch und Frau Antje Haug. Frauen, die neben ihrer Arbeit in den Abendstunden sich mit der Chronik befassten und die Arbeit in diesen Tagen zu Ende führten.
Ihnen allen gebührt der Dank der Gemeinde Gräbendorf.
Dann auch der Fa. Baur, Buchbinderei in Falkensee, die fachgerecht die Chronik restaurierte, vom Schimmelpilz befreite und ihr ein neues Gesicht gab, damit sie einen Ehrenplatz in der Gemeinde erhalten kann.
Gräbendorf, im Dezember 2005
Vorwort
Wenn ich es unternahm, die Geschichte des Ortes von Gräbendorf aus der Vor- und Jetztzeit zusammenzustellen, so geschah es in der Absicht, das Wenige was aus alter Zeit noch bekannt ist, zu sammeln und dadurch vor gänzlicher Vergessenheit zu bewahren.
Vieles war bereits vergessen und konnte nur noch mit vieler Mühe ermittelt werden.
Möge nun dieses kleine Werk dazu dienen, der Nachwelt einen Einblick in die Vergangenheit unseres Ortes Gräbendorf zu bieten und das Entstehen und den Entwicklungsgang desselben im Gedächtnis zu erhalten.
Gräbendorf: 1911Der VerfasserRudolf Müller Kaufmann in GräbendorfBearbeitet in den Jahren 1998 bis 2005
Der Inhalt ist entnommen aus:
Fidicin, Territorium der Mark Brandenburg. Band I.
Dr. Heinrich Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg. Band II.
Klöden’s Werke, Die Guitzow’s.
Kirchenakten von Gräbendorf
Schulchronik von Gräbendorf
Alte Akten der Gemeinde Gräbendorf
Berichte und Erzählungen alter Leute aus Gräbendorf, Groß Besten und Gussow.
Berichte aus Vereins- und Arbeitsbüchern & Gerichtsakten.
Eigene Erfahrung
Beseß Akten, Urkunden & Auskunft des Herrn Pfarrer Langemeier in Gräbendorf
Zeitungsberichte
Aus Marians Werke und Typographie 1652.
Märkische Forschungen von den Vereinen für Geschichte der Mark Brandenburg. 1187 - 1535. 1867.
Graebendorf in alter Zeit.
Es war eine trübe und traurige Zeit, aus welcher die ältesten Nachrichten über den Ort Gräbendorf berichten, dieselben datieren aus jener dunkler Vorzeit, in der die Wenden mit den Deutschen um den Besitz der Niederlausitz und der Mark Brandenburg kämpften.
Kein Mensch war weder bei Tage noch in der Nacht vor einem Überfall sicher und von einem festen Besitz oder Erwerb war gar keine Rede. Gesetz und Recht konnte nicht gehandhabt werden, da es in dieser Zeit noch keine rechtsmäßige Staatsgewalt gab, und deshalb der Stärkere sich ein Recht über den Schwächeren anmaßte.
Dass zu solchen Zeiten auch die Bewohner von Gräbendorf den größten Drangsalen ausgesetzt waren und in Mitleidenschaft gezogen wurden beweißt schon der Umstand, dass die Bauern Leibeigene der Großen waren und die streitenden Völker die Länder verherten.
Gräbendorf, im Kreis Teltow gelegen, gehört zum Regierungsbezirk Potsdam. Das Dorf liegt an der Verkehrsstraße zwischen Königs Wusterhausen und Storkow/Mark. Gräbendorf gehörte ehemals zur Herrschaft Teupitz und war ein ursprünglich zur Niederlausitz gehörig gewesener Güterkomplex, dessen Kern ein auf einer Insel des Teupitzsee belegenem Schloß, Teupitz, den früheren Besitzern, den Schenken von Landsberg gehörte. Man nannte es deshalb auch Schenkenländchen. Dieses Schenkenländchen war ca. 4 Meilen lang und 1,5 Meilen breit und gehörten dazu 16 Ortschaften, diese waren folgende, nebst 2 Schäfereien in Löpten und in Halbe.
Namen heute
Ehemals
Mühlen
01. Teupitz
Tupzig
Die
Neue Mühle (Kgs. Wusterhausen)
02. Gräbendorf
Gerwendorf
Mittel Mühle
03. Gussow
Guesse
Hohe Mühle
04. Pätz
Pretz
Kleine Mühle
05. Klein Besten
Bestewyn
Stacken
(bei Stakow a.d. Dahme)
06. Zernsdorf
Zerstorff
Lirische Mühle
07. Groß Köris
Köres
Körbis-Krugmühle
08. Klein Köris
09. Schwerin
10. Egsdorf
Eckersdorff
11. Sputendorf
12. Löpten
Lubbe
13. Tornow
14. Halbe
Holbe
15. Körbiskrug
16. Neuendorf
Gräbendorf besaß im 14. Jahrhundert 7 Bauerngehöfte und 2 Kossäten sowie seit 1350 eine eigene Pfarre Kirche.
Jeder Bauernhof umfasste 45 magdeburgische Morgen, Land und Wiesen zusammen. Der dichte Wald, welcher Gräbendorf umschloss, gehörte deren von Teupitze, Edlen.
Das Schenkenländchen im 14. Jahrhundert wozu Gräbendorf gehörte.
- - - - - - - - - - - - Alte Landstraße von Teupitz über Gräbendorf nach Berlin.
Gräbendorf war ganz von dichtem Wald umgeben, somit ein richtiges Heidedorf. Überhaupt das ganze Schenkenländchen war von größtem Teil mit Waldungen bedeckt, wo inmitten viele größere und kleine Seen sind. Dieselben haben ihre Namen unverändert bis auf den heutigen Tag beibehalten.
Es sind im Ganzen 31 Seen und zwar:
Name
Größe/Morgen
01. der Teupitzer See
1956
02. der Horning-See
0200
03. der Zimmin-See
0088
04. der Briesen-See
0024
05. der Tornow-See
0160
06. der Tabaks-See
0008
07. der Karbusch-See
0052
08. der Paddenluch-See
0028
09. der Diek-See
0032
10. der Roskat-See
0076
11. der Schulzen-See
0052
12. der kleine Modder-See
0020
13. der große Modder-See
0128
14. die kalten Wasserteiche
0024 0010
15. der Niklas-See
16. der Kleine Tornow-Karpfenteich
0012
17. der Große Tornow-Karpfenteich
0024
18. der Trübe-See
0300
19. der Griebok-See
0002
20. der Gülden-See
0096
21. der Schäfer-See (bei Tornow)
0024
22. die 3 Leber-Seen (bei Egsdorf)
0056
23. der Krumme-See (bei Schenkendorf)
0140 0028
24. der Krebs-See (bei Kgs. Wusterh.)
0724
25. der Pätzer Vorder-See
1060
26. der hinsterte Pätzer See
0496
27. der Zeesener See
0144
28. der Todnitz-See
0528
29. der Krüpel-See (bei Senzig)
0132
30. der Klein-Bestener-See
0036
31. der Tietschen-See
Klein Köriser-See, Hölzerner See, Schmölde-See und Huschte-See sind nicht erwähnt.
Auf einigen obigen Seen besteht noch von alters her die Fischereiberechtigung, doch heute 1910 meistens abgelöst, gehört nun mehr der königlichen Hofkammer und von dieser weiter verpachtet, gewöhnlich auf die Dauer von 6 Jahren bis 12 Jahren. Anno 1811 kaufte Gussow den trüben-See vom Amt Storkow für 400 Taler als eigen.
Die Bewohner von Gräbendorf waren durchweg arme Leute. Schon ihre ganze Stallung, ihre landwirtschaftliche Bestellung, ihr Absatzgebiet, ihre darauffolgende Bauten, ihre Bekleidung und Nahrung, alles sprach dahin, daß die Leute mit Noth und Sorgen um ihr Dasein zu kämpfen hatten. Die Dörfer waren nach damaliger Wendenart kesselförmig gebaut, wie zum Beispiel Paetz es heute noch ist. Gewöhnlich hatte das Dorf nur einen Aus- und Eingang. Die Wohnhäuser waren meißt aus Holz und Lehmwänden gemacht und die Dächer waren entweder Stroh- oder Rohrbedeckung. Stein und Ziegelbau fand meißtens nur bei Kirchen, Schloß und Burgen statt.
Gräbendorf gehörte bis zum Jahre 1301 zur Niederlausitz, kam dann an das Erzstift Magdeburg und im Jahre 1303 zu Brandenburg. Die Niederlausitz gehörte bis dahin zur Mark Meißen, östlich an der Saale gelegen.
Heute ist die östliche Hälfte des Herzogtums Sachsen-Altenburg der Landgrafschaft Thüringen, der sächsischen Pfalzgrafschaft des Hauses Wettin.
Die ersten Grundherren über Gräbendorf waren im Jahre 1186 Burchard de Plozeke, dann Bernt (Bernhard) von Plotzigk, jedenfalls ein und derselbe Herr. Dieser Bernt de Plotzeke war um 1295 häufig im Gefolge des Margrafen Otto Herrmann (1266 - 1308) und Waldemar (schon vor 1302, 1319 gestorben am 14. August in Bärwalde; nicht eindeutig zu lesen). Wie lange die Herren de Plotzeke Herren über Gräbendorf waren, läßt sich nicht genau feststellen.
Aber soviel steht fest, daß schon zu deren Zeiten Gräbendorf dem Brandenburgischen Staate einverleibt wurde.
Im 14. Jahrhundert waren die Schenken von Landsberg und Sydow - Seyda, im Kurfürstentum Sachsen eine sehr reiche und angesehene Familie, Grundherren in Gräbendorf, welche von den Bewohnern hier ihre Steuerlasten und Frohndienste forderten. Auch Wusterhausen, genannt Wendisch Wusterhausen, und Wendisch Buchholz erwarben diese Schenken noch hinzu. Die im Jahre 1303 begründete Verbindung der Lausitz mit der Mark Brandenburg war nicht von langer Dauer. Die Schenken Albrecht von Landsberg und Sydow, Otto und Erich von Schenkendorf wurden in den Jahren 1350 vom Papst in den Bann getan, weil sie den mit der Kirche verfallenen bayrischen Markgrafen von Brandenburg beigestanden hatten und so mußten sie sich gefallen lassen, daß sie mit noch mehreren Vasallen, Schlössern und Städten der Lausitz an Meißen abgetreten wurden. Die bayrischen Besitzer der Mark Brandenburg sahen sich nun genötigt die ganze Lausitz zu verpfänden. So war denn Gräbendorf mit verpfändet, ja sogar das Auslösungsrecht verpfändete Markgraf Otto im Jahre 1367 an Luxemburg. Kaiser Karl der 4. von Böhmen machte von seinem Auslösungsrecht gebrauch und Gräbendorf gehörte zu Böhmen.
Markgraf Otto der Faule 1365 – 1373
Kaiser Karl IV 1373 – 1378
Kurfürst Johann Cicero 1486 – 1499
Einzelne Lehrstücke in der Mark Brandenburg hatten sich die Herrn v. Schenken vorbehalten. Hierdurch gestalteten sich immer noch freundliche Beziehungen zwischen den Schenken und den Grafen von Brandenburg, welche dahin führten, daß der Albrecht von Landsberg, Herr zu Teupitz, im Mai 1357 zum Schiedsrichter zwischen den beiden Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg fungierte.
Dieserselbe Albrecht v. Schenk von Landsberg befand sich anno 1413 zu Berlin in der Umgebung des erst vom König Sigmund als Stadthalter der Mark Brandenburg eingesetzten Burggrafen Friedrich von Nürnberg, für dessen Schuldverschreibung er mit dem jüngeren Albrecht v. Schenk von Landsberg als Bürger eintrat. Am 18. April 1417 war Albrecht Zeuge bei de Belehung mit der Mark und wurde ihm die Auszeichnung des Hohenzollerschen Fürsten Friedrich zum kurfürstlichen Trohn zu geleiten und zum erstenmal das brandenburgische Banner vorzutragen. Auch für die Entscheidung der Uneinigkeiten, die zwischen der Mark und dem Erzstifte Magdeburg schwebten, wurde der hochgeschätzte Edle Schenk von Landsberg und Sydow zum Obmann bestellt für den Fall; daß die ernannten Schiedsrichter, Herzog Rudolf von Sachsen und Graf Heinrich von Schwarzenburg sich nicht einigen würden. Dieser Albrecht v. Schenk (auch Apitz v. Schenk) von Landsberg genannt hatte anno 1392 mit seiner einzigsten Tochter, Elisabeth, eine Wallfahrt nach dem heiligen Blute zu Wilsnak gemacht. Bei seiner Rückkehr am 17. August 1392 wurden sie beide unweit Guitzübel von Straßenräubern überfallen, aber durch Dietrich und Johann von Guitzow, welche in der Nähe der Jagd nachgingen, entdeckt. Sie folgten gern der Einladung nach dem Schlosse, um sich von dem Schrecken zu erholen. Sie wohnten am anderen Tage der Kindtaufe des jüngsten Sprößlings der Familie Guitzow, Namens Henning, bei. Als sie nach mehreren Tagen abreisten, stand bei Dietrich fest, die Elisabeth zu seiner Ehegattin zu nehmen. Seinen Eltern war diese Verbindung mit dieser hochgeachteten Familie ganz nach Wunsch. Im nächsten Jahre 1393 kam Dietrich von Guitzow durch Gräbendorf woselbst gerichtet wurde, nach Teupitz zum Befug. Am Sonntag Judica, den man den schwarzen, lahmen auch bösen Sonntag nannte, welcher als Unglückstag galt, schlug Herr Apitz von Schenk nach dem Mittagbrot einen Spazierritt vor. Es wurde nach Buchholz geritten. Unterwegs scheute das Pferd der Elisabeth, war ein weißes Reh, das über den Weg rannte, und ging durch. Das Pferd rannte quer durch den Wald, das Fräulein wurde abgeworfen und fiel mit dem Kopfe gegen einen Baumstumpf, wo sie ohnmächtig liegen blieb. Die übrigen Herrschaften konnten nicht flink genug folgen und verloren die Spur. Dagegen Spreewälder Straßenräuber fanden Elisabeth und schleppten sie nach einer Mühle, um sie am anderen Tage nach den Spreewald zu bringen, um gegen hohes Lösegeld freizugeben, doch wurde sie noch glücklicher Weise gerettet. Die Spreewaldräuber aber gefangen und hingerichtet.
Am 2. Osterfeiertag 1393 fand die Verlobung Ritter Dietrich von Guitzow mit Elisabeth Schenk von Landsberg auf Schloß Teupitz statt. Zu dieser Feier waren unter anderen geladen und erschienen Otto von Wittlitz (der Herr zu Baruth), damaliger Voigt der Lausitz.
Am 6. Juli 1394 wurde Dietrich v. Guitzow mit Frl. Elisabeth zu Ehebunde vereinigt. Der stattliche Hochszeitszug hoch zu Rosse kam auch durch Gräbendorf, wo in dem alten Dorfkrug, dem heutigen Müllerschen Geschäft, gerastet wurde. Dann ging der Hochzeitszug weiter nach Berlin, woselbst die Hochzeit noch mehr nach alter Sitte auf Kosten der Stadt Berlin mit großem Pomp gefeiert wurde.
Anno 1422 begaben sich die Schenken, Albrecht und Hans, auf Befehl des Kaisers Sigismund mit samt der Lausitz in den Schutz des Erzbistums Magdeburg. Da ihnen aber nicht genug Schutz geleistet wurde, traten die Gebrüder Friedrich, Heinrich, Apitz und Hans Schenken von Landsberg Teupitz, Sydow & Peitz 1431 unter den Schutz des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg. Dieser Kurfürst legte auch den großen Streit um die Holzgerechtigkeit bei, denn man wollte den Mittenwaldern und den Gräbendorfern die Holzgerechtigkeit nehmen.
Anno 1437 wurde das Schenkenländchen von den Rittern v. Biberstein auf Beskow/Storkow mit Fehde bedroht. Daher flüchteten die beiden noch lebenden Schenken Friedrich und Hans unter den Schutz des Herzogs von Sachsen. Dagegen Heinrich von Schenken hielt es mit Brandenburg. Somit war der Kurfürst Friedrich II. dem Schenkenländchen immerwegs sehr gewogen.
Anno 1440 trat dieser Heinrich Schenk in die Königsdienste Brandenburgs gegen Sachsen auf. In Folge dessen kam das Schenkenland wieder auf die Dauer von 3 Jahre unter den besonderen Schutz des Kurfürsten von Brandenburg, denn das Königreich Böhmen war durch den Tod Albrechts herrenlos geworden und Gräbendorf stand nun wieder unter brandenburgischem Banner.
1442 verkauften die Schenken das haus Schenkendorf an einen Herrn von Wiesenburg. Dagegen war die ansehnliche Herrschaft Peitz von Gure neu erworben und Heinrich Schenk ging in seiner Hingebung für den Kurfürsten von Brandenburg soweit, daß er mit Zustimmung seines Bruders Hans und seines Oheims Friedrich nicht nur sein Schloß Peitz mit Lehen am 15. August 1442 dem Kurfürsten ohne Vorbehalt abtrat, sondern auf die Herrschaft Teupitz, wozu auch Gräbendorf gehörte, für sich und seine Nachkommen von dem Kurfürsten zu Lehen nehmen, um dann in Zukunft der Mark Brandenburg als Vasall anzugehören und zu dienen.
Anno 1443 starb Heinrich v. Schenk kinderlos und ihm folgten Friedrich und Hans v. Schenken von Landsberg sobald in die Gruft, daß ihr Haus im Jahr 1449 durch einen unmündigen Erben, Namens Otto, wahrscheinlich ein Sohn Friedrichs und seiner Gattin Anna, allein noch vertreten wurde. Der Kurfürst übergab den jungen Erben zur Bevormundung und Erziehung seines Obermarschall Henning von Quast, früherer Hauptmann von Sarmund, welchem dieserhalb auf Schloß und Stadt Teupitz auf 6 Jahre die Verwaltung eingeräumt wurde. Ihm war dabei auch die Pflicht auferlegt, das Schloß mit Wächtern, Torwächtern, reisigen Knechten, Unterbefehlshaber und andrer notwendiger Wehr genugsam zu versorgen, die Lücken, Dämme und Befestigungen in gutem Zustand zu erhalten und die erforderlichen Mittel den Einkünften des Schlosses zu entnehmen.
Schenk Otto erwuchs unter feiner Obhut Brandenburgs zu einem der eifrigsten Diener des zollerschen Hauses. Er nahm an den Feldzügen, wie an den wichtigsten Staatsgeschäften, des Kurfürsten Friedrich II. teil und vertrag denselben nicht nur in der Begräbnisfeier des Markgrafen Johann von Brandenburg im Jahre 1464, wobei der Laufe das zollersche Banner vortrug, sondern auch in anderen, bedeutenden, auswärtigen Angelegenheiten.
Nach Friedrich II. Abscheiden unterstützte er als erfahrener Rat den zum Regenten der Mark bestellten Sohn des Kurfürsten Albrecht, den jungen Markgrafen Johann von Brandenburg, den späteren Johann Cicero, in dessen Heiratsangelegenheiten er auch als Unterhändler diente.
In der Folge berief ihn das Vertrauen des Kurfürsten Albrecht, Achilles zum Hofmeister seiner Tochter, der verwitweten Herzogin, Barbara in Schlesien zu Glogau und Krossen, deren fragensvolle Geschäfte lange in seiner Hand ruhten.
Aus seiner Ehe mit Amalibis von Biberstein hinterließ er 4 Söhne, die das lebensfähige Alter erreichten und dadurch sein Geschlecht wieder aufblühte.
Wohl zu berichten ist, daß die von Teupitz eingegangene Lehensverbindung mit Brandenburg, wenn sie auch von derer von Schenken treu beachtet wurde, doch noch keine rechtskräftig begründete war. Denn zur Gültigkeit eines solchen Lehnsauftrags, wie ihn die Schenken im Jahre 1142 vorgenommen hatten, war die Zustimmung ihres bisherigen Lehnsherren erforderlich. Nur das damalige Nichtvorhandensein eines Trägers der böhmischen Krone entschuldigt es, ohne es zu legalisieren, daß sie einen neuen Lehnsherren annahmen und sich dadurch aus unmittelbaren in mittelbare Vasallen der böhmischen Krone verwandelten.
Der böhmische Konsens zur Übertragung der Lehnsherrschaft über das Schenkenländchen an Brandenburg wurde auch nicht nach der am 28. Oktober 1458 erfolgten Krönung des Ladislaus zum König von Böhmen und ebenso wenig nach dessen frühzeitig erfolgten Tode von seinem am 2. März 1457 gewählten Nachfolger Georg von Podiebrad gegeben.
Freundliche Bundesverhältnisse, welche den Kurfürsten von Brandenburg mit dem Könige Ladislaus und in der ersten Zeit auch mit dem König Georg verknüpften, ließen die Lehnsangelegenheiten des Schenkenländchens, da gerade wichtigere politische Fragen schwebten nicht als Streitgegenstand hervortreten.
Da jedoch der neue König von Böhmen über jene Fragen mit dem brandenburgischen Kurfürsten in dem Maße sich so nun einigte, daß es am 13. Oktober 1461 zu einer förmlichen Königserklärung Böhmens gegen Brandenburg kam, so wurde unter den Böhmens Unzufriedenheit erregenden Angelegenheiten auch der Teupitzer Sache mitgedacht. Des Kurfürsten weise Vorsicht beugte dem Ausbruch eines böhmischen Krieges dadurch vor, daß er bei einer Reise des Königs nach Guben im Anfang des Juni 1462 sich ebendorthin begab und hier persönlich eine Aussöhnung zustande brachte, die den Frieden von Guben am 5. Juni 1462 zur Folge hatte. In diesem Friedensschlusse wurde endlich der Besitz von Gräbendorf, Teupitz sowie auch von Cottbus und einigen anderen in der Lausitz erworbenen Besitzungen in der Form böhmischer Kronlehen dem brandenburgischen Kurfürsten rechtskräftig zugestanden und dadurch die Verbindung des Schenkenländchens, Teupitz, mit der Mark Brandenburg für die Dauer rechtlich begründet.
Im Jahre 1475 kaufte Otto von Schenk die Herrschaft Wusterhausen mit den dazu gehörenden Dörfern Schenkendorf, Deutsch-Wusterhausen, Hoherlehme, Senzig und Zeesen.
Von den Jahren 1462 - 1718 sind von den Schenken fast gar keine Notizen zu finden. Nach den Berichten des Landwirtes Biener wird im Jahre 1610 Herr Wilhelm von Schenk als Besitzer von Teupitz, Neuendorf, Egsdorf, Sputendorf, Löpten, Tornow, Grewendorf, Gussow und Zernsdorf genannt.
In Wendisch-Buchholz wohnte Herr Joachim v. Schenk von Landsberg und Sydow.
Teupitz / Mark im Jahre 1900
Zur Zeit Kaiser Karl IV. hieß es nach dem alten Landbuch > Wusterhuse < oder Wendisch - Wusterhausen. Das wurde Thurm oder Diebesthurm genannt.
1295 war das Schloß ein Rittersitz und gehörte einem Ritter, Herrn von Torgau.
Im Jahre 1317 gehörte die Herrschaft Wusterhausen mit den dazugehörenden Dörfern und Lehungen einem Hauptmann Herrn Hanko von Mittenwalde.
Im Jahre 1427 war eine adlige Familie, von Schlieben, Besitzer, dann ging der ganze Besitz von Schloß Wendisch Wusterhausen im Jahre 1475 an die zur Zeit reich begüterte Familie Otto von Schenken Landsberg und Sydow über und gehörte nunmehr zur Herrschaft Teupitz, welcher insgesamt jetzt 36 Dörfer zu gehörten. Jetzt gehörte Wusterhausen zu Gräbendorf zu gerechnet und bildete nun ein gesamtes Schenkenländchen, ein etwa 4 Meilen langer und etwa 1,5 Meilen breiter Landkomplex.
Die Familie der Schenken von Landsberg verarmt im Laufe der Zeit und so ging der ausgedehnte Landbesitz gleicherweise so nach und nach an benachbarte Waldnutzer über. Im Jahre 1612 verkaufte Wilhelm von Schenk die Herrschaft Wusterhausen an eine adlige Familie von Jena, diese verkaufte sie wieder an die Familie von Dankelmann. Etliche Jahre darauf kaufte sie eine Familie aus Lübben. Diese behielt sich Wusterhausen auch nicht lange und verkaufte sie wieder an eine Familie in Puttlitz und diese veräußerte die Herrschaft wieder an die Herrn von Schlieben.
Diese Herrn von Schlieben veräußerten im Jahre 1697 die Wusterhausener Herrschaft an den Kurfürsten Wilhelm von Brandenburg den nachherigen König Friedrich I. von Preußen für seinen Sohn den Kronprinzen.
Nach dem Ableben des letzten Alexander, Ludwig von Schenken im Jahre 1720 war König Friedrich I. Besitzer des ganzen Schenkenländchens.
Am 18. Dezember 1717 hatte Friedrich Wilhelm I. die Herrschaft Teupitz von dem letzten Schenken, Alexander Ludwig, mit welchem das Geschlecht ausstarb für 54.000 Thaler gekauft.
Altes Schloß in Königs Wusterhausen Anno 1305
Anno 1720 wurde nun eine Teilung der Herrschaft Teupitz vorgenommen. Fünf Ortschaften, nämlich Klein Besten, Körbiskrug, Gussow, Pätz, Zernsdorf wurden dem Amtsbezirke von Königs Wusterhausen einverleibt.
Gräbendorf kam unter das Amt von Blossin. Die Herrschaft bestand nun noch aus Schloß Teupitz, auf welchem ein Amt eingerichtet worden war, der Stadt Teupitz und den Gütern und Vorwerken Repplinchen, Tornow, Egsdorf, Schwerin, Sputendorf, der Hohen-, Mittel- und Kleinen Mühle, einigen Meiereien, Heiden und Senn. Das Dorf Löpten und die Staakmühle selbst mehrere Heiden mußten eingelöst und andere veräußerte Güter wieder zur Herrschaft angekauft werden.
Von dieser Zeit hört der Name > Schenkenland < auf und es tritt an seine Stelle die Bezeichnung > Herrschaft Teupitz <.
Friedrich Wilhelm I. stellte Teupitz während seines Besitzes unter die von Ihm gestiftete > Fideikommis < Herrschaft Königs Wusterhausen.
In Folge dessen war der König Friedrich Wilhelm I von Preußen Grundherr und Kirchen-patron von Gräbendorf
Nach den Unglücksjahren 1806 - 1807 veräußerte König Friedrich Wilhelm III: als fürsorglicher Landesvater, um der herrschenden Geldnot abzuhelfen manches seiner Familiengüter. So wurde am 30. Juni 1812 von der französischen Deputation der kurmärkischen Regierung auch Schloß Teupitz, mit Vorwerk Teupitz, Vorwerk Sputendorf, Vorwerk Löpten, die dazu gehörigen Seen und Karpfenteiche und die Forstparzellen an die Witwe des 1803 verstorbenen Oberamtsmann Bein für 69.000 Thaler verkauft. Von der Mutter ging der Besitz auf den Sohn über. Von diesem kaufte es 1836 der Vekourier, Kommisarius Gobbin, der es 1840 an Herrn von Trott veräußerte, welcher es bald dem Herrn Gutsbesitzer Rösner verkaufte.
Dessen Nachfolger war Herr Baron von Treskow, welcher viele Stücke der Herrschaft veräußerte und endlich im August 1866 Schloß und Gut Teupitz den Rest seiner Besitzung an Herrn von Parpert verkaufte, welcher mit Aufwendung aller Kraft und vieler Geldmittel Schloß Teupitz durch herrliche Anlagen bedeutend verschönte. Zum Schloßbesitz gehört auch noch der Teupitzer See, dessen außerordentlich wohlschmeckende Zander gern gekauft werden.
Gräbendorf wurde ebenfalls verkauft, 1811 an Herrn Oberförster Egler.
Erbaut 1632 - 1662 Kirche in Gräbendorf in der Mark
Bevor die christliche Lehre hier eingeführt wurde, verehrten die Neueinwohner von Gräbendorf, welche Wenden waren und zur Lausitz gehörten, ihre Götzen Herowith und Radegast, auf wendisch Radagustus. Dieser Götze Herowith hatte als sein Zeichen ein großes goldenes Schild, welches neben ihn an dem einen Band des Zügels hing. Bavorith, der Gott des Friedens und der Kaufmannschaft, hatte 5 Köpfe, aber kein Schwert, doch ihr Hauptgötze war Radegast, welcher nackt und entweder von purem Golde oder auch nur von Holz war und auf dem Kopfe mit krausen Haaren eine Krone von Metall hatte worauf ein Vogel mit ausgebreitetem Flügel saß. Die Brust bedeckte er mit einem Schilde auf welchem ein Ochsenkopf abgebildet war. In der Linken hatte er eine Hellebarte oder eine Streitaxt.
Im Jahre 955 zerstörte Kaiser Otto I. diesen Götzen, wurde aber dennoch im Stillen beibehalten.
Die Wenden waren ein großes verzweigtes Volk, welches früh an Beschwerlichkeiten gewöhnt war. Sie wohnten nicht so einzeln und zerstreut, als die Sveven, sondern sie erbauten ihre Häuser in zusammenhängenden Reihen, errichteten Dörfer und Flecken und führten Gards, daß heißt Schlösser auf, welche bald zu Städten auswuchsen. Ihre Kleidung bestand nicht mehr aus bloßen Tierfellen, wie bei den Sveven, sondern sie bereiteten sich dieselben schon aus wollenen Zeugen, aus grober Leinwand und aus Pelzwerk, welche im Sommer und Winter einerlei waren. (aus S. Buchholz Geschichte der Kurmark Brandenburg).
Ebenso waren ihre Speisen auch schon mannigfaltiger. Sie bearbeiteten den Acker, legten Gärten an und hielten viel auf Viehzucht. Ihr Charakter war nicht so häßlich als er von ihren Feinden geschildert wird, von denen sie verächtlich und als Kriegsgefangene grausam behandelt wurden.
Straßenraub, Diebstahl, Mordbrennerei, Mordlust und Meineid waren ihnen unbekannt. Die Gastfreundschaft wurde bei ihnen so weit getrieben, daß derjenige, welcher einem Fremden abwies (welches aber höchst selten geschah), für ehrlos gehalten und sein Haus nebst allem was er hatte, verbrannt wurde. Arme wurden von der ganzen Gemeinde erhalten, man fand daher unter ihnen keine Bettler. Dagegen hatten sie aber die unnatürlichste Sitte an sich, daß sie ihre alten schwachen Eltern, überzählige Töchter, kranke und ungesunde Kinder und Knechte ermordeten. Im Kriege waren sie unmenschlich grausam, wozu sie größten Teils durch ihre Feinde und nochmals besonders durch ähnliche Behandlung der fanatischen Horden Barbarenkrieger wurden. Gegen ihre Obrigkeit waren sie sehr ehrerbietig.
Nachdem das Christentum hier eingeführt war, hatte Gräbendorf doch keine Kirche und die Leute mußten, was doch sehr umständlich und eine Tagesreise war, nach Teupitz zur Kirche, denn dorthin gehörte Gräbendorf. Teupitz hatte auch erst in Tagen 1250 eine Kirche erhalten.
Um das Jahr 1350 baute Gräbendorf auf Veranlassung des Markgrafen von Meißen eine Kirche, bestehend aus Holzfachwerk. Diese Kirche hatte sogar einen Thurm. Nunmehr hatten die Leute nicht mehr nötig nach Teupitz zur Kirche zu wandern, im Gegenteil von den umliegenden Dörfern kamen nun die Bewohner nach hier zur Kirche (es wurde katholischer Gottesdienst abgehalten). Die Kirche stand inmitten im Dorf auf derselben Stelle, wo heute noch die Kirche steht. Der Friedhof wurde um die Kirche angelegt und bis zum Jahre 1850 zur Leichenbestattung benutzt.
Im Jahre 1610 hieß Gräbendorf > Grevendorf < und Wilhelm v. Schenk war Besitzer von Gräbendorf. Von 1618 - 1648 dauerte der 30 jährige Krieg und Gräbendorf wurde viel von den kaiserlichen und den schwedischen Truppen heimgesucht, mehrere Male total ausgeplündert so auch 1627 wo man sämtliches Vieh hinwegtrieb und die Männer zwang Soldaten zu werden.
1632 wurde Gräbendorf wieder ausgeplündert und da die Kaiserlichen nicht genug erhielten, zündeten sie die Häuser, so auch die Kirche an, welche bis auf den Grund niederbrannte. Der Krieg war für Gräbendorf zeitgerweise sehr traurig. So hatte im Jahr 1620 Gräbendorf nur noch 2 Bauern, die übrigen waren fort zu den Soldaten. Die beiden hiergebliebenen Bauern hießen Kerstan und Schulz. Kerstan wohnte neben dem Gute, heut 1905 heißt der Besitzer Lieske. Schulz wohnte damals wo heute Huschke, vormals Bläske, wohnt. Der dreißigjährige Krieg hatte fast unbeschreibliche Drangsale, alles wurde verwüstet, geplündert und verheert.
Die Städte wurden durch unerhörte Centributionen erst ganz ausgesogen und dann, wenn sie nichts mehr aufbringen konnten, in Brand gesteckt. Die Dörfer waren öde, niemand bebaute mehr das Land. Die Straßen waren durch blutdürstige Krieger und geldgierige Räuber unsicher gemacht, Theuerung und Hungersnot. Die Pest kam dazu und riß zu tausenden die Menschen dahin. Die Übrigen flohen den fürchterlichen Aufenthalt und überließen die wimmernden Kranken einem grauenvollen Ende. Die Toten wurden von niemandem begraben. Sie wurden von Hunden, Wölfen und Raben gefressen.
Und all dies unverschuldete Unglück, welches sich mit gleicher Härte über einen großen Teil Deutschlands verbreitete, war die Folge eines unvernünftigen Religionshasses, wozu ehrgeizige und habsüchtige Pfaffen ihre Fürsten verleitet und diesen Krieg zur Sache Gottes gemachten hatten! - Wehe über den schuldigen Theil.
Nachdem die Kirche in Gräbendorf abgebrannt war, dachte man in Folge der traurigen Zeiten an einen Wiederaufbau der Kirche vorläufig nicht. Der Grundherr Wilhelm von Schenken selbst auf dem Wege zur Armut und die Einwohner hatten erst gar nichts, der Krieg raubte alles. Wohl suchen die Einwohner Feldsteine zum Wiederaufbau heran, denn der vorige Holzbau hatte sie ängstlich gemacht und um vorzubeugen, wollte man nur mit Steinen bauen, diese Steine anfahren, ging auch nur sehr langsam, ruhte oft lange Zeit. Endlich, nachdem der Frieden von Osnabrück am 15. Oktober 1648 geschlossen war, dachte man erstlich an den Kirchenbau. Wilhelm v. Schenk hatte das Doppelschulzengut zu Lehen einem reichen Cölner Ratsherren zu Cöln an der Spree überlassen. Dieser Ratsherr, Andreas Ideler war schon zu seiner Zeit ein Grundstückspekulant, war durch den Besitztitel von dem Doppelschulzenamt. Das heutige Gut in Gräbendorf war einmal stehts dem Schulzenamt verbunden, weshalb heute noch die Lehnung vom Guth, das Amt gleichzeitig erhielt und durch die Belehnung Erbherr in Greffendorf (Gräbendorf), Gussow und Zehrnsdorf, Neumühle und auch Gerichtsherr bei Neubrück ist. Dieser Andreas Ideler nahm den Kirchenbau in seine Hand und beauftragte einen Bauunternehmer Namens Mielke aus Zernsdorf damit. Außerdem wurden überall Spenden erbittet und gesammelt. Besonders vier Damen beteiligten sich mit Geldspenden, nämlich Eva Maria Fritzen, Anna Sabine Hellwichen, Barbara Lindholzen und Maria Grünfetten. Die Hand- und Spanndienste mußten die Bauern und Einwohner machen, das Holz zur Balkenanlage und Dachstuhl wurde durch die besitzende Holzgerechtssame aus hammerschen Forst geholt.
Im Jahre 1662 war endlich die Kirche fertig gebaut, wenn auch höchst einfach ohne Kreuz und ohne jeden inneren Schmuck, war sie doch von milden Gaben und eigenen Kräften der Einwohner von Gräbendorf, Gussow, Pätz und Prierosbrück entstanden.
Zum Andenken für sein wohlwollendes Mitwirken zum Gelingen des Wiederaufbau wurde für den Herrn Andreas Ideler sowie für die 4 Spenderinnen der Gaben an der Wandseite neben der Eingangstür eine Gedächtnisinschrift mit eingemauert.
Gedenktafel an der äußeren Wand der Kirche
des Rats- und Gerichtsherren, Herrn A. Andreas Ideler, aus Cöln an der Spree
Anno 1662
Derselbe war Erbherr in Greffendorf (Gräbendorf), die nebenstehenden Frauennamen sollen die Namen seiner 4 Frauen mit deren Wappen sein, denn jede Frau führte ihr Wappen in der Ehe weiter; anderer Version nach sollen die 4 Frauen die Spenderinnen zum Bau der Kirche gewesen sein, jedoch Bestimmtes darüber besteht nicht.
Mit den Bildern der Seiten → - → wurde die Bedeutung der Steinplatte seit 01.07. 2002 erst richtig bekannt.
Inneres der Kirche in Gräbendorf
Die Verhältnisse der Kirche sind noch dieselben wie vor 200 Jahren zu Anfang des 1700, daher Jahren. Die Sitzplätze sind nach den früheren Besitzern eingeteilt, die jünger neu hinzugekommenen Besitzer durch Verkäufe und desgleichen benutzten die alten Stammsitze mit, daß Platz ist und die übrigen Einwohner, Mieter und Büdner, benutzten das Chor so lange wie der Platz vorhanden ist, die übrigen stehen. Auf die Bauernbänke kam es zwischen Weibern wegen dem Vorrang in Sitzplatz oft in der Kirche zu Streitigkeiten, förmlich zum Prügeln.
Chorseite und Orgel erbaut 1866
Die Plätze mußten gänzlich frei sein, damit sich jeder Kirchenbesucher setzen kann wo er einen Platz findet. Aber so gibt es einen so genannten Sitz für mehrere Personen, als für das Gut, für den Pfarrer mit Familie, für die Lehnherrfamilie aus Gräbendorf, Gussow und Pätz, für die Bauern, für die Kossäten. Die Frauen sitzen für sich, ebenso die Männer.
Oben auf der rechten Chorseite sitzen die Männer aus Pätz und Gussow, auf der rechten und linken, besonders auf der linken Seite sitzen die Gräbendorfer Männer, hinterm Chor west Orgel sitzen die Kinder auch diejenigen, welche keinen Platz finden und auch gern schlafen während des Gottesdienstes.
Der Altar nebst Bild ist von königlicher Familie gespendet worden die Orgel wurde im Jahre 1866 von dem Orgelbauer Remmler aus Berlin erbaut. Bis dahin mußte der Küster vorsingen und die Gemeinde sang mit.
Die Orgel ist oftmals recht defekt. 1896 reparierte der alte Herr Remmler die Orgel noch mal selbst, trotzdem ist selbige defekt und es ist schon öfter vorgekommen, die Stimmen, Pfeifen, versagten und die Gemeinden wie in früheren Jahren ohne Orgelbegleitung sangen, dieser hörte sich sehr komisch an. An den Wochentagen flickt dann der Lehnherr so lange daran rumm, bis die gute Orgel wieder leidlich spielt.
Das Kreuz auf der Ostgiebelspitze wurde auf Veranlassung des Herrn Pastor von Aster im Jahre 1867 angebracht.
Die Glocken wurden während des siebenjährigen Krieges angeschafft im Jahre 1758 und tragen folgende Inschrift.
Anno 1758 sind diese Graebendorfsche Glocken gegossen. von I. F. Thielen Berlin Soli Deo Gloria Omnia bum, Deo et Nihil Sine eo
(zu Deutsch: Allein sei Gott Ehre in der Höhe, Alles mit Ihm und nichts ohne Ihm.)
Wie oft haben wohl diese Glocken schon zu Kindtaufen, Hochzeiten, Trauer und Feuersnoth geläutet. In den Kriegsjahren, in der traurigsten Zeit unseres Jahrhunderts 1806 - 1815, wenn der Feind in Sicht kam, wurde oftmals Sturm geläut damit jeder Einwohner informiert war.
Einer alten früheren Sitte Gebrauch, noch aus dem Katholischen beibehalten, wird mittags geläutet ebenso des Abends Feierabend Betglocke gestoßen, außerdem Früh zum Schulbesuch für die Kinder.
Für die Dörfer Gussow, Pätz und Gräbendorf wird für Verstorbene mit 3 Pausen i.S.3 mal innehalten Seelenglocke geläutet.
Der Preis dafür ist.
Für das alltägliche Läuten, welches ein Schulknabe verrichtet, erhält derselbe pro Jahr 50 Mark. Eine Frau Krüger für das Kirchenreinigen pro Jahr 30 Mark.
In den 1890 er Jahren sollte die Kirche umgebaut werden, doch ist das der Kosten wegen unterblieben.
Anno 1575 wurden hier die lutherischen Lehen, man sagte damals die neuen Lehen eingeführt durch den Pfarrherrn Thomas Zernike, welcher auch das Konkordienbuch mit unterschrieben hatte oder haben soll. Das Konkordienbuch ist nämlich eine Gesamtausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften, welche 1580 in Dresden erschienen das alte Lehrstreitigkeiten unter den Lutheranern beseitigen sollte, doch erreichte es sein Ziel nicht.
Inneres der Kirche in Gräbendorf am Weihnachtsheiligabend 24.12.1911
Um 4 Uhr Nachmittags wurde mit dunkel werden wie alljährlich am Weihnachtsabend mit beiden Glocken das heilige Weihnachtsfest eingeläutet. Um 6 Uhr begann die heilige Christnachtsfeier, nach dem es zuvor um 5 Uhr und 5.30 Uhr vorgeläutet hatte.





























