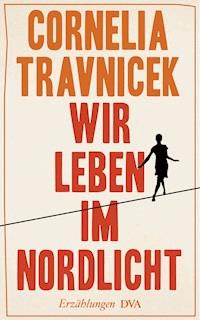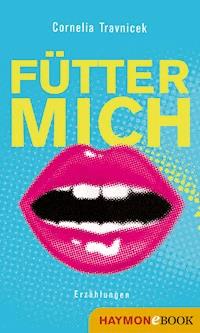6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Punkig, zärtlich, bedingungslos ehrlich – eine starke neue Stimme!
Mae zog noch vor Kurzem als Punk durch die Straßen Wiens, lebte von Dosenbier und den Gesprächen mit ihrer Freundin über Metaphysik und Komplizierteres. Im AidsHilfe-Haus, wo sie eine Strafe wegen Körperverletzung abarbeiten muss, lernt sie Paul kennen und verliebt sich in ihn. Als bei ihm die Krankheit ausbricht, beginnt Mae gegen sein Verschwinden anzukämpfen: Sie sammelt seine Haare und Fußnägel wie Devotionalien und fängt zuletzt die Luft in seinem Krankenzimmer in einem Tupperdöschen ein. Chucks erzählt eine bezaubernde Geschichte vom Aufwachsen zwischen Liebe und Tod und ist von einem Ton durchdrungen, der mal humorvoll, mal aufwieglerisch laut, aber auch überaus zärtlich sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cornelia Travnicek
Chucks
Roman
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2012 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung und Satz: DVA/Brigitte Müller
Gesetzt aus der Berling
Umschlagdruck: RMO & Welte Druck und Repro Produktions GmbH, München
ISBN 978-3-641-07427-2V002
www.dva.de
»Es gibt Aufgaben, die zu erfüllen wären,den Traurigen die Welt erklären.«
TOMTE
Vom Ende
Warum sich im Leben immer genau die Situationen wiederholen, die man doch auf keinen Fall noch einmal erleben will.
Ich streichle seine Hand, wie es sich gehört, so als würde jemand zusehen und Haltungsnoten vergeben. Das gleichmäßige Piepen der Geräte ermüdet mich, mein Lidschlag und sein Herzschlag werden gemeinsam fast unmerklich langsamer. Ich unterdrücke ein Gähnen, weil sich das nicht gehört: dass man gähnt, wenn jemand stirbt.
Von H-Milch und der Statik von Luftschlössern
Von oben sehen wir mit Mikroskopen bis hinunter zu den einzelnen Molekülen«, sagte Tamara, »und von unten können wir das Verhalten einzelner Atome berechnen. Aber dazwischen, dazwischen ist eine Lücke, die wir nicht genau bestimmen können. Bei einem Atom geht das noch, oder bei zweien, das ist auch noch nichts Kompliziertes. Aber sobald mehrere zusammentreffen, gibt es Probleme.«
Sie griff nach der verbeulten Dose mit dem letzten Rest schalen, warmen Bieres und trank sie in einem Schluck aus.
»Ist mit Leuten doch das Gleiche«, sagte ich und schnippte den Verschluss von meiner Dose ab. Ich sah dem kleinen Metallteil hinterher, wie es einmal auf dem Boden aufsprang, bevor es liegen blieb.
Das war vor vier langen Jahren, und dennoch erinnere ich mich an jedes Wort.
Als ich dreizehn war, dieses unheilvolle Alter, in dem plötzlich alles zusammenbricht und man mit einem Bauplan wie von Ikea und einem kleinen Inbusschlüssel alles wieder in Ordnung bringen soll, zeigte es sich langsam: Die Augen meiner Mutter waren müde, wenn sie meinen Vater anschrie. Mein Vater war müde, sobald er nach Hause kam, was er nicht mehr oft tat. Die meiste Zeit war er auf Dienstreise. Es ist ja nichts auszusetzen an Vätern, die viel verreisen, aber sie sollten gut gelaunt und mit kleinen Geschenken zu ihrer Familie zurückkehren und ihre Frauen auf den Mund küssen. Mein Vater brachte nie etwas mit, bis auf das eine Mal, versehentlich, da hatte er ein fremdes Höschen im Koffer. Meine Mutter nahm den Koffer und stellte ihn wortlos vor die Tür – und meinen Vater schob sie hinterher. Plötzlich waren wir allein. Ich und meine Mutter im Haus, mein Vater und sein Koffer davor, im Schuhregal immer noch dieses eine Paar Chucks, dazu die verschlossene Tür im ersten Stock und die kleinen Fläschchen mit den weißen Kügelchen im Medikamentenschrank.
Tamara war asozial, so würden das die meisten Leute wohl nennen. Keinen Job, kein Geld, Familie vielleicht, darüber sprach sie nicht. Keine Ausweise, kein Alter, manchmal eine Schlägerei. Tamara war dumm, weil sie alles tat, was ein intelligenter Mensch seinem Körper nicht antut. Aber sie überlebte immer. Und wenn es um mich ging, dann war Tamara fürsorglich und liebenswert.
Als ich sie zum ersten Mal sah, im Schatten des Stephansdoms, mitten unter weiß perückten Touristenfängern, die aussahen wie Lebendwerbung für Mozartkugeln, ich war gerade vierzehn, da bat sie mich um eine Zigarette, und ich gab ihr keine. Nicht weil ich keine Zigaretten gehabt hätte, aber ich hatte mir das mit Punks immer vorgestellt wie mit streunenden Hunden: Fütterst du sie ein Mal, wirst du sie nie wieder los.
Ich fragte sie also, ob ich so aussehen würde, als hätte ich Zigaretten, sie sagte Ja. Während ich noch damit beschäftigt war, die Kennzeichen des Zigarettenbesitzes an mir zu identifizieren, meine Mutter durfte davon natürlich nichts wissen, wollte Tamara dann doch lieber Geld.
»Davon kaufst du dir sicher nur Bier! Oder Drogen.«
Tamara zog die linke gepiercte Augenbraue hoch, bekam kleine Fältchen in den Mundwinkeln, sah mich prüfend an, legte den Kopf zur Seite wie ein aufmerksamer Hund und pfiff kaum hörbar durch die kleine Lücke zwischen ihren Schneidezähnen.
»Und was, meinst du, sollte ich mir davon kaufen?«
»Keine Ahnung.« Ich wollte die Hände in die Taschen stecken und fand keine an meinem Sommerkleid. Eines der Cafés fing meinen Blick. »Eis vielleicht?«
»Eis?«
»Ist ein warmer Tag heute.«
»Kaufst du mir ein Eis?«
Was soll man darauf sagen. Wenig später hatten wir beide eine Eistüte in der Hand, ich Zitrone und Tamara Pistazie. Und ich war immer der Meinung gewesen, nur alte Leute mögen Pistazieneis.
Auf einmal hatte ich einen Punk und war unheimlich stolz darauf, selbst Pippi Langstrumpf hat es nur zu einem Affen gebracht.
Seit jenem Tag, an dem mein Vater über eine Stunde lang vor der Tür unseres Hauses den Namen meiner Mutter gebrüllt, zuerst mit der Faust und dann mit der flachen Hand dagegengeschlagen hatte, war alles anders. Nicht viel, nur wie wenn man beim Radfahren das Gefühl hat, dass der Reifen eiert, man stehen bleibt, sich hinunterbeugt, aber keine Veränderung erkennen kann. Nicht dass vorher alles normal gewesen wäre. Aber nach dem, was geschehen war, war das Wort »normal« in Bezug auf uns relativ geworden. Meine Mutter und ich hatten gemeinsam überlebt, im Schweigen, mit dieser verschlossenen Tür im ersten Stock.
Mein Vater bezahlte vorerst weiter für das Haus, in dem ich mit meiner Mutter wohnen blieb, so musste ich die Schule nicht wechseln, während er eine kleine Einzimmerwohnung in der Nähe seiner Arbeitsstelle mietete. Er holte mich samstags manchmal ab, zum Eisessen, zum Zoobesuch, wofür ich eigentlich schon zu alt war, aber das sagte ich ihm nicht. Wir sahen Kinofilme und gingen einmal im Jahr in den Prater. Bei unseren Treffen gab er jedes Mal viel Geld für mich aus und rauchte dabei eine Zigarette nach der anderen, Mutter hätte ihn dafür getadelt, wäre sie dabei gewesen.
Ich erinnere mich an jedes Detail des Tages, an dem ich am Schottenring in die Straßenbahnlinie 2 einstieg, um mich das erste Mal mit Tamara am Karlsplatz zu treffen. Ich weiß noch, der Himmel war eine weite hellgraue Fläche, die trotzdem blendete. Die Straßenbahn, in der ich auf einem Einzelplatz saß, war alt, ich konnte die Rillen im Holzboden durch die dünn gewordenen Sohlen meiner Chucks spüren. Ich drückte die Nase an die Scheibe, Mütter verbieten das ihren Kleinkindern immer. Was ich sah, erinnerte mich an überbelichtete Bilder in vergilbten Reiseführern: die alte Börse, die Votivkirche, die Universität. Das Burgtheater, das Rathaus, das Parlament. Der Volksgarten, das Naturhistorische und das Kunsthistorische Museum, der Heldenplatz. Die Hofburg, der Burggarten, die Staatsoper. Diese Straßenbahnfahrt war eine lange, bescheuerte Sightseeingtour durch dieses Wien, das mit seinem an dieser Straße konzentrierten Prunk anzugeben schien. Genau das jedoch hatte einen herben Beigeschmack, jemand meinte mal, die Stadt sehe so traurig aus: all diese imperialen Gebäude und kein Imperium, um es zu regieren. Und genauso empfand ich es auch.
Tamara zog ihre zu weite Hose etwas hoch und ließ sich in den Schneidersitz sinken.
»Was machen wir jetzt?« Mit meinen Schuhspitzen schob ich platt getretene Zigarettenstummel zur Seite.
»Jetzt sitzen wir da.«
»Warum?«
»Weil man das so tut, dasitzen und Bier trinken und die Leute fragen, ob sie einem Geld geben.«
Ich setzte mich neben sie und starrte auf den schmutzigen Boden, ein Mädchen mit Dreadlocks ging vorbei. Sie trug neue Adidas-Sneakers, die so weiß waren wie Gletscherschnee vor der industriellen Revolution. Dabei dachte ich an die Schule, daran dass dort gerade Mittagspause war, an den Vorteil von Jausengeld und an meinen leeren Magen.
Tamara holte eine Dose Bier aus den Untiefen ihrer Hosentasche. Wir tranken. Mit geschlossenen Augen lehnte ich mich an die Steinwand, alles um mich herum verwandelte sich in ein Rauschen, in dem ich meinen Hunger vergaß. In regelmäßigen Abständen zogen die Junkies an uns vorbei, mit ihren monotonen »Substi, Substi«-Rufen, die zuerst kürzer und dann wieder länger wurden, je nachdem ob sie sich näherten oder entfernten.
»Dopplereffekt«, kicherte Tamara, und ich wusste nicht, ob sie nun den physikalischen oder alkoholischen meinte.
Irgendwann in ihrem Leben hatte Tamara die eine oder andere Bildungseinrichtung besucht und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar studiert. Aber konkreten Fragen über ihr Leben wich sie aus. Manchmal sagte sie etwas über Quanten und Strings und Quarks und Spins, dabei verdunkelte sich ihre sonst so helle Iris, sie kniff die Augen zusammen, ihre feinen Fältchen wurden sichtbar, und sie raufte sich die ohnehin in alle Richtungen abstehenden Haare. Leider hatte sie zwischen ihr Wissen Lücken gesoffen, sodass die Zusammenhänge für sie nur noch schwer herstellbar waren.
»Gib mir die Schnapsflasche«, sagte sie immer, wenn ich etwas von ihr wissen wollte, »dann geht es leichter.«
Aber leicht ging nur noch eines: was man in welcher Form rauchen, spritzen oder schnupfen konnte und was besser nicht.
Jetzt ist alles anders, jetzt umgibt mich Sicherheit. Sicherheit, das ist, wenn man Milch über seine Cornflakes gießen kann, ohne sich vorher schnuppernd vergewissern zu müssen, dass man nicht gleich verdorbene Eiweißklümpchen auf seinen Ballaststoffen findet. In den ersten Wochen bei Jakob habe ich immer noch die Luft angehalten und erst wieder eingeatmet, wenn die Milch in der Schüssel war und die Cornflakes appetitlich darin schwammen. Inzwischen fängt jeder meiner Morgen gut an.
Ich stelle meine Müslischale auf die Küchenwaage, die einunddreißig Gramm anzeigt, zupfe ein einzelnes Cornflake aus meiner Schüssel und stecke es zurück in die Packung. Die Waage zeigt dreißig Gramm an, genau die auf der Packung angegebene Portionsmenge.
»Jakob«, rufe ich durch die Wohnung, »Jakob, die Milch geht schon wieder aus.«
Fröhlich schlage ich die Kühlschranktür zu und schalte das Küchenradio ein. Eine Reporterin interviewt gerade unseren Bundespräsidenten und fragt, ob er denn in seiner Jugend auch einmal einer Frau seine Briefmarkensammlung gezeigt habe. Er meint, er habe in seiner Jugend nicht nur Briefmarken, sondern auch noch Bücher und vieles mehr hergezeigt. Weil das noch nicht genug des Guten war, fragt die Reporterin noch, ob er denn die besagte Briefmarkensammlung auch seiner Ehefrau gezeigt habe, und mir läuft die Milch aus der Nase.
»Jakob«, schreie ich wieder, »ich geh schnell einkaufen.«
Das, was am Abend vorher noch als Jakob ins Bett gegangen war, kommt nun tappend den Flur entlang und streckt ein zerknautschtes Gesicht in die Küche.
»Verwende so bald wie möglich einen Kamm«, sage ich und springe auf, als der Toaster die Brotscheiben ziellos in der Küche verteilt.
»Was für ein schöner Morgen«, schreie ich, um das Radio zu übertönen, »aber die Milch ist schon wieder alle.«
Jakob schüttelt den Kopf und schleift die Füße über den Boden, bis ich höre, wie sich die Badezimmertür hinter ihm schließt.
Ehe noch seine Haare getrocknet sind, steht eine neue Packung Milch im Kühlschrank. Und eine Packung H-Milch im Regal der winzigen Speisekammer.
Während meiner kurzen Abwesenheit hat Jakob das Radio verstellt, Klaviermusik perlt nun aus dem Regal über die Furniere der billigen Küchenschränke. Jakob sitzt mit einer großformatigen Zeitung vor seinem Frühstück. Das ist mein Jakob: klassisch. Beim Umblättern taucht er oft eine Ecke seiner Zeitung in die gleichmäßig auf dem Toast verteilte Erdbeermarmelade. Die farbig leuchtende Marmelade beschwert das Papier. Wenn ich frische Toastscheiben in den Schlitztoaster schiebe, dann legt Jakob manchmal seine Zeitung achtlos auf den Tisch, voll auf den Marmeladentoast, und fasst mich von hinten um die Hüften, um seinen Kopf am unteren Ende meines Rückens abzulegen. Macht er das, so rühren wir uns nicht, bis der Toaster die Brotscheiben in die Luft wirft und ich springe, um sie aufzufangen. Beim Essen lauschen wir andächtig der Klaviermusik, als wäre es eine Messe, andächtiger noch, weil uns keiner dazu zwingt, und sind so ganz und gar still miteinander, wie man selten mit jemandem sein kann. Nur hin und wieder sagt mir Jakob, ich solle doch bitte nicht so laut kauen, denn es klinge, als würde ich kleinnoppige Luftpolsterfolie essen.
»Plan was Schönes«, rufe ich Jakob nach, wenn er morgens aus der Tür geht, um sich ein paar Straßen weiter in einer Architekturfirma vor sein Zeichenbrett zu stellen. Manchmal schicke ich auch noch einen Luftkuss hinterher, aber Jakob ist ein schlechter Fänger.
Jakobs Gebäude sind Streber, sie streben nach allen Seiten und nach oben, sie haben keinen Mittelpunkt, wie auf dem Weg in komplizierte Yogapositionen erstarrte Frauen. Jeden seiner privaten Entwürfe steckt er in einen schmalen schwarzen Rahmen und erweitert damit die Ausstellung in unserem Flur, deren einzige, aber regelmäßige Besucherin ich bin.
»Was machst du da?«, frage ich ihn, wenn er abends noch vor dem Computer sitzt und zeichnet.
»Luftschlösser bauen, wie immer«, sagt er dann. Und obwohl ich ihn das jeden Abend frage, wird er nie müde, mir täglich die gleiche Antwort zu geben.
»Wir sollten wieder mal was unternehmen«, sage ich, als er abends endlich bei mir am Tisch sitzt, »was Ausgefallenes.«
»Bungee-Jumping.«
»Jetzt nimm mich doch ernst!«
»Mit Haien schwimmen?«
»Jakob!«
»Was immer du willst!«
»Wie kann man nur jeden Tag nach Hause kommen und den Fernseher einschalten, am Wochenende immer in dieselbe Bar gehen und sonntags bis genau elf Uhr schlafen?«
»Die Bar ist billig, du kannst gerne länger schlafen oder früher aufstehen, wie auch immer du das halten möchtest. Und außerdem: Wir sehen illegal Premiere, das macht das Fernsehen doch unheimlich aufregend und gefährlich.«
»Jakob!«
»Kauf dir doch einen Hund.«
Ich werfe mit einem der Sofakissen nach ihm.
»Was immer du willst!«, wiederholt er. »Du brauchst jeden Tag einen Alleinunterhalter, unglaublich.«
»Wie kann man nur so zufrieden sein wie du! Das finde ich unglaublich!«, sage ich und meine es als Beleidigung. Wie kann man nur.
Jakob ist der geborene Planer. Und wenn er je wirklich ein Luftschloss bauen würde, ich wette, er würde auch dafür einen Plan zeichnen, damit es auf keinen Fall einstürzt. Manchmal frage ich mich, wie ich in seinen Plan passe, wie lange er daran herumgerechnet hat, um mich in sein Leben einzufügen.
Jakob ist der einzige Mensch, dessen Träume Statik besitzen. Ja, das ist Jakob: statisch. Und es reizt mich, meinen Zeigefinger auszustrecken und ihn einmal, ein Mal nur, ganz leicht anzutippen wie einen in einer Reihe stehenden Dominostein. Das ist es, was ich an Jakob mag: seine aufgeräumten Zimmer, die geordneten Regalwände, den vollen Kühlschrank. Dass er immer weiß, wie viel wovon wo steht. Und warum. Das ist Jakob auch: rational.
Von Bewährungshelfern und dem Geruch von Kuheutern
Meine erste Erinnerung an meinen Bruder: Er wirft mir einen Holzbaustein an den Kopf, ich falle gegen ihn, und kichernd landen wir beide auf unseren Hintern. Ich bilde mir ein, dass mein Sturz damals von Windeln gedämpft wurde. Im Laufe der Jahre habe auch ich ihm viele Holzbausteine an den Kopf geworfen, ihn in Büsche und von Bäumen geschubst und oft versucht, ihn zum Essen von Grassuppe mit Erdbrockeneinlage zu überreden, wobei ich nicht immer sicher gewesen sein kann, dass alle Gräser, Blätter, Beeren und Wurzeln darin verträglich waren, ganz abgesehen vom Regenwurmanteil des mitverarbeiteten Erdreichs. Er verzieh mir alles, ich ihm auch, er war schließlich mein Bruder, und mein Bruder war unsterblich. Er hatte nie etwas Schlimmeres als ein paar Kratzer oder blaue Flecken gehabt. Und als er einmal am Scheitelpunkt von der Schaukel gesprungen war, auf den Waschbetonplatten aufschlug, mit dem Gesicht an der rau verputzten Hauswand bremste, einen offenen Unterarmbruch und eine tiefe Schürfwunde quer über der rechten Gesichtshälfte davontrug, da wuchs meine Bewunderung für ihn noch weiter.
Homöopathen denken, wenn man die Dinge nur lange genug verwässert, sie auflöst, dann würde nur noch das Gute übrig bleiben. Je weniger vom Ausgangsstoff noch vorhanden ist, desto stärker die Wirkung. Das Schlechte kommt von zu hoher Konzentration.
Als mein Bruder elf war und ich gerade sieben, war er neben Winnetou für mich der Größte. Das Einzige, was Winnetou hatte und mein Bruder nicht, war dieses lange schwarze Haar. Meine Mutter hätte meinem Bruder nie erlaubt, seine Haare wachsen zu lassen, aber die Farbe, die ließ sich ändern. Und so gingen wir gemeinsam in die nächste Drogerie und kauften eine Packung Haarfärbemittel, Schwarzblau.
Nach der Prozedur war der Kopf meines Bruders schwarz, meine Hände, einige Badezimmerfliesen, drei Handtücher und unsere ganze Badewanne. Und auch die Aura unserer Mutter, ihrer Laune nach zu urteilen. Sie strich uns das Taschengeld, von dem wir die Farbe gekauft hatten, den Freiraum, der es uns ermöglicht hatte, die Wohnung unbeaufsichtigt zu verlassen, und zudem durften wir drei Wochen lang nicht mehr fernsehen, was aber unsere Freude über das gelungene Projekt kaum dämpfte. Mein Vater lachte nur, was ihm wahrscheinlich ebenfalls eine Strafe einbrachte. Das weiße Gesicht meines Bruders leuchtete unter dem schwarzen Haar. Vorher war mir nie aufgefallen, wie blass er war.
Er war noch etwas blasser, als er nach den Sommerferien wieder in die Schule ging. Da war er dreizehn. Ich hielt das für einen Nebenaspekt des Erwachsenwerdens. Genauso wie es dazugehörte, dass er weniger mit mir spielte und jeden Tag früher schlafen ging. Was nach Meinung meiner Eltern nicht zum Erwachsenwerden gehörte: seine schlechten Noten in der Schule, die von Woche zu Woche noch schlechter wurden. Und im Sportunterricht fiel auf, dass seine Leistung abnahm. Die Lehrer rieten meinen Eltern, seine Entwicklung zu beobachten und, wenn notwendig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Meine Eltern beobachteten seine Entwicklung den ganzen Herbst über.
Beim ersten richtigen Schneefall nahm ich meinen Bruder an die Hand und lief mit ihm zum Park. Kurz standen wir vor der weißen Fläche und sahen unseren Atem als Dampf aufsteigen. Ich schob ihm eine Handvoll Schnee in seinen Mantelkragen und rannte kreischend in das Weiß hinein, er mir hinterher. Erst als wir nass waren und unsere Kleidung mit festgefrorenen Eiskristallen bedeckt war, blieben wir atemlos stehen und warfen uns in den Schnee. Ich konnte sehen, wie sein Bauch sich hob und senkte, schnell wie bei einem jungen Hund. Es war Samstag und seltsam still um uns herum, als mich ein klackerndes Geräusch erschreckte. Der Körper meines Bruders hatte zu zittern begonnen, und seine Zähne schlugen aufeinander, so hastig, als würde sein Kiefer vibrieren.
Ein Jahr später sah ich zu, wie meine Mutter regelmäßig meinen Bruder in ihr Auto steckte und mit ihm zum Arzt fuhr. Anfangs wollte ich mitkommen, der kleinen Süßigkeiten wegen, die man von der Sprechstundenhilfe bekam. Doch meine Mutter brachte ihn nicht zu unserem Hausarzt, diesem alten Mann mit blondem Haar, in das sich nur langsam das Grau mischte, in dessen Praxis es nie nach Arzt roch, sondern immer nur nach Holz und Salbe. Sie fuhr mit ihm in das AKH, dieses riesige Gebäude, in dem man sich schon im Eingangsbereich verliert.
»Punkerdusche«, schrie Tamaras Exfreund. Wir saßen im Resselpark. Tamara hatte ihn falsch verstanden, schüttelte ihre Bierdose und ließ den Verschluss knacken, und ich ging in Deckung. Weißer Schaum schoss durch die Luft.
»Nicht doch, lass das!«, schrie der Ex.
»Dann nicht«, meinte Tamara und leckte den Schaum von ihren Fingern.
»Deo! Ich wollte das Deo!«
Unsere ganze Gruppe roch nach Bier und Axe Africa. Die Bierflecken auf der Kleidung kühlten schnell aus, mich fröstelte. Es war mein erster Herbst auf der Straße.
»Na toll«, sagte ich, »ganz toll!«
»Scheiß dich nicht an«, gab Tamara zurück, »trocknet ja wieder.«