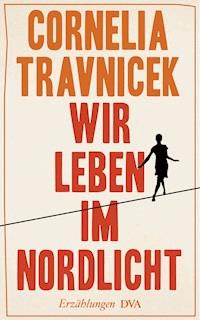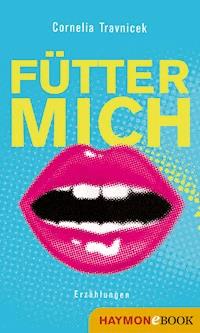2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man erwachsen werden, wenn man nicht weiß, wer man ist?
Johanna kümmert sich gern um andere – um die Tochter ihrer alleinerziehenden Nachbarin Julia, um den betagten Herrn Glantz und sein Malteserhündchen Gloria und auch um ihren besten Freund Ernst. Doch eines Tages beschließt Ernst, nach China zu reisen, um dort seine leibliche Mutter zu suchen, und Johanna bleibt mit ihrem langsam dement werdenden Vater allein zurück. Als sie beim Ausräumen des elterlichen Hauses eine alte Postkarte ihres Vaters entdeckt, die jahrelange Gewissheiten auf den Kopf stellt, beginnt auch für sie plötzlich eine Suche. Am anderen Ende der Welt muss Ernst erkennen, dass das reale China nichts mit dem märchenhaften Land seiner Kindheitsfantasie zu tun hat und er in seiner vermeintlichen Heimat ein Fremder ist.
Eine berührende Geschichte über die Suche zweier junger Menschen nach der eigenen Wahrheit, über Familie, Freundschaft und Aufrichtigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kann ein Mensch ganz bei sich sein, wenn er nicht weiß, woher er kommt?
Johanna kümmert sich gern um andere: um die Tochter ihrer alleinerziehenden Nachbarin Julia, um den betagten Herrn Glantz und sein Hündchen Gloria und auch um ihren besten Freund Ernst. Doch dann beschließt Ernst, nach China zu reisen, um dort seine leibliche Mutter zu suchen, und Johanna bleibt allein zurück. Als ihr Vater, der an Demenz leidet, ins Pflegeheim muss, entdeckt Johanna beim Ausräumen des Elternhauses eine alte Postkarte, die ihre Welt in neuem Licht erscheinen lässt. Plötzlich beginnt auch für sie eine Suche – während Ernst am anderen Ende der Welt sich im Wunsch, die eigenen Wurzeln zu finden, immer mehr zu verlieren droht.
Was macht Freundschaft aus? Was Familie? Verändert man sich selbst, weil sich das Wissen über die eigene Vergangenheit ändert? Unaufdringlich und gleichzeitig poetisch erzählt Cornelia Travnicek eine Geschichte über jene Lebensphase, in der man sich von vertrauten Gewissheiten verabschiedet.
Cornelia Travnicek, geboren 1987, lebt in Niederösterreich. Sie studierte an der Universität Wien Sinologie und Informatik und arbeitet in Teilzeit als Researcher in einem Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet, u. a. für ihr Romandebüt Chucks (2012) mit dem Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich und dem Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium. Für einen Auszug aus ihrem Roman Junge Hunde erhielt sie 2012 den Publikumspreis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
Cornelia Travnicek
JUNGE HUNDE
Roman
Deutsche Verlags-Anstalt
1
Die männliche Honigbiene hat keinen Vater.
Sperriges aus dem Haus
Der Tag ist frühmorgens mit flüssigem Licht übergossen worden und lichtern trieft es nun an den Bäumen herab. Es zieht ein Wind über die Landschaft, sodass Johanna im Haus alle Fenster öffnen möchte und alle Türen – und ein frischer Atem würde in Stößen durch das Haus gehen. Sie steht im Halbdunkel des Vorraumes im Obergeschoss, zwischen Kisten mit in Plastiksäcken verpackter Winterkleidung aus den Achtzigern und horcht auf die Geräusche unter dem Dach.
Johannas Bruder Stefan hat sich für einen Moment ins Auto gesetzt, um zu telefonieren. Ihr Vater ist hinten im Garten, seine Arme baumeln schlaff herab, und er hat den Blick hoch in den Kirschbaum gehoben, wo in diesem Jahr schon lange keine Früchte mehr hängen. Die Hündin geht ihren eigenen Angelegenheiten nach.
Johanna wendet sich wieder ihrer Arbeit zu, verschiebt Kisten, stapelt Kartons. Sie spürt, dass dieses Leerräumen der Zimmer ungehörig ist, sie hätten damit warten sollen, das Leben ihres Bruders aus diesem Haus herauszuoperieren, nur ein paar Tage, nur so lange, bis der Vater selbst nicht mehr hier war. Stefan hätte auch gar nicht unbedingt ausziehen müssen, sie hätten ihrem Vater diesen Eingriff ersparen können. Jeder Eingriff ist riskant. Jede Handlung, die einen Demenzpatienten aus der Bahn werfen kann, ist eine Operation am offenen Geist. Aber Stefan hat gemeint, es sei keine Zeit mehr, der Studienbeginn an der Fachhochschule in der Stadt über der Donau, seine erste eigene Wohnung und so weiter, sein neues Leben und so fort. Jetzt. »Ich habe auch keine Zeit«, wollte Johanna sagen. Sie hat noch etwas vor in diesem Jahr: Mit dem Studium fertig werden. Eine Reise machen. Über Zukünftiges nachdenken. Doch ihr Bruder hat sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen. Also hilft sie ihm fortzutragen, was er mitnehmen möchte, obwohl das nicht geplant war, genauso wenig, wie dass sie in Kürze ihrem Vater wird helfen müssen, seine Sachen zu packen. Ihr Vater hat viel, das wenig ist. Nur seine Spuren zu verwischen, wie er es vor Kurzem in einem gegen sich selbst gerichteten Wutanfall von ihr gefordert hatte, dabei wird sie ihm schwerlich behilflich sein können. Dazu müsste sie mit Abrissbirnen und Baggern vorfahren, das Haus dem Erdboden gleichmachen, dieses Stück Land umgraben. Und dann bliebe als Spur immer noch die Verwüstung. Bis Gras über die Sache wächst.
Lärm wird laut im Untergeschoss, ist gleich wieder vorüber. Sie möchte rufen, Stefan zurufen, er soll doch bitte vorsichtiger sein, noch liegt nicht alles in Scherben. Einer von der achtsamen Sorte war er noch nie, ihr Bruder. Sie geht wieder in sein Zimmer.
Warum eigentlich gerade sie das tun muss, fragt sich Johanna, warum sie hier steht und Gegenstände unsortiert in Schachteln fallen lässt, während das doch genau genommen Stefans Arbeit wäre. Der hat es jedoch zu seiner Aufgabe erklärt, Sperriges und alles, was sich nun langsam in der Einfahrt sammelt, in den geliehenen Umzugswagen zu schaffen. An einem Tag wie diesem wäre sie auch lieber draußen und würde etwas über den Pflasterweg tragen. Sie öffnet die spinnwebgleichen Vorhänge an den Fenstern, die Schattenmuster auf dem Fußboden verändern sich.
Etwas zu schnell trinkt sie aus einer nun halb leeren Flasche Frucade, die seit Jahren im Keller gestanden haben muss, ein Stück Kindheit, dessen Farbe sich schon am Boden abgesetzt hatte, bis sie nun von ihr wieder aufgeschüttelt wurde. Sie verschluckt sich. Die Limonade schmeckt schal, die Kohlensäure ist schon lange entwichen.
Als sie das letzte der wenigen Bücher aus dem Regal zur Hand nimmt, wischt sie über den Einband, als wäre dort eine Staubschicht, die es zu entfernen gilt. Das Cover Hochglanz wie eh und je. Knickerbockerbande. Weiter ist ihr Bruder als Leser nie wirklich gekommen. Sie legt das Buch zur Seite.
Beim Aufschauen begegnet ihr Blick im Glas der Schrankwand dem ihres eigenen Spiegelbildes. Streng sieht sie sich an. Schon von klein auf hat man ihr gesagt, sie solle doch freundlicher schauen. Worauf sie immer nur erwiderte, sie sei eben nachdenklich. Oder konzentriert. Konzentriert sieht sie nun einmal böse aus, was kann sie dafür. Sie betrachtet sich nicht oft im Spiegel. Ihr Vater hat sie früher von Zeit zu Zeit seine kleine Elfe genannt. Dünne Haarsträhnen, lange, schmale Finger, spitze Ohren, die schlaksigen Gliedmaßen – alles, was sie sieht, ist ein Kobold. Mit diesen Augenbrauen, die jede für sich keinen durchgängigen Strich formen wollen. Mit der Haut, die zu Rötungen neigt. Mit dem scheinbar zu oft fokussierten Blick. Sie wendet sich ab und dem Teil des Schrankes zu, der noch leer geräumt werden soll.
Dort stößt Johanna auf den Nähkorb ihrer Mutter. Sie fragt sich, was er hier verloren hat, im Kleiderschrank ihres Bruders. Ihre Mutter war schon immer ein systematisch unsystematischer Mensch. Der Korb geht ihr wohl nicht ab, dort in Peru, denkt Johanna nur, und weiter, dass es auch lächerlich wäre, beim Auswandern gerade das Körbchen mit Nähutensilien mitzunehmen. Eine Handtasche, zwei Rollkoffer und obenauf auf dem einen das Nähkörbchen, hölzern und mit gepolstertem Deckel. Wer fliegt schon so ab. Wer kommt schon so an. Niemand. Hinter dem Körbchen findet sie noch einen Stapel Bücher, deren Titel auch nicht nach ihrem Bruder klingen. Sie ist über ein Zwischenlager gestolpert, so scheint es zumindest, einen Ort auf halbem Weg von Aufbewahrung in Richtung Vergessen. Sie stellt den Nähkorb zurück in den Schrank, die Bücher stapelt sie neben dem Möbelstück. Nun ist der Schrank leer bis auf den Korb. Beim Abschließen knackt das Schloss. Die nackten Regale neben der Schrankfront wirken, als herrschte Lebensmittelknappheit. Die Schäden in der Wandfarbe sind jetzt besonders auffällig: Die an den Rändern ausgebrochenen Nagellöcher. Die zurückgebliebenen Klebestreifen der abgenommenen Poster. Ein graubrauner Schmutzrand, der ein fehlendes Bild rahmt. Ihr eigenes Zimmer sieht bei Weitem nicht so verlassen aus, obwohl schon seit Längerem niemand mehr darin wohnt.
Johanna hört ein Rufen, das wohl sie meint. Ihr Vater sucht etwas. Ihr Vater sucht seit einiger Zeit ständig nach etwas. Wiederholt er sich, so wird auch Johanna rufen, zuerst nach Stefan, der nie hört, und dann nach ihrem Vater, um ihn wissen zu lassen, dass da noch jemand ist, mit Zuversicht in der Stimme, dass gefunden wird, was auch immer er braucht. Aber es bleibt still. Sie zieht in Erwägung, dass sie sich die Stimme nur eingebildet hat.
Vielleicht muss Baghira hinaus. Obwohl der Garten durchaus als draußen gilt, möchte die Hündin ihr Häufchen lieber jenseits des Zaunes ins Gras setzen. Wer wollte ihr das auch verdenken. Mit ihr spazieren zu gehen, die kleine Runde zumindest, das klingt nach einer guten Idee. Johanna hat die Hündin den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Wahrscheinlich liegt sie auf einem der Teppiche, ihr Lieblingsplatz. Zuckt mit den Pfoten im Schlaf.
Schritte kommen die Treppe hoch. Ihr Bruder. Irgendwann muss es passiert sein, dass er größer wurde als sie. Er schüttelt sich die langen, mausfarbenen Stirnfransen aus dem Gesicht. Johanna empfängt ihn mit offenen Armen, aber es ist kein Willkommen – das war alles, sagen ihre Handflächen: Diese drei Kartons zu ihren Füßen, das ist der Rest. Und die Bücher, die nicht ihm gehören. Ihre Schultern heben sich wie zur Entschuldigung, als hätte Stefan das Recht, mehr von seinem Zimmer zu erwarten. Auch er lässt den Blick über die Regale wandern, auch er öffnet noch einmal alle Schranktüren, auch er bemerkt den Nähkorb, scheint sich aber nicht darüber zu wundern. Das Bett verlassen ohne Matratze. Ihr Bruder packt sich einen Karton auf die Schulter, sagt »Ich hol’ die anderen gleich« und wendet sich zur Tür. Ein Stück Hochglanzpapier segelt zu Boden, gleitet dahin, Unterseite nach oben. Reflexartig stellt Johanna den Fuß darauf, als würde tatsächlich auch im Haus der Wind wehen, als könnte die nächste Böe das Papier mit sich reißen. Dann hebt sie es auf.
Es ist ein Gruppenfoto, eine Art Familienaufstellung, von dem Johanna nicht weiß, wer es aufgenommen haben könnte – denn alle, die an jenem Tag dort waren, sind abgebildet: Johannas Vater, Johannas Mutter, Stefan, Johanna selbst, Ernst, seine Mutter Sibylle, sein Vater Johannes und die beiden Hunde Baghira und Balu. Das Foto ist per Selbstauslöser entstanden, so lautet die sehr wahrscheinliche Erklärung. Warum es bei Stefans Sachen liegt, hier in seinem Zimmer, würde sie gerne wissen. Der Vater sieht auf diesem Bild anders aus, als sie ihn in Erinnerung hat. Größer. Aufrechter. Den Blick direkt auf die Betrachterin gerichtet.
Das Licht sammelt sich nun in den Dachrinnen. Die Geräusche um das Haus werden stetig lauter, der Wind stärker, als wollte er etwas mit sich fortnehmen. Johannas Vater, dem die Jacke, die früher um die Schultern herum eng war, lose am Körper hängt, starrt weiterhin in die Kirschbaumkrone, in der die Blätter bereits dem Herbst nachgeben.
Schritte entfernen sich. Draußen stetig steigender Sonnenschein. Baghira hat es sich im Schatten bequem gemacht und lässt ihre Zunge weit aus dem Maul hängen, so weit, wie es einem Beagle nur möglich ist. Irgendwo sitzt Ernst in einem Flugzeug. Irgendwo auf einer Straße sind Ernsts Eltern auf dem Heimweg. Johanna steht zwischen den letzten beiden Umzugskartons ihres Bruders, die dieser gleich noch in sein Auto packen wird. Zuunterst im Stapel neben dem Schrank im Haus liegt das Tagebuch von Johannas Mutter, eingebunden in Packpapier, von Johanna unbemerkt.
一路顺风Yī lù shùn fēng 1
Die Stewardess schiebt mir den Getränkewagen gegen das Knie, und weil sie es von vorne tut, kann ihr mein Knie nicht ausweichen. Mein Bein gibt zwar etwas nach, klappt nach außen weg, bis die Dehnung an der Innenseite meines Oberschenkels unangenehm bis schmerzhaft wird, aber es macht nicht Platz. Seit dem Stoß bin ich wach. Die Stewardess zieht das Wägelchen ein wenig zurück, und ich denke, sie wird sich bei mir entschuldigen, aber noch bevor ich mich aufrichten und mein Bein wieder komplett im dafür vorgesehenen Fußraum verstauen kann, schiebt sie noch einmal kräftig an, als bestünde die Möglichkeit nicht, dass der Widerstand menschlicher Natur ist – als wäre ich eine Teppichfalte. Eine Teppichfalte auf dem Weg nach China.
Ich verstehe ja beinahe, warum sie sich weigert, mich wahrzunehmen, denn es kommt mir selbst so vor, als wäre ich nicht hier – als hätte ich nie den riesigen alten Rollkoffer, dessen rechtes Rädchen schief läuft, in Folie wickeln lassen und am Schalter für Großgepäck aufgegeben, hätte nie das Gate durchschritten, mich nie in dieses Flugzeug gesetzt. Aber da bin ich nun. Trotz allem.
Alle haben sie ihre Befürchtungen gehabt: Johanna, meine Eltern, sogar die Freunde meiner Eltern.
»Pass auf, sonst behalten sie dich da«, hat Johanna zum Beispiel ernsthaft gesagt.
»Vielleicht bekommst du gar kein Visum«, hat meine Mutter anfangs wieder und wieder befürchtet, »du tust ja so, als würden die Chinesen dich wie einen verloren geglaubten Sohn jederzeit gut gelaunt empfangen.«
»Zuerst Hongkong anzufliegen«, hat einer unserer vielen Gäste ausgerufen, »das ist, als würdest du dich von hinten an China anschleichen!«
»Hongkong ist ausgezeichnet«, habe ich gesagt, »das wird mein Basislager, China mein Achttausender.«
Ich habe genau das richtige Visum bekommen, eines mit der Berechtigung zu mehrmaliger Ein- und Ausreise, auf diese Weise kann ich zwischendurch auftauchen, Luft holen, einen neuen Anlauf nehmen, vielleicht von Thailand aus, vielleicht von Korea. Wer kann schon genau wissen, an welchem Ende der Volksrepublik es mich vielleicht aus der Bahn wirft. Aber darüber denke ich nicht zu genau nach.
Jetzt lächelt die Stewardess mich an, sie sagt etwas. Sie spricht Chinesisch mit mir, ich habe kein Wort verstanden, ich habe gar nicht zugehört, ich habe meine Extremitäten neu geordnet. Wie war der Satz noch mal, der für Könnten Sie das bitte wiederholen? Eigentlich möchte ich ihr sagen, sie solle doch etwas umsichtiger sein in ihren Bewegungen, in ihrem gesamten Handeln, immerhin ist das hier das Innere eines Flugzeuges. Ich forme die Silben für den eben in Gedanken zusammengebauten Satz, in der Hoffnung, dass es die passenden sind.
Was schaut sie denn so, das war doch richtig? Ist es mein Akzent? Passt mein Akzent nicht zu meinem Aussehen? Sie ist eindeutig eine Südchinesin, dieses Lispeln, das kann ich erkennen. Vielleicht klinge ich zu sehr nach Norden? Wahrscheinlich klinge ich gar nicht chinesisch. Hat sie noch nie einen Auslandschinesen gesehen? Das wäre sehr unwahrscheinlich bei ihrem Beruf. Einen Chinesen mit österreichischem Akzent? Sie schaut noch immer. Sie hat zwei Kannen. Tee oder Kaffee, das wird sie gefragt haben: Tee oder Kaffee.
»Wǒ yào hē chá.« Ich höre mir selbst zu, wie ich ihr sage, dass ich Tee trinken möchte, dann höre ich mir weiter zu, wie ich es auf Englisch wiederhole, weil sie sich immer noch weigert, mein Chinesisch zu verstehen.
»What«, sagt sie, »what?« Was heißt hier what, jetzt ist mein Englisch scheinbar auch besonders grauenhaft, oder wie soll ich das verstehen. Ich winke ab. Beim Abwinken deute ich wohl auf die Teekanne, denn sie greift danach und schenkt mir ein.
Der Tee riecht gut, es könnte ein Oolong sein. Für einen Österreicher kenne ich eindeutig zu viele Teesorten, das ist meiner Mutter zu verdanken. Dem urösterreichischen Volk ist jeder Aufguss gleich ein Tee. Mein Vater kennt genau zwei Arten, nämlich eine, die mit Rum serviert wird, und eine für alle Krankheiten, in die kommt Honig, der Rest ist parfümiertes Wasser. Daran konnte auch meine Mutter nichts ändern, diese kleine Sinologin, die meinem Vater nur bis zur Brust reicht, mit ihrer blassen Haut, die schnell rosa wird, wenn der Tee sie von innen erhitzt. Nach jeder Tasse treten ihr kleine Schweißperlen auf die Nase und die Oberlippe. Dann streicht sie sich die Haare hinter ihre Ohren und betont dadurch deren absurde Größe.
Ich glaube, Johanna liebte meine Mutter vom ersten Moment an, in dem diese ihr die Hand entgegengestreckte und sie wie eine Erwachsene begrüßte, einfach nur »Hallo Hanna, schön dich kennenzulernen« sagte.
»Ernsti, tā shì nǐ de nǚpéngyou ma?«, fragte meine Mutter gleich danach mich, und da wurde mir seltsam, ich weiß bis heute nicht warum, ich habe nur »Nein, ist sie nicht« gesagt und Johanna hinter mir hergezogen, die Treppen zu meinem Zimmer hinauf.
»Was hat sie gefragt?«, wollte Johanna dann von mir wissen. Ich versuchte, abzuwinken, aber sie ließ nicht locker und fragte nach, welche Sprache meine Mutter da eben gesprochen habe, und als ich erklärte, das sei Chinesisch gewesen, sagte sie: »Aber die ist doch gar keine Chinesin.«
»Ich bin Chinese«, sagte ich daraufhin, und Johanna konterte: »Chinesen sind gelb.« Diese Information hatte sie aus einem Lucky-Luke-Heft bezogen, das sie mir später einmal gezeigt hat.
»Ich bin nicht gelb«, stellte ich fest, griff nach meinem Hosenbein, zog es hoch und präsentierte meinen nackten Unterschenkel, ganz so, als wären Hände und Gesicht nicht schon Beweis genug, als könnte man an diesen Stellen schummeln. Ich hoffe, Johanna hat das alles längst vergessen.
Ich rieche noch einmal an meinem Oolong, bevor ich meine Hand mit dem Becher in Richtung Klapptischchen bewege. Das Gefäß passt genau in die kleine Mulde, die für diesen Zweck da ist, und bei nächster Gelegenheit macht das Flugzeug einen Ruck, und ich habe heiße Flüssigkeit auf der Hose. Zumindest ist es in meiner Vorstellung schon genau in dem Moment passiert, als ich den Becher dort abstelle. Ich sollte mich vielleicht besser an ihm festhalten.
Jetzt sagt mein Sitznachbar etwas, was die Stewardess versteht, während es wiederum mir unverständlich ist. Ich werde meine Mutter fragen, was sie mir da eigentlich beigebracht hat, was für eine Sprache das sein soll, Chinesisch ja wohl nicht, eher Chintsch, vielleicht Deunesisch, ein Irgendetwas.
Das Essen wird gebracht. Aluschale: abgedeckt, ein winziges Weißbrötchen, Plastikbesteck: plastikverpackt, ein Becher Fruchtsalat, ein leerer Hartplastikbecher für Tee. Ich schaue auf den Pappbecher auf meinem Tischchen, der noch halb voll ist.
Über der Konzentration auf die Nahrungsaufnahme wird es dunkel. Wir fliegen in die Finsternis hinein, durch sie hindurch. Die Nacht schiebt sich als graue Welle über die Landkarte, wo sich ein Miniaturflugzeug langsam Richtung Ziel bewegt. Warum hat hier nicht jeder seinen eigenen Bildschirm? Ich dachte, zumindest das wäre mittlerweile Standard. Der Gemeinschaftsmonitor sieht mehr aus wie ein veralteter Fernseher, den jemand in die Zwischenwand zur ersten Klasse eingebaut hat. Gleich kommt die Stewardess mit einer Videokassette und legt den Film ein, wie damals die Lehrer auf den langen Busfahrten bei den Schulausflügen. Wahrscheinlich startet das Unterhaltungsprogramm, wie sie es nennen, erst nach dem Abservieren. Was ist das eigentlich, das alles, da in meinem Gemüse? Eine Lotuswurzel? Und das? Schmeckt nach Kartoffel. Die Soße ist gut, wirklich gut. Mein Sitznachbar schmatzt, in seinem Alter darf man das wieder. Eine Frau lacht, die habe ich vorhin schon gehört, wo hat die eigentlich ihren Sitzplatz? Die lacht, dass Tote sich die Ohren zuhalten möchten. Kann man dagegen etwas machen? Man könnte es der Stewardess sagen. Ich allerdings kann der Stewardess gar nichts sagen, sie versteht mich ja nicht. Will sie mich nicht verstehen, verachtet sie mich? Denkt sie, meine Eltern sind mit mir ausgewandert, weil sie China nicht mochten und haben, ganz unehrenhaft, ihrem Sohn die eigene Sprache nicht ordentlich beigebracht? Liebt sie China? Fragt sie sich, warum ich hinfliege? Wahrscheinlich denkt sie gar nichts über mich. Oder sie hört schlecht und mag es nicht zugeben.
Da kommt sie schon wieder mit ihrem Getränkewagen.
»More tea, please.« Ich weiß nicht warum, aber warmer Tee beruhigt mich im Flugzeug, und momentan ist mir unwohl. Eine übergroße Aufregung drückt mir den Magen zusammen, und ich verstehe nicht weshalb. Es ist ja nicht so, dass mir meine leibliche Mutter mit offenen Armen entgegenlaufen wird, sobald ich aus dem Flugzeug steige, Hallo, ich habe gehört, dass du kommst, ich freu mich so in mein T-Shirt weint und ich sie fest an mich drücke, ihr den Kopf streichle, als wäre sie diejenige, die lange weg war und eben erst nach Hause gekommen ist. Nach Hause, nach Hause. Ist das zu Hause? Ist das eine Art Heimat?
Zu Hause. Das also, was zurückbleibt, wenn man weggeht. Das tiefgelbe Licht in den gedehnten Abendstunden, die in die Länge gezogenen Orte mit nur einer Hauptstraße, einer veralteten Tankstelle und einem Gasthaus, das gegenüber einer Autowerkstatt liegt, und alles eingebettet in Maisfelder, die uns über den Kopf gewachsen sind. Es gibt die Sommer, in denen man sich nicht wundern würde, Wüstensand durchs Dorf treiben zu sehen. Das Gras ist staubig, die Blätter an den Bäumen sind staubig, alle Fenster, Türen und die langsam erwachsen werdenden Kinder. Sie haben den Staub im Haar, in den Augenwinkeln, zwischen den Zähnen, er sammelt sich im Schweiß ihrer Achselhöhlen und verreibt sich dort zu kleinen dunklen Krümeln. Der Mais nimmt einem die Sicht auf den Horizont, hinter dem könnte vieles kommen, ganz Iowa oder die Unendlichkeit der High Plains. Zu Hause. Zu Hause herrscht jetzt Glutstille am Tag, wärmeersticktes Atemanhalten in der Nacht, und der Staub. Der Staub, als feiner Film auf jedem Blatt. Rennt man durch den Mais, peitscht einen das Grün und zieht minimalinvasiv Schnittwunden über die nackten Arme, das Gesicht. »Verirrst du dich in einem Maisfeld, lauf geradeaus, einfach geradeaus«, hat meine Mutter von klein auf zu mir gesagt, und bei diesem Satz hat sie jedes Mal eine Bewegung vor ihrem Gesicht gemacht, mit aufgestellter Handkante, als wollte sie Ziegel und dünne Bretter zertrümmern. Und meine Mutter ist eine Frau, die das mit Sicherheit könnte.
Neue Bilder lösen die Weltkarte auf den Monitoren ab. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Nun, dann sehe ich mir den Film eben zum fünften Mal an. Ich werde mehr Augenmerk auf die Farbsymbolik legen. Hat der Vorspann keine Musik? Ich habe nie darauf geachtet, bis jetzt. Ist der Fernseher zu leise eingestellt? Kein einziger Ton. Nun also als Stummfilm. Wenn das so ist, kann ich auch anderen Bedürfnissen nachkommen.
Die Toilette ist besetzt. Natürlich, nach dem Essen rennen sie alle auf das WC. Ich warte. Diese Falttüren, kluge Entscheidung, damit kann man niemanden vor den Kopf schlagen. Eintreten, alleine sein. Trotzdem das Hemd entlangstreichen, als wären da Falten, die niemand sehen soll. So viele Leute auf so engem Raum, da draußen, im Flugzeug. Im Stehen oder im Sitzen? Wenn ich stehen bleibe und das Flugzeug wackelt …? Ich setze mich besser. Ich möchte nicht wieder hinaus. Ein Fernseher fehlt noch hier drinnen, es wäre perfekt. Vor der Toilette wartet jemand, das spüre ich. Er oder sie steht mit der Nase fast an der Tür. Als wollte mich da eine Person am Geruch erkennen. Die eine falsche Ameise im Haufen. Die besondere Art der Tür verhindert, dass es Beulen gibt, als ich aus der Toilette trete, ich lasse den Blick gesenkt, ich sehe nicht, wer mich belauert hat.
Wieder auf meinem Platz: noch nicht abserviert. Mein Sitznachbar hat nicht aufgegessen, und jetzt hat er bemerkt, dass ich sein Tablett anstarre. Was deutet er mir? Ob ich es haben will? Brot und Obstsalat? Okay, Brot und Obstsalat.
»Xièxie nín.«
Hat er das verstanden, dass ich mich bedanke? Hat er nicht. Oder doch? Warum diese Obstsalatpäckchen so winzig sind. Ich sollte Johanna schreiben, es macht sie wahnsinnig, wenn ich mich nicht melde. Seit sie angefangen hat, mich jeden Abend vor dem Schlafengehen anzurufen … Als wären wir ein Paar. Machen Freunde das? Ich meine, ruft sie Julia jeden Abend an? Nein. Wobei man, fairerweise, auch zugeben muss, dass es wenig Sinn ergibt, jemanden anzurufen, mit dem man Tür an Tür wohnt. Es gibt immer noch keinen Ton zum Film. Wenn die Stewardess jetzt kommt, sage ich es ihr, das muss doch jemandem auffallen. Soll ich mich mit meinem Sitznachbarn unterhalten, nachdem er mir sein Brötchen geschenkt hat? Ich will gar nicht. Ich will mit niemandem reden, ich will diese paar Stunden einfach nur absitzen. Ich will ankommen, ankommen in Shanghai, dem Ziel dieses Fluges, denn irgendwann habe ich mir selbst eingestehen müssen, dass Hongkong wirklich nicht das Richtige gewesen wäre.
Ich stecke meine Hand auf der Suche nach meinem MP3-Player in die Außentasche an meinem Rucksack, und etwas sticht mich in den Zeigefinger. Vorsichtig zupfe ich an dem Ding, das sich im schmalen Fach verhakt hat. Ich schließe sachte meine Finger darum und ziehe die Hand heraus, öffne sie wieder: ein Papierschirmchen, hellgelb mit floral-grünem Muster. Das muss mir Johanna da hineingesteckt haben.
1 »Gute Reise!« (Mit dem Wind unterwegs sein.)
Wenn Freunde aus der Ferne kommen
Johanna wartet auf die Straßenbahn und blickt dabei auf die Haltestelle genau gegenüber. Dort steht ein hagerer Mann von fast zwei Metern, er beugt sich gerade zu seiner Miniaturausgabe einer Malteserhündin hinunter und bietet ihr etwas aus seiner Hand an, wahrscheinlich wie üblich ein Stückchen gekochtes Hühnerherz. Herr Glantz mit seiner Gloria. Der Anblick der großen Gestalt in Begleitung des Schoßhündchens erfreut Johanna.
»Herr Glantz!«
Ein paar der anderen Wartenden werfen Johanna einen kurzen Blick zu und kehren dann sofort zu ihren jeweiligen Beschäftigungen zurück. Glantz sieht hoch, entdeckt Johanna und zieht mit vornehmer Geste einen nicht vorhandenen Hut. Ein warmer Windstoß lässt die weiten Hosenbeine seines grauen Anzugs um die Knöchel flattern und sein Jackett sich blähen. Der Stoff von Glantz’ Kleidungsstücken ist mit dem Alter dünn geworden, genau wie Glantz selbst. Beinahe erwartet Johanna, dass der schmale Mann Fahrt aufnimmt und aus der Haltestelle segelt, herbstdrachengleich. Sie fragt sich, ob Glantz in die Anzüge ihres Vaters passen würde, und ob er das Angebot annehmen würde, sie zu tragen, oder ob er einfach nur an den seinen hängt, sie auftragen möchte, bis sie eben durchscheinend werden, ganz sentimental. Sie deutet einen Knicks an und winkt Gloria, die daraufhin, weil sie nicht an Johanna hochhüpfen kann, Glantz gegen das Bein springt, fast bis ans Knie. Das Hündchen hat eine Schleife am Kopf, die dünne Fellpalme wippt wie in einem Tropensturm. Glantz lächelt, was Johanna über die paar Meter Entfernung nicht gut erkennen kann, weil auch sein Lächeln mit dem Alter etwas schmal geworden ist. Beim Anblick Glorias muss Johanna an Baghira denken, die bald und oft ausgedehnten Urlaub bei Ernsts Eltern wird machen müssen, denn nach Wien kann sie die Hündin nicht mitnehmen, in ihre Einzimmerwohnung. Eigentlich: Dreiineinemzimmerwohnung, denkt Johanna. Betritt man die Wohnung, so steht man neben der Garderobe und dem Schuhregal, also im Vorraum, und direkt neben der Tür zur Toilette, die nachträglich eingebaut wurde. Geht man einen Schritt weiter, so findet man sich genau zwischen Spüle, Herd und Kühlschrank wieder, also definitiv mitten in einer Küche. Noch ein Schritt weiter, und man steht zwischen Vorratsschrank und Dusche, also halb im Bad, genau genommen aber weiterhin im Eingangsbereich. Danach betritt man den Hauptraum, der zur einen unteren Hälfte Wohnzimmer und zur anderen unteren Hälfte Esszimmer ist und oberhalb der eingezogenen Zwischendecke vollständig Schlafzimmer, von vorne betrachtet, also vom Flurküchenbad aus, wie ein Barbiehaus. Weil aber kein handelsüblicher Kleiderschrank auf dieser Zwischendecke Platz hat, muss dieser auch noch in der unten befindlichen Wohnzimmerhälfte unterkommen. Von der Schwelle der verglasten Tür bis zum Fenster sind es fünf, sechs Schritte. Nirgendwo Platz für einen Hund, auch nicht für einen Beagle, der sich gerne unter einen Stuhl legt, sodass man achtgeben muss, ihm nicht auf eines seiner Schlappohren zu treten.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Arbeit an diesem Roman wurde mit dem Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium gefördert.
1. Auflage
Copyright © 2015 by Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln, unter Verwendung von Fotografien von © plainpicture/fShop
Gestaltung und Satz: DVA /Andrea Mogwitz
Gesetzt aus der Berling Nova
ISBN 978-3-641-12605-6
www.dva.de