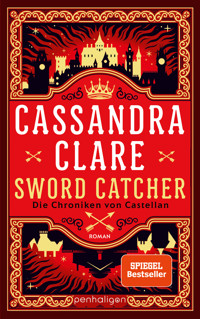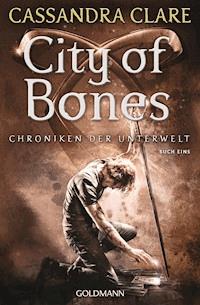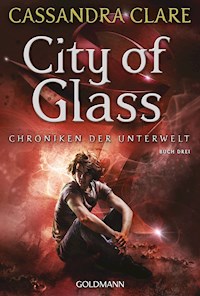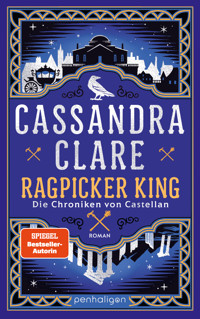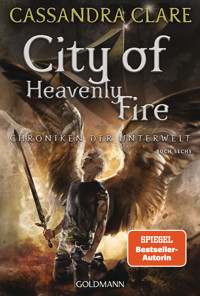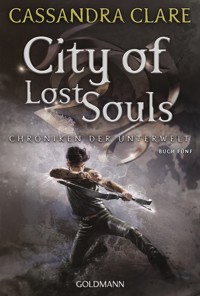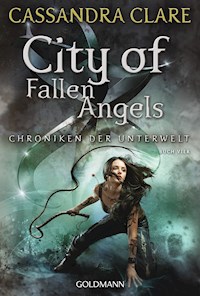9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Unterwelt
- Sprache: Deutsch
Clary glaubte, sie wäre ein ganz normale junge Frau – bis sie unter dramatischen Umständen erfuhr, dass sie eine Schättenjägerin ist, Teil einer Bruderschaft, die seit über tausend Jahren Dämonen jagt. Vampire, Werwölfe, Hexenmeister: Clary würde ihrem neuen Leben allzu gern den Rücken kehren. Doch die Unterwelt ist nicht bereit, sie gehen zu lassen. Dafür sorgt auch das starke Band zu ihren neuen Freunden, ihrer neugefundenen Familie. Und als Jace, der ihr mehr als einmal das Leben gerettet hat, in tödliche Gefahr gerät, stellt sich Clary schließlich ihrem Schicksal – und einem erbitterten Kampf gegen die Kreaturen der Nacht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Lange glaubte Clary, sie wäre eine ganz normale junge Frau – bis sie unter dramatischen Umständen erfuhr, dass sie eine Schattenjägerin ist, Teil einer Bruderschaft, die seit über tausend Jahren Dämonen jagt. Vampire, Werwölfe, Hexenmeister, blutige Kämpfe und geheimnisvolle Mythen: Clary würde ihrem neuen Leben allzu gern den Rücken kehren. Doch die Unterwelt ist nicht bereit, sie gehen zu lassen. Dafür sorgt auch das starke Band zu ihren neuen Freunden, ihrer neu gefundenen Familie. Darunter auch der charismatische Jace Wayland, der ihr mehr als einmal das Leben gerettet hat. Als ausgerechnet Jace in tödliche Gefahr gerät, stellt sich Clary schließlich ihrem Schicksal – und einem erbitterten Kampf gegen die Kreaturen der Nacht ...
Weitere Informationen zu Cassandra Clare sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
City of Ashes
Chroniken der Unterwelt
BUCH ZWEI
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »The Mortal Instruments. Book Two. City of Ashes« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2008.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Cassandra Clare LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Englischen Franca Fritz und Heinrich Koop © 2008 Arena Verlag GmbH, Würzburg. www.arena-verlag.de
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft), Pat Kinsella (Figur)
TH · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Inhalt
Prolog Rauch und Diamanten
TEIL EINS: EINE ZEIT IN DER HÖLLE
1 Valentins Pfeil
2 Blutmond
3 Inquisition
4 Das Kuckucksei
5 Die Sünden der Väter
6 Stadt der Asche
7 Das Schwert der Engel
TEIL ZWEI: DAS TOR ZUR HÖLLE
8 Der Lichte Hof
9 Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben
10 Ein Ort der Stille
11 Rauch und Stahl
12 Tückische Träume
13 Eine rebellische Engelsschar
TEIL DREI: TAG DES ZORNS
14Furchtlos
15 Schärfer als ein Schlangenzahn
16 Manch Herz zum Steine ward
17 Östlich von Eden
18 Sichtbar finstre Nacht
19 Dies irae
Epilog
Danksagung
Quellenverzeichnis
Für meinen Vater, der nicht böse ist. Na ja, vielleicht ein kleines bisschen.
Diese bittere Sprache
Ich kenne deine Straßen, geliebte Stadt, ich kenne die Dämonen und Engel, die wie Vögel schwärmen und sich auf deinen Ästen niederlassen.
Ich kenne dich, Fluss, als würdest du durch mein Herz strömen.
Ich bin deine Kriegertochter.
Hier finden sich Lettern, entstanden aus deiner Gestalt, so wie ein Brunnen aus Wasser entsteht.
Hier finden sich Sprachen, entlehnt deinem Vorbild, und wenn wir sie sprechen, erhebt sich die Stadt.
Elka Cloke
Prolog Rauch und Diamanten
Die gewaltige Konstruktion aus Glas und Stahl an der Front Street ragte wie eine glitzernde Nadel in den Himmel – das Metropole, das exklusivste Apartmenthaus in Manhattan. Im obersten Geschoss des siebenundfünfzig Stockwerke hohen Wohnturms befand sich die mit Abstand luxuriöseste Wohnung: das Metropole Penthouse, ein Meisterwerk eleganten Designs in Schwarz und Weiß. Auf den polierten, noch vollkommen staubfreien Marmorböden des nagelneuen Gebäudes spiegelten sich die Sterne, die durch die riesigen deckenhohen Fenster funkelten. Das Fensterglas war vollkommen transparent und erzeugte die perfekte Illusion, dass sich zwischen dem Betrachter und dem Ausblick absolut gar nichts befand – was selbst bei Besuchern ohne Höhenangst zu Schwindelanfällen führte.
Weit unten, überspannt von schimmernden Brücken und übersät von Booten so klein wie Fliegendreck, floss das silberne Band des East River, der die glitzernden Ufer von Manhattan und Brooklyn voneinander trennte. In klaren Nächten konnte man von hier aus die erleuchtete Gestalt der Freiheitsstatue im Süden erkennen, doch an diesem Abend war Dunst über dem Fluss aufgestiegen, und Liberty Island lag versteckt hinter einer weißen Nebelbank.
Trotz der atemberaubenden Aussicht schien der Mann mit dem hageren, asketischen Gesicht, der am Fenster stand, nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Mit gerunzelter Stirn wandte er sich schließlich von der Glasscheibe ab und ging entschlossen durch den Raum, wobei seine Stiefel auf dem Marmorboden laut klackten.
»Bist du noch immer nicht fertig?«, fragte er gebieterisch und fuhr sich mit der Hand durch die schlohweißen Haare. »Wir sind schon seit fast einer Stunde hier.«
Der Junge, der auf dem Boden kniete, sah nervös und genervt zu ihm auf. »Das liegt am Marmor. Der ist solider, als ich dachte. Und dadurch wird es schwer, das Pentagramm zu zeichnen.«
»Dann vergiss das Pentagramm.« Aus der Nähe wurde deutlich, dass der Mann trotz seiner weißen Haare nicht alt war. Sein hartes Gesicht wirkte streng, zeigte aber keine Falten, und seine Augen waren klar und wach.
Der Junge schluckte, und die dünnen schwarzen Flügel, die aus seinen schmächtigen Schulterblättern herausragten (seine Jeansjacke war im Rücken mit Schlitzen versehen), flatterten nervös. »Das Pentagramm ist ein unerlässlicher Bestandteil eines jeden Rituals zur Beschwörung von Dämonen. Das wissen Sie doch. Ohne diesen Drudenfuß …«
»… sind wir ungeschützt. Das weiß ich, Elias. Aber jetzt mach endlich weiter. Ich kenne Hexenmeister, die in der Zeit, die du brauchst, um die Hälfte eines fünfeckigen Sterns zu zeichnen, einen Dämon heraufbeschwören, ihren Spaß mit ihm haben und ihn anschließend wieder zurück in die Hölle schicken.«
Der Junge schwieg und widmete sich dem Marmorboden, nun noch verbissener als zuvor. Schweiß tropfte von seiner Stirn, und als er sich die Haare mit einer Hand zurückschob, sah man, dass deren Finger durch netzartige Membranen miteinander verbunden waren. »Fertig«, meinte er schließlich und hockte sich schnaufend auf die Fersen. »Es ist fertig.«
»Gut.« Der Mann klang zufrieden. »Dann mal los.«
»Mein Geld …«
»Das hab ich dir doch schon gesagt. Du bekommst dein Geld, nachdem ich mit Agramon geredet habe, nicht vorher.«
Elias stand auf und streifte die Jeansjacke ab. Trotz der Schlitze die er hineingeschnitten hatte, engte sie seine Flügel doch stark ein. Endlich befreit, dehnten und streckten sie sich und fächerten eine Brise durch den unbelüfteten Raum. Seine Schwingen besaßen die Farbe einer Öllache: schwarz, durchsetzt mit atemberaubend schillernden Regenbogenfarben. Der Mann schaute zur Seite, als würde ihm der Anblick der Flügel missfallen, doch Elias schien das nicht zu bemerken. Mit langsamen Schritten begann er, das gezeichnete Pentagramm zu umkreisen, entgegen dem Uhrzeigersinn und in einer Dämonensprache psalmodierend, die wie das Knistern einer Flamme klang.
Plötzlich und mit einem Geräusch, als hätte jemand die Luft aus einem Reifen abgelassen, schlugen aus den Umrissen des Pentagramms Feuerzungen empor, und in den zwölf hohen Fenstern spiegelte sich ein Dutzend brennender fünfeckiger Sterne.
Innerhalb des Drudenfußes rührte sich etwas – etwas Formloses und Schwarzes. Elias psalmodierte nun schneller, hob die schmalen Hände und zeichnete mit den verwachsenen Fingern komplizierte Konturen in die Luft, in deren Kielsog blaue Flammen aufflackerten. Der Mann sprach zwar nur wenig Cthonian, die Sprache der Hexenmeister, aber er erkannte genügend Worte, um Elias’ wiederholten Sprechgesang zu verstehen: Agramon, ich beschwöre dich. Aus den Tiefen zwischen den Welten beschwöre ich dich.
Der Mann schob eine Hand in die Tasche. Als seine Finger etwas Hartes, Kaltes und Metallisches berührten, lächelte er zufrieden. Elias hatte seine Wanderung unterbrochen. Er stand nun vor dem Pentagramm, und seine Stimme hob und senkte sich in einem ruhigen Sprechgesang. Um ihn herum flackerten blaue Flammen wie Blitze durch die Luft. Plötzlich erhob sich im Inneren des Pentagramms eine schwarze Rauchfahne; spiralförmig wand sie sich empor, dehnte sich aus und verfestigte sich. Zwei Augen glitzerten in den Schatten wie Edelsteine in einer Spinnwebe.
»Wer hat mich gerufen, quer durch die Welten?«, ertönte Agramons Stimme wie klirrendes Glas. »Wer ist es, der mich heraufbeschwört?«
Elias’ Gesang brach ab. Er verharrte reglos vor dem Pentagramm – reglos bis auf seine Flügel, die langsam auf und ab schwangen. Die Luft war erfüllt von einem beißenden Geruch, dem Gestank von Verätzung und Verbrennung.
»Agramon«, sagte der Junge. »Ich bin der Hexenmeister Elias. Ich bin derjenige, der dich heraufbeschworen hat.«
Einen Moment herrschte völlige Stille. Dann brach der Dämon in Gelächter aus – ein beißendes Lachen, ätzend wie Säure. »Närrischer Hexenmeister«, fauchte Agramon. »Du närrischer Junge.«
»Du bist ein Narr, wenn du glaubst, du könntest mir Angst einjagen«, erwiderte Elias, doch seine Stimme zitterte wie seine Schwingen. »Du bist ein Gefangener dieses Pentagramms, Agramon, bis ich dich freigebe.«
»Tatsächlich? Bin ich das?« Der Rauch brandete vor und zurück. Eine zarte Fahne nahm die Gestalt einer menschlichen Hand an und strich über die Konturen des brennenden Pentagramms. Und dann schoss der Rauch in einer Woge über die Ränder des Drudenfußes, ergoss sich über dessen Grenzen wie Wellen über einen Deich. Die Flammen flackerten und erloschen, als Elias aufschrie und zurücktaumelte. Fieberhaft sang er cthonische Abwehrzauber und Beschwörungsformeln. Doch nichts geschah; die schwarze Rauchmasse kam unaufhaltsam näher und nahm eine Gestalt an – eine missgebildete, riesige, grauenhafte Gestalt, deren glühende Augen auf die Größe von Untertassen anwuchsen und ein Furcht einflößendes Licht ausstrahlten.
Der Mann schaute mit ausdruckslosem Gesicht zu, wie Elias erneut aufschrie, sich umdrehte und losrannte. Doch er sollte die Tür nicht erreichen. Agramon schoss vor, und seine dunkle Masse walzte über den Hexenmeister wie eine Woge aus kochend heißem Teer. Einen Moment lang kämpfte Elias schwach gegen den Angriff an, doch bald rührte er sich nicht mehr.
Die schwarze Gestalt zog sich zurück und hinterließ den Hexenmeister mit verrenkten Gliedern auf dem Marmorboden.
»Ich hoffe doch sehr«, sagte der Mann, der den kalten Metallgegenstand aus seiner Tasche gezogen hatte und nun gedankenverloren damit spielte, »dass du ihm keinen Schaden zugefügt hast, durch den er für mich nutzlos wird. Schließlich brauche ich sein Blut.«
Agramon fuhr herum, eine schwarze Säule mit tödlichen, diamantharten Augen. Sie musterten den Mann in dem teuren Anzug, sein hageres, gleichgültiges Gesicht, die schwarzen Male, die seine Haut bedeckten, und das glänzende Objekt in seiner Hand. »Du hast das Hexenkind dafür bezahlt, mich heraufzubeschwören? Doch du hast ihm nicht gesagt, wozu ich fähig bin?«
»Ganz recht«, sagte der Mann.
»Das war schlau«, räumte Agramon widerwillig ein.
Der Mann ging einen Schritt auf den Dämon zu. »Ich bin sehr schlau. Und ab jetzt bin ich auch dein Gebieter. Denn ich besitze den Kelch der Engel. Du musst mir gehorchen … oder die Konsequenzen tragen.«
Der Dämon schwieg einen Moment. Dann glitt er zu Boden und vollführte eine spöttische Verbeugung, eine Geste, die einem Kniefall ähnelte – mehr war ihm als körperlosem Wesen nicht möglich.
»Ich stehe Euch zu Diensten, Lord …?«
Der Satz endete höflich, hing als Frage in der Luft.
Der Mann lächelte. »Du darfst mich Valentin nennen.«
Eine Zeit in der Hölle
Ich glaube mich in der Hölle, also bin ich es auch.
Arthur Rimbaud
1 Valentins Pfeil
»Bist du noch sauer?«
Alec lehnte an der Wand des Aufzugs und warf Jace einen zornigen Blick zu. »Ich bin nicht sauer.«
»Und ob du sauer bist.« Jace machte eine vorwurfsvolle Geste in Richtung seines Stiefbruders, fluchte dann aber unterdrückt, als ihm ein heißer Stich durch den Arm schoss. Jeder Teil seines Körpers schmerzte seit dem Aufschlag am Nachmittag, als er drei Geschosse tief durch vermodertes Holz in einen Haufen Schrott gestürzt war. Selbst seine Hände waren verletzt. Alec, der erst seit Kurzem wieder ohne Krücken gehen konnte, auf die er nach dem Kampf mit Abbadon angewiesen war, sah auch nicht viel besser aus als Jace. Seine Kleidung war über und über mit Schlamm bespritzt, seine Haare hingen verschwitzt und strähnig herab, und auf seiner Wange sah man eine lange Schnittwunde.
»Nein, bin ich nicht«, knurrte Alec zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Nur weil du gesagt hast, Drachendämonen wären ausgestorben …«
»Ich hab ›nahezu ausgestorben‹ gesagt.«
Alec fuchtelte mit dem Finger in Jace’ Richtung. »Nahezu ausgestorben«, entgegnete er mit vor Wut zitternder Stimme, »ist NICHT AUSGESTORBEN GENUG.«
»Verstehe«, sagte Jace. »Dann sollte ich wohl den Eintrag im Dämonologielehrbuch ändern lassen: von ›nahezu ausgestorben‹ zu ›nicht ausgestorben genug für Alec. Er bevorzugt seine Monster durch und durch ausgestorben.‹ Wärst du dann zufrieden?«
»Jungs«, sagte Isabelle, die ihr Gesicht in der verspiegelten Wand des Aufzugs betrachtet hatte, »hört auf zu streiten.« Mit einem heiteren Lächeln drehte sie sich um. »Okay, okay, es gab ein bisschen mehr Ärger, als wir erwartet hatten, aber ich hab mich prima amüsiert.«
Alec warf ihr einen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Wie schaffst du es eigentlich, dass du nie irgendwelchen Dreck abkriegst?«
Isabelle zuckte gelassen die Achseln: »Ich habe nun mal ein reines Herz. Das ist Schmutz abweisend.«
Jace schnaubte so laut, dass sie ihn stirnrunzelnd ansah. Er hielt ihr seine dreckstarrenden Finger vors Gesicht, deren Nägel an schwarze Halbmonde erinnerten. »Schmutzig von innen und außen.«
Isabelle wollte gerade etwas erwidern, als der Aufzug mit quietschenden Bremsen ruckartig anhielt. »Höchste Zeit, dass das Ding mal repariert wird«, sagte sie und stieß die Tür auf. Jace folgte ihr in die Eingangshalle; er freute sich darauf, die Waffen in die Ecke zu werfen und eine heiße Dusche zu nehmen. Er hatte seine Stiefgeschwister überredet, mit ihm auf die Jagd zu gehen, obwohl keiner von ihnen sich sehr wohl dabei gefühlt hatte, allein loszuziehen – ohne Hodge, der ihnen vorher immer Anweisungen und Ratschläge gegeben hatte. Doch Jace hatte die Zerstreuung des Kampfes gesucht, die brutale Ablenkung des Tötens und die Abwechslung schmerzender Verletzungen. Und da sie wussten, dass er auf jeden Fall gegangen wäre, hatten sie ihn begleitet, waren durch dreckige, verfallene U-Bahn-Tunnel gekrochen, bis sie den Drachendämon aufgestöbert und ihn getötet hatten. Alec, Isabelle und er hatten wie immer perfekt zusammengearbeitet – wie eine Familie.
Jace öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und schleuderte sie über einen Haken an der Wand. Alec saß neben ihm auf der niedrigen Holzbank und kickte die schlammverkrusteten Stiefel von den Füßen. Er summte leise und unmelodisch irgendetwas vor sich hin, damit Jace wusste, dass er nicht allzu sauer war. Isabelle zog die Nadeln aus ihrem langen dunklen Haar und ließ es über ihren Rücken hinabfallen. »Und jetzt hab ich Hunger«, sagte sie. »Ich wünschte, Mom wäre hier und würde uns was kochen.«
»Lieber nicht«, erwiderte Jace, während er den Waffengürtel ablegte. »Sie hätte sich längst wahnsinnig über den Teppich aufgeregt.«
»Da liegst du vollkommen richtig«, sagte eine kühle Stimme, und Jace wirbelte herum, die Hand noch immer am Gürtel. In der Tür stand Maryse Lightwood mit verschränkten Armen. Sie trug einen eleganten schwarzen Reiseanzug und hatte ihre Haare, die genauso pechschwarz waren wie Isabelles Locken, zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr bis zur Rückenmitte reichte. Ihre eisblauen Augen streiften wie Suchscheinwerfer über das Trio vor ihr.
»Mom!« Isabelle fing sich als Erste und lief zu ihrer Mutter, um sie zu umarmen. Auch Alec erhob sich und ging zu ihnen, wobei er die Tatsache, dass er noch immer humpelte, zu kaschieren versuchte.
Jace blieb dagegen wie angewurzelt stehen. Irgendetwas in Maryses Blick veranlasste ihn, sich nicht von der Stelle zu rühren. Das, was er gesagt hatte, war doch nicht so furchtbar schlimm gewesen, oder? Schließlich machten sie ständig Witze über ihre übertriebene Pingeligkeit mit den antiken Teppichen …
»Wo ist Dad?«, fragte Isabelle und trat einen Schritt zurück. »Und Max?«
Maryse hielt einen kaum wahrnehmbaren Moment inne und meinte dann: »Max ist in seinem Zimmer. Und euer Vater ist bedauerlicherweise noch in Alicante. Ein paar unaufschiebbare geschäftliche Angelegenheiten erforderten seine Anwesenheit dort.«
Alec, der für Stimmungslagen im Allgemeinen viel empfänglicher war als seine Schwester, schien zu zögern. »Stimmt irgendetwas nicht?«
»Das könnte ich dich fragen«, entgegnete seine Mutter trocken. »Humpelst du etwa?«
»Ich …«
Alec war ein furchtbar schlechter Lügner. Sofort sprang Isabelle ein: »Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit einem Drachendämon in einem U-Bahn-Tunnel. Aber das war völlig unbedeutend.«
»Und der Dämonenfürst, gegen den ihr letzte Woche gekämpft habt, der war vermutlich auch völlig unbedeutend?«
Diese Gegenfrage ließ sogar Isabelle verstummen. Sie warf Jace einen Blick zu, der inständig wünschte, sie hätte nicht zu ihm hinübergesehen.
»Das war nicht geplant.« Jace fiel es schwer, sich zu konzentrieren. Maryse hatte ihn noch immer nicht begrüßt, hatte nicht einmal Hallo gesagt und musterte ihn wieder mit ihren Augen, die wie blaue Dolche aussahen. Tief in seinem Magen breitete sich allmählich ein mulmiges Gefühl aus. So hatte sie ihn noch nie zuvor angesehen, ganz egal, was er angestellt hatte. »Es war ein Fehler …«
»Jace!« Max, der Jüngste der Familie Lightwood, quetschte sich an Maryse vorbei und stürzte in den Raum, wobei er der ausgestreckten Hand seiner Mutter geschickt auswich. »Du bist wieder da! Ihr seid alle wieder da.« Er drehte sich im Kreis und strahlte Alec und Isabelle triumphierend an. »Dacht ich’s mir doch! Dann hab ich mich also nicht verhört.«
»Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, in deinem Zimmer zu bleiben«, meinte Maryse.
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, erwiderte Max mit einer Ernsthaftigkeit, die selbst Alec lächeln ließ. Max war ziemlich klein für sein Alter – er sah aus wie ein Siebenjähriger –, besaß aber eine selbstgenügsame, ernste Haltung, die ihm, in Kombination mit seiner großen Brille, die Ausstrahlung eines deutlich älteren Jungen verlieh. Alec beugte sich vor und fuhr seinem Bruder durch die Haare, doch Max schaute noch immer mit leuchtenden Augen zu Jace. Jace spürte, wie sich die kalte Faust in seinem zusammengeballten Magen ein wenig entspannte. Max hatte ihn schon immer als Helden verehrt, auf eine Weise, die er nicht einmal für seinen eigenen älteren Bruder aufbrachte – möglicherweise weil Jace Max gegenüber viel toleranter war als Alec. »Ich hab gehört, du hast gegen einen Dämonenfürsten gekämpft«, sagte der kleine Junge nun. »Und, war es toll?«
»Es war … anders«, erwiderte Jace ausweichend. »Wie hat’s dir in Alicante gefallen?«
»Das war der Wahnsinn. Wir haben die tollsten Sachen gesehen. Die haben da ein riesiges Arsenal, und ich durfte zugucken, wie die Waffen gemacht werden. Der Waffenmeister hat mir sogar eine neue Methode zur Herstellung von Seraphklingen gezeigt, damit sie noch länger halten, und ich werde versuchen, Hodge zu überreden, mir …«
Jace konnte nicht anders: Sein Blick wanderte unwillkürlich zu Maryse, und er starrte sie ungläubig an. Dann wusste Max also noch nicht, was mit Hodge passiert war? Hatte sie es ihm denn nicht erzählt?
Maryse fing seinen Blick auf und presste die Lippen zu einer bleistiftdünnen Linie zusammen. »Das reicht jetzt, Max.« Sie packte ihren jüngsten Sohn am Arm.
Max legte den Kopf in den Nacken und schaute sie erstaunt an. »Aber ich rede doch gerade mit Jace …«
»Das sehe ich.« Sanft schob sie ihn zu Isabelle. »Isabelle, Alec, bringt euren Bruder auf sein Zimmer. Jace ….« Als sie seinen Namen aussprach, klang ihre Stimme furchtbar angespannt, so, als würde eine unsichtbare Säure die Silben in ihrem Mund austrocknen. »Zieh dir frische Sachen an und komm dann umgehend in die Bibliothek. Ich habe mit dir zu reden.«
»Das versteh ich nicht«, sagte Alec und schaute von seiner Mutter zu Jace und wieder zurück. »Was ist los?«
Jace spürte, wie ihm kalter Schweiß den Rücken hinunterlief. »Geht es um meinen Vater?«
Maryse zuckte zusammen, als hätten die Worte »mein Vater« sie wie Schläge getroffen. »Ich erwarte dich in der Bibliothek«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Dort werden wir über diese Angelegenheit reden.«
»Was während deiner Abwesenheit passiert ist, war nicht Jace’ Fehler«, warf Alec ein. »Daran sind wir alle beteiligt. Und Hodge meinte …«
»Über Hodge reden wir ebenfalls später.« Maryse warf einen warnenden Blick in Max’ Richtung.
»Aber Mom«, protestierte Isabelle. »Wenn du Jace bestrafen willst, solltest du uns alle bestrafen. Das wäre nur fair. Wir haben schließlich alle das Gleiche getan.«
»Nein«, erwiderte Maryse nach einer derart langen Pause, dass Jace schon dachte, sie würde überhaupt nicht reagieren. »Nein, das habt ihr nicht.«
»Anime-Regel Nummer eins«, sagte Simon. Er lehnte gegen einen Stapel Kissen am Fußende seines Bettes, eine Tüte Chips in der einen Hand und die Fernbedienung in der anderen. Sein schwarzes T-Shirt trug den Aufdruck »I BLOGGED YOUR MOM«, und ein breiter Riss zog sich quer über das Knie seiner Jeans. »Leg dich nie mit einem blinden Mönch an.«
»Ich weiß«, sagte Clary, nahm einen Kartoffelchip und tunkte ihn in den Dip, der auf einem Tablett zwischen ihnen stand. »Aus irgendeinem Grund sind sie immer wesentlich bessere Kämpfer als Mönche, die sehen können.« Sie warf einen Blick auf den Fernseher. »Tanzen die da etwa miteinander?«
»Das ist kein Tanz. Die versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Der da ist der Erzfeind von dem anderen Typen. Schon vergessen? Derjenige, der seinen Dad getötet hat. Warum sollten die zwei tanzen?«
Clary kaute geräuschvoll auf ihrem Kartoffelchip herum und starrte nachdenklich auf den Bildschirm, auf dem zwei geflügelte Männer umeinander herumschwebten, jeder einen glühenden Speer in der Hand, und gezeichnete rosa und gelbe Wolken zwischen den beiden Gestalten hin und her wirbelten. Ab und zu sagte einer der Männer etwas, aber da der Zeichentrickfilm auf Japanisch lief, mit chinesischen Untertiteln, trugen die Worte kaum zur Klärung der Handlung bei. »Der Typ mit dem Hut«, sagte Clary. »War das der Böse?«
»Nein, der Hut-Typ war der Vater. Er war der Kaiser mit den magischen Kräften, und das da war sein mächtiger Zauberhut. Der Böse war der Kerl mit der künstlichen Hand, die reden kann.«
In dem Moment klingelte das Telefon. Simon legte die Chipstüte beiseite und machte Anstalten aufzustehen. Doch Clary hielt ihn am Arm fest. »Nicht. Lass es einfach klingeln.«
»Aber das könnte Luke sein. Er könnte aus dem Krankenhaus anrufen.«
»Das ist nicht Luke«, erwiderte Clary, wobei sie sicherer klang, als sie sich tatsächlich fühlte. »Er würde mich auf meinem Handy anrufen und nicht hier bei dir.«
Simon warf ihr einen langen Blick zu und ließ sich dann wieder in die Kissen sinken. »Wenn du meinst.« Sie konnte die Skepsis in seiner Stimme hören, aber auch die unausgesprochene Versicherung: Ich will nur, dass du glücklich bist. Aber Clary war sich nicht sicher, ob »glücklich« das richtige Wort für ihren Gefühlszustand war – jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, wo ihre Mutter im Krankenhaus lag, an Schläuche und piepsende Maschinen angeschlossen, und wo Luke tagein, tagaus wie ein Zombie auf dem harten Plastiksessel neben ihrem Krankenbett hockte. Ganz zu schweigen von den Sorgen, die Clary sich um Jace machte. Etwa ein Dutzend Mal hatte sie den Telefonhörer in die Hand genommen, um im Institut anzurufen, dann aber wieder aufgelegt, bevor sie die Nummer gewählt hatte. Wenn Jace mit ihr reden wollte, konnte er sie schließlich auch anrufen.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen, ihn zu Jocelyn mit ins Krankenhaus zu nehmen. Clary war sich so sicher gewesen, dass ihre Mutter sofort aufwachen würde, wenn sie nur die Stimme ihres Sohnes, ihres Erstgeborenen, hörte. Aber sie war nicht aus dem Koma erwacht. Jace hatte steif und unbehaglich an ihrem Bett gestanden; sein Gesicht hatte wie das eines gemalten Engels ausgesehen, mit leeren, teilnahmslosen Augen. Nach einer Weile hatte Clary die Geduld verloren und ihn angeschrien, und er hatte zurückgebrüllt und war dann hinausgestürmt. Mit einer Art kühl analysierendem Interesse in den erschöpften Augen hatte Luke ihm nachgeschaut. »Das ist das erste Mal, dass ich euch beide wie Geschwister streiten sehe«, hatte er festgestellt.
Clary hatte nichts darauf erwidert. Es hatte keinen Zweck, ihm zu erzählen, wie sehr sie sich wünschte, dass Jace nicht ihr Bruder wäre. Schließlich konnte sie sich nicht die eigene DNA herausreißen – ganz gleich, wie sehr sie sich danach sehnte, und ganz gleich, wie glücklich sie dann wäre.
Doch obwohl es ihr nicht gelang, glücklich zu sein, fühlte sie sich hier bei Simon, in seinem Zimmer, wenigstens gut aufgehoben und zu Hause, dachte Clary. Sie kannte ihn schon so lange, dass sie sich sogar noch daran erinnern konnte, wie er als kleiner Junge ein Bett in Form eines Feuerwehrautos gehabt hatte und in welcher Zimmerecke die Legosteine immer gelegen hatten. Inzwischen besaß Simon einen Futon mit einem leuchtend bunt gestreiften Quilt – ein Geschenk seiner Schwester –, und die Wände waren mit Postern von Bands wie Rock Solid Panda und Stepping Razor übersät. In der Ecke, in der sich früher die Legos gestapelt hatten, befand sich jetzt ein Schlagzeug, und an der gegenüberliegenden Wand stand ein Computer, auf dessen Monitor ein World-of-Warcraft-Bildschirmschoner flackerte. Simons Reich war ihr fast so vertraut wie ihre eigene Wohnung – die aber nicht mehr existierte. Und deshalb kam sein Zimmer für sie einem Zuhause am nächsten.
»Noch mehr Chibis«, sagte Simon düster. Sämtliche Figuren auf dem Fernsehbildschirm hatten sich in zentimetergroße Kleinkindversionen ihrer selbst verwandelt und jagten sich gegenseitig mit Töpfen und Pfannen. »Ich zapp mal weiter«, verkündete er und griff nach der Fernbedienung. »Diesen Anime hab ich langsam satt. Ich versteh die Handlung nicht, und außerdem hat keiner der Typen je Sex.«
»Natürlich nicht«, sagte Clary und nahm sich noch einen Kartoffelchip. »Diese Zeichentrickfilme sind schließlich gute, saubere Unterhaltung für die ganze Familie.«
»Falls du Lust auf etwas weniger gute, saubere Unterhaltung hast, könnten wir ja mal den Pornokanal einschalten«, schlug Simon vor. »Möchtest du lieber ›Die Hexen von Eastfick‹ sehen oder ›Schneeflittchen und die sieben Zwerge‹?«
»Gib mal her!« Clary versuchte, die Fernbedienung an sich zu reißen, aber Simon kicherte nur hämisch und schaltete weiter.
Doch sein Gelächter brach abrupt ab. Überrascht schaute Clary auf und sah, wie Simon mit ausdruckslosem Gesicht auf den Bildschirm starrte. Auf diesem Sender lief ein alter Schwarz-Weiß-Film – ›Dracula‹. Clary hatte den Filmklassiker schon zusammen mit ihrer Mutter gesehen. Bela Lugosi stand hager und mit bleichem Gesicht da, in seinen bekannten Umhang mit dem hohen Kragen gehüllt, die Lippen leicht geschürzt, sodass seine spitzen Eckzähne zum Vorschein kamen. »Ich trinke niemals … Wein!«, intonierte er mit starkem ungarischem Akzent.
»Ich liebe diese Spinnweben aus Gummi«, sagte Clary und versuchte, einen leichten Tonfall anzuschlagen. »Die sind meilenweit zu erkennen.«
Aber Simon war bereits aufgesprungen und warf die Fernbedienung aufs Bett. »Bin gleich wieder da«, murmelte er. Sein Gesicht hatte die Farbe eines Winterhimmels kurz vor einem Regenguss. Clary sah ihm nach, als er aus dem Zimmer ging, und biss sich auf die Lippe. Es war das erste Mal seit der Krankenhauseinweisung ihrer Mutter, dass ihr bewusst wurde, dass Simon vielleicht auch nicht besonders glücklich war.
Jace fuhr sich mit dem Handtuch durch die Haare und betrachtete sein Spiegelbild mit zweifelnder, finsterer Miene. Eine Heilrune hatte seine schlimmsten Verletzungen beseitigt, aber die dunklen Schatten unter seinen Augen und die harten Linien rund um seine Lippen waren geblieben. Sein Kopf pochte schmerzhaft, und er fühlte sich leicht schwindlig. Er wusste, er hätte an diesem Morgen etwas essen sollen. Aber er war keuchend und mit einem Übelkeitsgefühl aus einem Albtraum hochgeschreckt und hatte keine Zeit mit Frühstück verschwenden, sondern sofort die beruhigende Wirkung körperlicher Aktivität spüren wollen – um seine Träume durch Schweiß und blaue Flecken auszutreiben.
Er warf das Handtuch beiseite und dachte sehnsüchtig an den süßen schwarzen Tee, den Hodge früher aus den Blüten einiger nachtblühender Pflanzen seines Gewächshauses aufgebrüht hatte. Der Aufguss hatte das Hungergefühl betäubt und ihn immer mit neuer Energie erfüllt. Seit Hodges Tod hatte Jace schon mehrfach versucht, die Blätter der Pflanzen in heißem Wasser aufzukochen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Aber das Ergebnis war jedes Mal eine bittere, nach Asche schmeckende Brühe, die ihn würgen und spucken ließ.
Barfuß lief er aus dem Bad in sein Zimmer und zog eine saubere Jeans und ein frisches T-Shirt an. Stirnrunzelnd schob er die feuchten blonden Haare nach hinten. Sie waren im Moment viel zu lang und fielen ihm in die Augen – ein Umstand, den Maryse garantiert bemäkeln würde. Das hatte sie schon immer so gemacht. Er mochte zwar nicht der leibliche Sohn der Lightwoods sein, aber sie hatten ihn stets als solchen behandelt, seit seiner Adoption im Alter von zehn Jahren, nach dem Tod seines Vaters. Dem angeblichen Tod, dachte Jace bitter, und das dumpfe Gefühl in der Magengegend kehrte zurück. Die vergangenen Tage hatte er sich wie eine Kürbislaterne gefühlt – als hätte man ihm die Eingeweide mit einer Gabel herausgepult und ihm ein starres Grinsen ins Gesicht geschnitten. Er fragte sich, ob irgendetwas von dem, was er sein Leben lang geglaubt hatte, jemals der Wahrheit entsprochen hatte. Er hatte gedacht, er sei eine Waise – aber das war er nicht. Er hatte gedacht, er wäre ein Einzelkind – aber er hatte eine Schwester.
Clary. Der Schmerz wurde nun nagender, und er versuchte, ihn zu unterdrücken. Sein Blick fiel auf die Spiegelscherbe, die auf seiner Kommode lag und noch immer grüne Zweige und ein Stück eines blauen Himmels reflektierte. In Idris hatte bereits die Abenddämmerung eingesetzt: Der Himmel schimmerte so dunkel wie Kobalt. Jace kämpfte gegen das mulmige Gefühl in seiner Magengrube an, stieg in die Stiefel und marschierte nach unten in Richtung der Bibliothek.
Während er die Steinstufen hinunterpolterte, fragte er sich, was Maryse wohl mit ihm allein besprechen wollte. Sie hatte ausgesehen, als würde sie am liebsten weit ausholen und ihm eine knallen. Jace konnte sich nicht erinnern, wann sie ihn das letzte Mal geschlagen hatte. Die Lightwoods waren keine Befürworter der Prügelstrafe – ganz im Gegensatz zu seinem Vater, der sich alle möglichen Formen von körperlicher Züchtigung ausgedacht hatte, um Gehorsam zu erzwingen. Jace’ Schattenjägerhaut war glücklicherweise immer wieder verheilt und hatte die äußerlichen Wunden kaschiert. Jace konnte sich erinnern, dass er in den Tagen und Wochen nach dem Tod seines Vaters seinen Körper nach Narben abgesucht hatte, nach irgendeinem Wundmal, das als Zeichen, als Andenken dienen konnte – etwas, das ihn körperlich mit der Erinnerung an seinen Vater verband.
Er erreichte die Bibliothek und klopfte einmal kurz an, ehe er die Tür aufdrückte. Maryse war schon da; sie saß in Hodges altem Sessel am Kamin, ein Glas Rotwein in der Hand. Auf dem Tisch neben ihr stand eine Kristallkaraffe. Durch die hohen Fenster fiel Licht in den Raum, und Jace konnte die grauen Strähnen in ihren Haaren erkennen.
»Maryse«, sagte er.
Sie zuckte leicht zusammen und verschüttete etwas Wein. »Jace. Ich habe dich nicht kommen gehört.«
Jace rührte sich nicht von der Stelle. »Erinnerst du dich noch an das Lied, das du Isabelle und Alec immer vorgesungen hast, damit sie besser einschlafen konnten – als sie noch klein waren und sich vor der Dunkelheit fürchteten?«
Maryse starrte ihn erstaunt an. »Wovon redest du?«
»Ich habe dich durch die Wand gehört«, sagte er. »Alecs Zimmer lag damals direkt neben meinem.«
Maryse schwieg.
»Es war auf Französisch«, fuhr Jace fort. »Das Lied, meine ich.«
»Ich weiß nicht, warum du dich gerade jetzt an so etwas erinnerst.« Sie schaute ihn betroffen an, als hätte er ihr irgendetwas vorgeworfen.
»Für mich hast du nicht ein einziges Mal gesungen.«
Maryse schien kaum wahrnehmbar zu zögern und meinte dann: »Ach, du … du hast dich doch nie vor der Dunkelheit gefürchtet.«
»Welcher Zehnjährige fürchtet sich nie vor der Dunkelheit?«
Sie musterte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen. »Setz dich endlich, Jonathan«, sagte sie. »Steh nicht da rum.«
Aufreizend langsam durchquerte Jace die Bibliothek und warf sich in einen der Ohrensessel neben dem Schreibtisch. »Mir wäre es lieber, wenn du mich nicht ›Jonathan‹ nennen würdest.«
»Warum nicht? Das ist doch dein Name.« Sie musterte ihn nachdenklich. »Wie lange weißt du es schon?«
»Wie lange weiß ich was?«
»Stell dich nicht dümmer, als du bist. Du weißt genau, was ich meine.« Sie drehte das Glas zwischen ihren Fingern. »Wie lange weißt du schon, dass Valentin dein Vater ist?«
Jace dachte einen Moment nach und verwarf dann mehrere Antworten, die ihm als erste einfielen. Normalerweise kam er bei Maryse mit allem durch, indem er sie zum Lachen brachte. Er war einer der wenigen Menschen auf der Welt, der sie überhaupt zum Lachen bringen konnte. »Etwa genauso lange wie du.«
Maryse schüttelte langsam den Kopf. »Das glaube ich dir nicht.«
Jace setzte sich ruckartig auf. Seine Hände hatten sich zu Fäusten geballt und pressten sich krampfhaft gegen die Armlehnen. Er sah, wie seine Finger leicht bebten, und fragte sich, ob dieses Zittern schon früher einmal aufgetaucht war. Er konnte sich jedenfalls nicht daran erinnern – seine Hände waren immer so ruhig gewesen wie sein Herzschlag. »Du glaubst mir nicht?«
Er hörte die Fassungslosigkeit in seiner eigenen Stimme und krümmte sich innerlich. Natürlich glaubte sie ihm nicht; das war vom ersten Moment nach ihrer Rückkehr an deutlich gewesen.
»Es ergibt keinen Sinn, Jace. Wie sollte es möglich sein, dass du nicht weißt, wer dein Vater ist?«
»Er hat mir gesagt, er sei Michael Wayland. Wir haben auf dem Landsitz der Waylands gewohnt …«
»Wie rührend«, sagte Maryse, »und dein Name? Wie lautet dein richtiger Name?«
»Du kennst meinen richtigen Namen.«
»Jonathan Christopher. Ich weiß, dass das der Name von Valentins Sohn war. Und ich weiß, dass Michael ebenfalls einen Sohn namens Jonathan hatte. Ein ziemlich gebräuchlicher Name unter Schattenjägern. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, dass beide den gleichen Namen trugen, und nach dem zweiten Namen von Michaels Sohn habe ich nie gefragt. Aber jetzt muss ich mich doch ziemlich wundern. Wie lautete denn nun der zweite Name von Michael Waylands Sohn? Wie lange hatte Valentin das, was er dann durchgeführt hat, schon geplant? Wie lange wusste er bereits, dass er Jonathan Wayland umbringen würde ….?« Sie verstummte und musterte Jace von Kopf bis Fuß. »Du hast Michael nie ähnlich gesehen«, sagte sie nach einer Weile. »Aber manchmal kommen Kinder eben nicht nach ihren Eltern. Darüber habe ich mir bisher nie Gedanken gemacht. Doch jetzt erkenne ich Valentin in dir. In der Art und Weise, wie du mich ansiehst. Dieser herausfordernde Blick. Es interessiert dich gar nicht, was ich sage, oder?«
Doch, es interessiert mich sehr wohl, dachte Jace. Er war lediglich besonders gut darin, Gefühle nicht nach außen dringen zu lassen. »Würde das irgendeinen Unterschied machen?«
Maryse stellte das Glas auf dem Tischchen neben ihrem Sessel ab. Es war leer. »Und du beantwortest Fragen mit Gegenfragen, um mich aus dem Konzept zu bringen – genau wie Valentin es früher immer gemacht hat. Vielleicht hätte ich es wissen müssen.«
»Vielleicht aber auch nicht. Ich bin immer noch der gleiche Mensch wie in den vergangenen sieben Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Wenn ich dich vorher nicht an Valentin erinnert habe, dann wüsste ich nicht, warum ich das jetzt tun sollte.«
Ihr Blick glitt an ihm vorbei zur Seite, als könnte sie es nicht ertragen, ihn direkt anzusehen. »Bei unseren früheren Gesprächen über Michael musst du doch gewusst haben, dass wir unmöglich deinen Vater damit gemeint haben konnten. Was wir über ihn gesagt haben, passte doch nie und nimmer auf Valentin.«
»Du hast gesagt, er wäre ein guter Mensch gewesen.« Ärger flackerte in ihm auf. »Ein mutiger Schattenjäger. Ein liebender Vater. Ich fand das ziemlich zutreffend.«
»Und was ist mit Fotos? Du musst doch irgendwelche Bilder von Michael Wayland gesehen und erkannt haben, dass das nicht der Mann war, den du als deinen Vater bezeichnet hast.« Sie biss sich auf die Lippe. »Erklär mir das mal, Jace.«
»Sämtliche Fotografien wurden während des Aufstands vernichtet. Das hast du mir selbst gesagt. Allerdings frage ich mich jetzt, ob Valentin sie nicht verbrennen ließ, damit niemand wusste, wer dem Kreis angehört hatte. Ich habe nie auch nur ein einziges Foto von meinem Vater besessen«, sagte Jace und fragte sich, ob er wohl genauso verbittert klang, wie er sich fühlte.
Maryse legte eine Hand an die Schläfe und massierte sie, als hätte sie Kopfschmerzen. »Ich kann das alles nicht glauben«, sagte sie, eher zu sich selbst. »Es ist zu irrsinnig.«
»Dann glaube es eben nicht – aber glaube mir«, erwiderte Jace und spürte, wie das Zittern in seinen Fingern zunahm.
Maryse ließ die Hand sinken. »Meinst du nicht, dass ich das wirklich gerne tun würde?«, fragte sie, und einen kurzen Moment hörte er in ihrer Stimme ein Echo der Maryse, die abends immer in sein Zimmer gekommen war, wenn er als Zehnjähriger im Bett gelegen, an die Decke gestarrt und an seinen Vater gedacht hatte. Die Maryse, die an seinem Bett sitzen geblieben war, bis er kurz vor der Morgendämmerung endlich einschlief.
»Ich habe es wirklich nicht gewusst«, erklärte Jace erneut. »Und als er mich aufgefordert hat, ihn nach Idris zu begleiten, habe ich abgelehnt. Ich bin noch immer hier. Zählt das denn gar nicht?«
Maryse drehte sich zur Seite und schaute auf die Karaffe, als zöge sie ein weiteres Glas Wein in Erwägung. Doch dann schien sie den Gedanken zu verwerfen.
»Ich wünschte, es wäre so«, sagte sie. »Aber es gibt so viele Gründe, warum dein Vater dich weiterhin hier im Institut wissen möchte. Solange es um Valentin geht, kann ich es mir nicht erlauben, irgendjemandem zu trauen, der unter seinem Einfluss gestanden hat.«
»Du hast auch unter seinem Einfluss gestanden«, sagte Jace und bereute es sofort, als er den Ausdruck sah, der sich auf ihrem Gesicht ausbreitete.
»Und ich habe mich von ihm abgekehrt«, erwiderte Maryse. »Hast du das auch getan? Könntest du das?« Ihre blauen Augen hatten die gleiche Farbe wie Alecs Augen, aber Alec hatte ihn noch nie auf diese Weise angesehen. »Sag mir, dass du ihn hasst, Jace. Sag mir, du hasst diesen Mann und alles, wofür er steht.«
Es verging ein Moment … und ein weiterer, während Jace auf seine Hände schaute, die so fest zusammengeballt waren, dass die Fingerknöchel weiß und hart wie Fischgräten herausstachen. »Das kann ich nicht.«
Maryse hielt geräuschvoll den Atem an. »Warum nicht?«
»Warum kannst du nicht sagen, dass du mir vertraust? Ich habe fast mein halbes Leben mit dir unter einem Dach verbracht. Du musst mich inzwischen doch gut genug kennen, um zu wissen, dass ich so was niemals tun würde?«
»Du klingst so aufrichtig, Jonathan. So hast du früher schon geklungen, auch als kleiner Junge, wenn du versucht hast, die Schuld für eine deiner Missetaten Isabelle oder Alec in die Schuhe zu schieben. Ich habe in meinem Leben bisher nur einen Menschen kennengelernt, der genauso überzeugend klingen konnte wie du.«
Jace schmeckte einen kupferartigen Geschmack im Mund. »Du meinst meinen Vater.«
»Für Valentin gab es immer nur zwei Sorten von Menschen auf der Welt«, sagte Maryse. »Diejenigen, die für den Kreis waren, und diejenigen, die sich gegen ihn stellten. Letztere waren seine erklärten Feinde, und die Ersteren bildeten die Waffen in seinem Arsenal. Ich habe gesehen, wie er versucht hat, jeden seiner Freunde, sogar seine eigene Frau, in eine Waffe für seine Zwecke zu verwandeln – und jetzt verlangst du von mir, ich soll dir glauben, dass er nicht auch das Gleiche bei seinem eigenen Sohn versucht hat?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kenne ihn besser.« Zum ersten Mal sah Maryse Jace mit einem Blick an, aus dem mehr Trauer als Wut sprach. »Du bist ein Pfeil, der direkt ins Herz des Rats geschossen wurde, Jace. Du bist Valentins Pfeil. Ob du es nun weißt oder nicht.«
Clary schloss die Zimmertür, hinter der der Fernseher plärrte, und machte sich auf die Suche nach Simon. Sie fand ihn in der Küche. Er stand über die Spüle gebeugt, in der das Wasser lief, und stützte sich auf den Rand des Beckens.
»Simon?« Die Küche leuchtete in einem warmen, heiteren Gelbton, und an den Wänden hingen gerahmte Malkreide- und Buntstiftzeichnungen, die Simon und Rebecca in der Grundschule angefertigt hatten. Rebecca besaß eine gewisse künstlerische Ader, das konnte man erkennen; aber Simons Skizzen von Menschen sahen alle aus wie Parkuhren mit Haarbüscheln.
Er schaute nicht auf, als Clary hereinkam, aber sie konnte an der Anspannung seiner Schultermuskeln sehen, dass er sie gehört hatte. Sie ging zu ihm und legte ihm vorsichtig eine Hand auf den Rücken. Durch das dünne Baumwoll-T-Shirt spürte sie die scharfen Knochen seiner Wirbelsäule und fragte sich, ob er abgenommen hatte. Auf den ersten Blick konnte sie keinen Gewichtsverlust an ihm erkennen, aber wenn sie Simon betrachtete, war das so, als würde sie in einen Spiegel schauen: Wenn man jemanden tagtäglich sieht, nimmt man kleine Veränderungen im Erscheinungsbild nicht immer wahr. »Alles in Ordnung?«, fragte Clary.
Mit einer ruckartigen Handbewegung drehte Simon den Wasserhahn zu. »Klar. Mir geht’s gut.«
Behutsam legte sie ihm einen Finger ans Kinn und drehte sein Gesicht zu sich. Er schwitzte; seine dunklen Haare klebten ihm feucht an der Stirn, obwohl die Luft, die durch das halb geöffnete Küchenfenster hereinströmte, ziemlich kühl war. »Du siehst aber gar nicht gut aus. Hat das etwas mit dem Film zu tun?«
Simon reagierte nicht.
»Tut mir leid. Ich hätte nicht lachen sollen. Es war einfach nur so lustig …«
»Erinnerst du dich denn nicht?« Seine Stimme klang rau.
»Ich …« Clary verstummte. Jene Nacht erschien ihr in der Rückschau wie ein langer verworrener Wirbel aus endlosem Laufen, aus Blut und Schweiß, aus Schatten in Torbögen, aus tiefen Stürzen. Sie erinnerte sich an die bleichen Gesichter der Vampire, die wie weiße Papierschablonen in der Dunkelheit geleuchtet hatten, und sie wusste auch noch, dass Jace sie gehalten hatte, ihr mit heiserer Stimme etwas ins Ohr gerufen hatte. »Nein, nicht besonders gut. Es ist alles verschwommen.«
Sein Blick flackerte; er schaute kurz zur Seite und dann wieder zu ihr. »Komme ich dir irgendwie verändert vor?«, fragte er.
Clary sah ihm in die Augen, die die Farbe von schwarzem Kaffee hatten – nicht pechschwarz, eher ein dunkles Braun, ohne jede Spur von Grau oder Haselnuss. Kam er ihr irgendwie anders vor? Seit dem Tag, an dem er Abbadon, den Dämonenfürsten, getötet hatte, wirkte er tatsächlich ein wenig selbstbewusster. Allerdings strahlte er auch eine nervöse Wachsamkeit aus, als wäre er auf der Hut oder würde auf irgendetwas warten – eine Haltung, die sie auch bei Jace festgestellt hatte. Vielleicht war es aber auch nur das Wissen um die eigene Sterblichkeit. »Du bist immer noch Simon«, erwiderte sie.
Er schloss halb die Lider, als wäre er erleichtert, und als sich seine Wimpern senkten, sah sie, wie spitz seine Wangenknochen aus seinem Gesicht herausstachen. Also hatte er doch Gewicht verloren, dachte Clary und wollte gerade etwas sagen, als er sich zu ihr hinunterbeugte und sie küsste.
Clary war so überrascht, seinen Mund auf ihren Lippen zu spüren, dass sie schlagartig erstarrte und sich Halt suchend am Rand der Spüle festklammerte. Allerdings schob sie ihn auch nicht von sich weg, was Simon eindeutig als ermutigendes Zeichen auffasste. Er legte eine Hand hinter ihren Kopf, verstärkte seinen Kuss und öffnete ihre Lippen mit den seinen. Sein Mund war sanft – sanfter als der von Jace –, und die Hand, die ihren Nacken umfing, fühlte sich warm und weich an. Er schmeckte nach Salz.
Clary schloss die Augen und ließ sich einen Moment in die Dunkelheit und Hitze fallen, in das Schwindelgefühl, das seine Finger in ihren Haaren erzeugten. Doch als das laute Schrillen des Telefons durch ihre Benommenheit schnitt, zuckte sie zurück, als hätte er sie fortgestoßen, obwohl Simon sich überhaupt nicht gerührt hatte. Einen Moment lang starrten sie einander verwirrt an, wie zwei Menschen, die sich plötzlich in einer seltsamen, völlig fremden Umgebung wiederfinden.
Simon wandte sich als Erster ab und griff nach dem Telefon, das neben dem Gewürzregal an der Wand hing. »Ja?« Er klang vollkommen normal, aber seine Brust hob und senkte sich in einem schnellen Rhythmus. Dann hielt er Clary den Hörer entgegen. »Für dich.«
Clary nahm den Telefonhörer, während sie in ihrer Kehle noch das heftige Schlagen ihres Pulses fühlen konnte, wie das Flattern eines unter der Haut gefangenen Insekts. Das ist Luke, der aus dem Krankenhaus anruft. Irgendetwas ist mit meiner Mutter passiert.
Sie schluckte. »Luke? Bist du das?«
»Nein. Hier ist Isabelle.«
»Isabelle?« Clary schaute auf und sah, dass Simon gegen die Spüle lehnte und sie beobachtete. Das leuchtende Rot auf seinen Wangen war verblasst. »Warum rufst du an … ich meine, was ist los?«
Isabelles Stimme klang angespannt, als hätte sie geweint. »Ist Jace da?«
Einen Moment lang starrte Clary erstaunt auf den Hörer in ihrer Hand, ehe sie ihn sich wieder ans Ohr hielt. »Jace? Nein. Warum sollte er hier sein?«
Isabelle stieß einen tiefen Schluchzer aus. »Es ist so … er ist nämlich verschwunden.«
2 Blutmond
Attraktiven Jungen hatte Maia noch nie über den Weg getraut, und das war auch der Grund dafür, warum sie Jace Wayland von der ersten Begegnung an aufrichtig hasste.
Ihr älterer Bruder Daniel war mit der honigfarbenen Haut und den riesigen dunklen Augen ihrer Mutter geboren worden, und er hatte sich zu jener Sorte Mensch entwickelt, die die Flügel von Schmetterlingen anzünden, um zuzusehen, wie sie fliegend verbrannten. Auch seine Schwester hatte er gequält, anfangs nur mit kleinen, nebensächlichen Boshaftigkeiten – er hatte sie an Stellen gekniffen, wo man die Druckmale nicht sehen konnte, oder das Shampoo in ihrer Flasche durch Bleichmittel ersetzt. Maia hatte ihren Eltern davon erzählt, aber diese hatten ihr nicht geglaubt. Niemand glaubte ihr, sobald Daniel in Sicht kam: Die Menschen hatten Schönheit mit Unschuld und Arglosigkeit verwechselt. Als Daniel ihr in der neunten Klasse den Arm brach, war Maia von zu Hause fortgelaufen, aber ihre Eltern hatten sie wieder zurückgeholt. In der zehnten Klasse war Daniel von einem unfallflüchtigen Fahrer auf der Straße überfahren worden und noch am Unfallort gestorben. Während Maia neben ihren Eltern am Grab stand, hatte sie sich für das überwältigende Gefühl der Erleichterung geschämt, das sie in diesem Moment verspürte. Gott würde sie bestimmt dafür bestrafen, dass sie über den Tod ihres Bruders froh war, hatte sie damals gedacht.
Und im darauffolgenden Jahr hatte er sie tatsächlich bestraft: Maia lernte Jordan kennen. Lange dunkle Haare, schmale Hüften in abgetragenen Jeans, Indieboy-Rockershirt und Wimpern wie ein Mädchen. Sie hätte nie gedacht, dass er sich für sie interessieren würde – Typen wie er bevorzugten normalerweise dürre bleiche Mädchen mit schwarzrandigen, eckigen Brillen –, aber ihm schienen ihre runden Formen zu gefallen. Zwischen seinen Küssen sagte er ihr immer wieder, wie schön sie sei. Die ersten Monate waren wie ein Traum … und die letzten wie ein Albtraum. Er wurde besitzergreifend, beherrschend. Wenn er sauer auf sie war, knurrte er und schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht, sodass ein roter Abdruck zurückblieb wie von zu viel Rouge. Als sie sich von ihm trennen wollte, versetzte er ihr einen solch heftigen Stoß, dass sie in ihrem eigenen Vorgarten zu Boden stürzte, ehe sie ins Haus flüchten und die Tür zuschlagen konnte.
Einige Zeit später sorgte sie dafür, dass er sie bei einem Kuss mit einem anderen Jungen sah – nur um ihm klarzumachen, dass es zwischen ihnen endgültig aus war. An den Namen des anderen Jungen konnte sie sich noch nicht einmal mehr erinnern. Aber woran sie sich sehr wohl erinnerte, war jener Abend, an dem sie im Nieselregen und mit schlammbespritzter Jeans eine Abkürzung durch den Park in der Nähe ihres Elternhauses genommen hatte. Und sie erinnerte sich auch an die dunkle Gestalt, die plötzlich hinter dem Kinderkarussell hervorgeschnellt war, an den riesigen, nassen Wolf, der sie in den Schlamm gestoßen hatte, an den heißen Schmerz, als seine Kiefer sich um ihre Kehle schlossen. Sie hatte geschrien und gestrampelt, ihr eigenes Blut im Mund geschmeckt, und ihr Verstand hatte protestiert: Das ist unmöglich. Vollkommen unmöglich! In New Jersey gab es keine Wölfe, nicht in ihrem ganz normalen Vorstadtviertel, nicht im 21. Jahrhundert.
Ihre Schreie hatten dafür gesorgt, dass in den benachbarten Häusern die Lampen angingen – ein Fenster nach dem anderen leuchtete hell auf, wie angezündete Streichhölzer. Daraufhin hatte der Wolf von ihr abgelassen; von seinen Zähnen triefte das Blut, und Fetzen ihrer Haut hingen ihm aus dem Maul.
Vierundzwanzig Stiche später lag sie wieder in ihrem rosa Mädchenzimmer, ihre Mutter wachte ängstlich über sie. Der Arzt auf der Unfallstation hatte gesagt, der Biss sähe aus wie der eines großen Hundes, doch Maia wusste es besser. Denn bevor der Wolf davongestürzt war, hatte sie eine heiße, vertraute Stimme an ihrem Ohr gehört, die flüsterte: »Jetzt gehörst du nur noch mir. Und so wird es immer sein.«
Jordan bekam sie nicht mehr zu Gesicht: Er und seine Familie packten die Koffer und zogen fort. Und keiner seiner Freunde wusste – oder wollte ihr sagen –, wohin sie gegangen waren. Maia war nicht sonderlich überrascht, als beim nächsten Vollmond die Schmerzen einsetzten: reißende Schmerzen, die ihre Beine hinaufrasten, sie zu Boden zwangen und ihr Rückgrat auf eine Weise krümmten, wie ein Zauberer einen Löffel verbiegt. Als ihre Zähne durch das Zahnfleisch brachen und wie Kaugummidragees auf den Boden prasselten, fiel sie in Ohnmacht. Das dachte sie zumindest. Denn Stunden später erwachte sie meilenweit entfernt von ihrem Elternhaus, vollkommen nackt und blutbespritzt, und eine Narbe an ihrem Arm pulsierte wie ein Herzschlag. In jener Nacht hatte sie den Zug nach Manhattan genommen. Die Entscheidung war ihr nicht schwergefallen. In ihrer konservativen Nachbarschaft war es schon schlimm genug gewesen, einer gemischten Ehe zu entstammen. Gott allein wusste, was diese Leute mit einem Werwolf anstellen würden.
Es hatte ihr keine großen Schwierigkeiten bereitet, ein Rudel zu finden, dem sie sich anschließen konnte. Allein in Manhattan gab es bereits mehrere. Schließlich war sie bei dem Innenstadtrudel gelandet, das in der alten Polizeiwache in Chinatown hauste.
Die Anführer des Rudels kamen und gingen. Zuerst war Kito der Leitwolf gewesen, dann Véronique, danach Gabriel und nun Luke. Maia hatte Gabriel zwar gemocht, aber Luke war noch besser. Er wirkte vertrauenswürdig, hatte freundliche blaue Augen und sah nicht allzu attraktiv aus, sodass er ihr nicht schon vom ersten Moment an zuwider war. Eigentlich fühlte sie sich ganz wohl hier bei diesem Rudel. Es gefiel ihr, in der alten Polizeiwache zu schlafen, Karten zu spielen und chinesisches Essen zu vertilgen – in den Nächten, wenn der Mond der Sonne nicht genau gegenüberstand. Und bei Vollmond genoss sie es, im Park zu jagen und am nächsten Tag den Kater, den die Verwandlung mit sich brachte, im Blutmond auszukurieren, einer der besseren Werwolfbars in der Stadt. Dort floss das Bier in Strömen, und niemand kontrollierte, ob man schon volljährig war oder nicht. Das Dasein als Lykanthrop sorgte dafür, dass man schnell erwachsen wurde – und solange man einmal im Monat Fell und Fangzähne entwickelte, war man im Blutmond immer willkommen, ganz gleich welchen Alters.
Inzwischen dachte Maia nur noch selten an ihre Familie, doch als der blonde Junge mit dem langen schwarzen Mantel in die Bar stolziert kam, erstarrte sie fast zur Salzsäule. Er sah zwar nicht aus wie Daniel – ihr Bruder hatte dunkle, lockige Haare und eine honigfarbene Haut gehabt, und dieser Typ hier strahlte vor Weiß und Gold. Aber sie besaßen den gleichen schlanken Körperbau, den gleichen Gang – wie ein Panther auf der Jagd – und das gleiche absolute Vertrauen in ihre eigene Attraktivität. Maias Hand schloss sich krampfartig um den Stiel ihres Glases, und sie musste sich selbst ermahnen: Er ist tot. Daniel ist tot.
Als der Junge sich auf die Theke zubewegte, ging ein Raunen durch die Bar und folgte ihm wie die Schaumkrone einer Woge im Kielsog eines Schiffs. Der Junge tat so, als würde er nichts bemerken, zog mit dem Stiefel einen Barhocker zu sich heran, setzte sich und stützte die Ellbogen auf die Theke. Maia hörte, wie er in der Stille, die nach dem Murmeln ausgebrochen war, einen Single Malt bestellte. Mit einer raschen Handbewegung kippte er den Whisky, der die gleiche goldene Farbe besaß wie seine Haare, zur Hälfte hinunter. Als er das Glas wieder auf der Theke abstellte, entdeckte Maia die dicken schwarzen und geschwungenen Linien auf seinen Handgelenken und Händen.
Bat, der Typ, der neben ihr saß und mit dem sie früher mal zusammen gewesen, jetzt aber nur noch gut befreundet war, murmelte irgendetwas, das wie »Nephilim« klang.
Ach, das war es also. Der Junge war überhaupt kein Werwolf. Er war ein Schattenjäger, ein Mitglied der Geheimpolizei der Verborgenen Welt. Sie traten als Hüter des Gesetzes auf, im Auftrag des Abkommens, und man konnte nicht einfach einer von ihnen werden: Man musste als Schattenjäger geboren werden – ihr Blut machte sie zu dem, was sie waren. Es kursierten ziemlich viele Gerüchte über sie, und die meisten waren nicht sehr schmeichelhaft: Sie galten als hochmütig, stolz, grausam, und es hieß, dass sie auf alle Schattenwesen hinabschauten oder sie sogar verachteten. Es gab kaum etwas, das ein Lykanthrop noch weniger mochte als Schattenjäger – von Vampiren vielleicht mal abgesehen, dachte Maia.
Die Leute erzählten sich außerdem, dass Schattenjäger Dämonen töteten. Maia erinnerte sich an den Moment, als sie zum ersten Mal von der Existenz der Dämonen hörte und erfuhr, was sie anrichteten. Das hatte ihr ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Vampire und Werwölfe waren einfach nur Menschen mit einer Erkrankung – so viel hatte sie inzwischen verstanden. Aber erwartete man wirklich von ihr, dass sie an diesen ganzen Schwachsinn von Himmel und Hölle glaubte, an Dämonen und Engel, obwohl niemand ihr mit Sicherheit sagen konnte, ob es überhaupt einen Gott gab oder was nach dem eigenen Tod passierte? Das war nicht fair. Allerdings glaubte sie inzwischen durchaus an Dämonen – sie hatte so oft gesehen, wozu sie fähig waren, dass sie ihre Existenz nicht länger leugnen konnte. Aber sie wünschte, sie müsste sich nicht mit ihnen befassen.
»Ich nehme mal an«, sagte der Junge und lehnte das Kinn auf die Hände, »dass ihr hier kein Wolfsbräu serviert. Zu viele unangenehme Assoziationen?« Seine Augen funkelten, schmal und schimmernd wie eine Mondsichel.
Der Barkeeper, Freaky Pete, warf dem Jungen nur einen Blick zu und schüttelte angewidert den Kopf. Wenn es sich nicht um einen Schattenjäger gehandelt hätte, hätte Pete ihn wahrscheinlich aus dem Blutmond geworfen, dachte Maia. Stattdessen ging er zum anderen Ende der Theke und beschäftigte sich nachdrücklich damit, Gläser zu polieren.
»Genau genommen«, setzte Bat an, der sich einfach aus nichts heraushalten konnte, »genau genommen servieren wir es deshalb nicht, weil es eine ziemliche Pissbrühe ist.«
Der Junge heftete seine schmalen, schimmernden Augen auf Bat und lächelte erfreut. Die meisten Menschen lächelten nicht erfreut, wenn Bat ihnen einen schrägen Blick zuwarf: Bat war fast zwei Meter groß, und eine dicke Narbe verlief quer über sein Gesicht – Silberpulver hatte ihm die Haut verätzt. Bat gehörte nicht zum engeren Kreis des Rudels, das in der Polizeiwache hauste und in den alten Zellen schlief. Er hatte seine eigene Wohnung und sogar eine feste Arbeitsstelle. Er war gar kein übler Freund gewesen, dachte Maia – zumindest bis zu dem Moment, als er sie für eine rothaarige Hexe namens Eve hatte sitzen lassen, die in Yonkers wohnte und in ihrer Garage eine Chiromantie-Praxis betrieb.
»Und was trinkst du da?«, fragte der Junge nun und beugte sich so weit zu Bat vor, dass es einer Beleidigung gleichkam. »Einen Schluck gegen den Kater, der euch bei Vollmond zum Heulen bringt?«
»Du hältst dich wohl für besonders witzig.« Inzwischen hatten die anderen Mitglieder des Rudels die Ohren gespitzt; sie standen bereit, falls Bat beschließen sollte, sich den anmaßenden Teenager so gehörig vorzuknöpfen, dass dieser erst in der Mitte der nächsten Woche wieder aufwachen würde. »Hab ich recht?«
»Bat«, sagte Maia warnend. Sie fragte sich, ob sie wohl die Einzige in der Bar war, die Bedenken bezüglich Bats Fähigkeit hatte, sich den Jungen vorzuknöpfen. Dabei zweifelte sie gar nicht so sehr an Bat … es lag vielmehr an den Augen des Jungen, die gefährlich funkelten. »Lass ihn.«
Bat ignorierte sie. »Hab ich recht?«
»Warum sollte ich eine offenkundige Tatsache leugnen?« Der Blick des Jungen wanderte über Maia, als wäre sie unsichtbar, und kehrte dann wieder zu Bat zurück. »Ich nehme nicht an, dass du mir verraten willst, was mit deinem Gesicht passiert ist? Es sieht aus wie ….« Erneut beugte er sich vor und raunte Bat so leise etwas zu, dass Maia es nicht verstehen konnte. Doch im nächsten Moment sprang Bat auf und holte zu einem Schlag aus, der dem Jungen den Kiefer zertrümmert hätte – wenn er noch am selben Fleck gesessen hätte. Doch er stand gut eineinhalb Meter entfernt und lachte, als Bats Faust das Whiskyglas traf, das daraufhin quer durch die Bar flog und an der gegenüberliegenden Wand krachend zersplitterte.
Ehe Maia auch nur mit der Wimper zucken konnte, war Freaky Pete schon auf die andere Seite der Theke gehechtet und packte Bat am Kragen. »Das reicht«, sagte er. »Bat, warum gehst du nicht ein paar Minuten vor die Tür und kühlst dich ein wenig ab?«
Bat versuchte, sich aus Petes riesigen Händen zu befreien. »Vor die Tür gehen? Hast du nicht gehört, was …«
»Doch, das hab ich.« Petes Stimme klang tief und dunkel. »Er ist ein Schattenjäger. Reg dich draußen wieder ab, Junge.«
Bat fluchte und riss sich von dem Barkeeper los. Langsam schritt er zum Ausgang, die Schultern vor Wut angespannt. Krachend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.
Das Lächeln des Schattenjägerjungen war verschwunden; er musterte Freaky Pete mit einem düsteren, vorwurfsvollen Blick, als hätte der Barkeeper ihm ein Spielzeug weggenommen. »Das wäre nicht nötig gewesen«, sagte er. »Ich kann gut auf mich selbst aufpassen.«
Pete betrachtete den Schattenjäger. »Ich mach mir Sorgen um meine Bar, nicht um dich«, sagte er schließlich. »Vielleicht solltest du dir einen anderen Laden suchen, wenn du keinen Ärger willst, Schattenjäger.«
»Ich hab nicht gesagt, dass ich keinen Ärger will.« Der Junge setzte sich wieder auf seinen Hocker. »Außerdem bin ich noch nicht dazugekommen, mein Glas Whisky zu leeren.«
Maia warf einen Blick über die Schulter, dorthin, wo der Alkohol von der Wand triefte. »Für mich sieht das ziemlich leer aus.«
Einen Moment lang musterte der Junge sie mit ausdruckslosem Gesicht, doch dann schlich sich ein amüsiertes Funkeln in seine goldenen Augen. In dieser Sekunde sah er Daniel so ähnlich, dass Maia am liebsten zurückgewichen wäre.
Pete schob ein weiteres Glas mit bernsteinfarbener Flüssigkeit über die Theke, ehe der Junge antworten konnte. »Hier ist dein Drink«, sagte er und sah dann zu Maia, die glaubte, so etwas wie eine Ermahnung in seinem Blick zu erkennen.
»Pete …«, setzte sie an, konnte ihren Satz aber nicht beenden. Denn im selben Moment flog die Tür der Bar auf, und Bat erschien im Türrahmen. Maia brauchte einen Augenblick, bis sie erkannte, dass seine Hemdbrust und seine Ärmel mit Blut getränkt waren.
Rasch rutschte sie von ihrem Hocker und lief auf ihn zu. »Bat! Bist du verletzt?«
Sein Gesicht war aschgrau, und die silberne Narbe ragte wie ein Stück Stacheldraht aus seiner Wange heraus. »Ein Überfall«, stieß er hervor. »In der Gasse ist ein Leichnam. Ein totes Kind. Blut … alles ist voll Blut.« Er schüttelte den Kopf und sah an sich hinab. »Nicht mein Blut. Mir geht’s gut.«
»Ein Leichnam? Aber wer …«
Bats Antwort ging in der ausbrechenden Aufregung unter. Hocker und Stühle fielen um, als das Rudel zur Tür stürzte. Pete kam hinter seiner Theke hervor und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Nur der Schattenjäger blieb reglos sitzen, den Kopf über sein Glas gebeugt.
Durch mehrere Lücken in der Menge, die sich um die Tür versammelt hatte, konnte Maia einen kurzen Blick auf die grauen Pflastersteine in der Gasse werfen, die mit Blut bespritzt waren. Das Blut war noch feucht und verteilte sich in den Spalten zwischen den Steinplatten wie die Ranken einer roten Pflanze.
»Ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt?«, wandte Pete sich an Bat, dessen Gesicht wieder etwas Farbe angenommen hatte. »Wie …«
»Da war jemand in der Gasse. Jemand, der sich über ihn gebeugt hat«, sagte Bat. Seine Stimme klang angespannt. »Keine menschliche Gestalt – eher ein Schatten. Als er mich gesehen hat, ist er abgehauen. Der Junge war noch am Leben. So gerade eben. Ich hab mich über ihn gebeugt, aber ….« Bat zuckte scheinbar beiläufig die Achseln, aber die Stränge seiner Halsmuskulatur ragten deutlich hervor wie dicke Wurzeln, die sich um einen Baumstamm winden. »Er starb ohne ein weiteres Wort.«
»Vampire«, sagte eine dralle Lykanthrope namens Amabel, die an der Tür stand. »Die Kinder der Nacht. Es kann niemand anderes gewesen sein.«
Bat warf ihr einen Blick zu, drehte sich dann um und marschierte zur Theke. Er streckte die Hand aus, um den Schattenjäger am Rücken seines Mantels zu packen, griff aber ins Leere, da der Junge längst zur Seite gesprungen war und sich ihm mit einer geschmeidigen Bewegung zugewandt hatte. »Was hast du für ein Problem, Werwolf?«
Bats Hand schwebte noch immer in der Luft. »Bist du taub, Nephilim?«, fauchte er. »Da draußen liegt ein toter Junge. Einer von uns.«
»Meinst du ein Lykanthrop oder irgendeine andere Art von Schattenwesen?« Der Junge zog spöttisch eine Augenbraue hoch. »Für mich seht ihr nämlich alle gleich aus.«