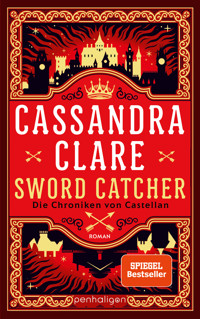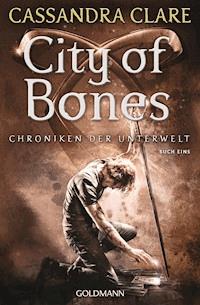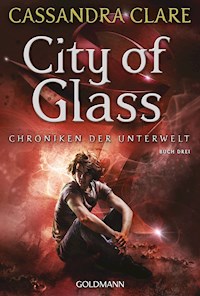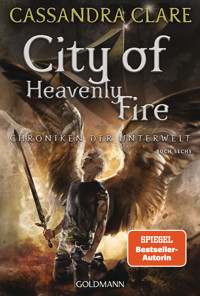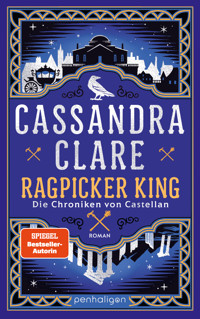
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die "Sword Catcher"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wem kannst du vertrauen, wenn jede Fehlentscheidung den Tod bedeutet? Der brandneue Bestseller von Cassandra Clare!
Ein Massaker hat den Palast von Castellan in Blut getränkt. Schwertfänger Kel muss die Schuldigen finden. Doch die einzigen Hinweise auf das Verbrechen hütet der Lumpensammlerkönig. Dieser Verbrecher hält aber nicht nur Kels Schicksal in der Hand: Auch die Heilerin Lin ist durch ein unheilvolles Bündnis dem Lumpensammlerkönig ausgeliefert. Dann entdeckt sie, dass der Wahnsinn, der vom König Besitz ergriffen hat, magischen Ursprungs ist – und diese uralte Kraft übt auf Lin eine ebensolche Anziehung aus wie Kronprinz Conor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 937
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Ein Massaker hat den Palast von Castellan in Blut getränkt. Schwertfänger Kel muss die Schuldigen finden. Doch die einzigen Hinweise auf das Verbrechen hütet der Lumpensammlerkönig. Dieser Verbrecher hält aber nicht nur Kels Schicksal in der Hand: Auch die Heilerin Lin ist durch ein unheilvolles Bündnis dem Lumpensammlerkönig ausgeliefert. Dann entdeckt sie, dass der Wahnsinn, der vom König Besitz ergriffen hat, magischen Ursprungs ist – und diese uralte Kraft übt auf Lin eine ebensolche Anziehung aus wie Kronprinz Conor …
Autorin
Cassandra Clare wurde als Tochter amerikanischer Eltern in Teheran geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit damit, mit ihrer Familie die Welt zu bereisen. Sie lebte in Frankreich, England und der Schweiz, bevor sie zehn Jahre alt war. Ihre Highschool-Jahre verbrachte sie in Los Angeles, wo sie Geschichten schrieb, um ihre Klassenkameraden zu amüsieren. 2004 begann sie mit der Arbeit an ihrem Roman City of Bones, inspiriert von der urbanen Landschaft von Manhattan, ihrer Lieblingsstadt. Seitdem ist Clare zu einer Weltbestsellerautorin mit fünfzig Millionen verkauften Büchern geworden. Die Romane Sword Catcher und Ragpicker King sind ihr Vorstoß in die High Fantasy.
Cassandra Clare
Ragpicker King
Die Chroniken von Castellan
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »The Ragpicker King« bei Del Rey, New York.
Das Zitat auf dieser Seite stammt aus: Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie. Siebzehnter Gesang. Berlin: Askanischer Verlag, 1916.
Nach der Übersetzung von Karl Witte.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2025 by Cassandra Clare, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Penhaligon
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Covergestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
nach einer Originalvorlage von Penguin US
Coverdesign und -illustration: Jim Tierney
BL · Herstellung: fe
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30434-8V001
www.penhaligon.de
Für meine Großmutter Isabel
Was dir am liebsten ist, das wirst du alles Verlassen, und das ist der erste Pfeil,Den der Verbannung Bogen auf dich schleudert.Dann wirst du fühlen, wie das fremde BrotSo salzig schmeckt, und welch ein harter Pfad istDie fremden Treppen auf- und abzusteigen.Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie
Prolog
Artal Gremont, Erbe der Tee- und Kaffee-Charta von Castellan, hatte das Meer nie besonders gemocht. Dabei war es die Quelle seines Reichtums: Tee und Kaffee im Wert von Millionen von Goldkronen, die in schnittigen Schiffen über die Ozeane zum Hafen von Castellan transportiert wurden, hatten seine Familie reicher gemacht als die Götter. Theoretisch schätzte er die Vorteile des Seewegs, aber in Wirklichkeit fand er das Meer flach, uninteressant und langweilig.
Andererseits fand Gremont die meisten Dinge langweilig. Der Großteil der Menschen neigte dazu, langweilig zu sein und generell kleingeistig. Die meisten Partys waren langweilig. Sein Dasein als Sohn eines Charta-Inhabers in Castellan, der zwar viel Geld, aber keine wirkliche Macht besaß, war ebenso langweilig gewesen. Und als er versucht hatte, sein Leben interessanter zu gestalten, hatten seine Eltern ihn ins Exil geschickt, um in fremden Gefilden ihre Geschäfte zu leiten – was äußerst langweilig gewesen war.
Doch jetzt begann die Situation, interessanter zu werden. Nach dem Tod seines Vaters hatte er die Tee- und Kaffee-Charta geerbt und war nach Castellan zurückgerufen worden, womit sein Exil beendet war. Daraufhin hatte er eine Passage auf dem nächsten Schiff gebucht, das den Hafen von Taprobana verließ: eine von Laurent Adens Galeonen, die gerade eine Ladung Teakholz nach Castellan transportierte. Das Schiff verfügte über sechs winzige Passagierkajüten in der Nähe des Hecks, während die riesige Kapitänskajüte sämtliche Fenster in Beschlag nahm. Gremonts Kajüte war kaum mehr als eine Abstellkammer mit einer in die Wand eingelassenen Koje und einem am Boden festgeschraubten Tisch, damit er bei den Bewegungen des Schiffs nicht hin und her rutschte.
Langweilig, langweilig, langweilig. Gremont lief in seiner Kajüte unruhig auf und ab. Auf diesem verdammten Schiff gab es keinerlei Abwechslung, und seine Unruhe wuchs von Tag zu Tag. Jedes Mal, wenn er sich in diesem Zustand befand, musste er einfach etwas tun, damit sich seine Laune hob. Es war ihm ein regelrechtes Bedürfnis, so wie andere Männer Nahrung oder Wasser brauchten.
Leider führte Laurent Aden als Kapitän ein strenges Regime auf seinem Schiff und hatte wenig Verständnis für Artals Vorlieben. In der Woche nach Verlassen des Hafens von Favár war eine blinde Passagierin an Bord entdeckt worden, und Artal hatte sich wenigstens etwas mit ihr vergnügen können, bevor Laurent davon erfuhr und das junge Mädchen in aller Eile aus Artals Kajüte holen ließ. Ein paar nicht besonders höfliche Worte waren gewechselt worden, und der Kapitän hatte Artal zu verstehen gegeben, sollte er sich auf der Black Rose noch einmal auf derartige Vergnügungen einlassen, würde er ihn im nächsten Hafen kurzerhand an Land setzen, Charta hin oder her.
Gremont hatte keine Ahnung, was mit dem Mädchen passiert war, und es war ihm auch egal. Sie hatte Blut auf seine Lieblingsjacke getropft, was ihn geärgert hatte – allerdings weniger als die Tatsache, dass er jetzt in dieser Kajüte festsaß.
Laurent hatte ihm gesagt, er solle nicht auf dem Schiff herumlaufen. Aber der konnte ihn mal am Arsch lecken.
Gremont riss die Tür seiner Kajüte auf, trat hinaus auf den schmalen Gang, der sich über die gesamte Länge des Schiffs erstreckte, und nahm eine Sturmlaterne von einem Nagel an der Wand. Am besten ging er zielstrebig durch den Flur, dachte er, und marschierte durch das Schiff auf die Treppe zu, die zum Sturmdeck hinaufführte. Ein zielstrebiger Gang gaukelte den Leuten vor, man sei in einer wichtigen Angelegenheit unterwegs.
Sein Weg führte ihn an der Kombüse vorbei, wo der Smutje auf einem Stuhl schlief, zu seinen Füßen einen Holzeimer mit halb geschälten Kartoffeln. Den Göttern sei Dank würden sie nur noch ein paar Tage auf See verbringen: Gremont hatte die Nase voll von Pökelfleisch, Salzkartoffeln und Rindertalg.
Weiter oben auf dem Sturmdeck war die Luft rein. Der Mond schwebte nahe über dem Horizont und zeichnete einen weißen Pfad auf das Wasser. Mehrere Taue für die Segel lagen in ordentlichen Windungen zusammengerollt, wie schlafende Schlangen.
Manch einer hätte die Aussicht bewundert – die Sterne am Himmel so schimmernd wie Nagelköpfe, das Wasser unruhig wie Riffelglas. Doch Gremont hatte für all das nur einen missmutigen Blick übrig. Das Meer war eine Barriere zwischen ihm und Castellan, zwischen ihm und der Rückforderung all dessen, was er im Exil verloren hatte.
Das Knarren einer Planke unter seinen Füßen machte ihn darauf aufmerksam, dass er nicht allein war. Er drehte sich um und sah einen Moment lang nichts. Aber dann tauchte sie vor ihm auf – ein Schatten, der sich aus den Schatten entwickelte. (Als er sie das erste Mal dabei beobachtet hatte, war er vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen, aber inzwischen hatte er sich an ihre Art von Magie gewöhnt.) Sie trug die typische Kleidung einer Attentäterin: Jeder Teil ihres Körpers war mit glattem schwarzem Stoff bedeckt. Dadurch wirkte sie gesichtslos, was Gremont nervös machte – obwohl er genau wusste, wie sie unter der Verkleidung aussah.
»Ich bin hier, um dir zu deiner bevorstehenden Hochzeit zu gratulieren, Artal«, sagte sie. Ihre Stimme klang tief und heiser. Hätte er ihr Geschlecht nicht gekannt, hätte er es wahrscheinlich nicht erraten können.
»Es hat wohl keinen Sinn, dich zu fragen, wie du vom Kontinent hierhergekommen bist«, erwiderte er missmutig. »Auf einer Fledermaus hergeflogen, wie?«
Sie lachte leise. »Für einen Mann, der im Begriff ist, eine sehr vorteilhafte Ehe einzugehen, bist du ziemlich verbittert. Wie amüsant.«
Er schnaubte. »Du weißt, dass ich mir mehr erhofft hatte als Antonetta Alleyne.«
»Ich weiß, dass du Anjelica von Kutani ins Auge gefasst hattest. Aber ihre Familie hätte dich niemals akzeptiert. Sie ist eine Prinzessin, und königliches Blut verlangt für eine Eheschließung nach königlichem Blut.«
»Du musst es ja wissen.«
Jetzt schnaubte sie, sprang dann leichtfüßig auf die Reling des Schiffs und balancierte mühelos darauf – während Gremont bei dem Gedanken an den tiefen Sturz ins Wasser mulmig wurde. »Sei nicht sauer, Gremont. Ich hoffe, du wirst dir das mit unserer Abmachung nicht noch einmal überlegen.«
Gremont spürte, wie ihm ein leichter Schauer über den Rücken lief. Er wusste, dass sie über Magie verfügte, obwohl er in dem Glauben aufgewachsen war, dass sämtliche Magie außer der Niederen Magie mit der Sonderung verschwunden war. Als sie ihm zum ersten Mal das Gegenteil bewiesen hatte, war er zutiefst schockiert gewesen. Und er trug noch immer die Narbe auf seinem Handrücken: ein glänzender Fleck verbrannter Haut, der einem Seestern ähnelte.
Selbst jetzt fürchtete er sie – obwohl ihn die Tatsache, dass sie es wusste, maßlos ärgerte. »Unsere Abmachung steht«, erwiderte er.
»Gut.« Sie blickte auf ihn herab, augen- und gesichtslos, ein dunkler Schatten vor dem weitläufigen Blau des Nachthimmels und des Ozeans. »Ich hoffe, du bist aus härterem Holz geschnitzt als dein Vater. Auch er hat uns seine Loyalität zugesichert, aber letztendlich wollte er uns verraten.«
»Er war immer schwach«, murmelte Gremont. Sein Vater hatte keinen Finger gerührt, um ihn vor dem Exil zu bewahren, und Gremont hatte das weder vergessen noch verziehen. Seine Mutter war genauso schwach, aber von einer Frau erwartete man weniger, und zumindest war sie ihm blindlings ergeben. »Du musst mich nicht daran erinnern, dass ich nicht so schnell aus dem Exil hätte zurückkehren können, wenn nicht gewisse Fäden gezogen worden wären. Ich weiß sehr wohl, wem meine Loyalität gilt.«
»Das freut mich«, sagte sie, »denn es hat sich eine neue Gelegenheit ergeben. Eine Chance für dich, deine Schlauheit unter Beweis zu stellen. Deine zukünftige Frau Antonetta, Erbin der Seiden-Charta, verfügt anscheinend über gewisse Informationen. Es gibt noch jemanden, den wir auf unsere Seite ziehen müssen, und sie weiß, wie wir ihn finden können.«
»Antonetta? Tatsächlich? Ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwelche Informationen in ihrem leeren Kopf hat.«
»Selbst eine Maus kann auf einen kostbaren Krümel stoßen. Wie dem auch sei, sobald ihr verheiratet seid, gebe ich dir die Erlaubnis, die Wahrheit aus ihr herauszupressen. Mit allen von dir bevorzugten Mitteln.«
»Wirklich? Mit allen Mitteln?« Gremont grinste. »Ich werde dich nicht enttäuschen.«
»Versuch bitte, dich dabei nicht allzu sehr gehen zu lassen, Artal. Im Moment hat Liorada Alleyne mehr Angst vor uns als vor dem Haus Aurelian, aber wenn sich dies ändert, könnte das all unsere Pläne durchkreuzen. Deine Heirat mit Antonetta ist ein weiteres Druckmittel, mit dem wir die liebe Liorada in Schach halten können. Also lass das Mädchen am Leben, in Ordnung? Mir zuliebe.«
»Selbstverständlich«, versicherte Gremont. »Es macht sowieso viel mehr Spaß, sie am Leben zu erhalten. Mein ganz persönliches Spielzeug. Wir werden sehen, wie sie reagiert, wenn ihre Seide zerrissen wird.«
Die dunkle Gestalt lachte leise. »Es freut mich, dass dich der Gedanke glücklich macht, Artal. Aber vergiss nicht: Auf dem Hügel gibt es viele, die uns gern scheitern sehen würden. Viele, die dem Haus Aurelian noch immer treu ergeben sind. Und trag dein Amulett! Es ist mächtiger, als du denkst.«
»In der Tat.« Artal hob die Hand, um den Anhänger zu berühren, den sie ihm in Taprobana geschenkt hatte, bevor er überhaupt einen Fuß auf dieses Schiff gesetzt hatte. »Ich wäre ein Narr, wenn ich seinen Schutz verschmähen würde. Und du hättest mich nicht angesprochen, wenn ich ein Narr wäre.«
Sie schwieg.
Leicht beleidigt schaute Artal auf, verwundert über ihr Schweigen, und musste dann feststellen, dass sie verschwunden war. Er stürzte zur Reling und beugte sich darüber, doch er sah nur Dunkelheit und Wasser in der Tiefe und den weißen Pfad des Monds, der den Weg nach Castellan wies.
1
Kel und Conor trainierten auf dem Heuboden.
Sie hatten schon eine ganze Weile nicht mehr miteinander trainiert, und beide waren etwas eingerostet. Dennoch kehrte die Routine wie üblich zurück. Muskeln haben ihr eigenes Gedächtnis, wie Jolivet zu sagen pflegte. Kel hatte den Morgen mit steifen Gliedern begonnen; sein Körper hatte sich noch im Halbschlaf befunden, und seine Gelenke hatten gegen jedes Dehnen und Strecken protestiert. Doch jetzt, nach etwa einer Stunde in dem Raum, in dem sie schon seit ihrer Kindheit trainierten, fühlte er sich geschmeidig, und seine Muskeln arbeiteten schnell und flüssig.
Die flache Seite seines mit einer Schutzkappe versehenen Schwerts schlug metallisch klirrend gegen Conors Klinge. Kel wollte seinen Vorteil ausnutzen. Aber dieses Mal wich Conor aus, sprang auf einen der Heuballen, die für ein abwechslungsreicheres Training überall im Raum verteilt lagen, und hob die linke Hand, um eine Auszeit zu signalisieren.
Kel ließ seinen Schwertarm sinken und rollte die Schultern.
Conor fuhr sich mit der Hand durch sein verschwitztes dunkles Haar und runzelte die Stirn. »Wir sollten öfter trainieren«, verkündete er. »Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was ich mit meiner Klinge anstellen soll. Zu viele lange Nächte am Schreibtisch, in denen ich nur meine Schreibhand trainiert habe. Vor lauter Untätigkeit hab ich mich in den letzten Monaten in einen regelrechten Pudding verwandelt, Kellian.«
»Pudding würde ich nicht unbedingt sagen«, widersprach Kel. Conor war schlank und fit wie immer. Trotz seiner vielen Aufgaben schwamm er noch immer und ritt fast jeden Tag auf seinem Pferd Asti. Außerdem: Hatte sich die Königin nicht erst neulich darüber aufgeregt, dass er zu dünn sei? Wenn Conor Probleme hatte, dann lag das wohl eher an den nächtlichen Arbeitsstunden und dem Schlafmangel.
Nicht dass Kel ihm das jemals sagen würde. Conor war bereit, sich von Kel Dinge anzuhören, die er von niemand anderem duldete. Aber die große Veränderung, die bei Conor vor etwa drei Monaten eingesetzt hatte – seine seltsame neue Leidenschaft für seine Rolle in der Regierung des Landes –, war selbst für seinen Schwertfänger tabu. Kel hatte den Verdacht, es lag daran, dass die ganze Sache eine Art Buße für Conor darstellte, aber das war nur eine Vermutung. Es musste einfach so sein. Conor wollte sich zu diesem Thema nicht äußern, und Kel drängte ihn nicht weiter.
»Wir können sicher öfter trainieren, wenn du willst«, sagte er jetzt. »Du kannst dich meinen Trainingseinheiten mit Jolivet anschließen. Ich bin bereit, dich bei allen puddingverringernden Aktivitäten zu unterstützen«, fügte er hinzu. Dann hob er sein Schwert und zeigte damit an, dass die Auszeit vorbei war.
Conor lachte, wirbelte vom Heuballen herunter und holte mit seiner Klinge zu einem seitlichen Schlag aus. Kel reagierte mit einem Oberhieb, und die Schwerter prallten mit dem befriedigenden Klirren von Stahl auf Stahl aufeinander. Als Conor ihn daraufhin bedrängte, tänzelte Kel rückwärts, außer Reichweite.
Sie trainierten schon so lange gemeinsam mit dem Schwert, dass sie die Bewegungen des jeweils anderen in- und auswendig kannten: Conor neigte dazu, zu rücksichtslos vorzugehen, während Kel zu vorsichtig war. Dabei trainierten sie entspannt genug, um sich während ihrer Paraden, Redoublements, Ausfälle und Finten zu unterhalten.
»Fühlst du dich bereit für das Treffen?«, fragte Kel. »Schließlich ist es die erste Sitzung der Uhrkammer seit … knapp vier Monaten.«
Fast hätte er seit dem Blutbad in der Glänzenden Galerie gesagt. Obwohl Conor bereit war, über den Angriff auf den Palast und die Ermordung der kleinen Prinzessin von Sarthe zu sprechen, wollte er ungern daran erinnert werden. Er hatte noch immer Albträume und wachte oft schreiend auf. Kel, der mit dem Prinzen im selben Zimmer schlief, blieb dann wach, angespannt und in der Hoffnung, dass sich Conors Atem wieder beruhigte. Dass er weiterschlafen würde.
Parade, Riposte. Conor wich geschickt aus, mit ausdrucksloser Miene. »Ein Haufen Feiglinge«, schnaubte er, womit er sich auf die Charta-Inhaber bezog – die elf mächtigsten Familien in Castellan. »Die Hälfte scheint davon überzeugt zu sein, dass sie ermordet werden, sobald sie auch nur einen Fuß in den Palast setzen.«
Fairerweise musste man einräumen, dass die Charta-Inhaber bei ihrem letzten Besuch, einem Bankett im Marivent, tatsächlich fast ermordet worden wären, dachte Kel.
»Natürlich würden sie nie zugeben, dass das das Problem ist«, fuhr Connor fort. »Stattdessen behaupten sie, dass sie zu beschäftigt sind oder unter seltsamen Erkrankungen leiden. Aber Mayesh hat Gerüchte in Umlauf gebracht, dass ich eine wichtige Ankündigung plane, also wird sie dieses Mal die Neugier hertreiben.«
Trotz der Befürchtungen des Adels war Conor fest entschlossen, die monatlichen Sitzungen der Uhrkammer so schnell wie möglich wieder einzuführen. Er hatte jeden der Verweigerer persönlich aufgesucht, um darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht wie Ratten verstecken konnten, sondern eine einheitliche, unerschütterliche Front bilden mussten. Spione würde es immer geben – vor allem jetzt, da Castellan durch die Forderungen der Sarther wie eine Traube in der Kelter ausgepresst wurde. Falls die Spione in ihre Heimatländer zurückkehrten mit der Information, dass Castellans herrschende Klasse zu Tode verängstigt war, würde das ihre Situation letztendlich nur noch verschlimmern.
»Und was für eine Ankündigung!«, bemerkte Kel.
Nun versuchte es Conor mit einem Senkrechthieb, den Kel allerdings mit einem Quart parierte.
Conor warf ihm einen scharfen Blick zu. »Du bist besorgt«, sagte er. »Glaubst du, dass ich das Falsche tue?«
»Nein«, antwortete Kel. »Aber die Adligen sind vermutlich anderer Meinung. Bei deiner letzten Ankündigung, du würdest heiraten, um die Probleme des Landes zu lösen, hat das Ganze ein schlechtes Ende genommen.«
Schlecht war eine Untertreibung. Schlecht meinte das Blutbad in der Glänzenden Galerie, das die Ursache für Conors Albträume war. Und der Grund dafür, dass Kel nicht nur keine Fragen stellte, sondern auch Geheimnisse hütete. Weit mehr Geheimnisse, als er jemals hatte hüten wollen.
»Na ja, diese Entscheidung hab ich nicht allein getroffen. Jolivet und Mayesh waren auch daran beteiligt. Genau wie meine Mutter. Und was meinen Vater betrifft … Tja, von dem werden sie keine Antwort bekommen.«
Das stimmte. Am Tag nach dem Blutbad war der König in den Nordturm gegangen und hatte ihn seitdem nicht mehr verlassen. Sämtliche Speisen wurden dorthin gebracht, er verließ sein Zimmer nicht, redete nicht und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Mayesh hatte den Zustand als eine Art Schock bezeichnet – Katatonie, nannte er es – und erklärt, dass diese Starre wie eine Krankheit mit der Zeit heilen würde.
Das ganze Ausmaß dieses Rückzugs war jedoch geheim gehalten worden. Außer Kel wussten nur Conor, Mayesh, Jolivet und die Königin, dass der König mit niemandem redete und dass es sich bei den »Befehlen des Königs«, die aus dem Nordturm kamen, in Wahrheit um Conors Befehle handelte, ausgearbeitet mithilfe von Mayeshs und Jolivets Ratschlägen.
»Ja«, sagte Kel. »Was irgendwie schade ist. Du hast den Krieg mit Sarthe die ganze Zeit über mit außerordentlicher Diplomatie abgewendet.« Nächtelange Arbeit, sorgfältig verfasste Briefe, Entschuldigungen, die keine Schuld eingestanden, Entgegenkommen ohne Kapitulation. »Aber du wirst dafür keine Lorbeeren ernten. Nicht von den Charta-Familien.«
»Mag sein«, räumte Conor ein. »Aber ich bin derjenige, der Erfahrung mit Erpressung hat.« Sein Lächeln war scharf wie eine Klinge. »Die Sarther interessiert der Tod der Prinzessin nicht. Es geht ihnen um das Druckmittel, das sie brauchen, um Forderungen stellen zu können. Und wenn ein Erpresser einen erst einmal in den Fingern hat, wird das Ganze kein einfaches Ende nehmen. Erpresser kommen wieder und wieder zurück und wollen immer mehr, ganz gleich, was man ihnen gibt. Die Sarther werden nicht einfach eines Tages verschwinden, so wie Prosper Beck.«
Prosper Beck. Manchmal fiel es Kel schwer, zu glauben, dass der Verbrecher, mit dem er einst um Conors Sicherheit und geistige Gesundheit verhandelt hatte, Castellan einfach verlassen hatte. Dabei hatte Becks Existenz ihn überhaupt erst in die Schattenwelt des Lumpensammlerkönigs gezogen – Beck hatte sich selbst als Andreyens Herausforderer positioniert, und der Lumpensammlerkönig hatte Kel beauftragt, für ihn herauszufinden, wer auf dem Hügel Becks verschiedene kriminelle Unternehmungen finanzierte. Beck erschien Kel als eine grausamere, gefährlichere Version des Lumpensammlerkönigs – jemand, der sich im Gegensatz zu Andreyen nicht von seinem eigentümlichen Ehrenkodex leiten ließ. Ein unkalkulierbarer Faktor, der zu allem fähig war.
Conor sprach noch immer von Sarthe, und Kel konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart. »Es gibt nur einen Weg, die Sarther zum Schweigen zu bringen: wenn wir demonstrieren, dass wir zu mächtig sind, um uns schikanieren zu lassen. Sobald wir uns durch diese Heirat Geld und Kriegsschiffe gesichert haben, werden die Sarther erkennen, dass es zu gefährlich ist, uns ausbluten zu wollen.« Seine grauen Augen blitzten. »Das erinnert mich an etwas. Apropos Heirat: Artal Gremont sollte bald hier eintreffen. Dann müssen wir uns alle auf einen sicherlich nicht enden wollenden Triumphzug einstellen, während Lady Alleyne Vorbereitungen für die Vermählung ihrer Tochter trifft.«
Kel bewegte sich einen Moment zu spät, um Conors Hieb zu parieren, und Conor tippte ihn mit der Schutzkappe seines Schwerts an, als wollte er sagen: Pass auf.
»In der Tat, das dürfte der Höhepunkt ihrer Pläne für Antonetta sein«, antwortete Kel steif. »Ich frage mich, womit sie sich wohl als Nächstes befassen wird, sobald die Tinte auf der Heiratsurkunde getrocknet ist.«
»Ich nehme an, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um sich in die Angelegenheiten von Gremonts Tee-Charta einzumischen«, sagte Conor. »Ich werde ein Auge auf die beiden haben müssen. So viel geballte Macht in einer Familie bedeutet wahrscheinlich Ärger. Wenigstens ist Antonetta nicht ehrgeizig«, fügte er hinzu, »obwohl ihre Mutter sie vermutlich dazu anstacheln wird, Schwierigkeiten zu machen.«
Nicht ehrgeizig. Das dachten alle von Antonetta; nur Kel wusste, dass sie damit falschlagen. Er erinnerte sich, dass sie ihm gesagt hatte, sie wolle die Kontrolle über die Seiden-Charta. Und ein anderes Mal hatte sie ihm erzählt, ihre Mutter halte es nicht für akzeptabel, dass eine unverheiratete Frau eine Charta führe. Aber wenn sie und Gremont heirateten, würde jeder von ihnen seine Charta für sich behalten, bis es an der Zeit wäre, die Chartas an eine neue Generation zu vererben. Die Tatsache, dass Antonetta bereit war, einen Wüstling wie Gremont zu heiraten, um die wertvollste Charta in Castellan unter ihre Kontrolle zu bringen, sprach Bände hinsichtlich ihres Ehrgeizes.
»Andererseits …«, setzte Conor an, und die Spitze seines Schwerts tauchte unter Kels Klinge hindurch und berührte ihn leicht an der Schulter. Kel schwieg, um den Punktgewinn zu bestätigen. »Ich denke oft daran, was der alte Gremont vor seinem Tod gesagt hat. Man kann niemandem wirklich trauen.«
Kel hätte fast die Augen geschlossen, als er sich an die Worte des alten Mannes erinnerte. Er war dabei gewesen, als Gremont starb – der Einzige an seiner Seite, als er die graue Tür passierte –, und Gremont hatte ihn nicht mal erkannt. Hatte ihn für Conor gehalten.
Vertraut niemandem, hatte er gesagt. Weder Mutter noch Berater oder Freund. Vertraut niemandem auf dem Hügel. Vertraut nur Euren eigenen Augen und Ohren, sonst wird die Graue Schlange auch Euch holen.
Die Worte waren für Conor bestimmt gewesen. Ein Ratschlag, den Kel in den schrecklichen Tagen nach dem Blutbad weitergegeben hatte – als Conor, statt zu schlafen, nachts unruhig auf und ab gelaufen war. Und als Kel ihm von Gremonts Worten erzählt hatte, war der Anflug eines Lächelns über Conors Gesicht gewandert.
»Ein guter Rat«, hatte er bestätigt, »aber diese Lektion habe ich bereits gelernt. Ich vertraue niemandem – außer dir, aber du bist ja auch meine Augen und Ohren, oder? Nicht mein Ratgeber, nicht mein Freund, nicht einmal mein Bruder. Du bist eher wie ich. Und ich werde dich jetzt noch dringender brauchen. Nicht nur, um mich zu schützen, sondern auch, um zu beobachten und zu lauschen. Um mir mitzuteilen, was du beobachtet und belauscht hast.«
Darauf hatte Kel nichts erwidert. Er konnte Conor nicht sagen, dass er ihn ebenfalls belog – selbst wenn es zu seinem Besten war. Weder damals. Noch jetzt. Er bewahrte sein Schweigen und redete sich ein, dass er damit in Conors Interesse handelte. Dass Conor eines Tages die Wahrheit erfahren und ihm den Verrat verzeihen würde.
»Oh, wie gut, dass du da bist«, sagte Antonetta Alleyne und richtete sich mühsam in dem riesigen Stapel von Kissen auf, der ihr vergoldetes Bett beherrschte. »Hat dich jemand hereinkommen sehen, jemand außer Magali?«
Lin Caster schüttelte den Kopf. An der Eingangstür hatte sie eine kurze Auseinandersetzung mit Magali gehabt. Das Hausmädchen war entschlossen gewesen, Lin den Mantel und ihre Heilkundigentasche abzunehmen, aber Lin hatte sich geweigert, ihr beides zu überlassen. Unter den wachsamen Augen von vermutlich zwei Dutzend Porträts verblichener Alleynes hatte ein stiller Kampf stattgefunden.
Lin hatte sich nie an die Einrichtung des Hauses Alleyne gewöhnt. Im Gegensatz zum Haus Roverge war das Gebäude nicht imposant und leer, sondern vollgestopft mit irgendwelchen Objekten: Landschaftsgemälde, massive, mit üppigen Seidenblumen gefüllte Silbervasen, vergoldete Uhren und Marmorbüsten von antiken Dichtern und Dramatikern. Jedes Möbelstück, das sich vergolden ließ, war auch vergoldet worden – oder mit weißer Spitze überzogen wie eine jungfräuliche Braut.
Schließlich hatte das Dienstmädchen den Kampf um Lins Habseligkeiten aufgegeben und sie eine vergoldete Treppe hinauf geführt, in einen langen, mit Seidenteppichen ausgelegten Gang. Beim Erklimmen der Stufen war Lin an einem Dutzend silbergerahmter Spiegel vorbeigekommen, in denen sie ihr Spiegelbild sah: rote, zu einem Zopfkranz geflochtene Haare, ein einfaches Kleid in Ashkar-Grau, eine abgewetzte Ledertasche in den Händen. Sie war garantiert das schlichteste und schmuckloseste Objekt im ganzen Haus.
Unwillkürlich erinnerte sie sich an das erste Mal, als Antonetta sie zu sich gebeten hatte. Angesichts des hohen Rangs der Familie Alleyne hatte sie die Bitte überrascht, aber Antonetta hatte nicht lockergelassen: Sie bestand auf einer wöchentlichen Visite von Lin – unter Einhaltung absoluter Diskretion. Und die Besuche mussten an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit erfolgen. Dafür hatte sie zwar keine Gründe angeführt, aber bei einem Gespräch mit Kel im Schwarzen Palais hatte Lin erfahren, dass zu diesem Zeitpunkt Lady Alleynes wöchentliches Kartenspiel mit den Ladys des Hügels stattfand. Was bedeutete, dass Antonettas Mutter höchstwahrscheinlich nicht zu Hause war.
Lin hatte Antonetta Alleyne schon seit ihrer ersten Begegnung gemocht – was nicht verwunderlich war, da Antonetta sie trotz der wachsamen Augen der Kastellwachen in den Palast geschleust hatte. Und im Laufe der wöchentlichen Treffen war ihre Freundschaft so gewachsen, dass sie sich gegenseitig duzten.
Antonetta war freundlich, wenn auch ein wenig zerstreut. Sie wirkte auf Lin wie ein Kaninchen unter den Schakalen des Hügels. Im Grunde bedurfte sie kaum medizinischer Versorgung, und normalerweise verbrachten sie beide ein paar Stunden mit Plaudern, während sie einen von Lins Kräutertees tranken. Nach Lins Einschätzung bezahlte Antonetta für ihre Gesellschaft, nicht für die Dienste einer Heilkundigen.
An diesem Tag fand sie Antonetta halb verloren inmitten einer riesigen Wolke von Stoffen wieder: Seide und Satin in allen Regenbogenfarben hingen an Kleiderstangen und sogar von den Vorhängen an den Fenstern. Auf jeder Oberfläche stapelten sich Papiere: Speisekarten, Einladungen, Listen der noch benötigten Dinge. Antonetta lehnte gegen einen Haufen Seidenkissen, die eine Art Barriere zwischen ihr und dem Kopfbrett ihres Betts bildeten – eine hübsche, aber unbequem wirkende Rose aus vergoldetem Holz.
Genau genommen war Antonettas Zimmer weniger extrem dekoriert als der Rest des Hauses: Zwar schimmerten die hellrosa gestrichenen Wände wie das Innere einer Muschel, und die Sofas waren mit Stoffen gepolstert, auf denen Hirtenmotive und Bauernhöfe prangten. Aber Lin entdeckte tatsächlich weniger Seidenblumen und überhaupt keine Marmorbüsten.
Antonetta entließ das Dienstmädchen mit einem kurzen Befehl – »Lass uns allein, Magali« – und bedeutete Lin, die Tür hinter sich zu verriegeln, bevor sie sich dem Bett näherte. Antonettas goldene Locken besaßen fast die gleiche Farbe wie die Seidenbettwäsche. Sie trug einen hellblauen Morgenmantel mit Spitzen an den Ärmeln und empfing Lin mit betrübter Miene. »Hast du etwas gegen die Kopfschmerzen, die der Stress bei der Planung einer Verlobungsfeier verursacht – einer Feier, von der man sich wünscht, dass sie nicht stattfindet?«, erkundigte sie sich.
Lin setzte sich auf das Bett zu Antonettas Füßen und kramte in ihrer Tasche nach einem Extrakt aus Weidenrinde. Beim Anblick des Titels eines ledergebundenen Buchs, das aufgeschlagen auf der Decke neben ihr lag – Das kalte Herz des einsamen Königs –, musste sie lächeln.
»Ist der Termin noch immer nächste Woche?«, fragte Lin mitfühlend. »Es scheint, als ob alles furchtbar schnell ginge. Dabei ist er noch nicht mal in Castellan eingetroffen, oder?«
»Sein Schiff legt in fünf Tagen an«, erwiderte Antonetta ohne Begeisterung und blickte hoffnungsvoll zu Lin hoch. »Vielleicht könnte ich ja eine mysteriöse Krankheit entwickeln, etwas, das mich daran hindert, ihn zu sehen? Zumindest für ein oder zwei Monate.«
Lin reichte Antonetta das kleine Tütchen mit Weidenrindenextrakt. »Das wäre nur ein Aufschub. Ich wünschte …« Sie verstummte. Denn sie wusste bereits, dass Antonettas Verlobter, Artal Gremont, nicht nur viel älter war als sie, sondern auch einen zweifelhaften Ruf genoss. Kel hatte ziemlich unangenehme Dinge über ihn angedeutet. Und dass Gremonts Familie gezwungen gewesen war, ihn ins Ausland zu schicken – was angesichts des Fehlverhaltens, mit dem der Adel von Castellan sonst regelmäßig davonkam, bedeutete, dass es sich um wirklich schlimme Verfehlungen gehandelt haben musste.
Aber Lin machte sich auch Sorgen darüber, wie resigniert Antonetta mit der ganzen Situation umzugehen schien – eine Verlobung, die ihre Mutter arrangiert hatte. Antonetta hatte kein Mitspracherecht gehabt, und es gab offenbar nichts, was sie tun konnte, um die Meinung ihrer Mutter zu ändern. Lin wusste, dass Antonetta sich eigentlich gewünscht hatte, ledig zu bleiben und die Seiden-Charta zu führen, wie ihre Mutter im Moment. Aber allem Anschein nach traute Liorada Alleyne ihrer Tochter nicht: Sie hatte Antonetta mitgeteilt, dass sie die Charta und die damit verbundene Macht einem entfernten Cousin überlassen und damit ihre eigene Tochter enterben würde, wenn Antonetta nicht einwilligte, zu heiraten und den Alleyne-Stammbaum fortzuführen. Jetzt schien Antonetta sämtliche Hoffnung auf die Möglichkeit zu setzen, dass Gremont von der Heirat ebenso wenig begeistert war wie sie und sie deshalb weitestgehend in Ruhe lassen würde, sodass sie ohne allzu große Einmischung das Leben einer wohlhabenden Adligen auf dem Hügel führen konnte.
»Ich hoffe, er hat entweder schon eine Geliebte oder nimmt sich bald eine«, sagte Antonetta nun. »Wenn er sehr an ihr hängt, wird er mich vielleicht gar nicht großartig belästigen.« Sie sah Lin an. »Hältst du das für möglich?«
»Leider liegt es außerhalb meines persönlichen Erfahrungsbereichs, wie man seinen Ehemann davon überzeugt, sich eine Geliebte zu nehmen«, antwortete Lin mit einem schiefen Lächeln. »Nimm das hier, und leg es unter deine Zunge.«
»Du bist wirklich anstrengend«, sagte Antonetta. »Glücklicherweise kann ich dich nach der Hochzeit weiterhin sehen. Ich wüsste nicht, warum ein Mann seine Frau nicht zu einer Heilkundigen gehen lässt.«
»Vermutlich ein Mann, der vielleicht vorhat, sie zu verletzen«, erwiderte Lin vorsichtig. Sie hatte schon viele solcher Frauen behandelt. Frauen, die darauf beharrten, dass ihre Verletzungen von ihrer eigenen Ungeschicklichkeit herrührten – obwohl sie sich der Tatsache bewusst waren, dass sie Lin nichts vormachen konnten.
Antonetta schnaubte. »Gremont wird mich nicht anrühren, wenn er in Castellan bleiben will«, sagte sie. »Der Angriff auf eine Adlige wird mit Verbannung bestraft – auch wenn der Angreifer ihr Ehemann ist.«
Wenn nur die einfachen Frauen von Castellan einen solchen Schutz hätten, dachte Lin, verdrängte den Gedanken aber. Es war besser, dass wenigstens einige Frauen geschützt waren als gar keine.
In der Hoffnung, das Thema zu wechseln, zeigte Lin auf das aufgeschlagene Buch auf dem Bett. »Ist das gut?«, fragte sie. »Der Titel klingt wie die Geschichte eines Wandererzählers.«
»Es geht darin um Prinz Conor«, erklärte Antonetta mit einem schiefen Lächeln. »Wie die meisten Geschichten der Wandererzähler.«
Lin spürte, dass sie errötete. Wie immer, wenn der Prinz von Castellan erwähnt wurde – was wirklich äußerst unangenehm war. Hastig begann sie, in ihrer Tasche zu kramen. »Doch bestimmt nicht alle Geschichten.«
»O doch«, versicherte Antonetta. »Die sieben Skelette der sieben Bräute des Prinzen. Der Prinz mit dem Herz aus Eis und der Krone aus Gold. Der Prinz in Seide und die Lady in Lumpen sowie Die grausamen Gesetze des bösen Prinzen …«
»Diese Titel scheinen ziemlich lang zu sein«, bemerkte Lin.
Antonetta zuckte die Schultern. »Jeder mag einen Prinzen, besonders wenn er unverheiratet ist.« Träge betrachtete sie ihre Nägel. »Allerdings wird er nicht mehr lange unverheiratet bleiben.«
Ruckartig hob Lin den Kopf. »Was meinst du damit?«
»Conor geht eine Verlobung ein«, berichtete Antonetta und musterte Lins Miene eindringlich. »Es ist schon alles arrangiert. Er wird Anjelica von Kutani heiraten.«
Ein Rauschen ertönte in Lins Ohren. Unwillkürlich musste sie an ihre letzte Begegnung mit dem Prinzen denken, in seiner Kutsche vor dem Sault. An seine letzten Worte an sie: Dann bin ich verdammt. Dazu verdammt, nur an Euch zu denken. An Euch, die Ihr mich für einen abscheulichen Menschen haltet. Ein eitles Ungeheuer, das dem Drang nicht widerstehen konnte, sich aufzuspielen, und das Euch damit unglücklich gemacht hat.
Sie hatte keine Gelegenheit gehabt, diese Worte zu überdenken. Und schon gar keine Gelegenheit, ihm zu sagen, dass sie ihn nicht für ein Ungeheuer hielt. An diesem Abend war es passiert – das Massaker. Das Blutbad in der Glänzenden Galerie. Der große Verrat. Es gab alle möglichen Namen für den Angriff auf den Marivent in jener Nacht – die Nacht, in der Lin sich zur Wiederauferstandenen Göttin erklärt hatte und die Schiffe der Familie Roverge im Hafen lichterloh brannten. Als sie am nächsten Morgen aufgewacht war, hatte sie die schwarzen Fahnen an den Brüstungsmauern des Palastes gesehen, die Totenglocken in der Stadt läuten hören und hatte gedacht, dass es irgendwie mit ihr zu tun hätte – mit ihrem Verbrechen, ihrer großen Lüge.
Ich bin die Wiederauferstandene Göttin.
Aber daran hatte es natürlich nicht gelegen. Mayesh war in ihr Haus gekommen, sein Gesicht bleich wie ein Totenschädel – er schien über Nacht um zehn Jahre gealtert zu sein. Er hatte sie angesehen und mit müder, angespannter Stimme berichtet: »Ein Blutbad im Palast. Und jetzt das.« Dabei hatte er nicht mal wütend geklungen. Nur sehr erschöpft.
Sie hatte ihm einen Becher Karak zubereitet und ihn gezwungen, ihr haarklein zu erzählen, was passiert war – der Angriff auf den Palast; der Tod der kleinen Prinzessin von Sarthe; was diese Ereignisse für Castellan bedeuten würden. Und die ganze Zeit hatte sie sich zurückhalten müssen, um diese drängenden Fragen nicht zu stellen: Ist er verletzt worden? ISTERVERWUNDET? Geht es dem Prinzen gut?
Sie hatte kein Recht, zu fragen. Und auch kein Recht, sich Sorgen um Kel zu machen. Verstohlen hatte sie die Hände unter dem Tisch in ihren Schoß gelegt, um ihr Zittern zu verbergen, bis ihr Großvater seinen Bericht beendet hatte.
»Wir können uns keinen Krieg leisten«, hatte er gesagt, und Lin war klar geworden, dass er nicht von Castellan, sondern von ihrem Volk, den Ashkar, sprach. »Wenn Castellan von außen angegriffen wird, werden die Bewohner mit neuem Eifer darangehen, das Innere zu säubern. Sie werden sich fragen: Wer sind sie, diese Ashkar, die in unserer Stadt leben, aber nicht zu uns gehören? Wem gilt ihre Loyalität?«
»Das werden sie nicht. Du hast so viel getan, Zai. So viele Errungenschaften, selbst in den letzten zwanzig Jahren …«
Doch er hatte sie nur angesehen, mit einem kühlen Blick in den Augen. »Sagst du das als meine Enkelin Lin oder als die Wiederauferstandene Göttin?«
Sie schluckte schwer. »Ich könnte dir sagen …«
»Nein«, hatte er erwidert. »Ich weiß nicht, was du dir von alldem erhoffst, aber sag es mir nicht. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß.«
Damals hatte sie gewusst, dass er und der Maharam einander zwar verabscheuten, sich aber in einem Punkt einig waren: Lin Caster war nicht die Wiederauferstandene Göttin, und es würde nichts Gutes dabei herauskommen, wenn sie das Gegenteil behauptete.
»Lin …«, setzte Antonetta jetzt besorgt an, »worüber denkst du nach?« Sie beugte sich vor. »Bringt dich die Nachricht über Conors Verlobung … aus der Fassung?«
»Ich habe einmal einen Mann mit einer Ahle im Kopf behandelt«, erwiderte Lin. »Ich bin nicht leicht aus der Fassung zu bringen.«
»Gut, denn ich möchte dich um etwas bitten … um einen unangenehmen Gefallen.«
»Was für einen unangenehmen Gefallen?«
»Ich möchte, dass du zu meiner Verlobungsfeier kommst …«
»O nein«, unterbrach Lin sie. »Keine weiteren Feiern auf dem Hügel. Die letzte …«
»Ich habe gehört, dass du sehr gut getanzt hast«, sagte Antonetta.
Lin warf ihr einen strengen Blick zu.
Aber Antonettas Augen wirkten groß und unschuldig. »Ich brauche dort jemanden mit etwas Mitgefühl, Lin. Jemanden, der auf meiner Seite ist. Bitte!«
»Was ist mit Kellian?«, fragte Lin. »Wird er nicht anwesend sein?«
Jetzt wandte Antonetta den Blick ab. »Ja, schon, aber er wird den Prinzen begleiten. Conor mag es, wenn er seine Freunde bei Feiern um sich hat.«
Natürlich, dachte Lin. Conor würde bei der Verlobungsfeier anwesend sein. Ein kleiner Teil von ihr schreckte vor der Vorstellung zurück, ihn zu sehen, aber ein größerer Teil flüsterte: Geh zu der Feier. Geh, und stell dich ihm. Schon bald wirst du dem Exilarchen und dem Sanhedrin gegenüberstehen. Währenddessen darfst du nicht an den Prinzen von Castellan denken. Sprich ein letztes Mal mit ihm, und dann zieh einen Schlussstrich.
»Bitte«, sagte Antonetta erneut. »Ich werde dir eines meiner Kleider leihen. Welches du willst. Du wirst absolut umwerfend aussehen.«
Und mit einem prächtigen Kleid ausstaffiert, wird mir das Ganze zumindest leichter fallen, dachte Lin. »Also gut, wenn du mich wirklich brauchst, Ana«, sagte sie mit einem zögernden Lächeln, »dann werde ich selbstverständlich erscheinen.«
alles Gute kommt von den Göttern, alles Böse von den Menschen.
Unwillkürlich starrte Kel auf die Worte, die als goldene Mosaiksteine in der Kuppel der Uhrkammer prangten. Jetzt schienen sie ein unheimliches Gewicht zu haben, das sie vor drei Monaten nicht gehabt hatten, als die Oberhäupter der Großen Chartas von Castellan das letzte Mal an diesem Ort zusammengekommen waren.
Allerdings war er sich nicht sicher, woran das lag. Schließlich war Conors Ankündigung besser aufgenommen worden, als Kel erwartet hatte. Anfangs hatte es Proteststimmen gegeben, nachdem Conor die Nachricht von seiner Verlobung verkündet hatte. Kel hatte Gesprächsfetzen aufgeschnappt, Einwände – Genau so eine Heiratsabsicht hat uns erst in diese Situation gebracht – und Beschwerden darüber, dass man die Charta-Inhaber nicht gefragt hatte. Aber Conor hatte sich in Geduld geübt – Geduld, die wie ein neuer Mantel unbequem auf seinen Schultern lag –, bis der Lärm abgeebbt war.
»Unser neuer Partner weiß über die Situation mit Sarthe Bescheid«, hatte er schließlich gesagt. »Man hat uns eine Mitgift von einhunderttausend Goldkronen und die Bereitstellung ihrer Flotte im Falle eines Kriegs zugesagt. Kutani hat zehntausend Kriegsschiffe. Die Sarther haben kein einziges; sie müssten Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um an fremde Kriegsschiffe zu kommen, und selbst wenn sie sich zu einem Angriff von der Seeseite her entschließen, würden sie unseren Hafen voller Schiffe vorfinden, die nur darauf warten, sie zu versenken.«
Seine Augen waren zu silbernen Schlitzen verengt, und Kel musste daran denken, wie viel Sorgfalt in die Vorbereitung dieses Moments eingeflossen war. Schlaflose Nächte, in denen Conor überlegt hatte, ob er das Richtige tat. Beratungen mit Mayesh, stundenlange Sitzungen im Nordturm mit dem Berater und dem Legaten und diesen Landkarten – zahllose, mit Stecknadeln gespickte Landkarten. Jede Stecknadel eine Armee. Und für jede Stecknadel, die die Armeen von Castellan repräsentierte, zehn weitere, die für die Armeen der Sarther standen.
Aber letztendlich war das Ganze keine wirkliche Frage gewesen.
Jetzt meldete sich Cazalet als Erster zu Wort.
Und so sollte es auch sein, dachte Kel, denn die anderen Familien orientierten sich am Inhaber der Charta für Bankwesen.
»Eine bewundernswerte Entscheidung, Monseigneur«, sagte Cazalet, »und eine Entscheidung, die eindeutig zum Wohle von Castellan getroffen wurde.«
Die Aufregung, die unter den Charta-Inhabern zu brodeln begonnen hatte, legte sich. Ciprian Cabrol wirkte aufrichtig erfreut. »Einfach brillant«, sagte er. »Gegen solche vereinten Kräfte können die Sarther nichts ausrichten. Sie werden nicht mal den Versuch wagen.«
Sogar Lady Alleyne hatte die Nachricht von Conors Heiratsplänen anstandslos hingenommen. Schließlich war Antonetta verlobt; Liorada hegte keine weitere Hoffnung, sie mit Conor zu vermählen. Sie hatte ihren Traum von einer königlichen Tochter aufgegeben und akzeptiert, dass Antonetta vermutlich nur sehr, sehr reich werden würde.
Kel hatte gehofft, dass Antonetta bei der Versammlung anwesend wäre, aber sie fehlte. Seit Bekanntgabe ihrer Verlobung – nur eine Woche nach dem Blutbad in der Glänzenden Galerie – hatte er sie kaum zu Gesicht bekommen. Sie hatte den Palast nicht mehr aufgesucht, und als er sie eines Abends im Haus Cabrol gesehen hatte, hatte sie nur strahlend gelächelt und gesagt, dass die Hochzeit eine Menge Vorbereitungen erfordere. Sie wäre viel beschäftigter, als sie sich vorgestellt hätte, und ob er glaubte, dass rosa Rosen auf dem Altar ein Problem sein könnten? Denn rosa Rosen wären ihre Lieblingsblumen, aber in der Blumensprache der Castellaner deuteten sie die Vergänglichkeit der Zuneigung an. Was er davon hielte?
Es war ihm gerade noch gelungen, sich aus dem Staub zu machen, ohne etwas zu sagen, das er nicht hätte sagen sollen. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie ihn vor Monaten angefleht hatte, etwas zu unternehmen, um die Hochzeit zu verhindern. Aber damals hatte er seinen Talisman getragen. Sie hatte ihn für Conor gehalten. Was bedeutete, dass Kel offiziell nicht wissen durfte, dass sie die Verlobung – zunächst – nicht gewollt hatte. Er konnte diese Tatsache nicht erwähnen, ohne gegen sein Schwertfänger-Gelübde zu verstoßen.
Plötzlich spürte er, dass er dringend frische Luft brauchte. Jetzt, nach der Sitzung, drängten sich mehrere Charta-Inhaber um Conor. Zwischen den wogenden Schultern derer, die versuchten, dem Prinzen nahe zu kommen, konnte Kel nur den hellen Schimmer seines roten Samtumhangs und das Funkeln des Rubins in seiner Krone ausmachen.
Eine Bewegung in der Nähe der Tür erregte seine Aufmerksamkeit. Legat Jolivet, der Anführer der königlichen Garde. Sein Haar schien seit dem Blutbad in der Glänzenden Galerie grauer geworden zu sein, sein Profil hagerer. Er hatte während der Versammlung nur wenig gesagt, obwohl er an jeder Entscheidung, die der Prinz in den letzten Monaten getroffen hatte, beteiligt gewesen war.
In den chaotischen Tagen nach der Ermordung der sarthischen Prinzessin, ihrer Leibwache und Botschafter hatte der Palast atemlos auf eine Nachricht von Sarthe gewartet. Als Zeichen des guten Willens schlug Jolivet vor, sofort eine Nachricht an die Sarther zu schicken, in der die Geschehnisse geschildert wurden – wahrheitsgemäß, wie er betonte. Denn der Ablauf der Ereignisse würde bald überall zu lesen sein, und der König in Aquila würde jede Lüge schnell erkennen. Die einzige Unwahrheit bestand nicht in den Worten, sondern in der Implikation, dass der König die Nachricht persönlich verfasst hatte. Stattdessen hatte Conor die Zeilen aufgesetzt und dann mit dem Namen seines Vaters unterschrieben.
Die Antwort aus dem Palast in Aquila war knapp und kalt. König Leandro d’Eon schrieb, dass die Sarther ihre Prinzessin in dem Glauben nach Castellan geschickt hätten, sie wäre dort sicher. Das Unglück im Marivent sei die Schuld von Castellan. Und um einen Krieg zu vermeiden, müsse ein Ehrenpreis gezahlt werden.
In seinem Brief nannte er einen Betrag in Höhe von einer Million Goldkronen. Selbst Mayeshs Miene hatte sich daraufhin verändert. »Das kann nicht sein Ernst sein«, hatte er gesagt. »Man könnte ganz Castellan verkaufen und würde nicht solch einen Betrag zusammenbekommen. Kein Land außer vielleicht Kutani könnte sich von so viel Gold trennen und das Ganze überstehen.«
»D’Eon sagt damit, dass er Krieg will«, hatte Conor müde erwidert. »Er bietet einen Ausweg an, aber es ist kein echtes Angebot.«
»Und auch kein echter Ausweg«, hatte Jolivet hinzugefügt. Er hatte sich im Raum umgesehen und sie alle gemustert, mit wie üblich unerschütterlicher Miene. »Wir werden nicht zahlen. Wir werden einen anderen Weg finden.«
Und das war ihnen auch gelungen, obwohl Jolivet über den offensichtlichen Erfolg des Plans nicht erfreut wirkte. Er deutete mit dem Kinn auf Kel, gab ihm damit zu verstehen, ihm aus dem Raum zu folgen, und ging.
Kel wand sich durch die Menge. Außerhalb des Sternenturms empfing ihn das grelle Licht der Mittagshitze. Eine Dunstglocke lag über der Stadt, die sich unterhalb des Hügels verflüchtigte und das Meer in einen fernen grünen Fleck verwandelte.
Er fand Jolivet im Schatten der Mauer vor, die den Garten der Königin umgab. Der Legat mit dem Löwenring und der goldenen Borte an der Uniform betrachtete ihn mit ausdrucksloser Miene. Als Kel sich ihm näherte, sagte er leise: »Ich nehme an, du wirst die Informationen aus dieser Versammlung zum Schwarzen Palais bringen.«
»Ich sehe keinen Grund, es zu verheimlichen«, antwortete Kel. »Die Stadt wird schon bald davon erfahren, und der Lumpensammlerkönig mit Sicherheit vor allen anderen.«
Jolivet brummte und verschränkte die Arme vor der Brust. »Vermutlich haben du und deine Freunde keine weiteren Fortschritte gemacht.«
Kel verkniff sich eine ärgerliche Erwiderung. Von allen Bewohnern in Castellan hätte er Legat Jolivet definitiv nicht als die einzige Person außerhalb des Schwarzen Palais ausgewählt, die sein Geheimnis kannte. Aber ihm war keine andere Wahl geblieben. Und Jolivet hatte ihm förmlich befohlen, sich mit dem König der Lumpensammler zu verbünden, um herauszufinden, wer die Morde in der Glänzenden Galerie angezettelt hatte.
Als Schwertfänger gehörte Kel zum Palast, er war dessen Eigentum. Wenn Jolivet ihm etwas befahl, wäre eine Weigerung einer kleinen Revolte gleichgekommen. Zwar hätte er sich an Conor wenden können, aber tief in seinem Herzen war er mit dem Legaten einer Meinung. Wer auch immer den Anschlag auf die Galerie verübt hatte, hatte ein größeres Ziel im Visier als die Delegation der Sarther.
Kel hatte einen der Attentäter aus der Galerie hinaus verfolgt und ihn auf dem Dach gestellt. Er erinnerte sich noch gut daran, was ihm die schwarz gekleidete Gestalt – deren Gesicht und Körper vollständig verborgen und deren Identität nicht zu erkennen gewesen war – zugezischt hatte, als er ungläubig mit dem Schwert in der Hand dastand.
Ihr steht an der Schwelle einer neuen Geschichtsschreibung, Schwertfänger. Denn dies ist der Beginn des Untergangs des Hauses Aurelian.
Conor war das einzige Kind eines Königs, der selbst der einzige Überlebende von drei Söhnen war. Wenn das Haus Aurelian enden sollte, bedeutete dies Conors Tod. Und Kel hatte geschworen, das zu verhindern. Selbst wenn es bedeutete, Jolivets Befehl zu befolgen und seine Aktivitäten geheim zu halten. Selbst wenn es bedeutete, sich mit dem Lumpensammlerkönig zu verbünden – dem größten Verbrecher in Castellan.
»Es geht nur langsam voran«, antwortete Kel. »Wir jagen Geister. Niemand scheint etwas über die Angreifer zu wissen. In jener Nacht müssen dreißig Männer ums Leben gekommen sein, aber es gibt keinerlei Gerüchte über Vermisste. Und der Lumpensammlerkönig bekommt viele Gerüchte mit.«
Jolivet brummte erneut. »Nichts geschieht ohne Vorwarnung«, sagte er. »Aber es kann sein, dass diese Warnungen vielleicht nicht so aussehen, wie du es dir vorstellst. Jeder ungewöhnliche Vorfall in der Stadt ist es wert, davon Notiz zu nehmen.« Er warf einen Blick zur Tür des Turms. Ciprian Cabrol, Joss Falconet und Lupin Montfaucon waren herausgetreten und kamen auf dem Kiesweg in ihre Richtung, die Köpfe eng zusammengesteckt, während sie sich unterhielten.
»Cabrol«, murmelte Jolivet mit seiner rauen Stimme. »Was hältst du von ihm?«
Kel zögerte einen Moment, bevor er antwortete, und beobachtete die drei Männer, die sich langsam näherten. Vor dem weißen Hintergrund der Palasttürme wirkten sie wie bunte Vögel. Montfaucon war wie immer prächtig gekleidet, in dunkler Hose und leuchtend gelbem Wams, wie ein Pirol. Joss trug einen kardinalroten Anzug mit einem gestickten Muster aus kupferroten Schlangen. Dagegen war Cabrol der Schlichteste der drei: in Dunkelgrau gekleidet, obwohl sein Gehrock ein eisvogelblaues Futter besaß, das beim Gestikulieren in seinen Ärmeln aufblitzte.
»Nach der Art und Weise, wie die Färbemittel-Charta in seinen Besitz gelangt ist, fällt es schwer, ihm zu vertrauen«, sagte Kel leise.
Bis vor drei Monaten hatte die Charta für Färbemittel der Familie Roverge gehört, deren Sohn Charlon zusammen mit Joss und Lupin zu Conors engsten Freunden zählte. In der Nacht des Blutbads in der Glänzenden Galerie war die gesamte Flotte der Roverges im Hafen verbrannt und ihr Vermögen vernichtet worden. Innerhalb weniger Tage waren sie vom Hügel verschwunden und hatten nur ein paar Habseligkeiten mitgenommen; der Rest ihres Besitzes wurde verkauft, um ihre enormen Schulden zu begleichen. Die Charta gehörte der Krone und dem Rat und war einer Familie übertragen worden, die Cazalet ausgewählt und der König – also in Wirklichkeit Conor – offiziell bestätigt hatte: die Cabrols, bekannte Tintenhändler der Stadt.
Die Familie bestand aus drei Personen: Ciprian, der älteste Sohn, Beatris, seine Schwester, und seine alte Mutter, die man aber seit dem Machtwechsel kaum noch sah. Ciprian war arrogant und attraktiv, und er schien fest damit gerechnet zu haben, die Zügel einer der profitabelsten Chartas von Castellan in die Hand gedrückt zu bekommen.
Und vermutlich hatte er auch guten Grund dazu. Nachdem Kel mit Lin über die zerstörte Flotte gesprochen hatte, hatte er Mayesh im Nordturm zur Rede gestellt: »Wir wissen doch alle, dass die Familie Cabrol die Schiffe der Roverges verbrannt hat, oder?«
»Aber ja«, hatte Mayesh bestätigt. Er hatte eine Landkarte von Sarthe mit bunten Stecknadeln studiert, deren Farbcodierung Kel jedoch nichts sagte. »Das Ganze ist ein offenes Geheimnis, Kellian.«
»Und es wird nichts unternommen deswegen?«
»Die Familie Roverge hatte viele Feinde.« Mayesh bewegte eine Stecknadel. »Sie haben jeden, den sie als Rivalen ansahen, bedroht und eingeschüchtert. Die Familie Cabrol war nur das jüngste ihrer Opfer … und das erste, das sich gewehrt hat. Ihr Verhalten hätte sie wahrscheinlich ins Gefängnis gebracht, wenn sie jemand anderes gewesen wären. Viele auf dem Hügel und in den Handelsgilden betrachten dies als Benedicts wohlverdiente Strafe.« Er betrachtete Kel neugierig. »Was hast du denn geglaubt, wie die Chartas den Besitzer wechseln?«
»Jedenfalls nicht auf diese Weise«, hatte Kel geantwortet und an den Hafen in der Brandnacht gedacht, an das Meer voller Färbemittel, an Wellen, die sich mit gelben, scharlachroten, türkisblauen und violetten Schaumkronen brachen. Noch Tage danach hatte der Rauch in der Luft über Castellan gehangen und die Sonnenuntergänge in ein malerisches Schauspiel aus Weinrot und Gold verwandelt. Eine Siegesfahne für die Cabrols. »Sie mögen zwar über Macht verfügen, aber es wird eine Rolle spielen, wie sie an diese Macht gekommen sind. Langfristig ist das immer relevant.«
Mayesh hatte bei diesen Worten matt gelächelt. »Eine scharfsinnige Beobachtung, Kel. Du hast einen Grund dafür ausgemacht, warum Adlige sich nicht ständig gegenseitig ihre Schiffe in die Luft jagen, um an eine Charta zu kommen.«
»Gibt es noch einen anderen Grund?«
»Schwarzpulver ist teuer«, hatte Mayesh mit einem leisen Lachen geantwortet und sich wieder der Landkarte zugewandt.
»Anjuman!«, rief Joss jetzt, mit seinem üblichen trägen Grinsen um die Mundwinkel. »Ich nehme an, du wusstest bereits von Conors großen Neuigkeiten, oder? Kein Wunder, dass du die ganze Zeit ausgesehen hast, als würdest du jeden Moment einschlafen. Keine Überraschung für dich.«
Kel nahm sich vor, an seiner Miene zu feilen. Offensichtlich vermittelte sie nicht, dass er ruhig, aber interessiert zuhörte. »Ja, ich habe es gewusst. Die Entscheidung ist Conor nicht leichtgefallen. Er hat mit sich gerungen.«
»In der Tat«, sagte Montfaucon mit einem Lachen. Das Gelb seines Wamses leuchtete fast erschreckend grell auf seiner dunklen Haut. »Er ist den Fesseln der Ehe nur knapp entkommen. Aber jetzt geht er bereitwillig zurück ins Gefängnis.«
»Conor geht selten einfach so irgendwohin«, bemerkte Joss. »Ich würde sagen, er schreitet zielstrebig zurück ins Gefängnis.« Er wandte sich an Jolivet. »Würdet Ihr dem zustimmen, Legat?«
Jolivet murmelte, dass er seine Truppen inspizieren müsse, und entfernte sich.
Cabrol sah ihm mit einer hochgezogenen Augenbraue nach. »Ein Mann mit heiterem Gemüt«, sagte er trocken. Er hatte ein ungewöhnliches Äußeres: dunkle Augen, aber Haare in der Farbe der roten Dachziegel von Castellan. »Normalerweise sind Soldaten in Tavernen ziemlich unterhaltsame Gesellschafter, aber ich würde sagen, der Legat bildet eine Ausnahme.«
»Soldaten können durchaus unterhaltsame Gesellschafter sein, wenn sie nicht im Dienst sind«, sagte Kel und fragte sich, warum er Jolivet verteidigte. Doch es war einfach stärker als er. »Aber Jolivet ist wohl nie außer Dienst.«
Cabrol musterte jetzt Kel mit hochgezogener Augenbraue. »Das stimmt vermutlich. An seiner Loyalität gegenüber der Stadt oder der Krone kann man sicher nicht zweifeln. Oder an Conors Loyalität«, fügte er hinzu. »Er heiratet eindeutig zum Wohl von Castellan. Und er wird sich die Dankbarkeit der Menschen dafür verdienen. Sogar von uns Charta-Inhabern auf dem Hügel.«
Seine Stimme klang sanft, sein Tonfall leicht. Aber Kel traute ihm keine Sekunde.
»Dankbarkeit.« Montfaucon winkte die Vorstellung als langweilig ab. »Hört zu, Anjuman, ich gebe heute Abend eine kleine Gesellschaft im Caravel. Alkohol und Stundengläser gehen auf mich. Bringt unseren jungen Prinzen mit. Er muss sich ein bisschen amüsieren.«
»In der Tat – schließlich bleibt ihm nicht mehr viel Zeit dafür«, sagte Joss und lachte. »Außerdem hat er sich halb zu Tode gerackert, seit …« Er verstummte, leicht verlegen, was für Joss ungewöhnlich schien; er war nur selten verlegen. »Nun ja, seit den letzten Monaten. Er hat es verdient, sich ein wenig zu amüsieren.«
»Ich werde ihm von der Gesellschaft heute Abend erzählen, Lupin«, sagte Kel. Ihm wurde klar, dass er sich nicht mal mehr daran erinnern konnte, wann Conor das letzte Mal die Freudenhäuser des Tempelbezirks aufgesucht hatte – ob nun mit seinen Freunden oder ohne sie.
Montfaucon zeigte mit seinem behandschuhten Finger auf ihn. »Sagt ihm, es ist wichtig«, sagte er. »Es gibt da jemanden, den ich ihm vorstellen möchte.«
Joss, der seine Fassung wiedererlangt hatte, klopfte Montfaucon auf den Rücken. »Montfaucon ist in einen neuen Liebhaber vernarrt und macht ein großes Geheimnis um ihn. Er will uns nicht mal seinen Namen verraten.«
Montfaucon zuckte die Schultern, obwohl er sichtlich zufrieden mit sich wirkte. »Ich habe doch gesagt, dass er mit seinem Arenanamen angesprochen werden möchte: die Graue Schlange.«
Cabrol lachte und erwiderte, dass man von Montfaucon wohl kaum erwarten könne, dass er seinen Geliebten im Rausch der Leidenschaft die Graue Schlange nannte, aber Kel hörte kaum zu. Er war zu schockiert, um irgendetwas zu sagen, und stand reglos da, während seine Gedanken in die Vergangenheit zurückkehrten.
Marcel
In der Ankerstraße im Labyrinth, fast direkt an den Mauern des Sault, steht ein Tempel mit einem Fries aus tanzenden Skeletten über den Eingangstüren: Er war einst Anibal, dem Gott des Todes, geweiht worden, als das Gebiet, das heute das von Verbrechen heimgesuchte Labyrinth beherbergt, noch aus Sumpfland und Hütten bestand. Eine Million schwarz gekleideter Anhänger hatten im Laufe der Jahre die breite Eingangstreppe mit ihrem Kommen und Gehen abgetragen, selbst als die Verehrung des Todesgottes an Beliebtheit einbüßte und diejenigen, die weiterhin zu ihm beteten, eher Misstrauen erregten.
Als der Strom der Gläubigen schließlich vollständig versiegte, ließ der Hierophant, der Hohepriester der Stadt, die Türen mit Vorhängeschlössern verriegeln, die Fenster verbrettern und den Tempel für die Bürger von Castellan für geschlossen erklären. Allerdings handelt es sich bei dem Bauwerk nicht um eine Ruine; die Angst vor Anibal und seinem Zorn hat Vandalen ferngehalten.
Marcel Sandoz, Trunkenbold und Mohnsaftabhängiger, schläft oft auf den Stufen des alten Tempels. Der Aberglaube verhindert, dass ihn hier selbst in den frühen Morgenstunden jemand stört. Wie üblich tief in seine bunten Mohnsaftträume versunken, sieht er sich selbst auf einer Wiese, umgeben von lachenden Mädchen in hellen Seidenkleidern, als er die Fremden kommen hört.
Blinzelnd öffnet er die Augen und verzieht sogar bei diesem schwachen Licht das Gesicht vor Schmerz. Vielleicht war das Geräusch ja Teil seines Traums, überlegt er. Oder vielleicht hat er die Shomrim auf den Mauern des Sault miteinander reden hören. Doch der dröhnende Schmerz in seinem Kopf und der Gestank des kalten Steins unter ihm vertreiben diesen Gedanken schnell. Das hier ist kein Traum, sondern die Wirklichkeit, und die Schritte kommen immer näher.
Auf Händen und Knien krabbelt er die letzten Stufen zum Säulengang hinauf, wo er sich hinter einer abgewetzten Marmorsäule versteckt. Wächter, vermutet er. Sie haben ihn jedes Mal fortgejagt, sobald er einen bequemen Platz zum Schlafen gefunden hatte. Doch als drei schemenhafte Gestalten die Stufen des Tempels erklimmen, läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Sie tragen nicht die üblichen roten und gelben Uniformen der Wächter. Stattdessen sind sie ganz in Schwarz gekleidet, als wollten sie mit der Nacht verschmelzen.
Eine der Gestalten – ein Mann, dessen kahl geschorener Schädel im Mondlicht schimmert – sagt etwas in einer Sprache, die nicht weich klingt wie die der Stadt, sondern voller harter Kanten und Grunzlaute ist.
Seltsam, denkt Marcel. Reisende aus Malgasi verirren sich selten nach Castellan. Jenes ist ein mysteriöses Königreich, östlich von Sarthe, über das dunkle Gerüchte kursieren.
»Cza vayuslam. Vaino sedanto anla.«
Im nächsten Moment knurrt die schlankste der Gestalten, eine Frau, mit kalter Stimme: »Bagomer, denk daran, was ich dir gesagt habe. Du musst dein Castellanisch üben.«
»Ich habe nur gesagt, dass der Tempel unbenutzt ist, Mylady. Hier wird uns niemand stören«, nuschelt der Glatzkopf.
»Das Gebäude ist ziemlich düster, nicht wahr«, bemerkt die Frau mit einem zufriedenen Unterton.
Marcel kann jetzt ihre Kleidung sehen: ein eng anliegender, durchgehend schwarzer Anzug, straff wie eine Schlangenhaut, als wäre sie mit schwarzem Öl bemalt worden. Eine Kapuze bedeckt ihre Haare, aber das Gesicht, das aus der Dunkelheit herausschaut, wirkt so bleich und hager wie die Schädel der tanzenden Skelette über ihr.
»Janos«, faucht sie den zweiten Mann an, über dessen Gesicht sich eine lange wulstige Narbe zieht. »Schick eine Nachricht an Artal Gremont. Sag ihm, dass die Prinzessin von Malgasi, Thronfolgerin von Belmany, in seiner Stadt angekommen ist. Das sollte ihm Beine machen.«
Als Janos nickt und in die Nacht verschwindet, spürt Marcel, wie ihn eine schreckliche Angst erfasst. Die Prinzessin von Malgasi? Da er die meiste Zeit seines Lebens in Castellan verbracht hat, weiß er eines ganz genau: Kein vernünftiger Bürger möchte in königliche Angelegenheiten verwickelt werden. Unter gar keinen Umständen.
Langsam robbt er sich durch den Säulengang, lautlos wie eine Schlange. Doch zu seinem Pech stößt er mit seinem nackten schmutzigen Fuß gegen eine leere Flasche in einem zusammengewehten Müllhaufen. Und diese rollt mit einem klirrenden Geräusch über die Marmorplatten.
Marcel rappelt sich mühsam auf. Er will davonlaufen, aber seine schweren Beine gehorchen ihm nicht. Er sieht, wie die beiden Gestalten auf der Treppe zu ihm hochblicken. Sieht, wie sich das Gesicht der Frau – der Malgasi-Prinzessin – verärgert verzieht.
Und dann scheint ihn auch schon eine große unsichtbare Hand zu packen und festzuhalten. Er strampelt, aber vergebens. Er wird auf den Rücken geschleudert, und der rissige Marmor der Stufen beißt sich in sein Rückgrat. Während er verängstigt Richtung Himmel starrt, schiebt sich die Gestalt der Malgasi-Prinzessin in sein Sichtfeld. Ein grausames Lächeln verzerrt ihre raubtierhaften Züge.
»Sieh dir das mal an, Bagomer«, sagt sie. »Ein Mäuschen aus Castellan.«
Der Mann hinter ihr auf der Treppe grunzt wieder. »Werdet ihn los«, sagt er. »Bevor ihn jemand sieht.«
Metallisch schmeckendes Blut sammelt sich in Marcels Mund. Er versucht, sich auf die Ellbogen zu stützen, und krächzt: »Bitte, tut mir nicht weh. Bitte. Ich werde auch sofort von hier verschwinden. Und den Wächtern nichts sagen …«
»Nein, du wirst den Wächtern nichts sagen«, bestätigt die Prinzessin mit einem fast verträumten Blick.
Und im nächsten Moment sieht Marcel nur noch etwas, das auch eine Vision aus einem seiner Mohnsaftträume sein könnte – ein Bild voller Farben, Flammen und Gefahren.
Die fremde Prinzessin hält eine Hand hoch, mit der Handfläche nach vorn, und aus deren Mitte schießt ein Feuerstrahl: golden und rot und bronzefarben an den Rändern.
Magie, denkt Marcel überrascht, aber ihm bleibt kaum Zeit, deren Schönheit zu bewundern, bevor er zu Asche verglüht.
2
»Wie oft muss ich es dir noch sagen: Benutz die Kanten deiner Füße, nicht die Zehenspitzen«, rief Jerrod. »Du sollst klettern, nicht tanzen.«
Kel blickte nach unten, um Jerrod anzufunkeln, doch das sollte er augenblicklich bereuen, ihm wurde reichlich mulmig. Vor Beginn seines Klettertrainings – bei dem er lernte, sich wie ein Mitglied der Kletten an Wänden hinauf- und hinunterzuhangeln und dabei selbst die winzigsten Risse und Spalten zu nutzen – war ihm nicht bewusst gewesen, wie sehr ihn große Höhen beunruhigten.
Das Thema Höhenangst war nie richtig zur Sprache gekommen, bevor Jerrod in den Dienst des Lumpensammlerkönigs getreten war und angeboten hatte, den Mitgliedern seines derzeitigen Teams – Kel, Merren Asper und Kang Ji-An – seine Klettertechniken beizubringen.
Kel hatte als Einziger das Angebot angenommen, was nicht einer gewissen Ironie entbehrte. Auf den ersten Blick hatte er deutlich weniger Grund als seine Freunde, Jerrod Belmerci zu vertrauen, weil der ihn – damals noch in Diensten von Prosper Beck – in einer Gasse überfallen hatte. Inzwischen hatten sie ihre Differenzen größtenteils beigelegt, und stattdessen hatten Merren und Ji-An Jerrod die kalte Schulter gezeigt. Ihre Loyalität gegenüber Andreyen hatte absolute Priorität, und Beck war eine Bedrohung für den Lumpensammlerkönig gewesen, bis er Castellan abrupt den Rücken gekehrt und Jerrod arbeitslos zurückgelassen hatte.