
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clans von Cavallon
- Sprache: Deutsch
Epische Tierfantasy der Extraklasse: Die große Saga von Pferden und Menschen geht weiter! Alte Feindschaften und gefährliche Bündnisse entzweien die Clans von Cavallon mehr denn je - und das, obwohl Menschen, Einhörner, Pegasus, Kelpies und Zentauren einst in Frieden miteinander lebten. Die Konflikte in Cavallon interessieren Meermädchen Nixi jedoch herzlich wenig. Sie will nur eines: wieder ein Mensch werden. Und dafür ist sie sogar bereit, ihre Retter zu verraten! Auch der zweite Band der vierteiligen "Clans von Cavallon"-Reihe verspricht süchtig machenden Schmökerstoff zwischen Tier-Fantasy und Heldengeschichte. Mit spannenden Twists, großen Verschwörungen und gefährlichen Abenteuern mit Gruselfaktor. Von den Machern der "Warrior Cats" - für alle Tierfantasy-Leser ab 10. Die Bücher der Reihe "Clans von Cavallon": Band 1 "Clans von Cavallon - Der Zorn des Pegasus" Band 2 "Clans von Cavallon - Der Fluch des Ozeans" Weitere Bände sind in Vorbereitung. Die Clans von Cavallon Menschen wohnen im gebirgigen Norden von Cavallon und in der Freien Stadt. Dort ist der Rat von Cavallon angesiedelt, in dem alle fünf Clans repräsentiert sind. Menschen spezialisieren sich darauf, Werkzeuge und Schmuck herzustellen und damit zu handeln. In der Freien Stadt leben die Clans friedlich zusammen. Im Rest des Landes jedoch bestimmen teilweise noch immer uralte Feindschaften und Aberglaube das Leben der Menschen. Einhörner haben die Schwarzhornwälder im Osten Cavallons als ihr Territorium erkoren. Sie leben nach dem Recht des Stärkeren und sind geschickte Jäger und Krieger, die sich Menschen als Sklaven halten. Der Legende nach soll in früheren Zeiten einmal ein außergewöhnliches Band zwischen Menschen und Einhörnern bestanden haben, doch seit dem Krieg von Cavallon schürt diese Vorstellung unter Einhörnern große Angst. Den Pegasus wird für den Krieg von Cavallon die Schuld gegeben. Sie gelten als extrem selten und sind als rachsüchtige Kriegstreiber gefürchtet. Nach der Unterzeichnung des Friedenspakts zog sich die einzig verbliebene Pegasusherde ins Wolkengebirge im Nordosten des Landes zurück. Ihre Federn werden auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Pegasus sind äußerst misstrauisch allen anderen Clans gegenüber. Kelpies leben in der Kalten See im Nordwesten und sind vielerorts gefürchtet. Denn sie ziehen Menschen unter Wasser und töten sie - so heißt es. Tatsächlich sehen Wasserpferde mit ihren spitzen Zähnen und kräftigen Fischschwänzen gruselig aus. Sie jagen jedoch nur Fische und ernähren sich von Algen. Nach dem Friedenspakt haben sich die Kelpies in die Unterwasserhöhlen rund um die Festungsinsel zurückgezogen. Zentauren leben in Corlandia, im Süden von Cavallon an der Warmen See. Sie gelten als die Gelehrten von Cavallon und die übrigen Clans erweisen ihnen höchsten Respekt. Ihre Hauptstadt ist Coropolis, dort horten die zentaurischen Chronisten alles Wissen des Landes. Sie können als einziger Clan lesen und schreiben, Menschen arbeiten für sie als analphabetische Schreiblehrlinge. Doch die Zentauren haben einen grauenhaften Pakt geschlossen und hüten ein Geheimnis, das ganz Cavallon erschüttern wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kim Forester
Aus dem Englischen von Ulrike Köbele
Über dieses Buch
Epische Tierfantasy der Extraklasse: Die große Saga von Pferden und Menschen geht weiter!
Alte Feindschaften und gefährliche Bündnisse entzweien die Clans von Cavallon mehr denn je – und das, obwohl Menschen, Einhörner, Pegasus, Kelpies und Zentauren einst in Frieden miteinander lebten. Die Konflikte in Cavallon interessieren Meermädchen Nixi jedoch herzlich wenig. Sie will nur eines: wieder ein Mensch werden. Und dafür ist sie sogar bereit, ihre Retter zu verraten!
For Pasmé, who always looks out for me. –
Für Pasmé, die immer auf mich aufpasst.
Inhalt
Die Clans von Cavallon
Das erste Jahr der neuen Zeitrechnung
Einhundert Jahre später
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Lies, wie es weitergeht
Autorenvita
Die Clans von Cavallon
Menschen wohnen im gebirgigen Norden von Cavallon und in der Freien Stadt. Dort ist der Rat von Cavallon angesiedelt, in dem alle fünf Clans repräsentiert sind. Menschen spezialisieren sich darauf, Werkzeuge und Schmuck herzustellen und damit zu handeln. In der Freien Stadt leben die Clans friedlich zusammen. Im Rest des Landes jedoch bestimmen teilweise noch immer uralte Feindschaften und Aberglaube das Leben der Menschen.
Einhörner haben die Schwarzhornwälder im Osten Cavallons als ihr Territorium erkoren. Sie leben nach dem Recht des Stärkeren und sind geschickte Jäger und Krieger, die sich Menschen als Sklaven halten. Der Legende nach soll in früheren Zeiten einmal ein außergewöhnliches Band zwischen Menschen und Einhörnern bestanden haben, doch seit dem Krieg von Cavallon schürt diese Vorstellung unter Einhörnern große Angst.
Den Pegasus wird für den Krieg von Cavallon die Schuld gegeben. Sie gelten als extrem selten und sind als rachsüchtige Kriegstreiber gefürchtet. Nach der Unterzeichnung des Friedenspakts zog sich die einzig verbliebene Pegasusherde ins Wolkengebirge im Nordosten des Landes zurück. Ihre Federn werden auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Pegasus sind äußerst misstrauisch allen anderen Clans gegenüber.
Kelpies leben in der Kalten See im Nordwesten und sind vielerorts gefürchtet. Denn sie ziehen Menschen unter Wasser und töten sie – so heißt es. Tatsächlich sehen Wasserpferde mit ihren spitzen Zähnen und kräftigen Fischschwänzen gruselig aus. Sie jagen jedoch nur Fische und ernähren sich von Algen. Nach dem Friedenspakt haben sich die Kelpies in die Unterwasserhöhlen rund um die Festungsinsel zurückgezogen.
Zentauren leben in Corlandia im Süden von Cavallon an der Warmen See. Sie gelten als die Gelehrten von Cavallon und die übrigen Clans erweisen ihnen höchsten Respekt. Ihre Hauptstadt ist Coropolis, dort horten die zentaurischen Chronisten alles Wissen des Landes. Sie können als einziger Clan lesen und schreiben, Menschen arbeiten für sie als analphabetische Schreiblehrlinge. Doch die Zentauren haben einen grauenhaften Pakt geschlossen und hüten ein Geheimnis, das ganz Cavallon erschüttern wird …
Berüchtigte Magische Bücher der Beschwörung sollen laut Friedensabkommen vernichtet werden
Von Arosios Diomedes, Chronist
Das erste Jahr der neuen Zeitrechnung
In den Ruinen der ehrwürdigen Stadt Hufhalte versammelten sich die Anführer der fünf Clans von Cavallon, um das gemeinsame Friedensabkommen zu unterzeichnen und dem Krieg von Cavallon ein Ende zu setzen. Während dieses Treffens wurde auch beschlossen, die berüchtigten Magischen Bücher der Beschwörung zu vernichten. Die Bücher hatten bei der Zerstörung von Hufhalte eine bedeutende Rolle gespielt: Innerhalb kürzester Zeit und mit beispielloser Unerbittlichkeit war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Attacke gilt als verabscheuungswürdigster Angriff des gesamten Krieges und erschütterte ganz Cavallon.
Die Vernichtung der Bücher wird durch die Zentauren vollzogen. Deren Anführer, König Jaroth, verkündete im Rahmen der feierlichen Vertragsunterzeichnung, dass die Clans entschlossen sind, Hufhalte mit vereinten Kräften wieder aufzubauen. »Aus der Asche des Krieges erheben wir uns gemeinsam zu neuer Stärke!«, rief er der versammelten Menge zu, die seine Worte mit stürmischem Applaus quittierte.
General Nettleburn, der Repräsentant der Einhornclans, trat an der Seite von Godfrey, dem König der Menschen, aufs Podium, um demonstrativ das Ende der Feindseligkeiten zwischen ihren Völkern zu besiegeln. »Im Geiste der Hoffnung werden wir ein neues Hufhalte erbauen«, verkündete er. »Es soll den Namen ›Freie Stadt‹ tragen.«
König Godfrey ergänzte: »Ob Einhorn, Mensch, Kelpie, Zentaur oder Pegasus – dort sind alle willkommen!« Dieses Gefühl von Einigkeit und Zusammenhalt war unter den Zuschauern bereits spürbar, wo Angehörige aller Clans friedlich beisammenstanden.
Auch Halifer, die Anführerin der Kelpie-Gesandten, schloss sich den versöhnlichen Worten ihrer Vorredner an: »Wir müssen aufhören, uns zu entzweien, und lernen, als ein Volk zusammenzuleben. Dies wird uns die Freie Stadt ermöglichen.«
Einzig die letzte Rednerin, Caris, Erste ihrer Herde, die als Vertreterin der Pegasus an der Versammlung teilnahm, gab eine abweichende Erklärung ab. »Die Worte, die heute hier gesprochen wurden, sind von großer Schönheit«, sagte sie, »doch sie bringen eine Hoffnung zum Ausdruck, auf die sich meine Herde nicht länger verlassen kann. Immer wieder sind wir angegriffen worden, obwohl wir nie etwas anderes im Sinn hatten, als unseren Nächsten zu helfen. Wir hegen keinen Groll gegen die anderen Clans, aber wir können die Vergangenheit nicht einfach vergessen. Wir Pegasus – jedenfalls diejenigen von uns, die noch übrig sind – werden uns in die Berge zurückziehen. Das Einzige, worum wir Euch bitten, ist, dass Ihr uns fortan in Ruhe und Frieden leben lasst.«
Sobald Caris ihren Hufabdruck unter den Friedensvertrag gesetzt hatte, erhob sich die Abordnung der Pegasus in die Lüfte und verschwand.
Nachdem er seinerseits das Abkommen unterzeichnet hatte, wiederholte König Jaroth unter Zustimmung des Rats der Zentauren seinen Schwur, die Magischen Bücher zu vernichten. »Wir Zentauren werden unseren Pflichten gegenüber Cavallon stets nachkommen. Darauf geben wir Euch unser Ehrenwort.«
Kapitel 1
Nixi strampelte mit den schwimmhautbesetzten Füßen. Das Wasser strömte über ihre schuppige Meermenschenhaut, während sie tiefer und immer tiefer in den dunklen Unterwassertunnel hineinschwamm. Vielleicht war das ein Fehler, schließlich war sie vor diesem Teil der Kalten See, dem sogenannten Schlund, gewarnt worden. Er war so gefährlich, dass selbst die Kelpies ihn mieden. Aber ich bin ja nicht absichtlich hier reingeraten. Sie war von einer starken Strömung in die Tiefe gerissen worden und dieser Tunnel war möglicherweise ihr einziger Ausweg.
Um sie herum war es so dunkel, dass sie kaum etwas erkennen konnte, aber wenn sie mit den Fingern über die Felswände strich, fühlte sie tiefe Rillen darin. Kratzspuren … Jemand war gegen seinen Willen in diesen Tunnel verschleppt worden. Schaudernd zog sie ihre Hand zurück. Von wem stammen diese Spuren? Und durch wen – oder was – ist er hier runtergezerrt worden?
Trotzdem schien ihr dieser Weg die beste Möglichkeit zu sein, dem Schlund zu entkommen. Sie strampelte noch heftiger mit den Füßen. »Du schaffst das, Nixi«, feuerte sie sich knurrend an. »Du kannst sogar Fischgekröse in Perlen verwandeln – das ist deine Spezialität.« Sie hatte ein Händchen dafür, schlimme Situationen zu ihren Gunsten ausgehen zu lassen, seit sie im Alter von sieben Jahren zur Waise geworden war. Von einem Tag auf den anderen hatte sie lernen müssen, mit dem wenigen auszukommen, was sie auf der Festungsinsel ergaunern konnte. Andere wären vielleicht verhungert oder hätten irgendwann aufgegeben, aber nicht Nixi. Sie hatte sich so lange als Taschendiebin durchgeschlagen, bis sie zur Anführerin der berüchtigtsten Gang von Waisenkindern auf der Insel geworden war und Schwarzmarkthändler, Schiffskapitäne und Ganoven gleichermaßen sie respektierten – und das noch vor ihrem dreizehnten Geburtstag.
Und nun machte sie eben das Beste daraus, dass sie ertrunken und von den Kelpies als Meermensch ins Leben zurückgeholt worden war. Auch wenn sie sich insgeheim nichts mehr wünschte, als wieder ein Mensch zu sein.
Je weiter Nixi in den Tunnel vordrang, desto dunkler wurde es. Ohne ihre Meermenschenaugen, mit denen sie auch bei trübem Dämmerlicht noch bestens sehen konnte, wäre sie längst vollkommen blind gewesen. Doch selbst so war sie gezwungen, langsamer zu schwimmen und sich mit den Händen vorwärtszutasten, um nicht gegen die Wände zu stoßen. Ihre Fingerspitzen ertasteten weitere Kratzspuren, die hier noch tiefer und dichter nebeneinanderlagen. Als hätte derjenige, der sie verursacht hatte, noch verzweifelter versucht, sich zu befreien …
Ihre Kiemen begannen zu flattern, als sie eine Veränderung im Wasser wahrnahm. Es fing an zu blubbern und zu brodeln. Druckwellen trieben aus der Tiefe auf sie zu. Da kommt etwas!
Plötzlich wurde sie von Panik erfasst, die jedoch schnell einer Art Frust wich. Ihr einziger Ausweg war versperrt! Sie hatte keine Wahl. Sie wirbelte herum und schwamm, so schnell sie konnte, zurück zum Tunneleingang, während das Wasser um sie herum gegen die Wände gedrückt wurde. Was auch immer da hinter ihr war, es kam näher, immer näher …
Nixi schwamm hastig um eine Biegung und unterdrückte einen Aufschrei, als sie sich den Arm an der Felswand aufschrammte. Obwohl sie Angst hatte, wagte sie einen Blick zurück. Sie konnte schattenhafte Silhouetten hinter sich ausmachen, so viele, dass es wirkte, als sei der ganze Tunnel voll davon. Verzweifelt strampelte sie noch schneller mit den Beinen – bis sie endlich in halsbrecherischem Tempo aus dem Tunnel schoss. Nach der Finsternis erschien ihr das düstere Dämmerlicht in der Tiefe des Schlunds hell wie Sonnenschein. Sie bekam einen Felsvorsprung zu fassen und brachte sich dahinter in Deckung.
Gleich darauf kam eine Herde Kelpies in einem Schwall schäumenden, aufgewühlten Wassers aus dem Tunnel geprescht.
Das glaubte Nixi jedenfalls im ersten Moment. Doch während die Kreaturen am Grund des Schlunds ihre Kreise zogen, mit kräftigen Beinschlägen gegen die Strömung ankämpften und dabei ein durchdringendes Kreischen ausstießen, begriff sie, dass es sich um etwas anderes handeln musste. Nur was? Ein Schauer lief über ihre Schuppen. Etwas derart Entsetzliches hatte sie nie zuvor gesehen. Obwohl diese Kreaturen die gleichen langen Hälse und behuften Beine wie die Kelpies besaßen, ragten spitze Flossen aus ihren Rücken und aus ihren Flanken sprossen glitschige Tentakel.
Ihre fahlen Augen blitzten im Dämmerlicht auf, während sie sich mit ganzer Kraft gegen die Strömung warfen. Einige versuchten, mit ihren Mäulern Halt an den glatten Felswänden zu finden, und eine andere Kreatur bäumte sich mit den Hufen strampelnd auf. Doch die Strömung zwang sie unbarmherzig zurück in die Tiefe.
Mit einem flauen Gefühl im Magen klammerte Nixi sich an dem Felsvorsprung fest. Sie wollen nach oben!
Sie musste die Kelpies warnen.
Aber wie? Das ist deine Schuld, Simeon! Sie verfluchte ihren erbittertsten Feind, dessen Schiff sie mithilfe der Kelpies versenkt hatte. So hatten sie Nixis Gang gerettet, die von Simeon an Bord gefangen gehalten worden war. Simeon selbst war bei der Aktion ertrunken. Nixi hatte versucht, ihn zu retten, damit aber nur erreicht, dass sie jetzt hier unten mit diesen fürchterlichen Kreaturen festsaß …
Denk nach, spornte sie sich an, wobei sie in denselben knurrenden Tonfall verfiel, den sie gegenüber ihrer Gang angeschlagen hätte. Sie duldete keine Feigheit, weder von ihnen noch bei sich selbst.
Die Monster glauben offenbar, dass es einen Weg nach oben gibt. Ich muss also nur versuchen, diesen vor ihnen zu finden.
Vorsichtig tastete sie sich am Rand des Abgrunds entlang, sorgfältig darauf bedacht, immer im Dunkeln zu bleiben. Mehrmals wurde sie von einer Strömung erfasst und einmal wäre sie beinahe mitten zwischen die fürchterlichen Kreaturen gerissen worden, doch Nixi gelang es im letzten Moment, ihre krallenartigen Fingernägel in einen Spalt im Fels zu graben. Sie hielt sich mit aller Kraft fest, während die Strömung an ihr zerrte und Nixi schließlich auf den Kopf stellte. Dabei fiel ihr Blick auf eine schmale Öffnung in der Felswand, durch die kleine Luftblasen aufstiegen und zum oberen Ende des Schlunds trieben. Ein Weg nach oben!
Der Abstand zwischen Nixi und den aufsteigenden Luftblasen war ungefähr so groß, wie ein Fischerboot lang ist, aber um dorthin zu kommen, musste sie an zwei der monströsen Kreaturen vorbei, deren Tentakel wie Seetang im Wasser wogten.
Nixi dachte nicht lange nach. Sie stieß sich von der Felswand ab, schoss auf die Kreaturen zu und über sie hinweg und kämpfte sich in Richtung der Luftblasen vor. Ihre Muskeln schmerzten vor Anstrengung. Ein Tentakel streifte ihren Knöchel. Sie spürte, wie er nach ihr griff, doch sie wich mit einer geschickten Bewegung aus. Die beiden Monster hoben den Blick. Mit funkelnden Augen sahen sie zu, wie Nixi an ihnen vorbeischwamm. Ihr schrilles Wiehern erfüllte die unterseeische Schlucht und in Nixis Ohren fühlte es sich so an, als versuche jemand, ihre Trommelfelle mit einer Harpune zu durchbohren.
Dann hatte sie die Aufwärtsströmung erreicht. Luftblasen sprudelten um sie herum. Sie hustete und würgte, weil sie zwischen ihre Kiemen drangen. Die Strömung riss sie hinauf und wirbelte sie umher. Mehrmals schlug sie sich die Knie und Ellbogen an den immer enger werdenden Wänden des Schlunds an, während sie in rasantem Tempo aus der Dunkelheit ins Helle schoss.
An der Kante des Abgrunds angekommen, krallte sie sich fest und zog sich aus dem Strom der Luftblasen auf den Meeresgrund. Mit einem Purzelbaum landete sie in ruhigerem Gewässer. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, doch sie hatte keine Zeit, wieder zu Atem zu kommen. Eilig schwamm sie auf die Seegrasfelder und Korallengrotten der Kelpies zu.
Es war erstaunlich, wie schnell sie sich an den Anblick von Kelpies, die die Seegrasfelder bestellten oder Fische in die Netze der Menschen trieben, gewöhnt hatte. Noch vor wenigen Tagen hatte sie die für Monster gehalten und jetzt schnürte sich ihr bei dem Gedanken, dass die Kreaturen dort unten im Schlund sie angreifen könnten, die Kehle zu. Ja, die Kelpies hatten sie in ein schuppiges Ungeheuer verwandelt – aber sie hatten ihr auch geholfen, ihre Gang zu retten. Und nun musste sie die Kelpies retten …
Sie entdeckte Sorsha, die Kelpiestute, die sie am besten kannte, vor der Speiselagune, wo sie sich gerade mit einigen anderen ein Mahl aus Seetang und Shrimps einverleibte. Nixi kraulte auf sie zu.
»Da bist du ja!«, begrüßte Sorsha sie. Ihr violettes Maul funkelte im Licht. »Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen, weil du nicht zurückgekommen bist, nachdem …«
»Etwas ist auf dem Weg hierher!«, platzte Nixi heraus. Sie war so aufgeregt, dass sie gar nicht aufhören konnte, mit ihren Armen und Beinen zu rudern, obwohl das Wasser hier viel ruhiger war. »Monster aus dem Schlund. Sie können jeden Moment hier sein! Macht euch bereit, gegen sie zu kämpfen!«
Sorsha starrte sie mit großen Augen an. Nixis Herz setzte einen Schlag aus. Warum sollte Sorsha ihr glauben? Nixi war alles andere als begeistert gewesen, dass sie in einen Meermenschen verwandelt worden war, und war bisher nicht gerade nett zu ihr gewesen.
Dann stahl sich ein entschlossener Zug auf Sorshas Gesicht. »Wir müssen die anderen warnen! Schwimm du zu den Höhlen, ich übernehme die Felder. Sag allen, sie sollen sich vor der Großen Grotte versammeln.«
Erleichtert kraulte Nixi los. Die Kelpies in den Höhlen glaubten ihr jedoch nicht so bereitwillig wie Sorsha. »Aus dem Schlund?«, fragte ein älterer Hengst, dessen Mähne von silbernen Strähnen durchzogen war. »Da unten kommt niemand raus, nicht mal ein Monster.«
»Ich schon«, knurrte Nixi. »Und wenn ich das kann, dann können die es auch!« Zu guter Letzt gelang es ihr, sie doch noch zu überzeugen. Sie versammelten sich vor der Großen Grotte. Die Meermenschen hielten spitze Steine oder Waffen in den Händen, die sie aus Schiffswracks geborgen hatten, während neben ihnen die Kelpies mit ihren kräftigen Hufen und scharfen Zähnen in Stellung gingen.
Nixi kämpfte sich mit einem Speer nach vorne zu Sorsha durch.
»Sie sind fast da!«, rief Egeria. Die zierliche Kelpiestute mit der sanften Stimme stand erhobenen Hauptes an der Spitze der Gruppe. Ihre Mähne tanzte in der Strömung.
Tatsächlich – von den Rändern der Seegrasfelder her kam ein dunkler Schatten auf sie zu. Er schob eine Woge aus schäumender Gischt vor sich her, die von Hunderten Hufen kündete, die das Wasser in wildem Galopp aufwühlten. Unmengen von Seegras wurden aus dem sandigen Grund gerissen und flogen nur so in alle Richtungen davon, während der Schatten unaufhaltsam über die Felder preschte.
»Bleibt zusammen und gebt aufeinander acht!«, schrie Egeria.
Nixi rückte noch etwas näher an Sorsha heran. Ihre Kelpiefreundin richtete sich neben ihr auf die Hinterbeine auf, bereit, mit ihren kräftigen Hufen zuzutreten.
Doch dann änderte die Woge die Richtung. Eine starke Strömung ließ Nixi seitwärtstaumeln. Um sie herum wurden verwirrte Rufe laut, während Meermenschen und Kelpies gleichermaßen versuchten, nicht davongewirbelt zu werden.
Blinzelnd sah Nixi durch das aufgewühlte Wasser zu den Monstern hinüber. Sie schwammen nach oben! Ihre gruseligen Tentakel und gigantischen Rückenflossen warfen im Licht der Sonne seltsame, wogende Schatten auf den Meeresgrund.
»Sie wollen an die Oberfläche!«, schrie jemand.
»Aber warum?« Sorsha ließ die Hufe sinken.
Ein Kribbeln lief über Nixis Rückgrat, als sei sie in ein Feld aus Anemonen gefallen. »Sie haben es nicht auf uns abgesehen«, keuchte sie entsetzt. »Sie wollen zur Festungsinsel!«
Genau dorthin, wo meine Gang ist …
Kapitel 2
Mein Plan ist es, ganz Cavallon zu erobern«, sagte Dromego. »Und du wirst mir dabei helfen.« Er packte Sam an der Schulter und schob ihn durch die unterirdische Werkstatt.
»Hey!«, protestierte Sam. Er versuchte, sich loszureißen, aber Dromego hielt ihn eisern fest. In der weitläufigen Höhle loderten überall riesige Schmiedefeuer, an denen Menschen mit rußgeschwärzten Gesichtern schufteten. Das Scheppern von Metall, das Klirren der Hämmer und das Fauchen der Flammen dröhnten in Sams Ohren. Neben ihm lief der große und muskulöse Minotaurus, aus dessen Stierkopf spitze Hörner ragten. Auf Sams anderer Seite ging Dromego und trieb ihn unerbittlich vorwärts. Sam warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Was war Dromego? Ein Mensch? Ein weiteres Monster? Dem Äußeren nach schien er nicht viel älter zu sein als Sam selbst. Er war schlank und man hätte ihn durchaus als gut aussehend bezeichnen können, wären da nicht die gebogenen Hörner, die aus seinem hellbraunen Haar hervorragten.
Was will er von mir?, fragte sich Sam verzweifelt. Angst machte sich in ihm breit.
Irgendwo über ihm ertönte ein furchterregendes Kreischen. Sam verschlug es vor Schreck den Atem. Direkt unter der Höhlendecke hockten auf Felsvorsprüngen Dutzende pferdeähnliche Gestalten mit langen, schuppigen Hälsen und gewaltigen ledrigen Flügeln, die sie eng an ihre Körper angelegt hatten. Ihre Hinterbeine waren mit schweren Ketten an den Fels gebunden. Sam kannte den Grund dafür: Erst vor Kurzem hatte er miterlebt, wie gefährlich diese riesigen Kreaturen waren. Sie konnten sogar Feuer spucken. Er hatte sie aus nächster Nähe gesehen, als sie sein Zuhause, die Freie Stadt, in Schutt und Asche gelegt hatten. Eines der Ungeheuer streckte sich, schlug ein paar Mal mit den Flügeln und riss das Maul auf. Lange, messerscharfe Zähne blitzten darin auf.
Sams Angst wich einem überwältigenden Zorn. »Diese Monster!«, schrie er. »Sie haben meine Eltern getötet! Und du hast sie geschickt, oder? Du Mörder!«
In der Höhle wurde es still. Die Arbeiter hielten in der Bewegung inne und starrten ihn entsetzt an. Sams Wut verpuffte so schnell, wie sie in ihm hochgekocht war. Zurück blieb lähmende Angst. Warum hatte er nicht die Klappe gehalten?
Dromego zog eine Augenbraue hoch. »Ach herrje«, spottete er. »Da hat wohl jemand schlechte Laune.«
Der Minotaurus beugte sich vor, sodass sein breites, haariges Gesicht auf gleicher Höhe mit Sams war. Seine Augen waren schwarz und ausdruckslos. Er stieß ein Knurren aus und blies Sam einen Schwall heißen, stinkenden Atems ins Gesicht. Sam zitterte so heftig, dass er sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte. Oh, ihr Sterne … Er wich vor den scharfen Zähnen und spitzen Hörnern des Minotaurus zurück, die im Feuerschein funkelten, und kniff die Augen zu.
Lasst es wenigstens schnell vorbei sein …
Eine Weile verstrich, ohne dass etwas geschah: Keine Zähne bohrten sich in seinen Körper, keine Hörner spießten ihn auf. Schließlich öffnete Sam die Augen vorsichtig und stellte fest, dass sich der Minotaurus wieder aufgerichtet hatte. Dromego grinste gehässig.
»An die Arbeit«, befahl Dromego, machte eine knappe Handbewegung und wandte sich ab.
Sams Erleichterung währte nur kurz, denn der Minotaurus schubste ihn unsanft zu einem der Schmiedeöfen hinüber. Ein Grüppchen Menschen in schmutzigen, abgetragenen Tuniken blickte ihm wortlos entgegen. Neben dem gleichmäßig brennenden Feuer drehte sich ein großes hölzernes Rad, das den Blasebalg bediente, der den Flammen frische Luft zuführte. Es wurde von einem alten Einhorn in Bewegung gehalten, das in dem Rad langsam vor sich hin trottete. Flackernde Schatten tanzten über das matte grau-weiße Fell und die zottelige weiße Mähne des Einhorns. Die Spitze seines Horns war stumpf gefeilt worden.
»Zurück an die Arbeit!«, blaffte eine große Frau mit dunkler Haut und stechenden blauen Augen. Hastig nahmen die Menschen ihre Tätigkeiten wieder auf. Die Frau drückte Sam einen Hammer in die Hand und sagte kurz angebunden: »Stell lieber keine Fragen, Junge. Nur so hast du hier eine Chance. Und jetzt hör gut zu, denn ich erkläre es dir nur ein Mal. Ich heiße Moyra und habe in diesem Trupp das Kommando. Es ist mir egal, wo du herkommst, wie du hier gelandet bist oder ob du Angst hast. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und Angst haben hier alle.« Bei diesen Worten huschte ein schmerzvoller Ausdruck über ihr Gesicht. Sie fuhr sich durchs verfilzte Haar. »Wenn du überleben willst, folge meinen Befehlen, schmiede Rüstungen und halte deinen Mund. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass Dromego vergisst, dass du hier bist.«
Moyra beschrieb, wo die Werkzeuge aufbewahrt wurden, doch Sam hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Er war zu sehr damit beschäftigt, die anderen Arbeiter zu beobachten. Sie wirkten gehetzt, von panischer Angst getrieben. Manche zuckten jedes Mal zusammen, wenn Moyra Dromegos Namen aussprach. Einer von ihnen, ein dünner Mann mit fleckigem Gesicht, zitterte so sehr, dass er das windschiefe Rüstungsteil, auf das er einhämmerte, immer wieder fallen ließ.
Und schon wieder eine Schmiede, dachte Sam. Ihm war gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen zumute. Er war ja überhaupt erst hier unten gelandet, weil er versucht hatte, seinem Schicksal als Sklave in einer Einhornschmiede zu entkommen. Dort hatte er sich durch Helme und Kettenhemden von außergewöhnlicher Qualität und Leichtigkeit hervorgetan, was er vor allem der seltsamen Verbindung mit Tordred zu verdanken hatte.
Wo bist du?, fragte er seinen Freund in Gedanken.
Doch es kam keine Antwort.
Moyra hielt ihm eine schmutzige Schürze hin. Mit zitternden Fingern band er sie sich um. Nun, da seine Angst langsam nachließ, überkam ihn bleierne Leere. Ein trockenes Schluchzen drang aus seiner Kehle und er griff nach der Kette unter seiner Tunika, die er aus der Brosche seiner Mutter gemacht und mit einigen Haaren aus Tordreds Mähne befestigt hatte. Sie war das Letzte, was ihm von seinen Eltern geblieben war. Und vielleicht auch von Tordred.
»Sieh zu, dass es perfekt wird, Junge«, schloss Moyra ihren Vortrag und schubste ihn zum Amboss hinüber. Sam betrachtete den Hammer in seiner Hand – er war von überraschend hochwertiger Qualität, viel besser als die, die er in der Einhornschmiede benutzt hatte – und machte sich daran, das Rüstungsteil in Form zu bringen, das Moyra ihm vorgesetzt hatte. Zum Glück wussten seine Hände, was zu tun war, denn er war in Gedanken ganz bei Tordred und bekam kaum mit, was er da tat. Er musste zu ihm durchdringen, das musste doch irgendwie gehen …
Ich bin hier unten, rief er seinem Freund in Gedanken zu, unter den Bergen. Ich brauche deine Hilfe, Tordred!
Es kam keine Antwort.
Neben ihm lief das alte Einhorn in dem Holzrad unbeirrt Runde um Runde und Sams Hammerschläge fielen bald in den Rhythmus der Huftritte und des quietschenden Rades ein. Vielleicht würde ihn das beruhigen.
Hilf mir, Tordred. Vor Anstrengung rann Sam der Schweiß übers Gesicht, was durch die lodernde Hitze des Schmiedefeuers noch verstärkt wurde. Hilf mir. Hilf mir.
Immer noch kam keine Reaktion. Frustriert ließ Sam den Hammer auf die Metallplatte krachen. »Jetzt antworte mir doch endlich!«, murmelte er.
Das alte Einhorn blieb stehen und sah Sam durchdringend an. Sam bedachte es mit einem finsteren Blick und wandte sich dann wieder seiner Rüstung zu. Der Schlag eben hatte eine unschöne Delle darin hinterlassen, die er schleunigst ausbeulen musste.
Als Moyra ihre Truppe mit einem Pfiff zum Essen rief, waren Sams Kleider völlig durchnässt und aus seinen Haaren rann ihm der Schweiß in die Augen. Seine kupferfarbene Haut war mit einer dicken Rußschicht überzogen.
Moyra führte sie aus der riesigen Werkstatt in eine kleine, etwas kühlere Kammer, wo eine alte Frau jedem von ihnen ein Stück dunkles Brot und einen Brocken Fleisch reichte, dessen Ursprung nicht mal zu erahnen war. Sam ließ sich auf den nackten Boden plumpsen und lehnte sich gegen die Wand. Er hatte seit zwei Tagen nichts mehr gegessen und daher war es ihm ziemlich egal, dass das Fleisch im Licht der Fackeln grau und seltsam klumpig aussah. Bevor er sich irgendwelche Gedanken darüber machen konnte, um welche Art Fleisch es sich wohl handeln mochte, hatte er es bereits verschlungen. Das Brot war besser – höchstens ein paar Tage alt. Wahrscheinlich wäre es klug, sich ein Stück davon aufzuheben, damit er etwas zu essen hatte, falls ihm die Flucht gelang, doch sein Magen forderte lautstark die gesamte Ration ein, und zwar sofort. Sam zwang sich, jeden Bissen zwanzigmal zu kauen, bevor er ihn runterschluckte. Immerhin lenkte ihn das von seinen Gedanken an Tordred ab.
Das alte Einhorn ließ sich ächzend neben Sam nieder. Es aß seine Ration Brot und Fleisch auf, dann beugte es sich zu Sam hinüber und raunte ihm zu: »Du solltest vorsichtiger sein.« Da alle um sie herum ins Gespräch vertieft waren, hörte keiner der anderen Arbeiter seine Worte.
»Was meinst du?«, fragte Sam zwischen zwei Bissen.
»Ich kann erkennen«, erwiderte das Einhorn noch leiser, »dass es ein Band zwischen dir und einem Einhorn gibt.«
Sam erstarrte. Das alte Einhorn musterte ihn mit seinen großen schwarzen Augen.
Sam wusste nur zu gut, dass Einhörnern schon allein die Vorstellung eines Bandes zwischen Menschen und ihresgleichen zuwider war – schließlich hatten Tordred und er deswegen vor dem Eisenhornclan fliehen müssen.
Er würgte das restliche Stück Brot in einem Bissen runter. Im Licht der Fackeln blitzte die stumpfe Hornspitze des alten Einhorns auf. Konnte es ihn damit trotzdem noch durchbohren?
Doch das Einhorn zuckte bloß mit den Ohren. »Du solltest vorsichtiger sein«, wiederholte es. »Dromego darf auf keinen Fall davon erfahren. Wer weiß, was er daraus machen würde?«
Jetzt sah Sam das Einhorn zum ersten Mal richtig an. Er bemerkte die Narben unter seinem matten Fell. »Ich, äh … danke«, stotterte er. »Ich werde besser aufpassen.«
Das Einhorn blickte sich um. »Du solltest trotzdem weiter versuchen, Kontakt zu deinem Einhorn aufzunehmen«, raunte es. »Wir alle würden sofort von hier fliehen, wenn wir könnten.« Es stieß Sams Oberarm mit seinem Maul an, was ziemlich schmerzhaft war, aber unter Einhörnern vermutlich als höflich galt. »Ich heiße Wardock.«
Sam rieb sich den Arm. »Sam Quicksilver.«
»Gib nicht auf«, sagte Wardock.
Vermutlich hätte Sam froh sein sollen, dass er hier, an diesem entsetzlichen Ort, so etwas wie einen Freund gefunden hatte. Doch auch das konnte ihn nicht aufmuntern. Er hatte Tordred verloren, seine Freiheit – einfach alles.
Kapitel 3
Die Pegasus glitten gemeinsam durch die Lüfte. Aquilla schlug mit den Flügeln und genoss das Rauschen des Windes, während sie mit den anderen sechsundneunzig Mitgliedern ihrer Herde in Formation flog.
Nein, dachte sie voller Zuneigung. Siebenundneunzig.
Das siebenundneunzigste Mitglied saß auf ihrem Rücken, hielt sich an ihrer Mähne fest und stieß gelegentlich ein übermütiges Johlen aus: Jaren, ihr menschlicher Freund. Die anderen Pegasus bedachten ihn mit freundlichen Blicken. Er war jetzt einer von ihnen. Die Ältesten hatten ihn offiziell in ihre Herde aufgenommen, weil er ihnen geholfen hatte, das Heer von Zentauren, Einhörnern und Menschen zu besiegen, das zu ihnen in den Norden Cavallons gekommen war, um die Pegasus zu vernichten.
Nun verwandelten sie die Geschichte ihres Sieges in eine ihrer vielen Erzählungen, die die Pegasus von Generation zu Generation weitergaben – die Saga von der Schlacht in den Splittern. Die Stimmung war ausgelassen, was nach dem Erfolg nicht verwunderlich war. Aquilla hätte sich gerne mit ihnen gefreut, doch es gelang ihr nicht recht.
Nicht solange Aquoro nicht bei uns ist. Die Sorge um ihren Bruder saß Aquilla wie ein Stein im Huf und ließ ihr keine Ruhe. Was ihr am meisten zu schaffen machte, war die Tatsache, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte, wo er steckte. Er war einfach verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.
»Die Saga vom Krieg von Cavallon!«, rief Zadia, ein junges Fohlen mit weißen Flügeln, als die Saga von der Schlacht in den Splittern zu Ende war. »Papa, erzählst du sie uns?«
Ihr Vater – Baros, ein imposanter Pegasus mit gelbem Fell – stimmte die Geschichte an. Aquilla versuchte, ihre anhaltende Sorge beiseitezudrängen, und passte ihren Flügelschlag dem Rhythmus seiner tiefen Stimme an. Er erzählte von der Dürre und der Hungersnot und von den gewaltigen Anstrengungen, die die Pegasus auf sich genommen hatten, um den Rest Cavallons mit Wasser aus den Bergen zu versorgen – ein nobles Ansinnen, das letztlich jedoch zum Scheitern verurteilt war.
»Die saftigen grünen Landschaften verdorrten zu unfruchtbaren Einöden«, trug Baros vor. »Unter den anderen Clans brach ein Raunen los: Es hieß, die Pegasus behielten das Wasser ganz für sich. Bald kamen Gerüchte auf, dass die Pegasus die Sterne um diese Dürre gebeten hatten, weil sie die anderen Clans auslöschen wollten. Und so schickten sie eine Armee nach Norden.«
Die anderen Pegasus sprachen die Geschichte leise mit. Ihr Tonfall war jetzt ernst und gedrückt, wie es die traurigen Ereignisse verlangten. Auch Aquilla flüsterte die vertrauten Worte, die sie wie ihre eigenen Federn kannte.
Auf ihrem Rücken stieß Jaren ein abfälliges Grunzen aus. »Also, wir Menschen kennen die Geschichte anders«, raunte er und beugte sich vor, damit nur Aquilla ihn hören konnte. »Wir glauben, dass eine Entführung der Auslöser für den Krieg war. Die Pegasus haben doch einen Menschen verschleppt, oder nicht?«
Aquilla drehte den Kopf nach hinten und blickte ihn entrüstet an. »Eine Entführung? So etwas würden Pegasus nie tun.«
Jaren zuckte mit den Schultern. Seine zotteligen braunen Haare flatterten im Wind. »Das ist so lange her, das spielt doch jetzt auch keine Rolle mehr.«
Aquilla sah wieder nach vorne. Jaren musste sich irren. Seine Version der Geschichte konnte nicht stimmen, oder doch? Trotzdem fiel sie nicht wieder in den Singsang der anderen ein, als sie die Saga zu Ende erzählten.
Als Baros’ Stimme wie die Flügelschläge ihrer ins Exil vertriebenen Vorfahren im Wind verhallte, machte Zadia in der Luft einen Purzelbaum. »Noch mehr! Ich will noch eine Saga!«, rief sie und flatterte mit ihren kurzen Flügeln. Schwungvoll schloss sie zu Aquilla auf. »Erzählst du uns die Saga von dem Menschen, der zum Pegasus wurde? Bitte?«
»Dem Menschen, der was wurde?«, fragte Jaren.
Aquilla lachte. »Sie meint die Geschichte über dich, du Dussel.« Zu Zadia sagte sie: »Ich glaube, diese Saga braucht einen schöneren Namen. Jaren hat sich ja nicht verwandelt. Die Ältesten haben ihn in unsere Herde aufgenommen, weil in ihm das Herz eines Pegasus schlägt, und das schon immer.«
Zadia musterte Jaren nachdenklich. »Ja«, antwortete sie schließlich. »Das sehe ich.« Jaren lachte erfreut.
Aquilla holte tief Luft und sammelte ihre Gedanken. Sie hatte noch nie als Erste eine neue Saga erzählt – das war ein großes Ereignis im Leben eines Pegasus. Sie räusperte sich. »Dies ist die Saga von Jaren«, begann sie. Erleichtert stellte sie fest, dass ihre Stimme klar und fest klang. »Einem tapferen Menschenjungen aus einem kleinen Bergdorf, der sich auf die Suche nach dem Abenteuer machte.« Sie drehte sich zu Jaren um, dessen Augen vor Freude funkelten. »Er kletterte gerade einen steilen Berghang hinab, als ein fürchterlicher Sturm losbrach …«
Die anderen kamen dichter herangeflogen, um Aquilla zu lauschen, während sie beschrieb, wie sie und Jaren sich in der Berghöhle begegnet waren, wo sie beide vor dem Unwetter Schutz gesucht hatten. Zadia wiederholte jeden Satz mit großem Ernst und Aquilla stellte sich vor, wie die kleine Pegasusstute die Geschichte in einigen Jahren selbst an die jüngsten Fohlen der Herde weitergeben würde. Der Gedanke erfüllte sie mit Stolz.
Als Aquilla zu der Stelle kam, wo die Zentauren Jaren einsperrten, stieg die Angst, die sie ausgestanden hatte, plötzlich wieder in ihr hoch und ihr versagte die Stimme.
Jaren übernahm für sie. »Sie steckten mich – ich meine, Jaren – in eine winzige Zelle mit einem winzigen Fenster, das so weit oben war, dass er es nicht erreichen konnte. Er dachte, sein letztes Stündlein habe geschlagen, doch dann hörte er lautes Getöse und wisst ihr, was? Aquilla war gekommen, um mich zu retten! Ich meine, ihn.« Seine Worte klangen nicht ganz so feierlich, wie es für eine Saga üblich war, aber das hielt die anderen nicht davon ab, gebannt zuzuhören.
»Doch die Wachen der Zentauren führten Jaren fort«, erzählte Aquilla weiter, die ihre Fassung wiedergefunden hatte. Sie verwob ihre Geschichte geschickt mit der Saga von der Schlacht in den Splittern, wo Jaren das gegnerische Heer bewusst in die Irre geleitet hatte, sodass die Pegasus die feindlichen Clans besiegen konnten, indem sie erst eine Schneelawine und dann einen Felssturz auslösten. »Und auch der Felssturz, der den Pegasus den Sieg brachte, war Jarens Idee gewesen«, schloss Aquilla. »Als Zeichen ihrer Dankbarkeit und Wertschätzung machten die Pegasus ihn zu einem der ihren. Und so war Jaren der erste Mensch in der Geschichte Cavallons, der Teil einer Pegasusherde wurde.«
»Sehr schön erzählt, Aquilla. Und du auch, Jaren. Eine ausgezeichnete erste Saga«, lobte Odelia, eine Älteste mit goldenem Fell. Sie war den ganzen Tag vorneweg geflogen, hatte sich nun aber zurückfallen lassen, um Aquillas Erzählung zu lauschen.
Die anderen stimmten Odelia zu und Aquilla nahm ihre Glückwünsche mit einem dankbaren Nicken entgegen. Trotz aller Bescheidenheit konnte sie ihre Freude darüber nicht ganz verbergen. Sie blickte sich zu Jaren um – er grinste von einem Ohr zum anderen. Wir sind ein gutes Team, dachte sie.
Ein leises Wiehern lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder an die Spitze der Gruppe, wo Rostro, Erster der Herde, sich zu den anderen umgedreht hatte. Seine graue Mähne tanzte im Wind, während er kraftvoll mit den Flügeln schlug, um sich auf der Stelle zu halten. Die Herde scharte sich um ihn, damit ihn alle hören konnten.
»Unsere Suche nach einem neuen Nachtlager hat uns über weite Strecken und an viele Orte geführt«, sagte Rostro, »und doch haben wir nichts gefunden, was unseren Bedürfnissen entspricht. Ich fürchte, uns bleibt nur noch eine Option – die Flügelbruchspitze.«
Ein entsetztes Raunen ging durch die Herde. Die kleine Zadia vergaß vor Schreck, mit den Flügeln zu schlagen, und sackte einige Pegasuslängen in die Tiefe, bevor sie in einen Luftstrom geriet, der sie sanft wieder aufwärtstrug.
Stirnrunzelnd flog Odelia zu Rostro und flüsterte ihm etwas zu. Ihre flachsgoldene Mähne war vom Wind ganz zerzaust.
»Was ist so schlimm an der Flügelbruchspitze?«, fragte Jaren Aquilla mit gesenkter Stimme. »Abgesehen vom Namen, meine ich.« Aquilla musterte ihn über ihre Schulter hinweg. Bei allen Sternen, die Menschen wissen wirklich nichts über den Krieg von Cavallon.
»Dort haben unsere Vorfahren ihre Waffen niedergelegt«, erklärte sie. »Sobald das Friedensabkommen unterzeichnet war, sind sie dorthin geflogen, haben ihre Waffen auf dem Gipfel gelassen und geschworen, nie wieder in den Kampf zu ziehen.«
Jaren stieß ein leises Pfeifen aus. »Das heißt – die Waffen sind alle noch da?«
»Das nehme ich an.« Aquilla war noch nie auf der Flügelbruchspitze gewesen. Aber sie war natürlich auch erst dreizehn und damit viel zu jung, um das Ende des Krieges selbst erlebt zu haben. Rostro war der Einzige, der sich an den Krieg von Cavallon erinnern konnte. Die Sagas aus jener Zeit priesen ihn als einen der größten Kämpfer der Pegasus.
»Moment mal«, fragte Jaren. »Wie konnten die Pegasus die Waffen eigentlich benutzen? Oder sie überhaupt herstellen?« Er wedelte mit einer Hand. »Braucht man dafür nicht so was hier?«
Aquilla schnaubte. »Nicht für magische Waffen«, antwortete sie. »Obwohl du nicht ganz unrecht hast. Es waren tatsächlich Menschen, die sie hergestellt haben. Damals, als wir noch mit euch Handel getrieben haben.«
Rostro erhob die Stimme, die trotz seines hohen Alters laut und kräftig war, um gegen das Flüstern und Tuscheln anzukommen, das durch die Herde ging. »Ich denke, dass wir uns dort wohl am besten vor dem Rest von Cavallon verstecken können. Die Flügelbruchspitze ist so abgelegen, dass die anderen Clans nicht einmal wissen, dass sie existiert. Und selbst wenn sie es wüssten, hätten wir nichts zu befürchten, denn die Hänge sind so steil und tückisch, dass niemand sie erklimmen kann.«
»Aber was ist mit unserem Schwur?«, warf Odelia ein.
»Haben wir den nicht ohnehin schon gebrochen?«, erwiderte Baros. »In den Splittern haben wir schließlich auch gekämpft.«
»Das war nur zu unserer Verteidigung«, stellte Rostro klar. »Der Schwur ist noch immer gültig – nie wieder werden wir gegen Cavallons andere Clans in den Krieg ziehen. Wir werden die Waffen dort nicht anrühren.«
Aquilla spürte die Wirkung, die Rostros ruhige, besonnene Stimme auf die Herde hatte. Der Widerstand wurde schwächer und mehr und mehr waren bereit, sich den Vorschlag zumindest durch den Kopf gehen zu lassen. Doch auch, wenn Rostros Argumente durchaus schlüssig waren, wusste Aquilla, dass keinem in der Herde diese Entscheidung leichtfallen würde. Auf der Flügelbruchspitze würden sie mit schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit konfrontiert werden und einmal mehr wurde ihnen allen bewusst: Die Pegasus würden ihre Vergangenheit niemals hinter sich lassen können.
»Lassen wir die Herde darüber abstimmen«, meinte Odelia. »Sprich, Rostro, Erster der Herde, und teile uns deine Entscheidung mit. Sollen wir uns auf den Weg zur Flügelbruchspitze machen?«
»Ich stimme für Ja«, verkündete Rostro. »Sprich, Odelia, Zweite der Herde. Was sagst du?«
»Ja«, antwortete Odelia.
So gab einer nach dem anderen seine Stimme ab, vom Ältesten zum Jüngsten. Die ersten stimmten alle dafür. Zwischendurch kamen sie bei der Reihenfolge etwas durcheinander, die sich geändert hatte, seit drei von ihnen in der Schlacht in den Splittern ums Leben gekommen waren. Mit hängenden Köpfen nahmen die nachrückenden Pegasus die Plätze der Verstorbenen ein. Nachdem die Sechsundachtzigste der Herde ihre Entscheidung kundgetan hatte, ging die Reihe bei Nummer achtundachtzig weiter. Der Siebenundachtzigste wurde übersprungen – das war Aquoro, von dem immer noch jede Spur fehlte. Aquilla blinzelte ein paar Tränen weg.
Wenigstens war er nicht unter den Toten.
Soweit wir wissen.
Schließlich war sie als Dreiundneunzigste der Herde an der Reihe. »Ja«, sagte sie entschlossen. Sie war ebenfalls der Meinung, dass die Flügelbruchspitze ihre beste Chance war. Mit zitternder Stimme sprach sich schließlich auch Zadia, die Sechsundneunzigste und Jüngste der Herde, dafür aus. Als sie fertig war, sah Rostro sie erwartungsvoll an.
»Oh!«, piepste sie. »Sprich, Jaren, Siebenundneunzigster der Herde, und teile uns deine Entscheidung mit.«
»Ich? Echt?«, fragte Jaren.
Aquilla war genauso überrascht wie er, versuchte aber, es sich nicht anmerken zu lassen. Zwar hatten die Ältesten Jaren in die Herde aufgenommen, aber sie hätte nicht damit gerechnet, dass die auch für Abstimmungen galt. Offenbar ging es einigen anderen ebenso, wie die Unruhe bewies, die hier und da aufkam. Doch die Ältesten sahen Jaren weiterhin abwartend an.
Aquillas Herz schlug schneller. Die Herde konnte nichts unternehmen, wenn nicht alle einstimmig dafür waren. Dadurch besaß jede einzelne Stimme ein enormes Gewicht. Jaren war sich dessen jedoch genauso wenig bewusst wie der schrecklichen Geschichte der Flügelbruchspitze. Er wirkte einfach nur erfreut, dass er ebenfalls gefragt wurde. »Äh, also, dann sage ich wohl mal Ja, glaube ich«, stotterte er.
Aquilla und der Rest der Herde atmeten erleichtert auf.
Rostro nickte. »So sei es«, verkündete er. »Folgt mir. Obwohl es hundert Jahre her ist, kenne ich den Weg dorthin noch genau.«
Sie wandten sich nach Norden. Die Sonne ging bereits unter, als die Flügelbruchspitze vor ihnen am Horizont auftauchte. Der Name passte: Auf der einen Seite stieg der Berg gleichmäßig an, ging dann aber abrupt in eine Reihe scharf abfallender Felsspitzen über, wodurch er wie ein gebrochener Flügel aussah. Der Gipfel war vollkommen kahl und die paar Bäume, die weiter unten aus dem Hang ragten, hoben sich von dem blassgrauen Fels ab wie schwärende Wunden. Aquilla lief ein Schauder über den Rücken. Nun, da sie hier waren, hätte sie am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht.
»Ist wahrscheinlich zu spät, um es mir noch mal anders zu überlegen, oder?«, raunte Jaren.
Rostro führte sie über eine tiefe Spalte, die den Übergang vom sanften Berghang zur schroffen, zerfurchten Ödnis markierte. »Hier«, berichtete er, »haben wir damals unsere Waffen und Rüstungen abgeworfen. Schweif-Morgensterne, eiserne Hufglocken, Helme mit Speeraufsätzen und stachelbewehrte Flügelspitzen.«
Bedrückt kreisten sie über der Spalte, die von knorrigen Pflanzen und Gestrüpp überwuchert war. Es fiel schwer zu glauben, dass die Waffen immer noch dort unten lagen, denn durch das dichte Unkraut war nicht das geringste metallische Funkeln auszumachen. Aquilla war ganz froh darüber.
Die Herde ließ sich auf der zerklüfteten Seite des Berges nieder. Zwischen den kümmerlichen Bäumen würden sie zumindest ein wenig Schutz vor dem unbarmherzigen Wind finden, der über die Hänge fegte. Im grauen Licht der Abenddämmerung machten sie sich sogleich daran, ihr Nachtlager zu errichten. Einige gruben mit den Hufen Schlafkuhlen für die Fohlen in den Boden, andere suchten die Gegend nach geeigneten Höhlen ab und wieder andere gingen im spärlichen Wald auf Futterjagd. Aquilla wandte sich ab. Mit einem unguten Gefühl im Magen ließ sie den Blick über die Berge der Umgebung schweifen, die im Dämmerlicht blasslila schimmerten. Weit, weit dahinter lagen die Felder, Wälder und Städte von Cavallon.
Jaren rutschte von ihr runter und beugte sich vor, bis er mit den Fingern seine Zehenspitzen berührte, um seinen Rücken zu dehnen und zu strecken. Der kalte Wind ließ ihn schaudern und er zog fröstelnd die Schultern hoch. Dann drehte er sich zu ihr um. »Was ist los, Aquilla?«
Ihr Seufzer stieg als kleine Wolke in die Abendluft. »Ich hätte niemals herkommen dürfen«, antwortete sie. »Nicht ohne Aquoro. Er ist verschollen und ich stehe hier in der Gegend rum!«
Ihr aufgebrachter Tonfall alarmierte die Pegasus in ihrer Nähe. Sie hielten inne und hoben beunruhigt die Köpfe.
»Vielleicht solltest du dir trotzdem etwas Ruhe gönnen«, sagte Odelia sanft. »Wenigstens eine Nacht. Aquoro ist schon seit Tagen verschwunden. Vielleicht ist er schlicht …«
»Ich kann nicht«, unterbrach Aquilla sie. Ihr Blick wanderte zurück in Richtung Cavallon. »Er ist irgendwo da draußen und nach allem, was in den Splittern passiert ist … Wenn die Zentauren, Einhörner oder Menschen ihn finden, werden sie keine Gnade walten lassen.«
Die anderen sahen einander unsicher an. Aquilla hätte sich einfach auf den Weg machen können – es war ihre eigene Entscheidung und darüber musste nicht abgestimmt werden. Doch sie wollte, dass die sie verstanden.
»Ich helfe dir bei der Suche«, meldete sich Selela plötzlich zu Wort. Ihre Miene war traurig, aber entschlossen. Sie kannte das Gefühl, ein Familienmitglied zu verlieren, nur allzu gut. Auf ihren kastanienbraunen Flanken prangten immer noch die Streifen aus getrocknetem Schlamm, als Zeichen der Trauer um ihr kleines Fohlen, das vor nicht allzu langer Zeit von einem Adler gerissen worden war.
Durch Selelas Worte angespornt, boten weitere Pegasus ihre Unterstützung an. »Ich werde ebenfalls nach ihm Ausschau halten«, sagte Baros. »Du hast recht, Aquilla. Wir können ein Mitglied unserer Herde nicht einfach im Stich lassen.«
Aquilla wurde ganz warm ums Herz. »Danke«, antwortete sie mit belegter Stimme. »Ich denke … es wäre am besten, wenn ihr hier in den Bergen nach ihm sucht. Ich fliege nach Coropolis.«
Odelia schlug mit dem Schweif. »Das ist viel zu gefährlich!«, warnte sie. »Du kannst nicht dorthin zurück.«
»Als ich versucht habe, Jaren aus dem Gefängnis zu befreien, bin ich einem Mann begegnet, der mich für Aquoro gehalten hat«, erklärte Aquilla. »Er hat ihn eindeutig gesehen, denn er hat mir erzählt, dass Aquoro verschleppt worden ist. Und zwar von einem … Minotaurus.«
Ein überraschtes Raunen ging durch die Herde. Kein Wunder: Die Minotauren waren vor Hunderten von Jahren ausgestorben.
»Kann sein, dass der Mann den Verstand verloren hat«, räumte Aquilla ein, »und ich weiß, dass es ziemlich unwahrscheinlich klingt. Der Mann … ist inzwischen tot.« Sie blinzelte, als die Erinnerung, wie sein ausgemergelter Körper, von Zentaurenpfeilen durchbohrt, von ihrem Rücken fiel, wieder in ihr hochkam. »Aber vielleicht steckte in seinen Worten ja ein Körnchen Wahrheit.«
»Ich finde, dem sollten wir auf jeden Fall nachgehen«, meinte Jaren.
Aquilla sah ihn ungläubig an. »Du kommst mit?«
Er nickte. »Na klar. Was dachtest du denn?«
»Aber Jaren, du wurdest dort ins Gefängnis gesteckt. Was, wenn sie dich wiedererkennen?«
»Und ein riesiger Pegasus, der über ihren Köpfen herumflattert, wird ihnen nicht weiter auffallen, oder was?«, entgegnete er. Er schauderte. »Bei diesem Wind kriege ich fast schon Heimweh nach meiner Zelle. Da war es wenigstens warm.«
Aquilla prustete ihm zärtlich ins Haar. Mit Jaren an ihrer Seite erschien ihr Vorhaben mit einem Mal nicht mehr ganz so beängstigend.
»Mögen die Sterne über eure Reise wachen«, ertönte eine tiefe Stimme. Rostro war dazugekommen. Er nickte erst Aquilla und dann Jaren zu.
»Ihr solltet besser gleich aufbrechen«, riet Odelia nüchtern. »Nachts seid ihr schwerer zu entdecken.«
»Danke«, sagte Aquilla zu ihrer Herde. Mehr brachte sie nicht heraus, denn in ihrem Hals steckte plötzlich ein dicker Kloß. Aber bestimmt wussten die anderen, dass sie es aus ganzem Herzen meinte.
Jaren hielt sich an ihrer Mähne fest und schwang sich wieder auf ihren Rücken. Inzwischen fühlte sich das vollkommen natürlich an, als müsste es einfach so sein. Sie waren ein Team. Aquilla breitete die Flügel aus und stieg über die zerklüfteten Gipfel auf. Unter ihr wurden die Pegasus kleiner und kleiner.
Sie umkreiste den Berg einmal, um sich zu orientieren, und wandte sich dann Richtung Süden. Ich werde dich finden, Aquoro. Wo auch immer du bist.
Kapitel 4
Nixi hatte geglaubt, sie wüsste inzwischen, wozu ihr Meermenschenkörper imstande war, doch die Geschwindigkeit, mit der sie nun durchs Wasser schoss, übertraf alles, was sie bisher erlebt hatte. An ihrer Seite pflügten die anderen Meermenschen durch das von den Hufen der Kelpies aufgewühlte Wasser – den Ungeheuern hinterher, die der Festungsinsel immer näher kamen.
In dem Chaos verlor sie Sorshas blassgrüne Mähne bald aus den Augen. Sie fand sich neben Jenera wieder, einer Meerfrau, die ein paar Jahre älter war als sie. Jenera war ertrunken, als sie versucht hatte, von der Festungsinsel wegzukommen, daher war Nixi überrascht, dass sie jetzt so schnell auf die Oberfläche zuschwamm, wie sie nur konnte. Ihr offenes, seegrasartiges Haar trieb wie ein Schweif hinter ihr her. Vielleicht lebt auf der Insel jemand, der ihr immer noch wichtig ist.
Neben ihnen kämpfte sich auch Gryce nach oben, ein Meermann, den Nixi in der Speiselagune kennengelernt hatte, wo Meervolk und Kelpies ihre Mahlzeiten einnahmen. Er hatte einen kurzen, zerzausten Bart und einen entschlossenen Ausdruck im Gesicht. Nixi schätzte, dass er Anfang zwanzig gewesen sein musste, als er ertrunken war. Hat er auch jemanden auf der Insel? Eine Frau vielleicht oder ein Kind?
Nixi selbst wollte natürlich ihre Gang verteidigen: die pfiffige und gewitzte Sylvie, Rye, der gerne wie der Boss auftrat, es aber eigentlich nur gut meinte, Granit, Karah, Dewey, Linus und der kleine Tamin. Und Floss, die Nixi so sehr an ihre verstorbene Schwester Mari erinnerte. Wenn diese Monster ihnen irgendetwas antun …
Als Nixi bei den Docks der Festungsinsel an die Oberfläche schoss, hatten die Kreaturen bereits das Ufer erreicht. Ihre Tentakel schleiften über den sandigen Untergrund, doch das knirschende Geräusch wurde schon bald von ihrem markerschütternden Kreischen übertönt. Den Menschen auf den Docks stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Zwei Seemänner ließen die Obstkisten fallen, die sie gerade in ihr Boot laden wollten, und hielten sich die Ohren zu. Das Obst rollte über die Planken und brachte diejenigen, die zu fliehen versuchten, zu Fall. Die größte der Kreaturen ließ ihre riesigen Vorderhufe auf den Anleger krachen und zog sich mit einer geschmeidigen Bewegung hinauf. Sie stieß ein furchterregendes Heulen aus. Ihre Rückenflosse ragte bedrohlich in die Höhe.
»Die Kelpies greifen an!«, schrie ein Seemann. »Lauft!«
Nixi hielt auf den Steg zu. Hastig kletterte sie hinauf, während das Wasser von ihren Schuppen strömte und tropfte. Oben angekommen, beugte sie sich vor, um Jenera an Land zu helfen. Einige Kelpies sprangen leichtfüßig aus dem Meer und gingen auf eines der Ungeheuer los, das einen Seemann zu Boden gerissen hatte und gerade seine spitzen Zähne in dessen Schulter schlug. Nun erst erkannte Nixi, wie groß diese Monster waren: Es brauchte die vereinten Kräfte von sechs Kelpies, um die Kreatur von ihrer menschlichen Beute wegzuzerren.
Nixi, Jenera und Gryce stürzten sich ins Gefecht. Nixi stach mit ihrem Speer auf die Monster ein. Jedes Mal, wenn sie eines


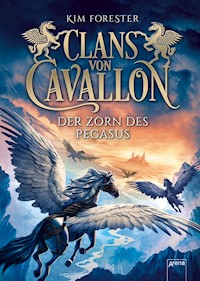














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











