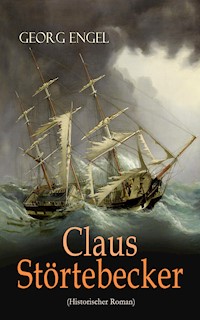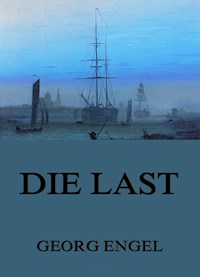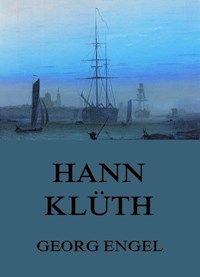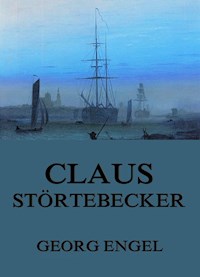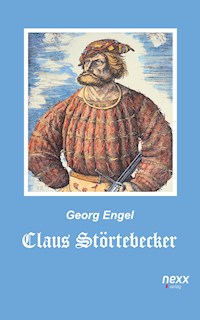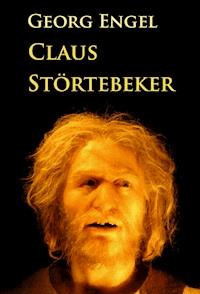
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Mach auf«, forderte draußen eine rauhe Stimme, und von neuem regte sich ein kurzes Rasseln. Schwerfällig und ohne sich weiter Rechenschaft darüber abzulegen, ob er klug oder vorsichtig handele, schob der Fischer den Querbalken zurück, und sofort schlug das Licht des Herdes nach draußen. Auf dem nassen, sturmgefegten Hügel standen zwei gepanzerte Knechte. Die führten zwischen sich ein verwirrtes, zitterndes Geschöpf, unentschieden ob Weib oder Mädchen, dessen kurze Röcke flatterten im Wind, und die nackten Füße sanken tief in den Sand. Ein blaues Tuch hatte das Wesen um den Kopf gewunden. Hinter ihnen, kaum noch erreicht vom roten Flackerschein, bemerkte der Bewohner der Hütte einen Zisterzienser, kenntlich an seinem grauen Gewand. Doch hatte der Mönch seine Kapuze weit über die Stirn gezogen, wie wenn er Schutz vor dem Unwetter suche, oder als ob er sein Antlitz verbergen möchte vor dem, was hier geschah ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Engel
Claus Störtebeker
idb
ISBN 9783962241513
Sinnspruch
Geschichten und Geschichte wachsen und wechseln im Entstehen
Das erste Buch
I
Sommerabend. – über die Buchenwipfel droben auf den Dünenhöhen fährt ein Rauschen. In langer Kette wälzt sich das bewegliche Gold der Sonne durch die aufgescheuchten Zweige. Und zwischen den grauen Stämmen steht blaß und aufrecht das Schweigen und starrt mit seinen unbeweglichen Zügen auf die tanzende See.
Das Meer aber spricht. Seine Augen sind bald tiefblau, bald purpurn, und wild blitzen sie, wenn das Element herüberruft zu den Kreidefelsen, die sich dicht unter die Wälder schmiegen wie ein weißes Knie unter ein grünes Gewand.
Was das Meer ruft, das versteht niemand. Denn nur selten horcht ein menschliches Ohr in den Wind, obwohl es manchmal von dort klingt, als donnere von draußen eine Forderung herüber oder ein vergessener Schrei aus fernen Zeiten. Doch zu deuten vermag man die Sprache des Wassers nicht. Und dann liegt der ungeheure Spiegel wieder still. Das Abbild des einzelnen strahlt er niemals wider, so tief man sich auch beugt, aber die Bewegungen des Himmels malt er ab, der goldne und der silberne Wagen rollen über seine Scheibe, die Zeiten huschen über ihn hinweg, und ein Kranz von Völkern faßt ihn ein.
Sommerabend.
Und in der Rüste des Tages, gerade als der purpurne Ball sich im Wasser kühlt, da steigt eine andächtige Stunde herauf. Da stockt der Tanz der Zeiten über dem Meer, der Zug der Völker wallt deutlicher, und die Vergangenheit schickt vom Rande des Horizontes ihr Schattenschiff an die Gestade der Lebendigen.
Ich stehe am Ufer und sehe die Scharen aus dem Fahrzeug an mir vorüberquillen. Sie tragen meine Züge, sie reden meine Sprache, es sind Menschen, die nicht tot sind, denn der Mensch stirbt nicht auf Erden, weil sein Geschick dauert. Unvermutet bin ich selbst in den Segler der Schatten gestiegen, und ich fühle, wie ich zurückgleite in den Nebel der Jahrhunderte. Oder vorwärts?
Von den Küsten der Vergangenheit zu den Gestaden der Gegenwart schwimmt das Schiff unaufhörlich hin und wider. Es trägt, was lebend ist von den Toten, und trägt das Tote fort zu den Gewesenen. Und dann gelangt es an einen Strich, wo man die Stimmen von beiden Küsten unterscheidet, wo sie sich mischen und ergänzen.
Horcht! Laßt uns lauschen!
Dort, wo jetzt Saßnitz seine terrassenförmig ansteigenden weißen Villen über der Ostbucht von Rügen erhebt, da träumte zum Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts tiefe Ruhe in den waldgekrönten Schluchten. Eine Ansiedlung gab es noch nicht, und der Küstenstrich führte nach der Ansicht grüblerischer Zisterziensermönche aus dem nahen Kloster nur deshalb seinen Namen, weil Graf Harro von Cona ein paar seiner »Sassen«, die man auch Leibeigne nennen konnte, dort in eine elende Bretterhütte behaust hatte, damit sie ihm von nun an fleißig den seltenen Seelachs fingen. Einen Lohn erhielten die unfreien Fischer dafür nicht, sie durften sich den Zehnten ihres Fangs behalten, das übrige aber mußten sie mit einem Strandvogt abrechnen, der mit Zahlen und Peitsche wohl umzugehen wußte. Eine besondere Vergünstigung bestand darin, daß es den Sassen vergönnt war, auch am Sonntag zu fischen. Allein die Beute war des Klosters, denn Graf Harro galt als ein frommer Mann und legte Wert darauf, seinen Lachs häufig in Gesellschaft des Abtes zu verspeisen. Wenn dann der geistliche Herr hie und da an den Hof des Herzogs von Wolgast ritt, dann ließ der Gottesmann wohl auch unauffällig etwas von den Wünschen des Conaer Grafen fallen, und so bezahlte sich der Lachs, und die armen Fischer arbeiteten heimlich und ohne daß sie es ahnten, an der Größe ihres Herrn mit. Freilich, sonder Bewußtsein. Denn in der gebrechlichen Hütte lebte man dahin ohne Kenntnis von den Dingen der Welt. Man stand auf, fuhr aufs Meer und warf sich abends auf die Schilfstreu, gleich einem Werkzeug, das nach dem Gebrauch wieder in die Ecke gestellt wird. Das gleichmäßige Schwelgen aber, das sich die Bewohner der Hütte einander vererbten, es schrieb sich dennoch her von einem Ereignis, vor dem die Sassen eben auf Zeiten hinaus verstummt waren. Etwa um 1366 hatte es sich zugetragen.
Der Platz in der Hütte war durch Todesfall wieder einmal erledigt. Da wurde in den Bretterbau ein Sasse gesetzt namens Claus Beckera. Als der Vogt ihn hineinführte, da lachte der gräfliche Beamte und meinte: »Nimm dich in acht, Claus, daß du das Querhölzlein nicht schädigst.« Und diese Warnung galt mit Recht, denn der neue Bewohner mußte sich tief bücken, bevor er die Schwelle überschritt. Zu riesenhaft ragte er an Wuchs und Gliedern, und ein langer fuchsroter Wirrbart hing ihm bis auf den Leib. Wer ihn nicht genauer kannte, der mochte ihn infolge der Haarwildnis für einen gereiften Mann schätzen. Er zählte aber erst fünfundzwanzig Jahre und war ein harmloser, gutmütiger Bursche, kundig des Legens und Knüpfens der Netze, und ein Meister mit der Axt. Bald fing er auch an, allerlei Gerät damit zu schaffen. Er baute einen hölzernen Stall für ein paar Ziegen, er wölbte über dem offenen Ziegelherd einen Rauchfang mit einem Abzug, ja eines Tages begann er sogar die lehmige Erde zu bahnen und legte Dielen. Alles, als wenn er geahnt hätte, was ihm bevorstand. So war der Herbst hereingebrochen. Durch die Wälder der Höhen wogte es, ein Knarren und Ächzen klagte um die Hütte auf ihrem einsamen Hügel, und die Seegräser auf dem gelben Sand pfiffen und schwirrten, als ob die Sichel auf einem Stein geschliffen würde. Unten stürzten die Schäumer schmetternd gegen die gewaltigen Steine, jedoch Claus Beckera merkte nichts von diesem ewigen Streit, denn eine finstere Nacht wölbte sich über der Leere, und er selbst hockte geruhsam in seinem breiten Armstuhl, den er erst vor kurzem aus rohem Eichenholz gezimmert, und beim Schein eines qualmenden Buchenfeuers auf dem Herd rieb er eifrig an einem eisernen Widerhaken, wie er zum Aalstechen benutzt wurde. Sein roter Bart glänzte gleich einer feurigen Welle. Dazu grölte er ein uraltes Schleiferlied:
»Wetze gut. Dann schnett se gut – Der Claus, der ist der Sigrun gut.«
Zwar besaß er keinerlei Beziehung zu solch einem Menschenkind, kannte wohl auch kaum die Trägerin eines derartigen Namens, doch der schärfenden Wirkung des Liedes tat dies keinen Abbruch.
Das Buchenfeuer puffte, und der Riese rieb mit seinem Stein immer emsiger über das Eisen, bis blaue Funken unter seinen Händen hervorspritzten.
Da wurde mit klirrender Faust an die Tür geschlagen, zwei-, dreimal, das leichte Holz zitterte, und in der Hütte dröhnte es wider.
»Sachte«, murmelte Claus, der vor Verwunderung aus seiner gebückten Stellung nicht emporfinden konnte. »Wie? Was? Ein Mensch?« Er versuchte sich zu sammeln und schüttelte in dumpfem Erstaunen den gewaltigen Haarbusch; so was stellte sich hier doch nur selten ein.
»Mach auf«, forderte draußen eine rauhe Stimme, und von neuem regte sich ein kurzes Rasseln.
Schwerfällig und ohne sich weiter Rechenschaft darüber abzulegen, ob er klug oder vorsichtig handele, schob der Fischer den Querbalken zurück, und sofort schlug das Licht des Herdes nach draußen. Auf dem nassen, sturmgefegten Hügel standen zwei gepanzerte Knechte. Die führten zwischen sich ein verwirrtes, zitterndes Geschöpf, unentschieden ob Weib oder Mädchen, dessen kurze Röcke flatterten im Wind, und die nackten Füße sanken tief in den Sand. Ein blaues Tuch hatte das Wesen um den Kopf gewunden. Hinter ihnen, kaum noch erreicht vom roten Flackerschein, bemerkte der Bewohner der Hütte einen Zisterzienser, kenntlich an seinem grauen Gewand. Doch hatte der Mönch seine Kapuze weit über die Stirn gezogen, wie wenn er Schutz vor dem Unwetter suche, oder als ob er sein Antlitz verbergen möchte vor dem, was hier geschah.
Inzwischen war der älteste der Eisenbewehrten über die Schwelle getreten. Dann zeigte er auf die zwei eingestickten blauen Kugeln seines Mantels.
»Kennst du die?« fragte er kurz und bedeutsam.
Ratlos nickte der Fischer. Er starrte noch immer von einem zum anderen, betroffen ob des unerklärlichen Aufzugs. »Wohl«, rang er sich endlich ab, »ihr seid des Grafen.«
»Und der Graf«, berichtete der Knecht scharf und schob sich die Sturmhaube aus der Stirn, damit ihn der andere besser verstehen möchte, »läßt dir sagen – – «
»Läßt mir sagen?« echote der Fischer und fing an mit schwerer Zunge zu stammeln, weil des Unmöglichen immer mehr wurde.
»Läßt dir sagen«, vollendete der Gewappnete finster, während er den Schaft seiner Lanze auf die neue Diele stieß, »dies sei dein Weib.«
»Dies sei – – «
»Dein Weib.«
Eine schwere Weile regte sich nichts zwischen den Menschen in der Hütte. Man hörte nur die keuchenden Atemzüge des Fischers und das Bersten der brennenden Buchenklötze. Einzig die hellblauen Augen lebten in dem versteinten Gesicht des Sassen; die wanderten hilfeflehend und ohne eine Spur von Verständnis von den Knechten zu dem zerzausten Mädchen, das ebenfalls mit vorgebeugtem Leib und gefalteten Händen zu lauschen schien, bis sich der Rücken des Riesen allmählich neigte, als ob man ihm einen Baumstamm auf den Nacken geladen.
Plötzlich aber schnellte er empor. Das Blut schoß ihm in die erblaßten Wangen, und die Rechte tastete nervig nach der Axt neben dem Herde. Jetzt hätte vielleicht eine schnelle Gewalttat alles entschieden. Doch ehe noch der schwere Holzstiel emporzutaumeln vermochte, da drängte sich hinter den Knechten die graue Gestalt des Mönches in den Kreis der Hadernden, und eine jugendlich schmerzerfüllte Stimme rief:
»Füge nicht zum Leid noch die Sünde!«
So ernst und mitleidsvoll klang die Mahnung, daß der leidenschaftgeschüttelte Riese einhielt. Die Axt entsank ihm, und mit beiden Händen und wankend griff er nach seiner Brust, denn eine Lanzenspitze hatte das dünne Hemd bereits durchschnitten und suchte dort bedrohlich Eingang. Dazu schrie der gepanzerte Knecht: »Wenn du leben willst, sei vernünftig.«
»Vernünftig – vernünftig«, gellte es dem Überwundenen zwischen die irren, durcheinandergehetzten Sinne. Er wußte nicht, sollte er lachen oder brüllen. War dies nicht Tollheit? Kehrte sich nicht alles Unterste nach oben? Schaukelte seine Hütte nicht auf der tobenden See, ohne daß er den Ausgang fand? Oder hatte man ihm vielleicht gar die Zunge herausgeschnitten und verlangte trotzdem, er solle sprechen? Wer half? Wer half?
In letzter Not blieben seine Blicke an dem jungen, hereingeschleppten Mädchen haften. Warum? Weil man der Fremden wohl anmerkte, daß sie scheu, zitternd und wider ihren Wunsch hier stand, und dann, weil die Dirne, die man mit ihren nackten Füßen gewiß von weit her bis zu ihm getrieben, gleichfalls ein Sassenkind war wie er, und deshalb gewohnt, nicht nach eigenem Willen zu schalten.
Heftig trat er auf sie zu und besah sie. Vor seinem mächtigen Schritt erschrak das Wesen, und in ihre braunen Augen trat ein offenes Flimmern der Angst.
»Was ist mit dir?« herrschte er und ahnte nicht, wie sehr sie sich vor seinen riesigen Armen fürchtete und vor den Haarbüscheln unter seinem Kinn. Sie kannte, was ein grimmiger Mann vermag. Dann aber faltete sie die Hände vor der Brust und sagte sanft und in ihr Schicksal ergeben:
»Mir geht es schlimm.«
Nichts weiter, allein die wenigen Worte fanden den Weg zum Verständnis des Riesen. Erstaunt wich er zurück, und tief aus seinem Innern quoll zum erstenmal ein Bewußtsein seines Standes und seiner Lage hervor. »So geht es uns allen«, murmelte er beinahe betroffen über die neue Erkenntnis, »dazu sind wir geboren.« »Genug Geschwätz«, unterbrach hier der gräfliche Knecht ungeduldig und schaute sich hastig nach dem jungen Zisterzienser um, der allem, was sich in der Hütte begab, mit gesenktem Haupt gelauscht hatte, »wir haben noch einen weiten Weg. Beeilt Euch.«
Da sandte Claus Beckera einen letzten sehnsüchtigen Blick nach dem Ausgang der Hütte. Als er sich jedoch davon überzeugte, daß sich die Lanzenspitzen von neuem drohend gegen ihn richteten und wie zu gleicher Zeit über den Leib der Magd ein ihm unbegreifliches, ja widerwärtiges Beben lief, da entschloß er sich, vor allem sein Leben zu retten, sein nacktes Leben, das einzige kostbare Geschenk seines Gottes!
So griff er denn gewaltsam nach der Hand des Weibes, so daß es taumelnd an seine Seite gerissen wurde, und in rohem Ausbruch entlud sich endlich seine Wut in vollem Hohn:
»Munter – munter, ihr eisernen Wichte, ihr Schnapphähne –, da ich mich doch gegen mein Unheil nicht wehren kann, so macht die Schandhochzeit wenigstens kurz.«
Erregt trat der Mönch hinter die sinkenden Spieße. Die spielenden Feuer huschten über sein zuckendes Antlitz. Er malte das Zeichen des Kreuzes in die Luft und sprach mit zitternder Stimme:
»Mühsal ist das Leben, Duldung das Gebot, Seligkeit das Scheiden. Wandelt in Frieden.«
Das Weib jedoch hörte auf nichts. Es sah starr in die Flammen des Herdes, die es fortan schüren sollte.
Mühselig kroch seitdem die Zeit dahin. Ein Tag sank arbeitsgebrochen und müde zum anderen, und in der Hütte richtete sich das Schweigen ein. Es wohnte dort und ließ sich aus dem engen Raum nicht mehr vertreiben. Ja, wenn die junge Frau selbstvergessen einmal versuchte, einen hellen Singsang aufzuschlagen, dann traf sie aus den vergrübelten Augen des Fischers ein seltsam drohender Blick, und sofort brach die Fröhlichkeit ab, und die zur Stille Verwiesene schaffte erschreckt und niedergeschlagen an ihrem Tagwerk weiter. Sie wußte recht gut, der mürrische Geselle grollte mit ihr, weil man ihm die unwillkommene Dirne aufgedrungen. Und das fand sie auch ganz in Ordnung. Aber manchmal strich sie doch an ihren weißen Armen herunter, und ein natürliches Staunen befiel sie, weil der Riese, der so dicht neben ihr lebte, so gar keinen Gefallen an ihr finden wollte. Warum? Was ihr früher widerfahren, ein solches Erlebnis fand sie nicht ungewöhnlich. Darein mußten sich die Dienenden einmal schicken. Vielen Mägden auf den Höfen der Mächtigen erging es so. Und seit sie den geschützten Unterschlupf gefunden, glaubte sie mit dem sicheren Bewußtsein eines starken Menschen, daß es keinen Zweck hätte, noch fürder an der Vergangenheit zu zerren. Claus Beckera war eben ein ungefüger, störrischer Klotz, dem man es nicht leicht recht machen konnte. »Aber warte nur«, dachte sie mit weiblichem Trotz, »auch große Mäuse fängt die Katz.«
Dabei entstand unter ihren flinken und noch merkwürdig zarten Händen allerlei Brauchbares und Nützliches, was bis dahin dem rohen Bretterbau gemangelt. Sooft Claus von der Seefahrt heimkehrte, entdeckte er stets irgendein neues Stück des Hausrats, ein frisches Linnenhemd, eine geflochtene Strohmatte oder gar ein festgefügtes Bettgestell für den Eheherrn, alles Dinge, die wie durch Zauber über Nacht an Stelle von etwas Altem und Verbrauchtem in der Hütte gewachsen waren. Natürlich bemerkte der Riese all diese wohnlichen Veränderungen sofort und sonder Hinweis, allein gleichmütig und ohne Dank nahm er sie hin, warf sich auf den neuen, linnenbesponnenen Strohsack und ließ seine Gefährtin nach wie vor auf der Schilfstreu in der Ecke liegen. Aber Hilda, so hieß das junge, verschleppte Geschöpf, verlangte nichts anderes. Ja, es galt ihr ganz natürlich, daß der Fischer nicht einmal ihren Namen zu kennen schien. Denn bei den kurzen Wünschen, die er selten an sie richtete, nannte er sie »Weib« oder »Fru«. Und darauf gehorchte Hilda und sprang zu ihm wie ein folgsamer Hund. Doch allmählich wurden ihre Bewegungen langsamer. Auch darum kümmerte sich Claus nicht, nur wunderte er sich zuweilen, wenn er das braun bezopfte Weib jetzt öfter ruhend an der Fensterluke lehnend fand, von wo es dann mit einem unverständlichen Lächeln und mit großen erwartenden Augen auf den sonnenblitzenden Eisrand der See hinabstarrte.
Claus begriff das nicht, ärgerte sich auch über die ungewohnte Versäumnis, und als er sie wieder einmal feiernd vor ihrem Ausguck antraf, da fuhr es grob aus ihm heraus, während er die großen Lederstiefel krachend in eine Ecke schleuderte: »Was tust du?«
Sie wurde blutrot, sendete ihm einen halb listigen, halb demütigen Blick zu und stotterte, langsam zum Herd zurückschleichend: »Ich sinne.«
Leicht hätte sie auch äußern können »ich träume«, denn ihre Gedanken waren jung und wanderlustig und ließen sich in den Verschlag des Schweigens nicht ebenso willig bannen wie ihr Leib. In solchen Stunden erblickte das suchende Weib die dunkle See dort draußen gleich einem gebahnten Tanzplatz. Und sie sah sich selbst dort unten mit seidengeschmückten Männern herumspringen, die sie herzten, um ihr dann goldene Schaumünzen um den Hals zu hängen. Fegte aber schließlich ein rauhes Wort ihres Gefährten all den Glanz auseinander, dann seufzte sie tief auf und bemitleidete heimlich den störrischen Gesellen, weil er für das seine, verborgene Spiel keinen Sinn besaß.
Und doch – auch dieser Weg ins Freie sollte der Beladenen eines Tages gestört werden. Frühlingsstürme pfiffen über die Dünen, Hilda stand in der offenen Tür und sog gierig das warme Wehen ein, das einen unbestimmten Duft von Veilchen und Tannenharz mit sich führte. Hoch oben am Waldesrand traten die jungen Rehe heraus und äugten über die funkelnde See.
Da stieg unten vom Strand ein einzelner Mann den gewundenen Fußpfad herauf. Hilda beugte sich spähend vor. Der Ankömmling trug ein weites blaues Wams und derbe Holzschuhe. Im ledernen Gürtel steckte ihm eine kurze geflochtene Peitsche, und seine Faust stützte sich klammernd an einen mannshohen Stab, dessen Spitze in eine kleine silberne Krone auslief. Das war der Strandvogt, eine untersetzte Gestalt mit grauer Schifferkrause und scharfen umfalteten Augen. Wie er sich jetzt schweren, knirschenden Schrittes emporwand, mußte man wohl erkennen, daß sich der Mann für einen Mächtigen hielt, dessen Faust das kleine zerstreute Leben hier am Strand behüten oder auch zertrümmern konnte.
Jetzt stand er vor dem jungen Weibe, doch bevor er zu reden anhob, kniff er erst beobachtend das linke Auge zu. Im Grunde genommen wußte er bereits, was er zu erkunden strebte.
»Gott zum Gruß«, begann er und wies mit seinem Stab gegen das Dach der Hütte, »die Sparren gegen die Windseite müssen gedoppelt werden. Vergiß das nicht.« Sein einziges offenes Auge lief geschäftig weiter. »Sieh da – auch ein Ziegenstall. Wieviel sind drin?«
»Drei«, erwiderte Hilda mit sich kämpfend, denn sie war sich des Unrechts bewußt.
»Um eines zuviel«, tadelte der Vogt, das Haupt mit der Lederkappe bedächtig wiegend. »Nun, man wird Nachsicht haben. Man gönnt dir das gute Fortkommen.« Bedeutsam strich er sich über den grau geringelten Bart und trat gewichtig näher. Augenscheinlich gelangte er erst jetzt zu seiner besonderen Absicht. »Wo ist Claus Beckera?«
»Auf See«, versetzte Hilda zögernd, wobei sie den Atem anhielt.
»Ich weiß«, bestätigte der Strandvogt. Vorsichtig blickte er sich um, als ob er einen Lauscher fürchte, dann beugte er sich ganz nahe an die Erblaßte heran. »Wann erwartest du deine Stunde?« forschte er ernst und dringend. Und als das Weib ihn finster anstarrte und in die Hütte zurückwich, um allerlei Abgebrochenes und Verwirrtes zu murmeln, da bedrängte er die Widerspenstige nicht weiter. »Es ist gut«, meinte er sich aufrichtend und knöpfte an der großen Ledertasche unter seinem Gürtel herum. »Nun hadere nicht, Dirn, man will dir nicht übel. Sieh her« – er langte in die Tasche und wog den Inhalt dann auf der flachen Hand –, »dessen zum Zeichen soll ich dir etwas zahlen. Es ist nicht wenig. Vier Silbergulden.«
»Silber?« schrie Hilda, die aus ihrer fernen Ecke hervorstürzte, und ein warmer Triumph lebte in ihrer Stimme. »Jetzt wird sich Claus freuen.«
Da legte der Vogt die vier Silberlinge breit auf den Tisch. Dann wandte er sich zum Gehen. Indessen ehe er die Schwelle erreichte, stand Hilda schon wieder hinter ihm. Das Geld hatte sie bereits zusammengerafft.
»Daß Claus mir nicht erfährt von wem«, forderte sie schroff.
Der Angeredete wandte sich kaum. »Von mir nicht«, gab er gelassen zurück. »Was schiert mich der Bursche? Solange er seinen Fang abliefert, bin ich ihm nicht gram.«
Damit nickte er steifnackig, stemmte seinen Stab in den Sand und schritt wuchtig den steilen Saumpfad hinab. Hilda starrte ihm finsteren Auges nach, solange sie die silberne Krone blitzen sah. Doch seit dieser Zeit wurde die Einsame nachdenklich, und oft schüttelte sie sich, als ob sie sich gegen böse Gedanken zu wehren hätte. Dann stach es ihr durch den aufgescheuchten Sinn: »Wie, wenn man ihr dasjenige, was sie erwartete, zu nehmen trachtete? Stellten die vier Silbergulden nicht vielleicht das Kaufgeld dar? Man erzählte sich von dem Conaer Herrn doch solche gewalttätigen Geschichten. Und war er nicht auch mit dem jungen Mecklenburger Herzog geritten, als dieser an der Spitze von allerlei Raubgesindel und Landstreichervolk die Heerstraßen der Kaufleute von Stralsund unsicher machte? Nach einem solchen Zuge hatte er ihr doch das blaue Kopftuch zugeworfen?« Wütend schlug sie mit der Faust gegen die Türpfosten und reckte sich drohend, allein gleich darauf schrak sie zusammen, und trotz der milden Frühlingsluft wurde sie von einem Schauer durchfröstelt.
»Warte«, quoll es dabei über ihre bebenden Lippen, »ich sag's Claus. Der läßt sich nichts nehmen.« Indessen im nächsten Augenblick stand sie schon wieder erstarrt. Ach du lieber Gott, was schierte denn Claus der fremde Balg? Er kümmerte sich ja nicht einmal um die Mutter, die alles nach seinem Willen tat. Nein, nein, am besten war's wohl, auf der Hut zu bleiben und auch das Geld nicht zu zeigen, um nicht unnötigen Fragen des Fischers ausgesetzt zu sein.
So nähte sie denn die Silbergulden in ihren Rock ein, und nur manchmal streifte sie ihren Genossen ängstlich und erwartungsvoll, als wünschte sie heimlich von ganzem Herzen, er möchte endlich das Geheimnis entdecken.
Aber seitdem war Unrast über ihr, und sie sang nicht mehr. Immer eilfertiger flogen die Tage an ihr vorüber, und immer unsicherer wurde ihr Gang.
Eines Nachts kehrte Claus nicht nach Hause zurück. Todmüde lehnte Hilda an der offenen Luke und suchte das unerkennbare Grau zu durchdringen. Vergeblich, nichts löste sich ab von dem schwarzen Dunst, in den der Sturm oftmals wie mit einem schweren Sack hineinschlug. Nur in entfesselter Wut lärmte die See, und im Morgendämmer fuhr an den Strandsteinen fast ununterbrochen eine schlängelnde weiße Mauer empor. Solange die Dunkelheit währte, hatte das verängstigte Weib von Zeit zu Zeit einen brennenden Kienspan aus der Fensterhöhlung herausgehalten, zum Zeichen für den auf der tosenden Fläche Herumirrenden, damit er nicht ins Weglose getrieben würde. Doch der wütige Zug hatte das karge Feuerlein jedesmal heißhungrig gefressen, und die nackten Arme sowie die offene Brust des Weibes schauderten vor Kälte. Jetzt wurde es heller. Dinge und Gerätschaften traten in der Hütte hervor. Und draußen im Stall begann der Geißbock die harte Stirn gegen die Tür zu reiben. Verwirrt, übernächtigt blickte sich Hilda in dem engen Raum um. Es fehlte etwas – es war etwas von seinem Platz genommen, das sich freilich nie gütig und freundlich gezeigt, dem aber doch alles hier eignete. Sogar sie selbst. Und dem man wohl auch Gehorsam und Dank schuldete. Mehr wußte sie nicht. Vergessen war ihre eigene Unkraft, verflogen die bleierne Müdigkeit der Glieder; ihrer selbst ungewiß, ergriff sie einen rohen Ast und wankte halbnackt zum Strand hinunter. Unten über die sonst so ebene gelbe Fläche spielte das Wasser, schwärzliche Seegrasbündel schlängelten sich der Vorwärtswatenden um die Füße, und der Sturm stemmte sich gegen sie wie eine gierige Faust, die ihr die Gewänder vom Leib zu reißen strebte.
Keuchend kämpfte sich Hilda weiter.
An einem jetzt halbversunkenen Pfahl, der gestern noch im Trockenen eingerammt war, scheuerte und zerrte sich ein Boot an zerfasertem Strick. Das war Claus Beckeras zweiter, kleinerer Kahn, und daneben ragte aus der Überflutung ein derber Mann in mächtigen Stiefeln auf, abgekehrt, die Lederkappe tief über die Stirn gezogen. Seine Rechte aber klammerte sich auch jetzt an den kronengeschmückten Stab. Gerade in der Not legte er ihn nicht ab. Hilda erkannte ihn sofort. »Vogt«, stieß sie hervor, »er ist draußen.«
Der Aufseher nickte, sprach jedoch nichts. Nur sein erkennender Blick, den er auf die Erregte heftete, verriet die Meinung, wie dem Weib vielleicht bald Hilfe nötiger sein möchte als dem Verlorenen. Inzwischen hatte sich Hilda hoch auf die Zehen aufgerichtet. Um sich besser zu heben, hatte sie dabei ihre Hände ganz sonder Achtung auf die Schulter des Vogtes gestützt. Der schien nichts zu merken.
Dann warf sie die Rechte vor. »Dort draußen das Schwarze«, wies sie.
»Ein Baumstamm«, belehrte der andere. »Ich sehe ihn schon lange.« Und halb tröstend setzte er noch hinzu: »Wir haben Seewind. Wenn er noch lebt, wird er ihn Hereinwerfen. – Auch so«, kaute er mit geschlossenem Munde.
Damit wandte er sich ab und schritt langsam die Dünen empor. Dort wollte er noch einmal Ausschau halten. Draußen hinter den rollenden Bergen schaukelte das längliche schwarze Ding auf und ab. Und wenn die Zurückgebliebene ihr Sehvermögen aufs äußerste anstrengte, dann glaubte ihre aufgescheuchte Einbildung einen dunklen Kopf und eine greifende Faust zu erkennen. Die drohte oder winkte zu ihr herüber.
Da hielt sie sich nicht länger. Ihr Mitleid war stärker als ihre Schwäche. Ungestüm bückte sie sich, so schwer es ihr fiel, löste die hänfene Schnur und kletterte in das regengefüllte Boot hinein. Ihr Glaube half ihr, denn der Kahn befand sich an der Stelle einer Strömung, so daß das Schiff mit einer Kraft und Stetigkeit hinausgetrieben wurde, als wären unsichtbare Segel an den fehlenden Mast gesetzt. Hochauf spritzte die Dünung, und das zerbrechliche Gerät seufzte in Schmerz und Jammer. Stieren Auges hockte das Weib auf dem morschen Brett, das Haupt unveränderlich nach dem herumgeschleuderten schwarzen Sarg gerichtet. Jetzt – und jetzt – da tauchte sie wieder vor ihr auf, die Faust, die sie halb im Traum vor sich geschaut. Mit einer wilden Bewegung warf sich das Weib lang in den Kahn und griff nach den krallenden Fingern. Ein wüster Kampf hob an. Der Verfallene dort unten war wohl schon der Tiefe verschrieben, denn er wehrte und sträubte sich, bis eine sich blähende Woge den schweren Körper plötzlich unter einem Schwall in den rettenden Nachen stürzte. Einen Augenblick wurden die Planken überschäumt und begraben, dann hoben sie sich wieder, kreiselten irre herum, und die rollenden Wasser trieben das Schifflein vor sich her, gleich einem geprügelten Hund.
Düster reckte sich das Land empor, und hoch oben gegen den verhängten Himmel zeichnete sich die Gestalt eines Mannes ab, der staunend das Begebnis verfolgte.
Der Vogt hatte den Schiffbrüchigen in die Hütte getragen. Der mächtige Körper ruhte jetzt auf dem Bettgestell und rang mit dem Tode. Und in der Ecke auf der Schilfstreu erwachte zur selben Stunde ein neues Leben. Hilda hatte einen Sohn geboren.
Ein langes, schmächtiges Knäblein. Es schrie nicht, sondern hatte die Fäuste geballt, und die schwarzen, nächtigen Augen hielt es fordernd ins Leere gerichtet. Nein, nicht ins Leere. Am Fußende der Streu hing die Axt an der Wand. Später erinnerte sich die Mutter, daß ihr Sohn zur Stunde seines Eintritts unausgesetzt die Schärfe des Beils betrachtet. Vom Vogt war aus dem Kloster einer der Zisterzienser geholt worden. Der schaffte nun kundig um die drei Unmächtigen herum. Zu jener Zeit erfüllten die Klosterleute, gleichviel ob jung oder alt, willig die Pflichten des Arztes und der Wehmutter, und die Gepflegten glaubten, es müsse so sein. Bruder Franziskus war zudem derselbe, der in jener von Hilda unvergessenen Nacht den erzwungenen Bund gesegnet hatte; jetzt tat er sein Äußerstes, um die bedrohte Gemeinschaft zu erhalten. Bald flößte er dem hingestreckten Fischer scharfe, seltsam duftende Tropfen ein, die er in einem venezianisch geschliffenen Büchslein aus seiner Kutte zog, bald pustete er unter die Flamme des Herdes, um der Wöchnerin einen warmen Trank zu bieten; ja, er reinigte den Neugeborenen sogar im ersten lauen Bade. Dabei glitt ein wohlgefälliges Lächeln über das ernsthaft jugendliche Antlitz des Bruders, und während seine Rechte zart über die weichen Glieder des Kleinen strich, sprach er mit der Bestimmtheit des Erfahrenen:
»Ein edler Bau. Wie nach den Maßen der alten Meister. Möge der Unerforschliche dies Kindlein zum Guten bilden.«
Hilda hörte es auf ihrer Schilfstreu. Und zum erstenmal zuckte es wie Stolz um ihre Lippen, da sie daran dachte, welch adligem Ursprung der Säugling seinem Blute nach entstammte. Zugleich aber heftete sie einen erschreckten Blick auf das Bettgestell, wo sich der gewaltige Körper ihres Eheherrn zu regen begann. Sofort griff sie hastig nach den eingenähten Silbergulden.
Ja, ja, das war das Mittel, um sich gegebenen Falles von jedem Tadel loskaufen zu können. Allein sonderbar – so schwer sie auch die Änderung begriff –, es traf sie kein lauter Vorwurf mehr. Noch ehe Claus auf seinen zerschlagenen Beinen hin und her zu kriechen vermochte, hatte der Mönch dem Entkräfteten kurz den Hergang seiner Rettung erzählt. Stumpf, in sich gesunken, hockte der Fischer dabei auf seinem Lager und ließ nur ab und zu einen forschenden Blick über das Neugeborene gleiten. Weder bedankte er sich, noch gab er sonst eine Erkenntlichkeit kund. Auch überließ er nach wie vor alle Hilfeleistung für sein Weib dem Bruder Franziskus. Und doch – es kam vor, daß er zuweilen die Milch der Geiß in einem Holzschaff dicht neben der Streu der jungen Mutter niedergleiten ließ. Keiner wußte zu welchem Zweck, und man konnte doch annehmen, daß der Trank für Hilda und ihr Kind bestimmt sei. Ein andermal freilich begab sich, was der glücklichen Frau anzeigte, nun sei der Damm von Groll und Übelwollen vielleicht für immer gebrochen. Eines Abends blieb der Mönch vor dem Aufbruch gedankenvoll an der Streu des Kleinen stehen, und während er ihn seiner Gewohnheit gemäß zum Abschied segnete, sprach er bestimmt:
»Nun ist es Zeit. Morgen wollen wir das Kind in das Kloster tragen, die Taufe zu empfangen. Wie soll es heißen?«
Hierauf regte sich Hilda nicht. Sie kehrte ihr Haupt vielmehr der Wand zu und kratzte ungeduldig mit den Nägeln gegen die Holzbohlen. Alles, um den ungestümen Wunsch, ihres Herzens zu betäuben. Statt ihrer jedoch erhob sich der Fischer von seinem Sitz neben dem Herd, tastete sich schwerfällig nach der Streu des Säuglings zurecht, und nachdem er in das schmale Gesicht, neugierig und kopfschüttelnd wie stets, herabgeschaut, da brach es plötzlich brummend und drohend aus ihm heraus, als hätte er sich gegen einen Angriff zu wehren:
»Das Knäblein heißt wie ich, nicht anders. Claus soll es heißen.«
Da nickte der Mönch mit einem stillen Lächeln, das liegende Weib jedoch hob ungestüm den Arm und versuchte glücklich auf der bärtigen Wange des Niesen herumzustreicheln. Unschlüssig und verletzt schüttelte er sie ab. Aber als nach der Taufe die junge Frau wieder in der Hütte auf und ab wirkte, da hörte sie draußen vor dem Gebäu ihren Eheherrn singen. Das war noch nicht. Auf leichten Sohlen schlich sie hinzu, um zu lauschen. Im Sonnenschein saß Claus und schliff seine Axt am Feuerstein. Dazu summte er behaglich in das Spritzen der Funken hinein:
»Wetze gut. Dann schnett se gut, Der Claus, der ist der Hilda gut.«
Er wußte sonst keinen Namen. Es hatte nichts weiter zu bedeuten.
II
Goldgrüne Schatten spielten um die Buchenwipfel hoch über der roten Klostermauer. Auf einer der verfallenen Grasstufen, die in breiten, unkrautbewachsenen Abständen zu der schmalen Eingangspforte hinaufleiteten, hatte sich ein einsamer Bruder hingelagert. Achtsam trug er in einer Falte seiner Kutte ein paar Brosamen weißen Hirsekuchens verborgen, und nun streute er die Krumen in weitem Bogen den Finken, Meisen und Amseln des Waldes hin, die in einiger Entfernung hoch aufhuschend nach den leckeren Bissen pickten. Noch hatte der Einsame seine gefiederten Freunde nicht allzulange gefüttert, als der Schwarm plötzlich schwirrend und rauschend auf die untersten Zweige der Buche abzog, stutzend vor eiligen Schritten, die den Waldpfad heraufklangen. Der Klosterbruder hob das Haupt. Der Tritt, dieses hastige, sprunghafte Ausgreifen deuchte ihm bekannt. Seit sechzehn Jahren fast hatte er ihm prüfend und abschätzend gelauscht. Und jetzt – aus dem schwarzgrünen Bogengang stürmte es hervor. Ja, Pater Franziskus kannte jene schlanke, geschmeidige Knabengestalt in dem weißen Linnenkittel, oft hatte er die wohlabgemessene Form dieser Knien und Waden in ihrer braun gesonnten Nacktheit bewundert, mit heimlichem Schrecken aber fast immer in die schwarzen begehrlichen Augen hineingeschaut, die wie zwei flimmernde Abgründe in dem schmalen Jugendantlitz brannten, ewig bereit, Nahes und Fernes zu verschlingen. Immer aufgetan zu neuer Forderung. Niemals zu müde, um zu suchen und zu fassen. Davor war dem Mönch nicht selten ein drückendes Befremden aufgestiegen, denn diese rastlos einschlürfenden Augen widersetzten sich allzusehr dem geduckten Dasein eines Gassenkindes. Ebenso wie die braunen Wellen des Haupthaares das Gebot der kurzen Schur leichtfertig mißachteten.
In weiten, glatten Sprüngen setzte der weiße Schatten durch den Wald. Daher kam es, daß seine Gefährtin, ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, dem sein rotes Röckchen hindernd um die entblößten Beine wirbelte, eine geraume Strecke hinter dem Buben zurückblieb. In den Kranz der blonden Zöpfe, die das Kind dichtgeflochten und eng um das Haupt trug, waren bläuliche und rötliche Muscheln gesteckt, und so erhielt die Kleine ein fremdartiges und wildes Aussehen. Zu dem sanften Gesicht wollte der absonderliche Schmuck keineswegs passen. Auch zögerte die jetzt ruhiger Schreitende und griff sich ein paarmal verstohlen in die Flechten, in sichtlicher Furcht, wie man das blitzende Stirnband an der Klostermauer beurteilen würde.
In der Tat war der ungewohnte Zierat das erste, was dem Bruder, während er sich auf seiner Grasstufe ein wenig aufrichtete, störend ins Auge fiel. Halb unwillig riß der Ruhende ein paar Halme aus, bevor er mit einer raschen Kopfbewegung nach den Muscheln wies:
»Wozu das, Anna? Was soll der Putz?«
Kaum war die Mißbilligung gefallen, als ein tiefes Rot über die Wangen der Getadelten ging, ihre blauen Augen drehten sich ängstlich, und unwillkürlich falteten sich ihre Hände vor der Brust. Dazu warf sie dem Knaben im weißen Kittel einen jähen Blick zu, als wäre dieser der Herr, von dem sie und ihr Schicksal abhingen. Der ließ sie auch nicht im Stich.
»Ich hab's ihr hineingesteckt«, sagte er lachend, und seine Augen weideten sich wohlgefällig an seinem Werk, als möchten sie sich von dem blaufeuchten Glanz der Muscheln nicht trennen. Dazu strafften sich die schlanken Beine, die er schon früher gespreizt aufgestemmt hielt, noch etwas fester in den Sehnen, und der ganze Bursche sah unbekümmert und keck aus, wie wenn nach seinem Wohlgefallen sich Regen und Sonnenschein zu richten hätten.
Unbehaglich bemerkte es der Mönch. Gerade dieses Aufbegehren einer unbändigen Natur suchte er zum Heile des Knaben zu unterdrücken. Der Fischerssohn, dem er anhing, mußte gegen sein Blut geschützt werden. Das war's. Dazu gehörte, daß man seine Unwissenheit nicht allzusehr erhellte. Auch durfte er nicht über seinen Stand hinauswachsen oder gar, wie er es liebte, seine Gedanken fabulierend ins Weite schweifen lassen. Das Meer verlockte zu derartigen Nebelfahrten. Aber solches Entgleiten war einem Sassenkind nicht günstig – jedenfalls in solcher Jugend nicht.
»Nimm der Dirne die Torheit aus den Haaren«, befahl er darum hart.
Claus Beckera rührte sich nicht. Nur seine Augen blitzten hartnäckig auf, und seine Rechte vollführte eine ungläubige, fortschleudernde Bewegung, als könnte er damit die unbegreifliche und ihm unklug dünkende Abneigung des Klosterbruders zerstreuen.
»Es sieht gut aus«, beharrte er noch immer in Bewunderung vor dem fremden Glanz. »Es sind Maimuscheln. Die Gnadenbilder in der Klosterkirche und die Fräuleins auf dem Schloß tragen auch solch bunte Steine.«
»Eben darum ziemt sich der Tand nicht für Anna Knuth, die Tochter der Strohflechterin«, belehrte Bruder Franziskus ruhig und streckte die Hand nach dem abenteuerlichen Schmuck aus, wobei er sich stellte, als bemerke er das heftige Zusammenzucken des wilden Jungen nicht. »Es sind Unterschiede in die Welt gesetzt. Sie stammen von Gott.«
Er zerpflückte jetzt die Muschelschnur zwischen den Fingern, und da er wahrnahm, wie sein halbwüchsiger Freund, um den er sich sorgte, die rote Unterlippe nagte, fuhr er begütigend fort: »Schau um dich, Nikolaus, schau auf den Wald. Hier blüht der Haselstamm und wird nur ein Strauch. Daneben aber die Buche wächst über zwanzig Ellen. Und machen doch zusammen den schattigen Wald aus und müssen sich dulden. So geht es auch bei den Menschen.«
Eine Weile raschelte der Wind durch die Zweige. Dann lachte der Knabe mit einem Male hell auf.
»Was hast du?« fragte Franziskus verwundert.
Heftig reckte sich der im weißen Kittel. Ein Zug von Vorwitz und frühreifer Spottsucht lief über sein schmales Antlitz, als er nun die Rechte bestimmt vorwarf.
»Da sieh, Geweihter«, rief er selbstsicher, denn er gebrauchte häufig für den Mönch die ehrfürchtige Bezeichnung seiner Mutter, »den Hasel- und den Buchbaum hier. Ob die einander gleichen?«
»Nein«, murmelte der Zisterzienser noch im Ungewissen, »sie gleichen einander nicht. Sie sind von verschiedener Art.«
»Aber die Menschen, die gleichen einander«, vollendete der Knabe jetzt rechthaberisch, tat einen Luftsprung und warf seiner Begleiterin einen Blick des Schutzes zu. »Du hast selbst gesagt, wir wären alle nach dem Bild Gottvaters gemacht.«
Da brach der Mönch verstimmt und finster das aussichtslose Gespräch ab. Zumal er auffangen mußte, wie das kleine Mädchen ob der Keckheit des Burschen verstohlen zu lächeln anhob.
»Es wäre dir besser«, brummte er aufgebracht, indem er sich ratlos mit beiden Handflächen die ergrauten Schläfenhaare zurückstrich, »dein Vater hätte dir öfter mit dem Gürtelriemen den Rücken gewalkt.«
Als des Vaters Erwähnung geschah, wich das vorlaute Wesen des Knaben gedankenschnell. Kleinlaut senkte er das Haupt und scharrte mit dem nackten Fuß über den Moosboden.
»Vater rührt mich nicht an«, meldete er nachdenklich. »Er sitzt den ganzen Tag auf der Düne und sonnt sich.«
Jetzt fuhr der Bruder mitleidsvoll über das wellige Gelock des Burschen. Sein Groll war verschwunden. Die Erinnerung an ein ehrenhaft mühselig Leben hielt ihn gefangen. »In deinem Vater sitzt die zehrende Sucht«, sprach er leise, »der Frühling ist für ihn ein gefährlich Ding. Und was tust du, sein Los zu erleichtern, Nikolaus?«
»Ich? –« Der Gefragte blickte suchend umher. Endlich schienen die scharfen Augen etwas erwischt zu haben, als sie rückschweifend einen schmalen Ausschnitt des durch die Stämme schimmernden Meeres entdeckten. »Ich fahre hinaus und lege seine Netze«, verteidigte er sich erwartungsvoll, denn er wollte gelobt werden. »Ich bringe mehr heim als er. Manchmal bin ich die ganze Nacht fort. Und ein sein Segel hab' ich gemacht aus rotem Packtuch«, setzte er befriedigt hinzu, »und kann den Wind vor- und rückwärts abfangen. Davon hat der Vater nichts verstanden. Das ist ein neu und gut Ding. Und Mühe hat es gekostet.«
»Dich nicht«, versetzte der Mönch unbeirrt, wobei er versuchte, den irrlichternden Strahl der schwarzen Augen auszuhalten. »Lüge nicht, Bursche. Dir ist es eine Lust, auf dem Wasser zu liegen und dich mit dem Wind herumzuschlagen. Du dünkst dich dann besser als andere Menschenkinder. Dort draußen fängst du auch die grilligen Gedanken, die dir nicht taugen. Sage, was führt dich heute her?«
Jetzt trat der Knabe näher und küßte zärtlich die feine weiße Kutte des Mönches. Ein Staatskleid der Brüder, das nur bei besonderen Anlässen getragen wurde.
»Mir war bange nach dir, Geweihter«, brach es inbrünstig aus ihm heraus, und er streichelte verstohlen das Tuch des faltenreichen Gewandes. »Es quält mich oft eine Unruhe, wenn ich dich nicht nach diesem oder jenem fragen kann. Denn du weißt alles, was mir fehlt.«
Da verbarg Pater Franziskus ein halbes Lächeln.
»Du Tor«, wies er bescheiden die übertriebene Meinung ab, »ich weiß nicht einmal, was deine Gespielin dort zwischen den beiden Binsendeckeln trägt. Was ist's?«
»Ja, das rätst du nicht«, schrie Nikolaus Beckera, plötzlich wieder in seine wilde Heftigkeit zurückfahrend, und dabei stürzte er auf das Mädchen zu und riß ihm ohne weiteres das grüne Geflecht aus den Händen. »Gib her – ein wunderlich Tier«, stammelte er atemlos und brach die Deckel auseinander. »Dergleichen gibt es sonst nicht in unserem Wasser. Und dir gehört es, Geweihter, dir allein.«
Eine ungeheure Scholle kam zum Vorschein, dunkelgrau mit roten Punkten und wohl anderthalb Fuß im Durchmaß. Der Fisch glänzte perlmutterfarbig in der Sonne. Bewundernd standen die drei um den seltenen Fang herum, und die Kinder lachten vor Freude, als der Pater mit Kennermiene den Finger spitz in den Rücken der Scholle setzte, um wohlgefällig das Fleisch des Tieres auf seine Festigkeit hin zu prüfen.
»Ein herrlich Stück«, gestand der Bruder selbstvergessen und klopfte dem Spender dankbar die Wange. Allein unvermutet hielt er inne, ein feindlicher Gedanke schien seine offene Lust zu hemmen.
»Was gibt's?« rief der Junge erschreckt.
Der Bruder maß ihn prüfend von oben bis unten.
»Hat der Vogt deinen Fang gesehen?«
Jetzt zuckte das kleine Mädchen, wie von einem Streich getroffen, zurück und sprang schutzsuchend hinter den nächsten Baumstamm. Claus Beckera aber wurde seltsam bleich. Dann begannen seine schlanken Glieder vor Zorn oder vor Scham zu zittern. Etwas Haßerfülltes, von Leidenschaft Überwältigtes brodelte aus seinen schwarzen Augen.
»Der Vogt weiß von nichts«, widersprach er hart und schob die Faust geballt von sich. »Ich hab' das Tier die ganze Nacht über zwischen den Strandsteinen versteckt.«
Kopfschüttelnd wies der Mönch das Geschenk von sich, auch entsetzte er sich heimlich darüber, wie wenig sein Zögling zu Bescheidenheit und zu geduldigem Dienst zu lenken wäre.
»Weißt du nicht«, ermahnte er heftig und hob drohend den Finger, »daß all dein Fang dem Grafen eignet? Was soll ich mit dem entwendeten Gut?«
»Essen«, schrie Claus, der noch immer zitterte und bebte. Und wie tückische Pfeile schnellten die Worte von ihm: »Der Graf hat satt. Wie kann er uns das nehmen, was wir fangen? Gehört ihm die See?«
»Wem gehört sie sonst?«
»Dem, der auf ihr segelt und Netze legt«, eiferte der Knabe ohne jedes Besinnen. Schmetternd warf er den Fisch auf den Waldboden und machte Miene, ihn mit seinen nackten Füßen zu zerstampfen.
»Claus«, rief das kleine Mädchen hinter seinem Baum um Erbarmen flehend.
Jetzt sprang auch der Bruder hinzu, bückte sich und riß den Flossenträger an sich. Dunkelrot war das weiße Gesicht des Mönches übergossen. Es blieb unentschieden, ob vor Anstrengung oder weil er den feinen Mund des Fischerssohnes in befriedigtem Triumph lächeln sah.
»Unsinniger«, zürnte er in ehrlichem Unwillen, »Gottes gedeihliche Gabe vernichten? Oh, ich sehe, ich bin zu schwach gegen den bösen Geist, der in dir wohnt. Geh mir aus den Augen und kehre so bald nicht wieder.«
Einen Augenblick blieb es still zwischen den dreien, dann wandte sich Pater Franziskus, den Fisch noch immer in den flachen Händen, und stieg mit weiten Schritten die Grasstufen in die Höhe. Bald mußte er das kaum mannshohe Pförtlein in der Mauer erreicht haben. Da geschah etwas Unerwartetes.
Ebenso schnell wie Claus Beckera in Zorn und Wut hineingerast war, so erfaßte ihn jetzt eine verzweifelte Reue. Urplötzlich füllten sich seine funkelnden Augen mit Tränen, und unbekümmert darum, ob seine kleine Gefährtin sein Handeln begriffe, stürzte er auf die unterste Stufe nieder, wo er die Arme wild emporwarf, als könnte er so den Entweichenden zurückhalten.
»Tu das nicht, Geweihter«, schluckte er schmerzzerrissen. »Ich hab' dich lieb. Und wer soll mir die Hand auf die Stirn legen, wenn mich die Schmerzen quälen, die mich blind machen? Nein, tu das nicht. Geweihter – tu das nicht.«
Noch zitterte die Klage dieses wahrhaftigen Knabenschmerzes unter den sonnenstillen Bäumen, noch hatte sich der leicht gerührte Bruder nicht völlig gewandt, da klang in der Schwärze des Waldes ein Horn. Zugleich hörte man den Hufschlag der Rosse.
Einen Augenblick wurzelten die drei auf der grünen Lichtung fest. Dann geriet Leben in den Mönch, und während er die Scholle eilfertig auf einen Mauervorsprung zu betten suchte, segnete er Gott im stillen für die gelegene Unterbrechung. Wohltätig enthob sie ihn der begehrten Versöhnung mit dem aufgeregten Knaben.
»Sie kommen«, rief er dem verblüfften Fischer zu, der ohnehin alles, was bis dahin geschehen, längst vergessen hatte. Ungestüm war er aufgesprungen, um nun, fiebernd vor Neugier, das dicke Gehölz zu durchdringen.
»Vier – fünf – zehn Pferde«, zählte er, »sieh – sieh, Anna, Stahlpanzer und seidene Mäntel.«
»Dänische Herren«, berichtete der Bruder erregt und strich sich die weiße Kutte glatt, »reiten auf Tagfahrt nach Stralsund und nehmen zur Nacht hier Obdach.« Gespannt drängten sich die Kinder an beide Seiten ihres Freundes. Kaum konnte er sich ihrer erwehren.
»Dänen?« stammelte Claus zweifelhaft. Denn er vermochte nicht mit Sicherheit anzugeben, wo jene Völkerschaft seßhaft wäre. »Was treiben die in Stralsund?«
Doch der Mönch schüttelte ihn ab, ohne den stets regen Eifer des Wißbegierigen befriedigen zu wollen.
»Wozu brauchst du das erfahren, Claus?« weigerte er sich vorsichtig. »Was kümmern dich die Händel von Königen und Herren? Diesmal zwar handelt es sich um eine gerechte Sache«, setzte er mehr für sich hinzu, »gilt es doch, die Horde der gesetzlosen Schuimer zu vertilgen.«
Da packte ihn der Knabe heftig am Kleid. »Was sind Schuimer?« drängte er ungebärdig. »Sag es mir.«
Der Mönch erschrak. Gar zu wild brannten die dunklen Knabenaugen in die seinen. Das geheimnisvolle Wort, das im Volk für die unter der schwarzen Flagge Herumstreifenden umging, schien in der unbeherrschten Seele ein Feuer entzündet zu haben. Wieder rettete der Pater seine Verlegenheit hinter strenge Abweisung.
»Schweig«, befahl er. »Was schiert sich ein Sasse, der von der Herrschaft gut gehalten wird, um die von jedem Ehrsamen gemiedene Brut der Friedlosen? Danke Gott im stillen dafür – der du ein nährend Gewerbe und einen sicheren Platz hast –, daß die Fürsten und Städtischen dem wüsten Drang ein Ende machen wollen. Merk dir, Bursche, solange das Gelichter nicht von der See fortgefegt wird, solange kannst du, wenn du ehrlich bist, unter deinem Dach nicht ruhig schlafen.«
Schon wurden die bunt geschirrten Rosse unter den Stämmen sichtbar. So blieb Pater Franziskus nur noch Zeit, die Kinder beiseitezuschieben und den wesenlos Gaffenden gutmütig zuzuflüstern:
»Schaut auf die Vordersten. Ja, die beiden. Das sind die Gesandten der Königin. Der Drost Reichshofmeister Henning von Putbus. Und der Hauptmann Konrad von Moltke. Gar stolze und mächtige Herren.«
Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte Claus Beckera nun das sich entwickelnde farbige Bild. Er merkte nicht einmal, wie er dabei krampfhaft die Hand seiner kleinen Gefährtin ergriffen hatte. So übergewaltig, so betörend wirkte auf ihn der goldige Glanz der Großen. Allmählich spann sich ein feines, unwirkliches Netz vor seine hinstarrenden Blicke, und er zuckte beinahe schmerzhaft zusammen, sobald aus dem Gewebe ein besonders greller Blitz auf ihn zuschoß. Da –
Trat aus der Pforte über den Grasstufen nicht der Abt mit seinem Prior hervor? Beides hinfällige Greise. In seinem schneeweißen Gewand, das goldene Kreuz klappernd auf den dürren Gliedern, trippelte das Männchen, achtsam auf jedem Absatz die Schleppe hebend, auf den ersten der Reiter zu, um endlich dem Reichshofmeister mit zitternder Hand einen silbernen Pokal entgegenzureichen. Auf breitem Gaul saß der Drost zurückgelehnt, die überlangen Beine gewaltig gespreizt, denn die flickenreiche Zaddeltracht beengte den hochaufgeschossenen Mann. Zwiefältig war das Staatskleid zusammengesetzt, auf der linken Seite rot, auf der rechten gelb, während Arme und Beine umgekehrt bekleidet waren. Dazu saß ihm eine ungeheure blaue Wulsthaube auf dem verkerbten Haupt, von der ihm noch eine riesige blaue Fahne fast bis an die Knie hinunterfloß. Man sah ihm an, der lange Ritt hatte ihm heiß gemacht, denn er schob luftschöpfend an dem schwarzen Ledergürtel unterhalb seiner schmalen Hüften herum, und wenn die tiefliegenden lauernden Augen nicht widersprochen hätten, so hätte man den Reichshofmeister der Königin Margaretha für einen abgedienten und eitlen Höfling halten können. Aber die Augen wohnten ihm unter graustruppigen Brauen wie der Fuchs in seinem Bau. Aufmerksam, sprungbereit. Und über die verschrumpfte Stirn flog manchmal ein erhellender Blitz. Nicht umsonst ging die Sage, diese vermorschte, im Winde schwankende Leiter hätte die Sprossen geboten, auf denen die zierlichen Füße seiner Königin bis in die kältesten Höhen der Staatskunst emporgeklettert wären. Doch die Sage fügte ihm Unrecht zu, denn er selbst hatte in dem fürstlichen Frauengemach erst die unmerklichen Windungen und herzenskühlen Methoden gelernt, die die nordische Welt jetzt in Spannung hielten.
Von ganz anderer Art war sein Gefährte, der dicht neben ihm seinem gescheckten Schimmel wuchtig den schweißenden Hals klopfte. In einem verregneten Lederkoller hockte der Hauptmann Konrad von Moltke auf seinem abgetriebenen, sehnigen Gaul. Sein linkes, von einem grünen Strumpf umspanntes Bein hatte er lässig in die Höhe gezogen, so daß er den Arm darauf stützen konnte. Und auf diesem ruhte wieder der völlig kahle, in der Sonne glänzende Schädel, unter dem eine krumme Geiernase rauflustig und hochmütig in die Welt stach. Die eiserne Sturmhaube, die den beinernen Totenkopf wohl allzusehr drücken mochte, hing ihm schaukelnd vom Sattel, und die rot verschwollenen Augenlider blieben hartnäckig geschlossen, vielleicht vor Müdigkeit, vielleicht aus Abneigung gegen das Mönchsgesindel, dem seine Herrin so auffallende Bevorzugung erwies. Man munkelte da allerlei. Der verkniffene Mund des Dänen jedoch redete laut von Geiz und Beutesucht.
»Er sieht aus wie der Seeadler, wenn man ihm die Federn ausgerupft hat«, dachte Claus Becker« staunend, ohne den gierigen Blick von dem Knochenmann abwenden zu können.
Inzwischen hatte sich die hinfällige Kinderfigur des Abtes auf den Zehen aufgerichtet. Ängstlich vor dem scharrenden Braunen ausweichend, reichte er dem Reichshofmeister seinen Becher dar. Das Männchen, dem ein paar einzelne graue Locken verloren um die Stirn flatterten, machte unverkennbar den Eindruck, als ob er sich hinter seinen Pergamentrollen wohler fühle als bei dieser ungewohnten Staatshandlung.
»Herr Henning von Putbus«, lispelte er ohne Mark und kaum hörbar, »Reichshofmeister und Drost der großmächtigen – – –«
Hier klatschte der Knochenmann seinem Gaul höchst wuchtig gegen den Hals und kniff seine Lider immer unbegreiflicher zusammen.
Der Abt verwirrte sich.
»Der Herr führte Euch zum Segen an die deutsche Küste«, stotterte er verlegen und begann mit dem Becher hin und her zu zittern. »Er führte Euch an die Küste – ja – und möge die Tagfahrt zu Stralsund Euren Wünschen entsprechen.«
Höflich streckte der Hagere seine Beine noch steifer von sich, ergriff den Becher und verneigte sich so geschmeidig, wie man von dem vertrockneten Gerüst in dem Geckengewand kaum erwarten konnte. »Da der redliche Abscheu Eures Ordens gegen die Vergewaltiger der See bekannt ist«, sprach er ziemlich unbeteiligt, »so werden Eure Gebete mit uns sein. Ich weiß – ich weiß.« Er führte den Pokal oberflächlich und ohne zu nippen an seinen Mund. Sein Nachbar jedoch, der Hauptmann von Moltke, riß ihm ungeduldig den Pokal, bevor er noch dazu aufgefordert wurde, aus der Hand, tat einen tiefen Blick hinein und stürzte das Getränk gierig hinunter. Der Kriegsmann mochte durstig sein. Allein unvermutet hielt er inne, und während er böse die verschwollenen Augen aufriß, goß er gereizt den Rest auf die Erde.
»Gemischt«, knurrte er, und seine Stimme klang, wie wenn man Scherben gegeneinander reibt. »Himmel und Hölle – ich – –«
In diesem Augenblick schlug erneutes Pferdegetrappel aus dem Wald heraus, der Reiter verschluckte das Weitere, hob die abschreckend dürre Hand und schwenkte sie dem neuen Ankömmling entgegen. »He, Cona«, krähte er immer in demselben bitteren, menschenverachtenden Ton, »meiner Seel! Ihr standet gut im Futter, seit wir uns zuletzt begegneten. Wißt Ihr noch auf der Tagfahrt zu Wismar? Man sagt, Liebwertester, Ihr hättet über See recht einträgliche Geschäfte betrieben. Und kennt die Schliche der Schuimer aus Erfahrung.«
Es mußte eine besonders giftige Anspielung in jener Anrede liegen, denn der Reichshofmeister, der plötzlich noch fahler aussah als gewöhnlich, hob abwehrend die Rechte, schöpfte vergeblich Luft und versuchte sein Unbehagen hinter einem begrüßenden Lächeln zu verbergen. Er brachte es jedoch nur zu einem Grinsen, zumal er wahrnahm, wie der Graf von Cona, der nun in der Abendsonne dicht neben seinem jungen Sohne mitten auf der Lichtung hielt, verärgert und beschämt das feiste Vollmondgesicht verzog. Spähend blinzelte der so Wohlgenährte im Kreise umher, ob auch die Mönche den beißenden Spott verstanden hätten. Dann strich er mit der fleischigen Hand über den halblangen blauen Tappert, der ihn schlafrockartig umhüllte, und stieß endlich kurzatmig nach Art der Dicken hervor:
»Seid gegrüßt, ihr Herren. Auch du, Moltke. Immer munter. Immer gelenkig. Wollen absteigen und das Nachtmahl einnehmen, das der Herr Abt für uns gerüstet. Aus leerem Magen steigt zudem allerlei verwirrtes Zeug. Und wenn es euch wirklich Ernst gegen die Freibeuter ist, die ja manchem ein verstecktes Plätzchen gut zu bezahlen wußten – nicht wahr, nicht wahr, so ist es doch? –, dann werden wir morgen in Stralsund weitersehen. Werden sehen, wo unser Vorteil liegt. Und nun zu Tisch, liebe Herren.«
Schwerfällig und ächzend schwang er das rechte Bein vom Roß. Allein durch die weit ausladende Bewegung des unförmlichen Körpers mochte der dürre unruhige Gaul des Dänenhauptmanns gereizt werden. Mit einem schrillen Wiehern stieg das Tier kerzengerade in die Höhe. Ringsum wurde ein einziger Schrei laut. Doch ohne Zögern schlossen sich die sehnigen Beine des Kriegers um den Leib seiner Schecke zusammen. Ja, er rührte sich kaum, so fest saß er im Sattel. Zu gleicher Zeit aber sah man, wie der Knabe im weißen Kittel hochauf in den Zügeln des Schimmels hing. Die kleinen Fäuste rissen erbarmungslos am Maulbügel des Tieres.
»Laß los«, krähte der Däne ungehalten und fletschte die stockigen Zähne. Da war das Pferd schon zur Erde gebracht. Und der Helfer stand nun, keineswegs befangen, sondern die Hände stolz in die Hüften gesetzt, geschwellt von einem rauschenden Kraftgefühl, mitten in dem ihn umgaffenden Kreis. Wieder merkte er es kaum, daß seine Gefährtin auf ihn zugestürzt war, um ihm ängstlich Brust und Glieder zu befühlen.
»Unsinn«, schimpfte der Hauptmann mißfällig, »Ragazzaccio maledetto!« vervollständigte er seinen Fluch auf welsche Art, denn er hatte sich seinen ersten Kriegsruhm in den italienischen Städtekriegen erworben. Gezwungen nestelte er an seiner Ledertasche, um dem Buben ein paar Scheidemünzen zuzuwerfen, doch einer besseren Einsicht folgend, unterließ er diese Spende wieder auf halbem Wege.
»Wer ist der Bursche?« fragte statt seiner der Graf von Cona, der inzwischen auf krummen Beinen neben dem gleichfalls abgestiegenen Reichshofmeister stand. Und da er den einfachen linnenen Kittel und daneben den prächtigen Wuchs des Knaben nicht recht zusammenzureimen wußte, setzte er dringlich hinzu, denn die nahe Tafel lockte den immer Hungrigen: »Schnell, schnell, wer ist es? Gäbe einen stattlichen Knecht.«
Eine Stille entstand. Bis das Schweigen von der Stimme des Bruders Franziskus unterbrochen wurde. Einem unwiderstehlichen Trieb folgend, hatte sich der Pater vor die Kinder aufgepflanzt. Jetzt gab er besorgt die Auskunft:
»Es ist der Sohn des Fischers Claus Beckera.«
»Das ist ein lauer Hund«, stotterte der Dicke, der im ersten Augenblick seine unangenehme Überraschung nicht meistern konnte. »Sorgt schlecht für uns.« Und sein Doppelkinn unter dem Kragen des blauen Tappert weit hervorschiebend, begann er vor Verlegenheit zu poltern: »Wozu treibt sich der Sasse hier herum?«
In das Antlitz des Jungen war Hitze gestiegen, böse zerrten die dunklen Augen an dem blauen Faltenrock herum.
»Mein Vater – –«, schrie er.
Da wurde er von dem Mönch zurückgerissen. Zugleich fühlte er, wie ihm die Lippen fest verschlossen wurden.
»Er hat eine Sternscholle für die Tafel gebracht«, erklärte der Bruder ruhig und zeigte nach dem Mauervorsprung, auf dem der Riesenfisch in der Abendsonne glitzerte.
Neugierig wandte sich der Graf. Mochte es nun sein, daß ihn der Anblick des mächtigen Fanges versöhnte, oder war er sonst froh, der lästigen Begegnung überhoben zu sein, gemütlich schob er seinen Arm unter den des Reichshofmeisters und zog ihn mit sich.
»Man speist gut bei den Brüdern«, schmatzte er mit breitem Lachen. »Wer weiß, welche Überraschung unser wartet. Kommt, Herr Drost, ihr Herren kommt. Man soll den Koch nicht warten lassen.«
So zogen die Gäste, geführt von den Mönchen, durch die enge Pforte über den Grasstufen. Die Knechte leiteten die Pferde um die Mauer herum in die Ställe, und bald lag die Lichtung in Einsamkeit.
Nur ein einzelner Reiter war zurückgeblieben. Auffällig zögerte er mit dem Absitzen, lenkte seinen Rappen vielmehr spielerisch hin und her, bis der Junggraf Malte von Cona seinen Entschluß gefaßt haben mußte. Mit einem Sprung setzte sein Pferd hinter den bereits heimkehrenden Kindern her, und während die Jungmännerfaust keck und ohne Umstände in die Haarflechten des aufschreienden Mädchens griff, rief er wie zur Beruhigung mit einem zugleich harmlosen und gebieterischen Lachen, denn das Ganze sollte nach der Sitte der Zeit einen Scherz darstellen:
»Dirn, versteh Spaß, wo kommst du her?«
Die Kleine starrte ihn mit blauen Augen flehentlich an und begann vor dem vornehmen Herrn zu zittern.
»Laß ab, Herr«, stammelte auch Bruder Franziskus in aufsteigender Empörung, »es ist noch ein Kind.«
Doch der Jüngling warf dem Mönch nur einen verächtlichen Blick zu, es kümmerte den Geschorenen nichts, mit wem der Grundherr seine Belustigung auf offener Straße treiben wollte. Doch verwunderlich dünkte es den Reiter, auf welche Weise der Fischerknecht den gnädigen Scherz aufnahm. Atemlos lehnte der weiße Kittel an einer mächtigen Buche, von wo der Knabe zuvörderst ohne genaue Erkenntnis des Vorganges die bunte Pracht des Adligen in unruhiger Gier verschlang. Die überlangen Schnäbel der rosa Strümpfe, die enggepreßte rote Schecke des Wamses und darüber den kurzen gelben Kragen, der mit blitzenden Gold- und Silberstücken besetzt war. Und doch – die Faust des Burschen riß und zerrte dabei auf eine sonderliche Art an einem stämmigen Ast herum. Wollte der Lümmel etwa die schuldige Ehrfurcht vergessen? Ungläubig und geringschätzend zuckte der Junker die Achsel, dann ließ er seinen Blick von neuem hartnäckig über die feine Gestalt der Dirne laufen, die sein Anruf so völlig der Sprache beraubt hatte.
»Komm zu dir, Rotröckchen«, meinte er ungeduldig, obwohl er beifällig genug auf die nackten Füße des Kindes herabschaute. »Wo kommst du her? Bist du die Schwester des Sassen da?«
Noch immer hielt er das Ganze für einen ihm ziemenden Scherz und wunderte sich nur, warum das Mädchen so sehr in Zittern und Beben versank.
»Nein«, flüsterte sie und senkte das Haupt, »ich bin Anna Knuth.«
»Und meiner Mutter Schwestertochter«, sprach Claus hart dazwischen. Er hatte den Ast herabgerissen und trat nun, auf alles vorbereitet, näher. Dabei schauerten seine Glieder dennoch wie im Frost, denn die vererbte Achtung bäumte sich gegen die Gier, ein Abenteuer zu erleben. Rastlos schwankte die Zufallswaffe in seiner gekrampften Faust. Er wußte selbst nicht, wogegen er kämpfen sollte.
»Du bist nicht gefragt«, schleuderte ihm der Junggraf unwillig entgegen, wobei er herrisch die Rechte vorwarf, als wolle er die nahende, die unbegreifliche Auflehnung an ihren Platz bannen. »Gleich packst du dich von dannen, Tölpel.«
Der im weißen Kittel rührte sich nicht. Nur der Buchenast hörte auf zu zittern, ja, das Holz gewann von Minute zu Minute eine immer straffere Spannung. Eine Weile verharrten die drei Gestalten bewegungslos wie in der Tiefe eines Traumes. Selbst das Pferd stand gepreßt unter dem einfangenden Druck. Da vermochte sich der Zisterzienser in seiner Herzensangst am frühesten aus der Lähmung emporzuraffen. Kaltblütig schritt er, als wäre nichts Erhebliches geschehen, bis dicht an die Flanke des Rosses heran, um dort dem Tier kosend über den Hals zu klopfen. Mit großen Augen verfolgten die Jungen, die Aufgeregten, sein Tun.
»Ja, es sind Annerbäulkenkinder«,[*] sprach er im weichen Dialekt der Gegend, und keine Hast, keine Unruhe verrieten in dem ebenen Antlitz, wie sehr er mit der Überlegenheit des Alters bemüht war, die aufgepeitschten Sinne der anderen zu besänftigen. »Anna Knuths Vater ist ertrunken. Man sagt, die Schuimer hätten ihn ins Meer geworfen. Da hat sich ihre Mutter nun ein Hüttlein dicht neben den Beckeras errichtet, und Mutter und Tochter nähren sich recht und redlich vom Mattenflechten. Ein mühselig Gewerbe, Herr, das die Finger zerschneidet.«
Weisend hob er den Arm der Kleinen empor, und der Graf bemerkte nun verdutzt, wie die Hand der Blonden von schwärzlichen Kerben durchfurcht war. Das lenkte seine unüberlegte Begehrlichkeit wohltätig ab. Sofort suchte er nach Art der großen Herren das Leid der Armen durch ein Almosen zu lindern.
»Warum sagtest du das nicht gleich, dummes Gör«, tadelte er wohlwollend, während er ungestüm an einer Silbermünze seines gelben Kragens herumdrehte. »Matten? Gut, da magst du die weichsten von deinem Geflecht auf unseren Hof bringen. Mein Hund soll darauf liegen. Und hier, Rotröckchen, hier hast du deinen Lohn im voraus.«
Lachend, mit einer freigebigen Gebärde schleuderte er den abgerissenen Knopf dem Mädchen vor die Füße. Und ehe die drei Zurückgebliebenen sich noch besinnen konnten, hatte der gewandte Reiter seinen Gaul zur Seite geworfen und sprengte nun um die Mauer herum dem Stalle zu.
»Eilt nach Hause«, drängte der Bruder die beiden Kinder, die bestürzt auf das sich entfernende Klingeln der silbernen und goldenen Münzen lauschten. »Geht – geht rasch, der Mann will euch nicht wohl.«
III
Sie saßen in der Hütte der Beckeras zum kargen Nachtmahl vereint. Die Alten hatten ihren Hunger bereits gestillt und hockten ausruhend am Herd, von wo ein verglimmender Kienspan leuchtete. Zu ihnen hatte sich Anna Knuths Mutter gesellt, ein hageres, früh ergrautes Weib mit unzähligen Sommersprossen im abgemagerten Antlitz. Arbeitsverbittert sah sie aus, und vor der hereinströmenden Kühle des Meeres fröstelte die Abgezehrte häufig zusammen.
»Kalt – immer kalt«, schüttelte sie sich. Dann hob sie den gespendeten Silberknopf von ihrem Schoß, um ihn beinahe ungläubig gegen den ungewissen Lichtschein zu kehren. »Warum er das wohl geschenkt?« suchte sie in fruchtlosen Zweifeln zu ergründen; als aber die Hausfrau, die prall und rund, voll gesparter, selbstbewußter Kraft ihr gegenüberlehnte, eine heftige Bewegung gegen die Esse ausführte, wie wenn sie das Wertstück am liebsten in die Flammen schleudern möchte, denn Hilda kannte die Aufmerksamkeiten der Herren, da schüttelte die Mattenflechterin müde das Haupt. »Nicht doch – nicht doch«, wehrte sie sich gegen diesen Gedanken ihrer gewalttätigen Schwester. »Wie käme ich wohl je wieder zu solch einem Schatz? Morgen segle ich nach Stralsund und kaufe für uns Decken. Die Hauptsache ist, daß wir es warm haben.«