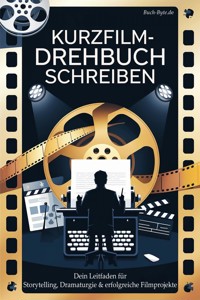Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Unbekannter verschafft sich Zutritt zu den Wohnungen alleinstehender Frauen. Er tötet sie, drapiert die Toten auf makabre Weise und hinterlässt eine Tarotkarte am Tatort. Kommissar Steiner steht vor einem Rätsel, denn der Täter schlägt scheinbar wahllos zu. Der Fall scheint unlösbar – bis der Mörder den Weg der Detektivkatze Cleo kreuzt. Nun ist ihm eine Ermittlerin auf den Fersen, deren sieben Sinne jeder Spurensicherung überlegen sind. Doch der Täter kann nur gefasst werden, wenn Katze und Kommissar zusammenarbeiten ... Begleiten Sie Cleo bei einem humorvoll und spannend erzählten Kriminalfall, der das Leben der Detektivkatze auf den Kopf stellt. Ein Thriller für Katzenfreunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Jan
Katzen sind geheimnisvoll.
In ihnen geht mehr vor, als wir gewahr werden.
Sir Walter Scott
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
Prolog
Ein Geräusch ließ Lisa aus dem Schlaf hochfahren. Das Zimmer lag im Dunkeln. Nur das flackernde Licht des Fernsehers huschte über die Wände. Seit sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, schlief sie regelmäßig in ihrem Sessel ein. Lisa ärgerte sich, denn schon mindestens dreimal hatte sie den Anfang dieses Films gesehen und noch immer wusste sie nicht, wie er endete. Verdammte Werbepausen! Sobald die Werbung einsetzte, schlief sie ein, als hätte man einen Schalter umgelegt. Sie sah sich um und stellte fest, dass ihr Hals schmerzte. Sie massierte kurz ihren Nacken und griff dann nach der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten, als es an der Tür klopfte. Lisa ließ die Fernbedienung, wo sie war, und setzte sich auf. Das war das Geräusch, welches sie geweckt hatte. Das Klopfen hatte nichts mit dem Programm zu tun, wie sie in duseligem Halbschlaf angenommen hatte. Auf dem Fernsehbildschirm demonstrierte ein übertrieben freundlicher Verkäufer die Leistungsfähigkeit eines Bodenstaubsaugers und lobte ihn in den höchsten Tönen: „Gründliche Reinigung auf allen Böden dank umschaltbarer Universal-Bodendüse. Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten den Ferrari unter den Bodenstaubsaugern für nur einhundertneunundneunzig Euro.“ Lisa sah auf die Uhr. Es war zwei Uhr fünfundvierzig. Sie fragte sich, wie viele Leute nachts das Bedürfnis verspürten, einen Staubsauger zu kaufen. Noch dazu um diese Uhrzeit! Das Klopfen wurde drängender. Und wer um Himmels willen wollte zu dieser unchristlichen Zeit etwas von ihr? Lisa schaltete den Fernseher aus, erhob sich und ging zögernd in den Flur. Sie ärgerte sich darüber, dass sie keinen Spion in die Tür hatte einbauen lassen. Sie hielt ihr Ohr an die Tür und lauschte. Erschrocken fuhr sie zusammen, als es erneut klopfte.
„Hallo? Wer ist da?“, fragte sie zaghaft. Keine Antwort. Vielleicht brauchte jemand Hilfe? Ein Einbrecher würde wohl kaum anklopfen. Was sollte schon passieren, wenn sie öffnete? Soweit sie sich erinnern konnte, war in diesem Viertel noch nie was passiert. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn die Straße, in der sie wohnte, war zwar hübsch und malerisch gelegen mit Blick auf den Park, aber sie war auch spießig und langweilig. Das einzige kulturelle Highlight dieses Wohnviertels war der Zigarettenautomat neben der Bushaltestelle. Schließlich siegte die Neugier und Lisa entriegelte das Schloss.
Als die Tür aufschwang, erkannte sie schlagartig, dass sie einen tödlichen Fehler begangen hatte. Mit ganzer Kraft warf sie sich gegen die Tür, versuchte, sie wieder zu schließen. Doch sie war dem Eindringling nicht gewachsen. Der Fremde packte sie; eine Klinge blitzte auf; kalter Stahl zerschnitt ihren Hals. Sie konnte nicht mehr schreien. Sie griff sich an den Hals, versuchte verzweifelt, die Wunde zuzuhalten. Doch das Blut spritzte pulsierend zwischen ihren Fingern hindurch, klatschte an die Wand neben der Tür und lief in Rinnsalen die Tapete hinunter. Sekundenlang stand sie da, starr vor Angst. Sie hörte ihr gurgelndes Röcheln und hellrotes, schaumiges Blut quoll aus ihrem Mund. Dann wurde ihr Blick leer, sie ließ die Hände sinken und mit einem letzten rasselnden Atemzug verebbte der Schmerz. Lisa war tot. Einen Moment lang trotzte sie noch der Schwerkraft, dann kippte sie zur Seite und krachte wie ein gefällter Baum auf das Parkett neben dem gestreiften Kokosteppich. Der Mörder stieg über sie hinweg, darauf bedacht, nicht in die Blutlache zu treten, die sich nun ausbreitete. Seine Arbeit war noch nicht getan. Und er wusste, niemand würde ihn stören.
„Heute werden sie die bedauernswerte Lisa finden. Immer noch berauscht von der letzten Nacht, male ich mir aus, wie es sein wird: Die Bäckerei, in der sie als Verkäuferin arbeitet, öffnet um sieben Uhr. Aber Lisa wird es nicht sein, die die Ladentür aufsperrt und die ersten Kunden begrüßt, wie sonst immer. Die Kollegen aus der Backstube werden denken, Lisa verspätet sich. Fünf Minuten, zehn Minuten — das kann jedem Mal passieren. Aber nach einer Stunde werden sie langsam sauer, weil sie sich bis zu Lisas Ankunft nun auch noch um den Verkauf kümmern müssen. Sie werden versuchen, Lisa anzurufen. Aber weder auf dem Handy noch auf dem Festnetzanschluss werden sie Erfolg haben. Es wird klingeln und klingeln, aber niemand nimmt den Hörer ab. Vielleicht ist ihr etwas passiert? Ist sie krank geworden? Lisa wohnt allein. Wenn sie nicht in der Lage ist, sich krankzumelden, dann tut es auch kein anderer. Und je später es wird, umso beunruhigender sind die Gedanken, die sich den Kollegen aufdrängen. Gegen Mittag, wenn das letzte Brot aus dem Backofen gezogen wurde, wird man beschließen, bei ihr vorbeizuschauen.
Ich freue mich schon auf den gellenden Schrei, den es zweifellos geben wird, wenn man ihren toten Körper findet.
Ich werde um die Mittagszeit meinen Wagen ganz in der Nähe parken, damit ich dabei sein kann; damit ich den Schrei hören kann; damit ich die Angst in ihren Augen sehen kann, wenn sie vor Entsetzen aus dem Haus gerannt kommen. Und kotzen. Heute werden sie sie finden, oder vielmehr das, was von ihr übrig ist.“
1. Kapitel
War das eine Nacht! Abgekämpft, nass und frierend, müde und hungrig war ich durch das offene Klofenster hereingekommen — mein üblicher Weg, wenn ich von draußen kam. Ich schlich durch den Flur zur Küche. Mein Fressnapf war blitzeblank sauber und … leer! Das konnte ich schon von Weitem riechen, trotzdem ging ich hin und sah hinein. Vom Boden des Edelstahlfutternapfes starrte mir ein enttäuschtes Katzengesicht entgegen, das mir nur bedingt ähnlich sah, denn es war durch die Rundung des Napfes verzerrt und verzogen. Ich inspizierte die Küche. Alles war aufgeräumt; nichts Fressbares lag herum. Der Vorratsschrank war nicht aufzukriegen, seit mein Frauchen, sie heißt übrigens Sarina, ihn mit einem Gummiband gesichert hatte. Den Kühlschrank hatte ich noch nie aufbekommen, obwohl ich es schon etliche Male versucht hatte. Ich wusste, dass Sarina dort die leckersten Sachen versteckte. Aber beim Backofen hatte ich schon zwei- oder dreimal Glück gehabt. Also versuchte ich es dort noch einmal. Ich hängte mich an den Griff und in dem Moment, als die Ofenklappe nach unten schwang, sprang ich weg. Geschafft! Der Backofen war offen … und leer. Mist. Einmal hatte ich einen kalten Braten darin gefunden, der schon in Scheiben aufgeschnitten war. Ich hatte eine Scheibe nach der anderen herausgezerrt und verputzt, bis ich so voll war, dass ich kaum noch auf die gepolsterte Eckbank springen konnte, um mein Verdauungsschläfchen zu halten. Je mehr ich an dieses Festmahl zurückdachte, umso lauter knurrte mein Magen. Es nützte nichts, ich musste mein Frauchen in die Küche holen.
Es war noch ganz still im Haus. Ich trottete also wieder den Flur entlang und fand die Schlafzimmertür angelehnt. Ich drückte mit der Pfote dagegen. Der Türspalt wurde breiter und ich schlüpfte hindurch. Ich sprang auf das Bett, setzte mich aufs Kopfkissen und betrachtete mein Frauchen. Sarina war Ende zwanzig und der hübscheste Langbeiner, den ich je gesehen hatte. Besonders ihre Augen gefielen mir. Sie waren denen einer Katze nicht ganz unähnlich. Aber jetzt waren ihre Augen zu. Sie schlief noch fest, aber ich fand, es war Zeit, aufzustehen. Schließlich musste sie sich um mich kümmern. Ich war ihre Katze! Und ich hatte jetzt Hunger. Vorsichtig tippte ich mit der Pfote ihre Nase an. Keine Reaktion. Dann drückte ich ihr meine kalte, feuchte Nase ins Gesicht. Das klappte meistens, aber heute drehte sie sich weg und ich sah nur noch ihr goldblondes verwuscheltes Haar. Die Decke hatte sie vorsorglich bis zum Hals hinaufgezogen. Kein Arm oder Bein ragte darunter hervor, mit dem ich hätte kuscheln können. Also stieg ich auf den Hügel, den ihr Körper unter der Bettdecke formte, und begann, zu trampeln und zu pföteln und verpasste ihr eine Rückenmassage allererster Güte. Mürrische Laute von sich gebend, drehte sie sich unter der Bettdecke. Es hatte den Anschein, als ob sie noch nicht gewillt war, munter zu werden. Ich überlegte, wie ich sie am schnellsten aus dem Bett kriegen könnte. Das Bett hatte eine Umrandung, die aus Schränken und einem über dem Kopfende befindlichen Regal bestand. Hier hatte Sarina ein paar Kristallsachen aufgestellt, eine hübsche Schale, ein Kerzenständer, eine kleine Vase. Ich sprang auf das Regal und schob mit der Pfote eines der Kristallteile in Richtung Abgrund. Das kratzende Geräusch, das das Kristall auf dem Regalbrett verursachte, ließ sie normalerweise aus den tiefsten Träumen hochfahren. Wie gesagt, normalerweise. Heute nicht. Pech gehabt. Ich schob das Dekoteil weiter, es stürzte ab, landete aber weich auf dem Kissen — eine Handbreit neben Sarinas Kopf. Keine Reaktion. Sie schlief tief und fest. Nachdem Nase antippen, Rückenmassage und der Kristallteiltrick fehlgeschlagen waren, blieb mir nur noch eine letzte, drastische Maßnahme, um sie wach zu kriegen. Ich sprang auf den Nähmaschinentisch, der in einer Ecke des Schlafzimmers stand, und von dort auf den Kleiderschrank, der bis knapp unter die Zimmerdecke reichte. Dann kroch ich auf dem Schrank entlang, bis ich die Stelle erreicht hatte, die sich genau über Sarina befand.
Ich schätzte noch mal die Flugbahn ab, dann sprang ich nach unten auf den Bettdeckenhügel, unter dem mein Frauchen friedlich schlummerte. Geschlummert hatte. Mit einem Schreckenslaut fuhr sie aus dem Schlaf hoch und wollte grade loszetern. Doch da fiel ich ihr um den Hals, als hätte ich sie jahrelang nicht gesehen, rieb meinen Kopf an ihr und drückte ihr meine kalte Nase ins Gesicht. Dagegen war sie machtlos. Sie nahm mich in den Arm, streichelte mich und meinte:
„Du hast wohl Hunger, was?“ Ich schnurrte.
„Du hast ja Recht, Cleo. Ich stehe ja schon auf.“ Mit einem Seufzer schwang sie die Beine aus dem Bett und verschwand im Bad. Geschafft. Ich schlenderte schon mal voraus in Richtung Küche. Als Sarina aus dem Bad gekommen war, sich angekleidet hatte und sich endlich in der Küche blicken ließ, füllte sie als Erstes meinen Napf. Erwartungsfroh kam ich angetrabt, blieb dann aber abrupt stehen. Wie kam sie nur auf diese abstruse Idee, mir dieses Latzikatz-Zeug vorzusetzen? Man sollte es „Latzikotz“ nennen. Wer um Himmels willen frisst denn so was? Wieso hatte sie kein Bashe für mich? Keine Hühnerbrühe? Ich musste mir unbedingt ein paar Erziehungsmethoden einfallen lassen. Als Erstes: Futterboykott! Ich schnupperte kurz, dann drehte ich mich gleichgültig weg und sprang aufs Fensterbrett. Sarina würde bald zur Arbeit gehen, spätestens in einer halben Stunde. Solange konnte ich den Futterboykott auf jeden Fall durchhalten.
Das Fensterbrett war breit, aber die Aussicht deprimierend. Seit einer Viertelstunde grollte ich mit dem drögen Anblick, der mir jede Lust verhagelte, nach draußen zu gehen. Regennass glänzte die Straße im Licht der Laternen. Die Nacht war lange vorbei, doch der Himmel war so wolkenverhangen, dass sich die Straßenbeleuchtung nicht ausgeschaltet hatte. Nebelschwaden hingen über den Wiesen im gegenüberliegenden Park. Auf dem Gehweg vor unserem Haus hatte der Wind einen kleinen Laubhaufen zusammengeschoben, der nun nass an den Steinen klebte. Ich setzte mich auf, streckte ein Hinterbein an meinem Nacken vorbei und begann mich zu putzen. Mein samtig weiches Fell war schwarz und so dezent von Rot durchsetzt, dass die meisten Langbeiner mich für eine schwarze Katze hielten. Nur mein linkes Hinterbein war rot. Akribisch leckte ich die hübschen weißen Flecken auf meiner Brust und meinem Bauch. Besonders stolz war ich auf meine weißen Zehenspitzen, die ganz gleichmäßig alle vier Pfoten zierten.
Als ich mit der Morgentoilette fertig war und mein Pelz im Schein der Küchenlampe schimmerte, hockte ich mich hin und legte meinen buschigen Schwanz, der so gar nicht zu einer Hauskatze passte, um meine Pfoten herum.
Seit einigen Tagen war die Heizung, die sich unter dem Fensterbrett befand, eingeschaltet. Die aufsteigende Wärme hüllte mich ein und machte mich schläfrig. Es würde ein fauler Tag werden. Zu nass für neue Abenteuer. Ich würde heute drinbleiben, mir ein weiches, gemütliches Plätzchen suchen und den Tag einfach verschlafen. Aber auch für einen langen Schlaf musste man gerüstet sein. Ich erhob mich und spähte zu meinem Futternapf hinüber. Er war immer noch gut gefüllt mit diesem Latzikotz-Zeug. Na ja, besser als nichts. Ich schaute zu meinem Frauchen. Sarina saß am Küchentisch. Ihr Teller war bereits leer, also keine Chance, noch etwas Wurst abzustauben. Seit einigen Minuten starrte sie in die Zeitung.
„Oh mein Gott …“ Sarinas Stimme bebte. Hastig las sie den Artikel in der MORGENPOST:
„Leichenfund in der Parkstraße
Gestern Mittag wurde die verstümmelte Leiche der zweiundvierzigjährigen Lisa G. in ihrer Wohnung entdeckt. Besorgte Arbeitskollegen wollten nach dem Rechten sehen, nachdem Lisa G. nicht zur Arbeit erschienen war. Sie fanden die Eingangstür unverschlossen. Als sie eintraten, machten sie die grausige Entdeckung und verständigten sofort die Polizei, die wenig später am Tatort eintraf. Der leitende Ermittler, Kriminalhauptkommissar Steiner, wollte sich noch nicht zu dem Fall äußern. Auf die Frage, ob ein Zusammenhang zu den anderen beiden Morden bestehen könnte, die im Abstand von wenigen Tagen unweit vom jetzigen Tatort verübt worden waren, antwortete er ausweichend, die Ermittlungen hätten grade erst begonnen. Wenn alle Spuren gesichert wären, würden sie auch auf Parallelen achten. Bis jetzt deute jedoch nichts auf einen Zusammenhang zwischen den Morden hin. Über den Zustand der Leiche wollte sich Steiner aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Doch der Anblick muss sehr schockierend gewesen sein, da sich die Arbeitskollegen, die Lisa G. gefunden hatten, in ärztliche Behandlung begeben mussten. Eine anonyme Quelle aus dem Krankenhaus Süd erklärte, dass die Kollegen der Toten einen schweren Schock erlitten hätten und einer der Kollegen von einer Tarotkarte berichtet habe, die er am Tatort gesehen haben wollte. Es ist zurzeit unklar, ob dieses Detail von Bedeutung ist.“
Sarina ließ die Zeitung sinken. Sie war beunruhigt, das spürte ich. Neugierig sprang ich auf ihren Schoß, rieb meinen Kopf an ihrem Kinn und atmete den Duft ihres Haares. Es roch nach Shampoo und irgendwie nach Mandeln. Ich pfötelte auf ihrem Schoß, ließ mich nieder und warf einen Blick auf die Seite, die sie gerade gelesen hatte. Ich sah das Bild eines Tatortes: die Umrisse eines am Boden liegenden Langbeiners waren mit weißer Kreide auf den Fußboden gemalt worden. Neben dem Foto gab es jede Menge von diesen Schriftzeichen. Die ganze erste Seite war voll davon. Und ganz oben sah ich die Fotografie einer Frau. Sie kam mir bekannt vor. Ich prägte mir das Bild ein und versuchte, mich zu erinnern, woher ich sie kannte.
Doch dieser Zeitungsartikel war nur ein weiteres Puzzleteilchen. Irgendetwas stimmte in der Welt der Langbeiner nicht. Die Unbekümmertheit und Vertrautheit, mit der sie bisher miteinander umgegangen waren, war verschwunden. Jetzt beherrschte die Angst unser ganzes Revier. Eine eisige Atmosphäre aus Misstrauen griff wie ein Virus um sich. Die Herbststürme, mit denen der Oktober in diesem Jahr Einzug hielt, taten ihr Übriges. Die Langbeiner eilten, in dicke Mäntel gewickelt, mit hochgeschlagenem Kragen durch die Straßen. Ihre Mützen oder Kapuzen hatten sie tief in die Stirn gezogen, um gegen die lausig kalten Stürme geschützt zu sein. Die meisten murmelten nur einen kurzen Gruß, ansonsten wechselten sie kaum ein Wort. Meist beäugten sie sich nur misstrauisch, wenn sie aneinander vorbeieilten. Viele blickten sich ängstlich um, als ob sie sich verfolgt fühlten.
Und noch etwas war mir aufgefallen, das mich nachdenklich machte: Jeden Abend, wenn Sarina von der Arbeit kam, schloss sie die Tür ab und legte die Kette vor. Das hatte sie bis vor ein paar Tagen nie getan. Sarina hatte Angst. Und so sehr ich auch versuchte, zu begreifen, was sie derart beunruhigte, ich konnte mir keinen Reim darauf machen.
2. Kapitel
Als Sarina am Abend nach Hause kam und die Kette vorgelegt hatte, zog sie die Schuhe aus, hängte ihre Jacke auf einen der Messingbügel an der Garderobe und ging als Erstes in die Küche. Ich hatte es fertiggebracht, die Hälfte von diesem Latzikotz-Zeug übrig zu lassen. Sarina nahm den Napf und ging damit ins Bad. Sie kippte den Rest wortlos in die Toilette und drückte die Spülung. Das hätte ich am liebsten gleich heute Morgen getan, als sie mir dieses Zeug aufgetischt hatte. Sie wusch meinen Napf aus und füllte ihn mit Bashe, meinem Lieblingsfresschen. Na bitte, geht doch! Ausgehungert stürzte ich mich auf das frische, herrlich duftende Futter und schlang alles in Rekordzeit hinunter. Sarina hatte sich eine Limonade aus dem Kühlschrank genommen und war ins Wohnzimmer gegangen. In einer Ecke des Wohnzimmers befand sich ein Schreibtisch, auf dem so ein flacher Kasten stand. Jeden Abend klappte sie den oberen Teil dieses Kastens hoch. Das hochgeklappte Teil wurde dann hell und erwachte irgendwie zum Leben. Auf dem unteren Teil des Klappkastens, wo sich lauter flache Klötzchen mit merkwürdigen Zeichen drauf befanden, tippte sie dann herum und diese merkwürdigen Zeichen erschienen dann auch auf dem oberen, beleuchteten Teil. Manchmal piepste dieses Dings oder eine fremde Stimme sagte: „Sie haben Post.“ Am Anfang bin ich nach diesem Hinweis gleich zur Katzenklappe gelaufen, aber der nette Briefträger, der fast jeden Morgen kam, war nirgends zu sehen. Und Post war auch keine da. Merkwürdig.
Nun liege ich meistens auf Sarinas Schoß und versuche zu ergründen, was sie da treibt. Manchmal, wenn dieses Ding sagt, dass Post da sei, lächelt Sarina. Und einmal hat sie mir die Fotografie von einem Langbeiner gezeigt. „Schau mal, Cleo“, sagte sie, „sieht der nicht nett aus?“ Ich spürte ihre Aufregung. Ja, er sah ganz nett aus, aber ich konnte ihn nicht riechen. Das heißt, dieses Dings, auf dem Sarina immer herumtippte, roch wie immer. Ich konnte den Geruch von diesem Langbeiner nicht wahrnehmen. Also wusste ich noch nicht, ob ich ihn riechen konnte oder nicht. Da verstehe einer die Langbeiner! Es sah fast so aus, als hätte sich Sarina in diesen Langbeiner verliebt, ohne ihn jemals gerochen zu haben. Langsam machte ich mir wirklich Sorgen um mein Frauchen. Ach, könnte ich ihr doch nur eine richtige Freundin sein! Als Erstes würde ich ihr raten, erst mal abzuwarten, wie der Typ riecht. Mein Liebesleben sah zwar nach Alfreds Tod im letzten Jahr auch nicht mehr so rosig aus, aber immerhin hatte ich bis vor Kurzem noch ein Liebesleben. Nun schleichen ab und zu ein paar neue Verehrer ums Haus, mehr oder weniger stattliche Kater, die mir hin und wieder Mäuse auf die Terrasse legen. Aber um Sarina mache ich mir wirklich langsam Sorgen. Bei meinem Frauchen habe ich, solange ich hier wohne, noch nie einen Langbeiner gesehen, der ihr mäuseähnliche Geschenke brachte. Keine Ahnung, was Langbeinermännchen ihren Auserwählten vor die Tür legen. Fleisch vom Metzger? Oder Fertigfutter von der Imbissbude? Ist Sarina nur deshalb noch allein, weil der Hund vom Nachbarn diese Geschenke heimlich wegfuttert? Vielleicht sollte ich mich auf die Lauer legen und unsere Eingangstür im Auge behalten. Jedenfalls war noch nie ein männlicher Langbeiner bei uns zu Besuch. Aber wenn ich mir’s so überlege, ist es kein Wunder, dass Sarina keinen Freund hat. Denn jeden Tag geht sie ins Badezimmer und badet dort oder duscht. Das ist ja auch so weit okay, dagegen will ich ja gar nichts sagen. Aber wenn sie sauber ist, dann schmiert sie sich übel riechendes Chemiezeug überall auf die Haut und dieselt sich dann noch mit Spraydosen und kleinen Flakons ein, dass es einem den Atem verschlägt. Spätestens, wenn Sarina zur Spraydose greift, ist der Moment gekommen, in dem ich das Bad fluchtartig verlasse. Langsam mache ich mir Sorgen. Sie kann ja kein Männchen abkriegen, wenn sie sich immer so eindieselt. Dabei hätte sie ohne diesen ganzen Chemiekram so einen wunderbaren natürlichen Duft. Darum wälze ich mich gern in dem Haufen getragener Wäsche, der jedes Wochenende neben der Waschmaschine liegt. Ich liebe es, wenn es nach Sarina duftet, nicht nach Chemie. Am allerliebsten mag ich ihre Socken.
3. Kapitel
„Ich musste es tun. Schon wieder. Ich sah diese roten Locken und das freche Grinsen, da musste ich ihr einfach folgen. Es war nicht geplant. Doch der Drang, dieses Miststück zu beseitigen, war übermächtig. Ich war nicht darauf vorbereitet, doch vielleicht würde sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Also folgte ich ihr durch die Stadt, wartete wie zufällig vor Geschäften, in denen sie Besorgungen machte, stand am Hotdogstand hinter ihr in der Schlange. Sie bemerkte mich nicht. Sie traf eine Bekannte und schnatterte lautstark drauflos. Sie ließ sich über ihren Ex-Mann aus und schien ihr Single-Leben sehr zu genießen. Perfekt. Sie wohnte anscheinend allein. Als ob das noch nicht genug des Guten wäre, schlug sie nach diesem kurzen Stopp eine Richtung ein, die mir sehr gelegen kam. In dieser Gegend kannte ich mich aus. Hier war mein Jagdrevier. Nach etwa zwanzig Minuten wurden ihre Schritte langsamer und sie kramte in der Handtasche nach dem Schlüssel. Wir waren anscheinend angekommen. Sie ging die Einfahrt hinauf, schloss die Tür auf und verschwand in dem hübschen Einfamilienhäuschen. Ich sah mich um. Auf der Straße war niemand zu sehen; keiner der Nachbarn hielt sich im Garten auf; niemand schaute aus dem Fenster. Trotzdem war es riskant. Ich wusste viel zu wenig über sie. Es hätte sein können, dass noch jemand im Haus war, doch jetzt war mir alles egal. Ich folgte ihr zur Haustür und drückte die Klingel. Sie öffnete mir arglos. Die Tür war noch nicht ganz offen, da packte ich mit beiden Händen ihren Hals, schob sie ins Haus zurück und trat mit dem Fuß gegen die Tür, sodass sie ins Schloss flog. Ich hielt sie am Hals gepackt und lauschte. Meine Sinne waren geschärft, wie die eines Raubtiers. Das Ticken einer Wanduhr hallte aus einem der Zimmer; ein Kühlschrank brummte, ansonsten war kein Laut zu hören. Sie war allein. Ich konnte mir Zeit lassen und mein Werk in aller Ruhe vollenden. Ich sah ihren Schlüsselbund, den sie auf dem kleinen Garderobenschränkchen abgelegt hatte. Es würde also auch kein Problem sein, heute Abend noch einmal her zu kommen, um eine Tarotkarte neben der Leiche zu platzieren.
Es ist jedes Mal anders und doch immer gleich: Ich liebe die Angst in ihren Augen. Ich kann ihre Panik fast körperlich spüren, wenn sie schreien wollen, aber nicht können, weil sich meine Finger um ihre Kehle schließen. Und zudrücken. Am schönsten ist es, wenn man den Kehlkopf zerquetscht hat. Man kann getrost loslassen, denn es gibt dann keine Rettung mehr. Aber der Tod wird sie erst in etwa acht oder neun Minuten ereilen. Sehr lange Minuten. Die Erkenntnis in ihren Augen, wenn sie begreifen, dass das Grauen erst seinen Anfang genommen hat, ist einfach überwältigend. Wenn ich das Messer aus meiner Manteltasche hervorzaubere, sind sie starr vor Entsetzen. Und sie schnappen nach Luft, wie Fische auf dem Trockenen. Die Augen treten fast aus ihren Höhlen heraus, als bekämen sie Stielaugen. Oder liegt das am langsamen Ersticken? Egal. Die Schlampen begreifen schnell, wer hier das Sagen hat. Jetzt zetern sie nicht mehr. Sie wollen, dass ich Mitleid mit ihnen habe. Sie können es natürlich nicht sagen, aber ich lese es in ihren Augen. Mitleid! Es gibt kein Mitleid. Das Urteil ist längst gefällt.“
Die Terrassentür öffnete sich und Bobby, der kleine Kläffer der Lehmanns, schoss aus dem Haus, als hätte er einen Raketenantrieb. Er preschte durch den Garten, blieb vor dem gegenüberliegenden Zaun stehen und bellte das Nachbarhaus an. Dieses merkwürdige Verhalten zeigte er schon seit Tagen. Frau Lehmann, die schon ahnte, was kommen würde, spurtete hinter ihm her, packte ihn am Halsband und schleifte ihn zurück ins Haus. Es war nicht möglich, ihn in den Garten zu lassen, ohne dass er die Nachbarschaft zusammenbellte.