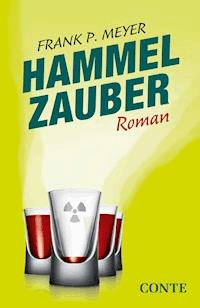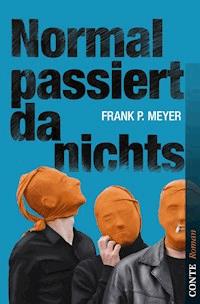Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Für ein Treffen mit früheren Kommilitonen kehrt Peter Becker nach Oxford zurück. Doch der eigentliche Grund für seine Reise ist Laureen Mills Beerdigung. Als ihre Leiche jetzt, über zwei Jahrzehnte nach ihrem spurlosen Verschwinden, gefunden wird, erwartet niemand mehr ernsthaft die Aufklärung dieses Falles. Zur selben Zeit sind weitere Ehemalige in Oxford, die die College-Bibliothekarin kannten: Louise, Ed, Brandy Jones und der Bischof – allesamt Mitglieder im exklusiven "Club der Romantiker". Inspector Osmer ahnt nichts von der Verbindung der Clubmitglieder zur Toten, und sein Vorgesetzter will, dass der alte und scheinbar unlösbare Fall endlich zu den Akten gelegt wird. Aber der Zufall und ein immer nervöser werdender Ex-Romantiker spielen dem Ermittler und seinem übereifrigen Sergeant in die Hände. Ein spannender und überraschender Roman vor und hinter den Kulissen des altehrwürdigen Oxford.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Prolog
»Liebling, Jesus hat angerufen.«
Jesus? Schon wieder?
»Du sollst dich melden.«
Auch das noch. Worum es wohl geht? Es hat keinen Zweck, nicht zurückzurufen. Jesus hat eine Nachricht für ihn. Und das ist beunruhigend.
Teil IMichaelmas
1
Natürlich wird er zur Beerdigung gehen, immerhin war er es gewesen, der sie erschossen hatte. Die Beerdigung ist der eigentliche Grund. Nur wegen des Ehemaligentreffens würde er nicht nach Oxford fahren. Seit 24 Jahren hat er es vermieden, dorthin zurückzukehren. Jetzt will er doch hin, um endlich mit dem Unglück abschließen zu können, das ihm damals widerfuhr. Ihm? Der armen Laureen war es widerfahren. Streng genommen war es ein Unfall gewesen. Ein unglücklicher Zufall. Egal, welchen Begriff er für das Geschehene ausprobiert hat, es bleibt doch immer die Schuld. Seine Schuld. Manchmal schreckt er mitten in der Nacht hoch, wenn auch nicht mehr so oft wie früher. Dann sieht er sich mit der Pistole in der Hand. Der Schuss verhallt. Die anderen starren ihn an. Vor ihm liegt der leblose Körper. Er ist nicht alleine schuld, aber mehr als die anderen, die dabei gewesen sind.
Die anderen. Dr. Corvus hatte Peter Becker am Telefon mitgeteilt, Frau Buckwood habe ihre Teilnahme angekündigt und ausdrücklich nach ihm gefragt. Auch Dr. Davies käme sicher. Und Dr. Branwen Jones war informiert worden. Von Gareth hatte Dr. Corvus nichts gesagt. Warum sollte er auch? Offizieller Anlass des Anrufs war natürlich das Ehemaligentreffen und nicht die Beerdigung, und Gareth war an einem anderen College gewesen. Dr. Corvus hatte nicht versäumt, darauf hinzuweisen, dass die Beerdigung nur einen Tag vor dem großen Ehemaligen-Dinner stattfindet.
Wie wird es sich anfühlen, mit den anderen zusammen an dem Grab zu stehen, in das die sterblichen Überreste von Laureen Mills hinabgelassen werden? Viel an sterblichen Überresten konnte wohl nicht mehr vorhanden sein.
Dr. Corvus arbeitet also immer noch im College. Schon Anfang der Neunziger hatte er alt gewirkt. Seine ergrauenden schwarzen Haare und die krächzende Stimme ließen Dr. Corvus bereits damals gealtert erscheinen. Dazu kam die schnabelartige Nase, die so weit aus dem Gesicht ragte, dass sie an eine Pestnase erinnerte. Als er Dean des Colleges geworden war, musste er tatsächlich noch recht jung gewesen sein. Vielleicht war auch einfach vergessen worden, ihn in Rente zu schicken. Oder er ist längst in Rente und arbeitet unentgeltlich weiter, weil er nicht weiß, wo er sonst mit sich hinsoll.
»Sie waren doch näher bekannt mit Laureen Mills, oder irre ich mich, Herr Professor?«
»Bitte lassen Sie den Professor weg«, hatte er Corvus am Telefon verbessert, »ich bin kein Professor mehr, sondern arbeite jetzt als Lehrer an einer Dorfschule. Schon lange. Sie sagen, Louise Buckwood kommt auf jeden Fall, und Edward Davies auch? Ganz sicher?«
»Wie bitte? Ach so, das Ehemaligentreffen, ja, Frau Buckwood hat, wie gesagt, ausdrücklich nach Ihnen gefragt. Sie heißt jetzt übrigens anders. Hat einen Schotten geheiratet, aber ich müsste nochmal in meinen Unterlagen nachschauen, welchen Mac genau sie auserwählt …«
»Nicht nötig, Dr. Corvus, bitte sagen Sie ihr, falls sie nochmals nachfragt, dass ich komme.«
»Bestimmt wird sie nachfragen. Ich hatte in der Tat den Eindruck, dass Frau Mac… Buckwood durchaus Wert darauf legt, dass ich Sie erreiche, Dr. Becker. Professor Bishop ist übrigens immer noch in Oxford, jetzt allerdings im Exeter College, Gott sei’s geklagt. Ich kann gerne den Kontakt zu ihm herstellen, sobald Sie hier eingetroffen sind.«
»Danke, das mache ich selbst. Aber bitte sagen Sie auch Branwen Jones, falls Sie in Kontakt mit ihr treten sollten, dass ich zur … zum Ehemaligentreffen komme.«
»Natürlich, Dr. Becker. Dazu bin ich als Alumni-Beauftragter ja da. Vor allem, wenn es um ein Treffen in Oxford selbst geht.« Bei Dr. Corvus hört man daran, wie er ›in Oxford selbst‹ sagt, dass er die Welt in zwei große Hemisphären aufteilt: in Oxford und in den Rest, von dem, wenn überhaupt, allenfalls die Oxforder Filiale, Cambridge, als ebenbürtig zu erachten ist.
Seine Nachricht hatte Corvus jedenfalls überbracht, und Peter Becker steht ein Ehemaligentreffen bevor, an dem er normalerweise nicht teilnehmen würde, sowie eine Beerdigung, die mit fast einem Vierteljahrhundert Verspätung stattfindet.
Von dem kleinen walisischen Dorf, in dem er lebt, nach Oxford ist es eine halbe Tagesreise. Da er erst nach der Schule, am späten Nachmittag, losfahren kann und nicht mitten in der Nacht in Oxford ankommen will, hat er beschlossen, nur bis Liverpool zu fahren, dort zu übernachten und am nächsten Morgen nach Oxford weiterzureisen.
Er hat sich für ein Hotel am Albert Dock entschieden. Da er Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hat – er ist zu aufgeregt bei dem Gedanken, doch wieder nach Oxford zurückzukehren –, verlässt er sein Hotelzimmer zu einer Zeit, die in seinem jetzigen Leben spät für ihn ist. Er geht zur Mathew Street und dort die verheißungsvolle Wendeltreppe hinunter in den Kellerclub, in dem er zuletzt vor einem Jahr gewesen ist, auf einem Nachmittagskonzert, bei dem John Lennon-Lieder gespielt wurden.
Der Gewölbekeller ist gut gefüllt. Er taucht in die Menschenmenge ein und in die Livemusik, trinkt das erste Bier gleich an der Theke. Dann noch eins. Er hofft, dass es ihm spätestens nach dem dritten Bier gelingt, sich vorzugaukeln, es sei alles in Ordnung und sein Leben sei soweit normal verlaufen. Das war es im Grunde ja auch. Er hat eine Frau, eine Tochter, beide gesund, ein Haus und einen sicheren Job. Allerdings hat er auch eine Ex-Frau und einen inzwischen erwachsenen Sohn in Deutschland, den er seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Daran versucht er so selten wie möglich zu denken. Daran nicht und nicht an die sprichwörtliche Leiche, die er noch im Keller hat.
Er ergattert einen freien Stuhl an einem Tisch direkt vor der Bühne. Sein Plan ist, spätestens mit dem vierten Pint so viel von seiner Unruhe ertränken zu können, dass er im Hotel doch noch ein paar Stunden Schlaf findet. Es ist Jahre her, seit er vier Bier an einem Abend getrunken hat.
Die Melodie des Songs pfeifend, den die Band gerade gespielt hat, geht er aufs Herrenklo, um Platz für mehr Flüssigkeit zu schaffen. Als er am Pissoir steht, singt er vor sich hin: »I once had a girl, or should I say she once had me. She showed me her room. Isn’t it good? Norwegian Wood hm-hm-hm-hm.«
Er versucht sich zu erinnern, wie der Text weitergeht, da singt eine brummige Stimme von irgendwoher die Strophe weiter: »She asked me to stay and she told me to sit anywhere.« Peter dreht erschrocken den Kopf und lenkt dabei beinah den Strahl aus der Pissoir-Schüssel heraus. Die Stimme kommt offensichtlich aus einer der verschlossenen Klokabinen. »So I looked around and I noticed there wasn’t a chair.«
Soll das ein Scherz sein? Setzen die Betreiber des Clubs jemanden hinter eine Klotür, der angefangene Beatles-Songs zu Ende singt, falls einem Gast der Text ausgeht?
»Hallo, Kumpel. Guter Song. Haben sie den drinnen gerade gespielt?«
»Ja?«, antwortet Peter und hebt dabei so die Stimme, dass es wie eine Frage klingt.
»Kommst du öfter hierher, Kumpel?«, brummt es von hinter der Klotür. »Ich komme jede Woche einmal von Tranmere rüber, von der anderen Mersey-Seite, mit der Fähre.«
Reflexartig fragt Becker den Unbekannten in der Klokabine: »Tranmere? Bist du Tranmere Rovers-Fan?«
»Ja«, tönt es von hinter der Klotür, » ich verpasse kein Heimspiel. Scheiß auf Liverpool. Und Everton. Oh, ist sonst noch jemand da, Kumpel?« Becker schließt den Hosenschlitz und schaut sich um: »Scheint nicht so, wenn nicht in einer der anderen Kabinen noch ein …«
»Scheiß auf die Roten, ich gehe nur zu den Blau-Weißen. Aber man muss vorsichtig sein, sogar hier im Club. Auch die Roten hören Beatles-Musik. Und müssen mal aufs Klo. Das wäre ja noch schöner, dass mir ein Liverpool-Fan im Cavern Club eine aufs Maul haut. Oh, sorry mein Freund, ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt. Bist du etwa … nein, du klingst nicht wie ein Liverpool-Fan. Everton vielleicht? Damit könnte ich leben. Ich würde sofort alles zurücknehmen, was ich eventuell über Everton gesagt … also, wen unterstützt du? Alles kein Problem, solange es nicht Arsenal ist. Oder Manchester United. Nee, ich mache nur Spaß, keine Angst. Du klingst nach Waliser. Bist du Waliser?«
»Ja, nein, ich wohne schon seit … ja, also ich gehe dann mal wieder rein. Will noch ein bisschen Musik hören.«
»Gar kein Ding, Kumpel. Hör mal: Wie heißt du, Kumpel?«
»Peter«, antwortet er, wieder reflexartig, und verflucht sich leise dafür. Was, wenn dieser Idiot sein Geschäft erledigt hat und nachher durch den Club schreit: Peter, Kumpel, wo bist du? Die nächste Runde geht auf mich.
Da öffnet sich die Klotür einen Spalt. Fünf Finger erscheinen, dann ein behaarter Handrücken: »Peter, lass mich dir die Hand schütteln! Willkommen in Liverpool, Kumpel.«
Obwohl der zur Hand gehörende Mann hinter der Tür sich ihm nicht vorgestellt hat, gibt Peter beinah dem Reflex nach, die Hand zu schütteln, zuckt aber im letzten Moment zurück. »Angenehm … ähm, ja«, stottert Peter. Der behaarte Handrücken verschwindet wieder in der Klokabine, die Tür bleibt aber einen Daumenbreit offen, als lauerte die Hand dahinter darauf, doch noch eine Chance zu bekommen, nach Peter zu greifen. Der schaut auf seine eigenen Finger, ist sich nicht sicher, ob die behaarte Hand ihn nicht doch ganz kurz berührt hat. Er hält seine Hand mit ausgestrecktem Arm angeekelt ein Stück von sich und geht zum Waschbecken. Während das Wasser läuft, hört er nicht auf das Geplapper, das durch den Türspalt dringt. Peter wäscht sich ausgiebig die Hände. Als er den Wasserhahn abdreht, hört er: »Bleibst du noch länger im Club, Peter? Oder …«
»Ich muss gleich weg«, fällt Peter ihm hastig ins Wort, »bin auf der Durchreise. Bin spät dran, will morgen vor Mittag in Oxford sein.«
»Oxford? Weißt du, dass dort in den nächsten Tagen eine Frau beerdigt wird, die vor fast 25 Jahren spurlos verschwunden ist? Irre Sache.«
Peters erstarrt einen Moment, dann fragt er: »Woher weißt du das?«
Ein junger Mann betritt, die Melodie von Yesterday pfeifend, das Männerklo.
»Aus den Nachrichten«, sagt die Stimme hinter der Klotür.
Der junge Mann schaut auf die einen Spalt offenstehende Klokabine, aus der es spricht. Er hat aufgehört zu pfeifen, fragt: »Stör ich, Jungs?«, und dreht sich nach Peter Becker um. Aber der ist verschwunden, rennt bereits die Wendeltreppe hoch. Erst draußen auf der Mathew Street atmet er tief durch. Schließt kurz die Augen. Dann beeilt er sich, wegzukommen.
Ein Mann kommt aus der Toilette, schaut sich am Tresen vorsichtig um, reckt den Hals, lässt den Blick über die kleinen Tische bis vorne zur Bühne schweifen. Dann geht er zur Wendeltreppe, sieht sich noch einmal um. Er kramt sein Smartphone aus der Hosentasche und schreibt: P. ist unterwegs zu euch nach Oxford.
2
Mein Vater schenkte mir seinen alten Opel Kadett Kombi. Er dachte, ich sei jetzt endgültig verloren und wollte mir einen letzten Gefallen erweisen.
Er und meine Mutter waren heilfroh, als ich mein Studium geschafft hatte, auch wenn ich mir dafür einige Semester länger als angekündigt gegönnt hatte. Nach dem Studienabschluss hätte alles gut sein können. So meinten zumindest meine Eltern. Und Beate. Sicher hätte ich irgendwo eine Stelle in Pendlerdistanz zum Baugrundstück bekommen, das mein Großvater noch in der Hinterhand hatte, mit Blick auf das Dorf und die Flussaue, aber nein, nun wollte ich auch noch eine Doktorarbeit schreiben.
Schon die Idee mit dem Studium war schwer zu verdauen gewesen für meine Familie, die seit Generationen ganz auf Kohle und Stahl gesetzt hatte. Als ich nach dem Abitur gestand, dass ich mich nirgends wohler fühle als in einer Bibliothek, erntete ich betrübte Blicke. Bei meinem Vater keimte zwar zwischenzeitlich die unausgesprochene Hoffnung auf, der nach dem Abitur anstehende Wehrdienst könnte mich noch zur Vernunft bringen. Aber nachdem ich am östlichen Rand unserer Republik den Russen, der damals angeblich ständig vor der Tür stand, erfolgreich davor abgeschreckt hatte, die innerdeutsche Grenze zu überschreiten, war ich nicht mehr an Kompromissen interessiert, und es kam für mich nicht in Frage, mich für immer in unserem Tal niederzulassen. Ich studierte vor allem, um von zuhause wegzukommen. Und wegen des sagenumwobenen Studentenlebens natürlich. Zum Glück nahmen damals, in den frühen Achtzigern, eine Handvoll weiterer Primstaler ein Studium auf und zog in WGs, so dass mein Lebensplan nicht allzu abwegig erschien.
»War doch klar, dass der Junge nicht hierbleibt«, meinte mein Großvater, »der passt doch gar nicht hierher«, was mir als Erklärung nun auch wieder nicht gefiel – obwohl mir klar war, wie er darauf kam: Aufgrund meiner schulterlangen Mähne, dem üppigen Bart, der Nickelbrille, sowie dem mir bereits seit der Bundestagswahl 1983 anhaftenden Verdacht, einer dieser Grünenwähler im Dorf zu sein, sahen mich nicht nur meine engsten Verwandten in direkter geistiger Linie zu den 68ern. Dennoch half mir mein Vater, ein Zimmer in einer heruntergekommenen Straße hinter der stillgelegten Tuchfabrik in Trier einzurichten. Er freute sich darüber, dass in dieser Nachbarschaft, deren Sozialstruktur man heute als prekär bezeichnen würde, eine Bude für 160 Mark Warmmiete zu kriegen war. Immerhin musste er sie bezahlen, bis ich im dritten Semester ein Stipendium von einer Gewerkschaftsstiftung bekam. Er erschrak allerdings darüber, dass einer meiner WG-Mitbewohner, ein Philosophiestudent mit noch gewagterer Barttracht als ich selbst eine trug, im Treppenhaus freudig verkündete, dass ich in die um die Ecke liegende Kneipe namens Simplicissimus getrost noch nach elf Uhr einkehren könne. Ihn jedenfalls würde ich dort fast jeden Abend bis halb eins antreffen.
Die Dachzimmerbude war in anderthalb Stunden komplett eingerichtet. Da ist die Halbliterflaschenpause schon mit eingerechnet, die wir uns gönnten, nachdem wir die gerahmten Bilder meiner Lieblingsküsten, Beachy Head und die Klippen von Moher, über dem kleinen Schreibtisch an die Wand genagelt hatten.
Nach getaner Arbeit gingen wir durch die Germanstraße, an zweifelhaften Clubs mit roten Leuchtreklamen vorbei, zum Viehmarktplatz, um dort an einer Imbissbude Currywurst mit Pommes zu essen. In den Schlaglöchern des Platzes stand schlammgraues Wasser. Die Currywurst war genießbar. Zumal wir sie mit einem Bier runterspülten und sicherheitshalber noch einen Kurzen hinterhergossen. Wegen meines verstohlenen Blicks in Richtung der roten Leuchtreklamen machte sich mein Vater keine Sorgen. Wohl aber wegen meiner unverhohlenen Vorfreude auf die Bibliotheken. Ich hatte herausgefunden, dass ich keine zwei Fußminuten von der Trierer Stadtbibliothek entfernt wohnte. Der Blick meines Vaters schien zu sagen: Also Bibliotheken, mein Junge, da bin ich mir nicht sicher. Man weiß nie, was einen da erwartet. Als mein Vater sich verabschiedete, um zurück nach Primstal zu fahren, hoffte er, noch genau ein einziges Mal bei einem Umzug Hand anlegen zu müssen, nämlich dann, wenn der Spuk vorüber war und ich nach dem Studium wieder nach Hause kam.
Mit dem Stipendium für Oxford hatte niemand ernsthaft rechnen können, nicht einmal ich selbst. Aus Deutschland wäre ich auch weggegangen, wenn es nicht Oxford geworden wäre, trotz der gerade herrschenden landesweiten Euphorie. Zuerst hatte ich die Zusage für ein Stipendium in Dublin bekommen. Über Dublin hatte ich viel Gutes gehört. Über die Pubs, das Bier und die Livemusik und über die Irinnen, die angeblich sehr unkompliziert sein konnten. Einer aus unserem Dorf wohnte da. Christian. Der war ein oder zwei Jahre älter als ich und hatte Mitte der Achtziger, noch während seiner Studienzeit, in Dublin ein kleines Unternehmen gegründet. Bei ihm hätte ich bestimmt jobben können. Und wohnen vielleicht. Auch Rolf und Andi hatten mir von Irland vorgeschwärmt. Sie überlegten damals selbst, dorthin auszuwandern, wenn auch nicht nach Dublin, sondern an die Westküste. Da hätte ich also schon Leute gekannt, die wiederum Leute kannten, und das hätte meine Eltern weniger verängstigt. Aber mein Professor erklärte mich für verrückt, als ich ihm eröffnete, ich wolle lieber das Stipendium am Dubliner Trinity College annehmen als das in Oxford. Für Beate machte es keinen Unterschied, ob ich nach Dublin oder Oxford ging. Mit ihr hatte ich unerfreuliche Diskussionen darüber, dass ich überhaupt länger als zwei Wochen ohne sie weg wollte. Nicht, dass sie auch nur einen Augenblick ernsthaft in Erwägung gezogen hätte, mitzugehen. Nicht um alles in der Welt hätte sie Primstal verlassen. Dann lieber mich. »Ist doch höchstens für zwei Jahre«, machte ich den kläglichen Versuch, die Streitereien zu beenden, »den Rest der Doktorarbeit schreibe ich dann hier fertig. Du wirst sehen, wie schnell …« aber ehrlich gesagt wollte ich, anders als Beate, nicht darüber nachdenken, was in zwei Jahren sein würde. Also Oxford. Mein Vater bot mir nicht an, beim Umzug zu helfen und ich bat ihn auch nicht darum. Wir wussten beide nicht, ob ich schon nach zwei Wochen wieder zurückkäme oder nie wieder.
Deshalb gab er mir seinen alten, metallicgrünen Kadett Kombi mit. So wie früher Väter ihren Söhnen das Erbschwert mitgaben oder den Familiengaul oder was man sonst in der Fremde gebrauchen konnte. Natürlich war es auch eine gute Ausrede für ihn, sich nach zehn Jahren endlich selbst wieder einen neuen Wagen anschaffen zu dürfen. Aber ich bin sicher, er wollte mir – wenn sonst schon nichts – wenigstens ein Gefährt mitgeben, auf das Verlass war: den altgedienten Familiendiesel, an dem die schnöden englischen Rovers, Mini Coopers oder diese dreirädrigen Möchtegernautos zerschellten, falls ich mit den Straßenseiten einmal durcheinanderkommen sollte.
Da ich eine Abendfähre gebucht hatte, fuhr ich am helllichten Tag los und machte gleich auf den ersten Kilometern einen Umweg über einen der Hügel, um einen letzten Blick auf das Tal zu werfen.
Nach der Fährüberfahrt überhitzte schon kurz hinter Ashford der Motor. Unserem treuen Familiendiesel bekam offensichtlich die Inselluft nicht. Wäre er ein Gaul gewesen, hätte ich ihn erschießen müssen. Bei Maidstone fuhr ich von der Autobahn ab und war froh, dass ich mitten in der Nacht eine Werkstatt fand, in der noch Licht brannte. Wenige Sekunden, nachdem ich die Klingel gedrückt hatte, war der Werkstattbesitzer an der Tür. Er könne sowieso nicht schlafen, sagte er, bevor ich eine Entschuldigung zurechtstottern konnte. Er blickte in den bis unters Dach mit Kram vollgepackten Kadett, dann auf das Nummernschild und fragte, in welche Richtung ich unterwegs sei: nach Hause oder weg von dort. Ich sagte, dass ich zum Studieren nach England käme. Erwähnte nichts von einer Doktorarbeit und schon gar nichts von Oxford. Er fragte auch nicht weiter. »Schätze, du bist in der falschen Richtung unterwegs«, sagte er, »bei euch ist doch gerade richtig was los. Da geht’s jetzt bergauf. Mischt wieder ganz oben mit in der Weltpolitik und so.« Er sagte es ganz ruhig, ohne Groll. Er brauchte nicht lange, bis er die Stelle fand, wo das Kühlwasser austrat. Er wechselte einen Schlauch, bastelte an einem Ventil herum und meinte schließlich: »Jetzt geht’s wieder, zumindest für eine Weile.«
Er berechnete mir nur die Materialkosten für den Schlauch und die nachgefüllte Kühlflüssigkeit, und bot mir einen Kaffee an. Während wir den tranken, erzählte er mir, dass sein Sohn wohl genau so alt sei wie ich. Zwei, drei Jahre jünger vielleicht.
»Wo ist er?«, fragte ich und wunderte mich über mich selbst, dass ich das fragte.
»Momentan noch in Deutschland stationiert. Seine Einheit wird aber wohl bald in den Golf verlegt. Kuwait, so viel ich weiß«, antwortete der Vater nach kurzem Zögern, »hab sonderbarerweise schon seit Wochen nichts von ihm gehört. Sei froh, dass ihr euch die letzten Jahrzehnte aus so einem Mist raushalten konntet.« Er machte mir den Tank voll, bevor ich weiterfuhr, und winkte ab, als ich für den Sprit zahlen wollte.
Es war noch stockdunkel, als ich von den Chilterns ins Themsetal fuhr. Erst als ich nach Oxford kam, begann sich das dunkle Blau über den träumenden Türmen aufzuhellen. Bevor ich in die Stadt kam, machte ich in einem Park im Vorort Headington eine kurze Pause, um den restlichen Marmorkuchen aufzuessen, den meine Mutter mir gebacken hatte. Von dort oben sah Oxford aus wie ein zu groß geratenes Dorf.
Die einzigen Fahrzeuge, die mir in der High Street begegneten, waren der Milchwagen und ein fast leerer Linienbus. Die runden Scheinwerfer des Milchwagens blickten mich traurig an, und der Bus schien mir im Vorbeifahren zuzuraunen: Was willst du denn hier? Kehr um, noch schläft Oxford, noch hat niemand mitbekommen, dass du hier warst!
Ich bog von der falschen Seite in die Turl Street ein. Der Straßenplan, den ich auf den Oberschenkeln ausgebreitet hatte, zeigte zwar die Einbahnstraßen mit Pfeilen an, aber ich ignorierte sie einfach und war froh, in dem mittelalterlichen Straßengewirr überhaupt zum Tor der Pförtnerloge zu finden, vor dem ein absolutes Halteverbot galt. Ich war hundemüde und wollte nur den Schlüssel für mein Zimmer haben und herausfinden, wo genau dieser Parkplatz in der Farndon Road war, auf dem ich das Auto abstellen durfte.
Ich atmete durch, bevor ich eintrat. Ab 6 Uhr sei die Porters’ Lodge besetzt, hatte das College mir geschrieben. Als ich eintrat, fröstelte es mich bei dem Gedanken, dass ich hier keinen einzigen Menschen kannte. Und niemand mich. Ich wusste nicht einmal, was ich jetzt tun musste. Mich anmelden wie in einem Hotel? Mich vorstellen? Mit Vor- und Nachnamen?
Als ich durch das geöffnete Glasfenster in die Pförtnerstube schaute, sah ich eine hagere Gestalt im dunklen Anzug und die grauen Haare eines Hinterkopfes. Der Pförtner sortierte etwas in einem großen Schlüsselkasten, der an der Wand hing. Obwohl ich mich nicht bemerkbar gemacht hatte, drehte der Pförtner sich plötzlich um, blickte mich einen Augenblick an und sagte dann: »Sieh an, Peter, Peter Becker, nicht wahr? Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise von Trier? Willkommen im Jesus College!«
»Die College-Pförtner haben auch Augen am Hinterkopf«, erzählte mir Alex später, »und die Hüter der Toreingänge riechen, wenn jemand etwas ausgefressen hat. Außerdem kennen sie sämtliche Studenten ihres Colleges namentlich. Sie kriegen vor Semesterbeginn eine Liste der Neuen und deren Fotos und lernen die Namen auswendig. So wissen sie schon, wer man ist, bevor man zum erstem Mal über die Schwelle der Pförtnerloge tritt.« Einige der neuen Studenten fühlten sich dadurch wie eine Berühmtheit. Andere wiederum fragten sich erschrocken, ob schon Steckbriefe mit ihrem Konterfei in Oxford aushingen, bevor man überhaupt etwas ausgefressen hatte.
Der Pförtner erlaubte mir nicht, den Kadett gleich auszuladen, da ab halb sieben die Turl und die Ship Street Milchautos, Kehrmaschinen und anderen Liefer- und Arbeitsfahrzeugen vorbehalten seien. Er gestattete mir, eine Reisetasche für eine halbe Stunde bei ihm in der Porters’ Lodge zu deponieren, den Rest könne ich ja am Abend nach dem Dinner ausladen, da sei die Ship Street weniger frequentiert. Der Pförtner sprach ein Englisch wie aus einem uralten Schulbuch. Ich bekam eine Parkmarke für den Hof des Studentenwohnheims Stevens Close, wo ich den Kombi sogleich hinbrachte. Von dort ging ich eine Viertelstunde zurück ins College, um mir endlich mein Zimmer anzusehen. Auf dem Weg sah ich in der St. Giles’ Street, gleich neben der St. Benet’s Hall, einen Obdachlosen am Gehsteigrand auf einer niedrigen Mauer sitzen. Zwei mit alten Kleidern und Flaschen gefüllte Co-op-Tüten standen vor der Mauer, wo auch ein alter Schlafsack lag. Er trug einen spitzen Zauberhut und jonglierte gekonnt mit drei Zwiebeln. »Haben Sie etwas Kleingeld, verdammt?«, murmelte er. Ich kramte eine 50-Pence-Münze aus der Hosentasche. Er jonglierte alle drei Zwiebeln in eine Hand und streckte die andere aus. Ich legte die Münze in seine Handfläche. Die Finger schnappten zu, wie eine fleischfressende Pflanze, in die sich eine Fliege verirrt. Im Nu ließ er die 50 Pence in der Jackentasche verschwinden und warf die Zwiebeln wieder hoch. »Etwas Kleingeld?«, murmelte er wieder, »verdammt.«
3
Niemand erwartet von Detective Chief Inspector Osmer ernsthaft, dass er diesen Fall löst, und er selbst hat auch nicht vor, sich länger mit diesen alten Knochen zu befassen. Selbst der Chief Superintendent hatte ihm klar gesagt, er solle bloß nicht zu viel Zeit auf diese alte Sache verschwenden, die sowieso nicht mehr aufzuklären sei. Keiner von denjenigen, deren Aufgabe das eigentlich gewesen war, ist noch bei der Thames Valley Polizei. Die Knochen des damaligen hauptverantwortlichen Ermittlers, Inspector Pilkington, sind inzwischen genau so verblichen wie die von Laureen Mills, nur dass niemand das Bedürfnis oder einen Anlass hat, Pilkingtons Gebeine genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie ruhen in Frieden auf einem malerischen Friedhof in Abingdon. Die verschwundene Bibliothekarin war einer von Pilkingtons letzten Fällen gewesen. Kurz zuvor hatte er noch den Mord an einer Oxforder Büroangestellten aufgeklärt, deren Mann sie erschlagen, ihre Innereien ausgeweidet und den restlichen Körper so präpariert hatte, dass die Leiche nicht roch, und sie schließlich zuhause im Wohnzimmer unterm Holzfußboden deponierte. Die breiten Holzdielen, unter denen die Leiche lag, hatte der Mörder im Blickfeld, wenn er sich samstagsabends im Fernsehen die Topspiele in Match of the Day ansah. Aber die alte Spürnase Pilkington fand auch geruchlose Leichen. Außerdem hatte er sich in Oxford 1991 dadurch eine solide Popularität erworben, dass er einige der gefürchteten Joyrider erwischte. Deshalb wurde bei seiner Abschiedsfeier 1992 in keiner der zahlreichen Lobreden, eine davon von Chief Constable Sir Charles Pollard persönlich, darauf eingegangen, dass Pilkington einen Fall ungelöst hinterlassen hatte. Seine Nachfolger wechselten in rascher Abfolge und hatten mit so verschiedenen kniffligen Fällen zu tun, dass die verschwundene Bibliothekarin des University College irgendwann nebensächlich wurde und sich bei der Thames Valley Police niemand mehr darum kümmerte. Fairerweise muss man sagen, dass damals keinerlei Anhaltspunkte ermittelt werden konnten, die im Zusammenhang mit dem plötzlichen Verschwinden von Laureen Mills auf ein Verbrechen hatten schließen lassen. Es kam durchaus vor, dass jemand Oxford fluchtartig und ohne sich zu verabschieden verließ. Allerdings handelte es sich dabei zumeist nicht um festangestellte Bibliothekarinnen.
Und auch jetzt, ein knappes Vierteljahrhundert später, liegen außer der Leiche keine wirklich neuen Erkenntnisse vor. Selbst die lokale Presse interessiert sich nur mäßig für den Fall, was zum einen daran liegt, dass in der Öffentlichkeit die Aufregung über die Brexit-Wahl immer noch alle anderen Themen überdeckt. Zum anderen hat die Polizei der Presse bislang einige wichtige Details zum Leichenfund vorenthalten, um noch kein Täterwissen preiszugeben. Inzwischen ist die Leiche zur Beerdigung freigegeben. Die halbherzig geführten Ermittlungen haben keinerlei Ergebnisse gebracht. Detective Chief Inspector Osmer, den seine Kollegen auch No Osmer nennen, weil er auf unbritische Art sehr unverblümt »Nein« sagen kann, darf es sich schon als Erfolg anrechnen lassen, überhaupt herausgefunden zu haben, dass es sich bei dem zufälligen Leichenfund um die Gebeine der Bibliothekarin Mills handelt. Dazu hatte es der Hilfe einer Pathologin aus London bedurft, die DCI Osmer während seiner Zeit in Birmingham kennen und schätzen gelernt hatte. Das immerhin hatte die zufällige Entdeckung der Leiche als erfreulichen Nebeneffekt mit sich gebracht, nämlich dass die Pathologin mehrere Tage in Oxford verbringen musste, unter anderem um die ungewöhnliche Fundstelle der sterblichen Überreste genauer unter die zu Lupe nehmen. Die Fundstelle wird vor der Öffentlichkeit noch geheim gehalten. Nur die Leitung und der Chef-Pförtner des University College sind darüber informiert, wo und unter welchen Umständen die ehemalige Mitarbeiterin gefunden wurde. Dass es sich tatsächlich um die vor über 24 Jahren verschwundene Laureen Mills handelt, konnte die Pathologin aufgrund des Gebissabdrucks feststellen, den der ehemalige schottische Zahnarzt der Verschwundenen noch immer in seiner Praxis im Glasgower Stadtteil Partick aufbewahrt.
Inspector Osmer begleitet die Pathologin nach Abschluss ihrer Arbeit zum Bahnhof. Sie sprechen nicht über den Fall. Gestern Abend hat die Kollegin ihre Untersuchungen in Oxford abgeschlossen. Vor ihrer Rückkehr nach London bestand sie darauf, mit Osmer auszugehen. Dazu hatte Osmer nicht »no« gesagt. Auch nicht dazu, dass sie nach der letzten Runde im White Horse noch mit in seine Wohnung gekommen war.
Bevor er ihr beim Einsteigen in den Zug mit dem Gepäck hilft, lächeln beide sich verlegen an. »Danke«, sagt Inspector Osmer, »es war schön, mit dir … zu arbeiten.«
Sie errötet. »Ich habe zu danken, Herr Kollege.«
Er bleibt nicht am Bahnsteig stehen, um ihr nachzuwinken, denn das tut man nicht unter Kollegen. Man weiß nie, ob nicht sonst noch irgendwelche Beamten der Thames Valley oder der Metropolitan Police per Zug unterwegs sind.
Bevor er zurück ins Büro geht, kauft er sich die Oxford Mail. »Entschuldigung«, sagt er zu einem Mann, den er am Zeitungsständer versehentlich anrempelt. »Kein Problem«, antwortet der und greift nach der Oxford Times. Er trägt einen grünweißen Schal.
*
Peter Becker wirft die Zeitung aufs Bett und wickelt sich den Schal vom Hals.
Nachdem er zu Fuß vom Bahnhof zur Porters’ Lodge gegangen war, hatte er sich zunächst nach Ray erkundigt. Aber die beiden jungen Pförtner wissen nichts von einem Random Ray. Haben noch nie von ihm gehört. Sie lächeln Becker freundlich zu. Natürlich ist Ray schon längst nicht mehr im College. Er muss schon Anfang der Neunziger an die 60 gewesen sein. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt.
In der Porters’ Lodge erfährt Peter, dass im College selbst kein Zimmer mehr frei ist. Er muss mit einem Zimmer in der Ship Street vorliebnehmen. Von dort hat er einen direkten Blick auf die College-Bibliothek und auf das nördliche Eingangsportal.
Auf dem Weg durchs College zur Ship Street bildet er sich ein, die steinernen Fratzen der Wasserspeier beäugten ihn argwöhnisch, so als ob sie ihn wiedererkennen und sich daran erinnern, was er damals getan hat.
Er blättert in der Oxford Times, die er am Bahnhof gekauft hat, und überfliegt den kurzen Artikel, den er zur Beerdigung findet: »Leiche freigegeben, Beisetzung am Freitagnachmittag, 15 Uhr … University College übernimmt die Beerdigungskosten.« Nichts über polizeiliche Ermittlungen. Er will gar nicht wirklich wissen, was in letzter Zeit über den Fall berichtet worden ist. In der Beerdigungsankündigung steht nichts davon, was die Obduktion ergeben hat. Kann man eine fast 25 Jahre alte Leiche noch obduzieren? Es wird lediglich erwähnt, dass die Todesumstände noch immer ungeklärt seien. Aber die Kugel in Laureens Schädel werden sie doch wohl gefunden haben. Ob die Thames Valley Police noch an dem Fall dran ist? In den überregionalen Nachrichten hat Peter nichts über den Fall gehört. Er weiß überhaupt nur von Corvus’ Anruf, dass die Leiche gefunden wurde und dass morgen die Beerdigung stattfindet; von polizeilichen Ermittlungen hatte Corvus nichts gesagt. Falls doch noch welche im Gange sind, ist Peter Becker zur falschen Zeit am falschen Ort.
4
Bei bestem Spätsommerwetter hatte ich auf der Primstaler Kirmes Abschied gefeiert und die lauwarme Septemberluft mit nach Oxford genommen. Wenn ich in den ersten Tagen des Michaelmas-Trimesters im zweiten Innenhof saß und nach oben über die gerundeten Sandsteingiebel blickte, glich das Blau genau dem des Himmels über unserem Kirmesplatz.
Ich roch den Sandstein, als ich an jenem Septembermorgen 1991 mit meinem Zimmerschlüssel in der Hand zum ersten Mal durch die drei Innenhöfe ging. Jedes Mal, wenn ich mir später den zweiten Innenhof, den Second Quad, vorstellte, gaukelte mir meine Erinnerung den Geruch von Sandstein vor. Sandstein riecht bei jedem Wetter anders. Das wusste ich von zuhause. Als Kinder spielten wir oft im alten Steinbruch am Ende der Haagstraße. Dort rieselte es immer an irgendeiner Stelle, vor allem wenn nach längerem Regen die Sonne die rotbraune Wand erwärmte. In unserem Steinbruch hörte man die Zeit rieseln. Als Kind stellte ich mir vor, die Felsen unseres Steinbruchs seien viele tausend Jahre alt. Erst später lernte ich, dass man bei Steinen in anderen Zeitdimensionen denken muss.
Der Sandstein, aus dem das College erbaut worden war, ist von einer anderen Farbe als der unseres Steinbruchs. Honiggelb, heißt es offiziell. Die müssen einen recht blassen Honig in England haben. Auch die Struktur des College-Sandsteins ist anders als die unseres Steins in der Haagstraße. Viel feiner. Dadurch wirkt er stabiler. Da rieselt nichts. Zumindest nicht, so lange man nicht daran kratzt.
Das College hat zwei Ein- und Ausgänge. Der Haupteingang befindet sich in der Turl Street. Ein großes Holztor, das an den Eingang eines mittelalterlichen Klosters erinnert, führt zur Porters’ Lodge. Dort befanden sich auch die pigeonholes, die »Taubenlöcher«, wie die alphabetisch geordneten Postfächer genannt wurden. Sie waren zu jener Zeit für sämtliche Collegemitglieder das wichtigste Kommunikationsmedium.
Die beiden großen Torflügel des Haupteingangs blieben meistens geschlossen. Man benutzte die Tür im Tor: ein kleines Türchen, bei dem jemand von meiner Körperlänge den Kopf einziehen oder sich gar ein wenig bücken musste, um hindurchzugehen. In meiner Erinnerung ist der Durchlass nicht viel höher als eine Saustalltür. Dieser Vergleich sagt den meisten Oxfordstudenten nichts. Kaum einer von ihnen wird je eine Saustalltür gesehen, geschweige denn sich schon einmal durch eine hindurchgebückt haben.
Das College hat drei Innenhöfe, die man Quads nennt. Im ersten Quad befinden sich auf der rechten Seite die Chapel und die Wohnung des Principals, dem Oberhaupt des Jesus College. Links die Verwaltungsbüros, mit weiß gestrichenen Sprossenfenstern. Mir fielen gleich die türlosen Eingänge auf, die in die einzelnen Treppenhäuser führten. Geradeaus, über ein Gehwegkreuz, das die Rasenfläche des Innenhofs in vier Teile zerschnitt, und über abgewetzte Sandsteinstufen gelangte ich in den großen Essenssaal, die Hall. Durch einen holzverkleideten Durchgang ging ich in den zweiten Quad. Von dort aus wiederum führte mich in nördlicher Richtung ein Rundbogen in den dritten Innenhof. Über dem Durchgang war eine Laterne angebracht, auf der die Aufschrift POLICE zu lesen war. Ich stellte mir vor, dass ein ehemaliger Absolvent es zum Chief Superintendent gebracht und bei der Auflösung irgendeiner Polizeistation diese Lampe sichergestellt hatte, um sie seinem College zu vermachen. Oder es war irgendein Studentenstreich, dessen vollständigen ironischen Gehalt ich noch nicht zu würdigen wusste. Der dritte Quad ist enger und dunkler als die beiden ersten und nicht quadratisch, sondern länglich. Von diesem Quad aus gibt es wiederum ein großes Holztor, das damals meistens verschlossen war und für dessen Saustalltür man einen Extraschlüssel brauchte. Wenn man den hatte, konnte man auch direkt von der Ship Street jederzeit ins College kommen.
Der zweite Innenhof bildet ein wunderschönes Quadrat, mit 52 geschwungenen Zieraufsätzen, die sich rundum auf allen Seiten über die Fenster der oberen Stockwerke wölben – eine ebenmäßige Renaissancefassade in blassem Honiggelb, die eine solide Harmonie vorspielt. Nur der gemauerte Kamin der großen Hall durchbricht das Bild perfekter Gleichmäßigkeit. In der Mitte des zweiten Quads befindet sich eine quadratische Rasenfläche, auf der tagsüber die Studenten saßen, wenn es trocken war. Um das Rasenquadrat herum stehen einladende Holzbänke. Und auch hier, im inneren Innenhof, verschlossen damals keine Türen die Zugänge zu den einzelnen Treppenhäusern. Die sandsteingerahmten Eingänge sahen aus wie große Münder, die »Oh« machten. Vor allem hier, im zweiten Quad, konnte ich die Jahrhunderte des Sandsteins riechen, konnte riechen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen er aufgesogen hatte in den vergangenen vierhundert Jahren, und wohl auch viel Kotze, die sich nach Bällen, Partys oder spontanen Saufgelagen auf die gar nicht mehr honiggelben Gehwegplatten ergossen hatte. Ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich als Collegestipendiat wohl nicht mehr »Kotze« sagen sollte, sondern »Erbrochenes«‹, oder »Resultat eines revoltierenden Magens« oder wie es sonst auf Oxfordisch heißen mochte.
An einigen Stellen im College waren flache Mauerstücke abgeplatzt. Dort war der Sandstein aufgeraut und dunkel verfärbt. Das College würde nicht umhinkommen, hier bald ein paar Renovierungsarbeiten durchzuführen. Und tatsächlich standen neben der Toreinfahrt des dritten Innenhofs auch schon einige Paletten mit frischen, schmalen Sandsteinblöcken bereit.
Von den gut 450 Jesus-Studenten wohnten knapp 150 im College. Auch für die restlichen 300 gab es collegeeigene Wohnungen, die sich auf Nord-Oxford und den südöstlichen Vorort Cowley verteilten. Im ersten Jahr aber wohnte man im College, wohl um den richtigen Stallgeruch zu bekommen. Die Zugänge zu den Zimmern waren in zwanzig Treppenaufgänge aufgeteilt, und wurden, in römischen Zahlen, von Staircase I bis XX durchnummeriert. Ich war im Staircase XX untergebracht, musste also durch sämtliche drei Innenhöfe durch, wenn ich von der Pförtnerloge her ins College kam. Die Treppenhäuser hatten drei Stockwerke und unseres war das einzige mit einer Holztreppe, deren schiefe Stufen so knarzten, dass es unmöglich war, sich unbemerkt hinauf- oder herunterzuschleichen.
Das Erdgeschoss wurde nicht als Wohnraum genutzt. Ich war im ersten Stock untergebracht, in einem Zimmer mit unebenem Holzfußboden, begehbarem Kleiderschrank und einem bay window, einem dreigeteilten Erkerfenster. Beinahe hätte ich mir vorstellen können, in der Kapitänskajüte eines alten Segelschiffes zu wohnen, wenn das Fenster nicht aus dem College hinaus in die Welt, genau gesagt auf die geschäftige Haupteinkaufsstraße Oxfords, die Cornmarket Street, gezeigt hätte und wenn nicht alle paar Minuten das rote Dach eines Doppeldeckerbusses im Sichtfeld der Fensterscheiben vorbeigeglitten wäre. Wenn man das Fenster hochschob, roch es nach Diesel. Direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, blickte man in den ersten Stock einer HMV-Filiale sowie in Räume, die zu einem Restaurant gehörten.
Pro Stockwerk gab es drei Zimmer, die alle von einem quadratischen Flur abgingen, sowie eine kleine Gemeinschaftsküche und ein Bad. Außer mir wohnten im ersten Stock noch Sergej, direkt gegenüber, und Alex, dessen Zimmer neben meinem lag. Niemand war imstande, eine Teetasse oder ein Sherryglas auf englischere Art zu halten und zu Munde zu führen als Alex, und wenn er mit einer geäußerten Meinung nicht einverstanden war, pflegte er mit süffisantem Unterton zu fragen: »Tatsächlich? Glaubst du das wirklich?«
Sergej war ein Russe aus Sankt Petersburg, wie man seit Kurzem wieder offiziell sagen durfte. Er nannte mich Petja oder Petrowitsch und behauptete, diese russische Varianten meines Namens klängen netter als Peter. Und Sergej beschämte mich gleich anfangs dadurch, dass ich trotz seiner Hilfe beim Reintragen ungefähr zwanzigmal zwischen dem in der Ship Street geparkten Kadett und meinem Zimmer hin- und herlaufen musste, um mein gesamtes Umzugsgepäck auszuladen. Sergejs gesamte Habe dagegen passte in eine Sporttasche und einen Wanderrucksack. Dabei bestand, wie ich später herausfand, der Inhalt der Sporttasche zu einem nicht unerheblichen Teil aus selbstgebranntem Wodka. Nicht einmal Bücher hatte er dabei. Als ich ihn einmal fragte, wie er denn in einem Zimmer ohne Bücher zurechtkäme, tippte er sich an die Stirn und sagte: »Theorrrätische Physiieek.« Als ich ihn verblüfft ansah, fügte er hinzu: »Bin prrraktisch so etwas wie Mathämatikerrr. Alläs da oben drrrin, Petja, brrrauche ich nur kleine Schiefärrrtafel.«
Ich kam mir lächerlich vor, weil ich meinen halben Hausstand mitgebracht hatte, obwohl ich die Weihnachtsferien zuhause verbringen wollte, während Sergej, wie er mir traurig erzählte, mit seinem Jahresvisum bis Ende des nächsten Sommers an England gebunden war und er es sich sowieso nicht leisten konnte, zwischendurch nach Hause zu fliegen. Sein rollender Akzent verlor sich leider rasch. Was sich aber unerschütterlich hielt, war seine Vorliebe für Wodka, die ich bald mit ihm teilte. Mindestens einmal pro Woche veranstalten wir, beide von Heimweh geplagt, ein Heilsaufen. Dabei erzählte er mir von einer gewissen Olga, bei der er sich nicht sicher sei, ob sie auf ihn warten würde. Das wäre ein guter Moment gewesen, um ihm von Beate in Primstal zu erzählen. Aber ich ließ die Gelegenheit verstreichen und wir schwärmten uns gegenseitig von der Schönheit der Sankt Petersburger und Primstaler Frauen im Allgemeinen vor.
Im oberen Stockwerk wohnten die Mädchen. Die Amerikanerin Marilyn, die trotz ihrer dicken Brillengläser attraktiv war, sowie eine Engländerin, die so unscheinbar wirkte, dass nicht einmal Sergej ihr etwas abgewinnen konnte – und das hieß schon etwas. Denn ansonsten konnte ich mit ihm keine zwanzig Meter die Broad Street entlanggehen, ohne dass er mich mit dem Ellbogen anstieß, mit den Augen in Richtung unter Pullis wippender Brüste deutete und dabei kehlige Laute von sich gab. In der Mädchenetage wohnte auch Branwen, genannt Brandy, die mich einmal beinah die schiefen Treppenstufen hinunterstieß, als ich sie in einem unaufmerksamen Moment als Engländerin bezeichnete. »Merk dir ein für alle Mal«, drohte sie mir, mit wild vor die Augen fallenden Haarsträhnen, »wenn du mit mir klarkommen willst: Ich bin genauso wenig englisch wie du! Kapiert? Ich bin Waliserin. Und Europäerin. Leider muss ich noch einen britischen Pass führen, ich hoffe aber, dass sie das in Brüssel bald ändern.« Branwen wirkte auf mich eher skandinavisch als keltisch, mit ihren hellblauen Augen und dem blonden, strohigen Haar.
Das waren die sechs, die in Staircase XX wohnten, die Männer-WG im ersten, die Frauen-WG im oberen Stockwerk. Aber sechs ist keine märchenhafte Zahl. Und tatsächlich gab es auch noch einen Siebten, der genauso zum Staircase gehörte wie wir sechs Studenten, einen, der zuweilen wie ein unsichtbarer Geist anmutete und der die beiden Stockwerke, deren Bäder und Küchen, ja sogar unsere Zimmer am Laufen hielt, der viel über uns wusste und verschwiegen war wie ein Verschwörer: Ray, genannt Random Ray. Der »Willkürliche«, der »Zufällige« Ray. Unser Diener.
Den Beinamen »Willkür« trug Ray zu Unrecht. Es stimmte zwar, dass Ray mittags bei der Essensausgabe verschieden große Portionen verteilte. Manche Studenten, zu deren Nachteil dies geschah, glaubten dabei an Zufall. Tatsächlich aber verfügte Ray über eine innere Liste von Studenten die er a) sehr mochte, b) einigermaßen mochte, c) nicht besonders mochte oder d) überhaupt nicht mochte. Je nachdem, in welche Kategorie Ray uns einordnete, fiel der Apple Crumble mit Vanillesoße als a) doppelte, b) normale, c) halbe oder d) mickrige Portion aus. Wenn Ray jedoch das Curry verteilte, verhielt es sich mit den Essensmengen genau umgekehrt. Denn das Curry war so ungenießbar, dass man gut beraten war, den dazugehörigen Reis lieber trocken zu essen. Sanjay, ein indischer Jura-Student, blieb der Hall grundsätzlich fern, wenn irgendetwas angeblich Indisches auf der Speisekarte stand. Schon bei der Nahrungsaufnahme machte das extrascharfe Curry keine Freude, weil es stundenlang die Geschmacksnerven lahmlegte. Vor allem aber bestanden gute Gründe dafür, sich vor dem Moment zu fürchten, wenn das Curry verdaut war. Dann brannte es noch einmal, wenn auch an einer anderen Stelle als beim ersten Mal. Alex flüsterte mir einmal zu, und ich gestehe, ich verstand seine Anspielung zunächst nicht, man dürfe keinesfalls unser College-Curry essen, wenn man mit dem Hintern in den folgenden 24 Stunden noch etwas vorhätte. Studenten, die Ray überhaupt nicht leiden konnte, bekamen grundsätzlich eine zweite Kelle Curry auf ihren Reis. Der freundlichen Studentin, die im Rollstuhl saß und von ihren Freunden in die Hall und vom ersten zum zweiten Quad getragen wurde, oder der blonden Waliserin mit den blauen Augen dagegen schenkte Ray ein Lächeln und gab ihnen nur einen winzigen Klecks vom Curry auf den Tellerrand, so dass genügend Reis curryfrei blieb. Bei oberflächlicher Betrachtung konnte man vermuten, die unterschiedlichen Portionen hätten etwas Zufälliges, aber wenn man Rays Vorgehen selbstkritisch reflektierte, durfte man nicht zu diesem Schluss kommen.
Ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre kam, dass bei meinem Apple Crumble der Teller vor lauter Vanillesoße fast überlief, wohingegen Ray mir beim Curry zuraunte: »Iss den Reis lieber trocken, oder ich bringe dir etwas Ketchup vorbei. Geselle dich doch zur netten Waliserin, die unter Lawrence von Arabien sitzt, der habe ich dasselbe gesagt. So, der Nächste! Ah, Edward Davies, gerne eine doppelte Portion Curry?«
Manche Studenten erschreckten sich vor Rays überdimensionierter Brille, oder genauer gesagt, vor Rays Augen, die hinter den dicken Gläsern wie die Sehorgane eines Koboldmakis wirkten und einen Blickwinkel von über 180 Grad zu haben schienen. Außerdem verstanden die meisten Studenten ihn akustisch nicht. Obwohl Ray einen breiten Mund hatte, fand die Zunge offensichtlich nicht genug Platz darin. Ray klang meistens, als schöbe er ein Wollknäuel in der Mundhöhle hin- und her. Manchmal sprach er jedoch sehr deutlich. Als Sergej und ich ihn einmal in unserer Küche trafen, während er unser Geschirr abspülte, raunte er uns gut verständlich zu: »Ihr wisst ja, Jungs, Damenbesuche sind eigentlich strengstens verboten, aber von mir erfährt keiner etwas, falls ich eine junge Dame erwischen sollte, die sich frühmorgens aus einem eurer Zimmer schleicht, und ich würde erst recht nichts verraten, wenn ich einen von euch«, er hielt inne und sah erst mich, dann Sergej vielsagend an, »morgens im Zimmer der netten Waliserin oder von mir aus auch dieser Amerikanerin vorfände. Das ist doch unnatürlich, so ein Verbot. Jungs in eurem Alter, die wollen doch auch mal … ihr wisst schon.«
Ich erzählte Alex davon und meinte: »Ray ist eigentlich ein recht toleranter Typ.«
»Tatsächlich? Glaubst du das wirklich?«, entgegnete Alex.
Ray warnte uns: »An den Tagen, an denen ich frei habe, müsst ihr allerdings aufpassen, was Damenbesuche betrifft. Meine Vertretung ist eine alte Hexe.«
Aber Ray hatte fast nie frei. Er arbeitete sechs Tage pro Woche, vormittags als Scout, wie die Diener offiziell hießen, bei uns im Staircase und mittags und abends bediente er in der Hall. Nur einmal pro Jahr fuhr er in Urlaub, und nur jedes zweite Jahr tat er dies gern, denn er hatte einen Deal mit seiner Frau eingehen müssen. Die liebte die Alpen und deshalb musste Ray alle zwei Jahre vierzehn Tage nach Österreich, wo er sich zu Tode langweilte. Fairerweise ging es dafür jedes zweite Jahr nach Newcastle-upon-Tyne, in die Industrie- und Hafenstadt im Nordosten Englands, wo er jeden Abend mit einem alten Kumpel, mit dem zusammen er vor vielen Jahren einmal eingesessen hatte, auf Kneipentour ging. Zusammen mit den Ehefrauen natürlich, aber die störten dabei kaum. Ja, Ray war in Ordnung, und er hat mich gerettet, zumindest soweit er das konnte.
Als erstes mussten wir ihm abgewöhnen, unsere Zimmer täglich mit Rosenduftaroma einzusprühen. Alex mochte das, aber Sergej schämte sich, wenn es bei ihm wie in einem Mädchenzimmer roch. Ray behauptete, die im 2. Stock liebten seinen Rosenduft. Von Branwen wusste ich aber, dass sie ihm gedroht hatte, er bekäme keine Flasche Brandy zu Weihnachten, wenn er weiterhin ihr Zimmer verseuchte. Ray erzählte mir einmal, es sei keineswegs selbstverständlich, dass ihm »seine« Studenten etwas schenkten. Sie müssten das nicht tun, immerhin erfülle er nur seine Pflicht und sei froh, überhaupt diesen Job zu haben. Aber natürlich freute er sich über jedes Geschenk. Als er nebenbei erwähnte, dass er am nächsten Tag Geburtstag habe, bekam er von mir eine Flasche Moselwein. Genau wie zu Weihnachten, da schenkte ich ihm sogar zwei. Ray gestand mir mit überschwänglicher Freude, er selbst trinke grundsätzlich nur Bier und Hochprozentiges, aber bei seiner Frau könne er für Gutwetter sorgen, wenn er sie zum Weihnachtsessen mit Moselwein überraschte. Mein Geschenk hatte also einen strategischen Wert für ihn. Alex schenkte Ray eine große Schachtel Pralinen zu Weihnachten und auch zum Geburtstag. Doch das Verhältnis zwischen ihm und Alex blieb distanziert. Höflich, aber distanziert. Vor allem Ray achtete darauf, dass das so blieb. Alex bekam von Ray meistens abgeschwächte Normalportionen, sowohl beim Apple Crumble als auch beim Curry. Sergej schenkte Ray nie etwas. Weil er es sich nicht leisten konnte. Und das wusste Ray. Sergej bekam von ihm die gleichen Portionen wie ich und die Waliserin. Bei Ray war nichts Zufall, und Willkür war ihm fremd.
5
DCI Osmer verlässt das Polizeipräsidium mit einer Brotdose und einer Thermoskanne bewaffnet in Richtung Magdalen College. Für Fälle im Oxforder Zentrum steht ihm ein Extrabüro in der St. Aldate’s Police Station zur Verfügung. Seine Kollegen haben es aufgegeben, ihn zu fragen, ob er mit in die Kantine kommt oder auf ein Pint ins Pub um die Ecke. Osmer sagt immer »no«. Nur »nein«, nicht einmal »nein, danke«. Der Inspector mag es nicht, wenn man ihm ins Essen quatscht. Er will in Ruhe auf seinem Curryhuhn-Sandwich herumkauen und seinen Tee dazu trinken. Oft geht er dazu in den Fellows’ Garden des Magdalen College. Die Pförtner dort kennen ihn, seit er beim Selbstmord einer drogenabhängigen Studentin den Vorwurf der verzweifelten Eltern hatte entkräften können, die Drogen würden über die Pförtnerloge an die Studenten verteilt. Die Hüter des Eingangstores grüßen Osmer mit aufrichtiger Freundlichkeit und wünschen ihm eine ruhige Lunch-Pause im Fellows’ Garden.
Osmer stammt aus dem Bilderbuchstädtchen Tenterden in Kent. Er hat einen Vorfahren, der im 19. Jahrhundert ein bedeutender Politiker war. Osmer interessiert sich weder für Politik noch für Vorfahren. Er konzentriert sich aufs Tagesgeschäft: Ein englischer Tourist aus Poole hatte einem Polen in der Broad Street das Nasenbein gebrochen, weil dieser lauthals eine fremdländische Sprache gesprochen habe. Das hatte der Engländer, mitten im Herzen der Stadt, die der reinsten Form der englischen Sprache ihren Namen gibt, als offene Provokation verstanden und den Polen, der mit einer polnischen Kollegin diskutierte, aufgefordert, er solle auf einer öffentlichen Straße gefälligst Englisch sprechen. Als »dieser Osteuropäer« ihn in grammatisch einwandfreiem, aber zu direktem Englisch »Jetzt gebt doch endlich Ruhe! Euer idiotischer Brexit kommt doch bald und dann sind wir hier weg« anschnauzte, hatte der Engländer sich verpflichtet gefühlt, zuzuschlagen.
Osmers Kollegen sind geteilter Meinung darüber, wie man mit dem Fall umgehen soll, ohne dass er eine unnötige politische Brisanz entwickelt. Was kümmert Osmer die politische Dimension einer gebrochenen Nase? Die polizeiliche Ermittlung geschieht unabhängig von der nationalen Zugehörigkeit der gebrochenen Knochen.
Osmer gönnt sich einen Blick von der Magdalen Bridge auf den Cherwell. Vielleicht fällt ja gerade wieder ein Tourist beim Stocherkahnfahren ins Wasser. Das ist immer lustig. Auf der Brücke steht ein Mann in grün-weißem Collegeschal. Grün-weiß … das ist doch … Jesus College, glaubt der Inspector sich zu erinnern. Allmählich hat er alle Collegefarben drauf. Nachdem er von Birmingham nach Oxford versetzt worden war, hatte er lernen müssen, dass es gar nicht die Universität Oxford gibt, sondern etwa 40 unabhängige Colleges, alle mit eigener Verwaltung, eigener Leitung, eigenen Studenten, eigenem Pfarrer, Arzt, Wohnheimverwalter, eigener Bibliothek, Bar, eigenem Waschsalon, Kiosk und vor allem mit eigenem Finanzhaushalt. Aufgrund einiger Fälle, in denen er in Colleges ermittelt hatte, wusste Osmer, über welch üppige Jahresetats diese verfügen. Manch englische Kleinstadt wäre mit dem Budget gut versorgt, das den betuchteren Colleges zur Verfügung steht.
Wenn es in einem College etwas zu ermitteln gibt, ist das immer kompliziert. Die Collegemitglieder bilden so engverbundene Netzwerke, dass für Außenstehende schwer einzuschätzen ist, mit welcher Frage man sich an wen richten soll. Osmer bevorzugt die Taktik, sich zuerst einmal an die Pförtner zu halten.
*
Peter schaut von der Magdalen Bridge auf die Verleihstation der Stocherkähne, der Punts. Eine Armada langer Flachboote wartet vor dem Botanischen Garten darauf, von Touristen über den Cherwell gestochert zur werden. Während der Hauptverkehrszeiten, wenn Autos, Laster und Busse den freien Blick auf den Fluss versperren, wirkt die Brücke viel unromantischer als auf Bildern oder in der Erinnerung. Peter stellt sich die Magdalen Bridge immer so vor, wie er sie von dem Maimorgen in Erinnerung hat, als er frühmorgens auf dem Balustradengeländer stand, ins schlammige Wasser des Cherwell blickte und Brandy Branwen zu ihm sagte: »Peter, lass den Quatsch. Du musst nicht springen. Wirklich, wenn du einen Moment darüber nachdenkst, wird dir klar, dass das nicht nötig ist. Also komm verdammt noch mal da runter. Lass uns zu den Maitänzern gehen und danach lade ich dich zu einem Glas Champagner ohne blöde Erdbeeren ein, oder zu einem Brandy, wenn dir das lieber ist. Bitte, spring nicht.«
Er sieht, wie ein japanischer Tourist, oder ist es ein Chinese, gleich hinter der Brücke, wo der Cherwell in Richtung Themse fließt, mit dem langen Stab im Morast steckenbleibt. Der Amateur-Punter hält den Stab tapfer fest, während das Punt unter ihm gemächlich weitergleitet. Der Körper des Asiaten und der Stocherstab formen ein langsam breiter werdendes A ohne Mittelstrich. Im letzten Augenblick lässt er den Stab los. Der ragt schräg aus dem Fluss. Der Kahn entfernt sich im Zeitlupentempo vom Stab. Wenigstens ist der Japaner nicht reingefallen. Jetzt erst bemerkt Peter, dass in dem Punt eine zierliche Frau sitzt, die in einer asiatischen Sprache drauflosschimpft, und dass der stablose Mann am falschen Ende des Punts, nämlich auf der Cambridger Seite, steht. Die Stocherkahnverleiher sagen den Touristen nie, wo sie richtig stehen. Die schimpfende Frau findet das kleine Paddel, das sicherheitshalber immer im Punt liegt. Sie paddelt den langen Kahn hektisch in Richtung des steckengebliebenen Stabs zurück. Der Mann hat sich hingekniet, um mehr Stabilität zu bekommen. Er bringt sich in Position, um den Stab wieder aus dem Matsch zu ziehen. Es ist noch längst nicht ausgemacht, ob er tatsächlich trocken zur Anlegestelle zurückkommen wird, aber Peter verfolgt das Schauspiel nicht bis zum Ende. Im Weggehen hört er, wie eine von zwei älteren Damen, die ihre Teebecher auf der Balustrade abgestellt haben, Sandwiches essen und dem Japaner beim Kampf mit den Oxforder Elementen zusehen, sagt: »Ich wette ein Pfund darauf, dass er es schafft und dabei trocken bleibt.« Sie beißt in ihr Eier-Mayo-Sandwich. »Da halte ich dagegen«, kontert die andere.
6
Michaelmas Term, das erste Trimester, verlief harmlos, verglichen mit den nachfolgenden Trimestern Hilary und Trinity. Dennoch war auch Michaelmas alles andere als langweilig. Gleich am ersten Abend – ich hatte einen Brief nach Hause fertiggeschrieben und war gerade im Begriff, mich schlafen zu legen – klopfte es an meine Tür. Sergej stand vor mir und trat verlegen von einem Bein aufs andere. Er wollte nicht hereinkommen, bat mich jedoch, meine Zimmertür offen zu lassen. Wenigstens diese eine Nacht und vielleicht auch die nächste. Ich schaute ihn so verwundert an, dass er als Erklärung hinzufügte, dies sei die erste Nacht seines Lebens, die er alleine in einem Raum schlief. Wenn wir beide unsere Zimmertüren aufließen, fühle er sich nicht so einsam. Ich muss ihn so ungläubig angesehen haben, dass er sogleich freimütig erzählte, er habe vier Geschwister. Die Sankt Petersburger Wohnung seiner Familie verfüge jedoch nur über drei Schlafzimmer. Eins für die Eltern, eins für seine beiden Schwestern und er hatte sich die letzten 20 Jahre das kleinste der drei Zimmer mit seinen beiden jüngeren Brüdern geteilt. Er sagte nicht: »habe teilen müssen.« Ich willigte ein, meine Tür offen zu lassen. »Danke, Petja.« Er strahlte mich so erleichtert an, dass ich ihm rasch eine Gute Nacht wünschte, bevor er mir vor Dankbarkeit um den Hals fiel. Keine zehn Minuten später hörte ich ihn schnarchen und ich fand den Rest der Nacht keinen Schlaf. Erst gegen Morgen nickte ich ein und wurde kurz darauf von Ray geweckt, der das Waschbecken in meinem Zimmer putzte. »Warum steht denn deine Tür auf?«, fragte er, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Ich richtete mich im Bett auf und schaute durch meine offene Tür über den kleinen Flur. Sergejs Tür war geschlossen. »Der ist schon auf den Beinen, habe ihn gerade zum Frühstück gehen sehen«, erläuterte Ray, während er mein Waschbecken trockenlederte.
»Danke, Ray, das mache ich selbst.«
»Dann raus aus den Federn. Ich hänge dein Bettzeug über den Sessel und mache …«
»Nein, danke, ich mache das wirklich lieber selbst.«
»Aber irgendwas muss ich hier doch machen. Küche und Bad sind ja praktisch noch sauber.«
Beide blickten wir auf den Mülleimer, in dem zerknüllte Briefe lagen. »Liebe Eltern, hier ist es toll«, stand auf einigen drauf. Oder: »Scheiß auf das Stipendium, ich komme zurück und nehme Opas Bauplatz«, oder: »Das Zimmer ist nett. Mein russischer Zimmernachbar sieht ein bisschen aus wie Edgar aus Mettnich.«
»Mülleimer leeren?«, schlug ich vor.
»Mülleimer leeren«, brummte Ray zufrieden, »und wenn du dir noch ein Rührei sichern willst, musst du jetzt in die Hall.«
Das mit der offenen Tür konnte so nicht weitergehen, also einigte ich mich mit Sergej auf eine andere Vorgehensweise. Wir veranstalteten erstmals unser Heilsaufen, das darin bestand, das Abendessen in der Hall ausfallen zu lassen und stattdessen in Ruhe so lange Wodka zu trinken, bis das Heimweh nachließ. Ein anderer Russe, Jewgenij, ein Informatik-Doktorand, gesellte sich manchmal zu uns. Er war schon ein Jahr vorher nach Oxford gekommen, litt aber ebenfalls an Heimweh und fand die Idee ausgezeichnet, mit Wodka dagegen anzutrinken. Er kam aus Moskau, aber seine Familie stammte aus Armenien, so dass er neben Russisch auch Armenisch sprach. Das hatte ihm die zweifelhafte Ehre eingebracht, den Bibliotheksschwur der Bodleian Library ins Armenische übersetzen zu dürfen. Um die Bodleian nutzen zu dürfen, musste man – feierlich in einen Talar gekleidet und mit erhobener Hand – einen offiziellen Eid leisten, indem man laut wiederholte, was der Bibliothekar einem vorsprach. Fast wie bei einer Trauung, nur mit einem Buch in der Hand statt einer Frau an der Seite. Ich schwor also, auf Englisch, keine Bücher oder anderen Dokumente aus der Bibliothek zu entwenden, noch sie in irgendeiner Weise zu beschädigen oder sonst irgendwie zu »verletzen«. Weiterhin verpflichtete ich mich, niemals in der Bibliothek zu rauchen und erst recht kein Feuer darin zu entfachen oder auf sonst irgendeine Weise eine Flamme in das Gebäude zu tragen. Abschließend schwor ich, mich auch ansonsten allen Regeln der Bibliothek zu unterwerfen. Lauter vernünftiges Zeug eigentlich. Ich muss gestehen, dass ich die endlosen Regalreihen, die Millionen von Büchern, von denen etliche viele Jahrhunderte auf dem Buchrücken haben, gleich ernster nahm, als ich nach dem Eid offiziell als Bibliotheksbenutzer aufgenommen war. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn die Pfarrbücherei Primstal für ihre Benutzer eine ähnliche Zeremonie einführen würde.
Der Bibliothekar, der die Vereidigung vornahm, fragte mich, in welcher Sprache ich den Schwur leisten wolle, bei Bedarf könne er mir auch den deutschen Text geben. Er blätterte in einem dicken Ordner mit Zetteln, die in Klarsichthüllen abgeheftet waren – es müssen an die hundert gewesen sein – aber ich lehnte dankend ab und meinte, es ginge auch auf Englisch. Ob ich denn alles verstünde, was ich da zu schwören hätte? Als ich dies bestätigte, meinte er, nicht alle kämen mit dem antiquierten Englisch zurecht, und daher ließ die Bibliotheksverwaltung, wann immer sich ein vertrauenswürdiger Übersetzer fand, eine entsprechende Version hinzufügen. Seit Kurzem stünde der Schwur sogar auf Armenisch zur Verfügung.
Bei einem unserer Heilsaufen-Treffen gestand uns Jewgenij, er habe bei der armenischen Version ein wenig improvisiert und – neben der Sache mit dem Stehlen, Beschädigen und Feuer anzünden – auch noch einige andere, wie er fand nützliche Schwurteile hinzugefügt, zum Beispiel, dass die Bibliothekarinnen unter keinen Umständen in den Po gekniffen werden durften und dass nach einer sich spontan ergebenden Kopulation zwischen den Shakespeare-Folianten auf die Zigarette danach unbedingt zu verzichten sei. Der Schabernack wäre beinahe aufgeflogen, als wenige Wochen nach Jewgenijs Übersetzung ein armenischer Gastprofessor beim Schwur laut lachen musste. Zum Glück bestätigte er auf die Frage des besorgten Bibliothekars, ob alles in Ordnung sei, dass sicherlich alles im Sinne des englischen Originals übertragen worden sei, nur eben in sehr eigenwilliger Ausdrucksweise. Ein Glück für Jewgenij, dass der armenische Professor sich entschlossen hatte, den Landsmann nicht in die Pfanne zu hauen und dadurch sicherstellte, dass Armenier mit einem Lächeln im Gesicht als Benutzer der Bodleian-Bibliothek vereidigt werden.
Während Sergej kein größeres Netzwerk in Oxford aufbaute und praktisch nur mich und Jewgenij näher kannte, gingen bei Alex ständig gutaussehende Privatschulabsolventen ein und aus. Zumindest stellte ich mir vor, dass es sich ausnahmslos um Studenten handelte, die eine Erziehung auf Eliteinternaten hinter sich hatten. Viele von Alex’ Besuchern kamen nur ein einziges Mal und nur wenige erschienen regelmäßig in unserem Staircase. Wenn jemand öfter als dreimal bei Alex im Zimmer gewesen war, wurde er Sergej und mir offiziell vorgestellt. Simon zum Beispiel. »Er ist ein guter Freund«, erläuterte Alex, ohne dass wir ihn nach einer genaueren Definition gefragt hatten, »ein Freund, nicht mein Freund.«
Simon war sympathisch und hilfsbereit. Bei ihm war ich mir nicht sicher, ob ich ihn in die Schublade der Privatschulabsolventen stecken sollte. Er verkaufte mir seinen alten Talar für nur 20 Pfund und schenkte mir den dazugehörigen Hut, der wegen seiner flachen, viereckigen Form auch Mörtelbrett genannt wurde. Vor allem aber erklärte er mir dankenswerterweise die »sub-fusc-Etikette«, also was man unter dem Talar in Weiß und was in Schwarz tragen musste. Außerdem brachte Simon Sergej und mir das Stocherkahnfahren bei, weil er nicht wollte, dass wir das Jesus College blamierten, und nicht, wie die Touristen, mit dem Punting-Stab, dem Pole, im Matsch der Themse oder des Cherwell steckenblieben und ins Wasser fielen.
Sergej verlor rasch das Interesse am Punting, ich aber beherrschte nach ein paar von Simons Privatstunden diese wichtige Oxforder Schlüsselqualifikation recht gut. Das sollte mir noch nützlich sein. Louise zum Beispiel liebte es, auf dem Cherwell gepunted zu werden. Mit einem Schälchen Erdbeeren und einer Flasche Champagner bewaffnet. Sie wollte, dass ich ihr während des Stocherkahnfahrens romantische Gedichte aufsagte. Auf Deutsch. Wenn wir an Long Meadow vorbeigeglitten und uns soweit von der Magdalen Bridge entfernt hatten, wie kein Tourist es schaffte, blickte sie den Cherwell flussauf- und flussabwärts. Sobald sie sich vergewissert hatte, dass kein anderes Punt