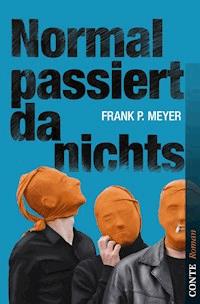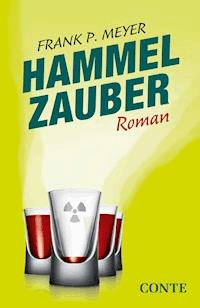
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es war sonderbar still auf dem Kirmesplatz. Vielleicht, weil die Szene wie eine Invasion von Aliens aussah. Oder weil sich die Leute an die Tage nach dem GAU erinnert fühlten.« Das Saarland in nicht allzu ferner Zukunft. Viele Jahre nach einer Kernschmelze im französischen Atomkraftwerk Cattenom sind weite Teile des Landes noch immer unbewohnbar. Aber ein Dorf bleibt stur und dort, wo es schon immer war: Primstal. Seine Bewohner erklären den Ort am Rand der Sperrzone zum gemütlichsten Wartesaal Gottes, in dem der Hammelzauber und das Rollatorrennen zur Dorfkirmes die Höhepunkte des Jahres markieren. Doch in der ersten Kirmesnacht werden zwölf absonderliche Straftaten verübt. Die Saarbrücker Kommissarin Paula Luecno muss vor Ort ermitteln, und der Einzige, der ihr dabei wirklich helfen kann, ist der alte Jus. Denn der weiß Bescheid, da können Sie in Primstal fragen, wen Sie wollen. Frank P. Meyers Roman vermengt Science-Fiction, Krimi und Dorf-Groteske zu einer aberwitzigen Geschichte und so viel sei verraten: Für einige Bewohner des Dorfes, in dem »normal nichts passiert«, war der GAU noch eine der kleineren Katastrophen ihres Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prolog
In der Nacht vom 14. auf den 15. September wurden in Primstal zwölf Straftaten begangen:
– eine Erpressung
– ein Diebstahl
– eine Sachbeschädigung
– eine versuchte Vergewaltigung
– eine schwere Körperverletzung
– ein ungeklärter Todesfall mit Leichenschändung
– eine Entführung
– ein Einbruch
– eine Verleumdung
– eine Brandstiftung
– ein Fischfrevel
sowie ein weiteres Verbrechen, von dem die Öffentlichkeit nichts erfuhr.
Wie selbst ein kriminologischer Laie erkennt, handelte es sich bei den einzelnen Fällen um Straftaten verschiedener Schwere. Die Polizei hatte keine Ahnung, wie diese Taten zusammenhingen. Sie wusste nicht einmal, ob sie überhaupt zusammenhingen. Für einen Ort, in dem normal nichts passiert, war es überraschend, dass in einer einzigen Nacht Straftaten fast im Stundentakt begangen wurden, auch wenn es sich dabei um die erste Nacht der Dorfkirmes handelte.
Teil ISamstag, 15. September
1
Weil die Saarbrücker Kripo grundsätzlich nicht gerne von einem Zufall ausgeht, sondern lieber von Verschwörung oder zumindest von organisierter Kriminalität, hatte sich noch während des Vormittags des 15. September im Polizeipräsidium, wo von nichts anderem gesprochen wurde, die Bezeichnung ›der Fall Primstaler Kirmes‹ etabliert. Die Polizei behandelte die Ereignisse der ersten Kirmesnacht also als einen Fall. Und dieser Fall, das war den Behörden klar, musste umsichtig angepackt werden. Niemand hatte ein Interesse daran, die Angelegenheit allzu sehr aufzukochen. Schon allein deshalb nicht, weil der Ort, Primstal, ein heikler war.
Mit der Lösung des Falles wurde Kriminalhauptkommissarin Paula Lück betraut. Sie war keineswegs glücklich darüber. Und der einzige, der ihr bei der Aufklärung der Verbrechensserie würde helfen können, war Justus, genannt Jus. Denn Jus wusste Bescheid, da können Sie in Primstal fragen, wen Sie wollen.
2
»Das ist ziemlich dumm gelaufen, was?«, sagte mein Opa, und mir war nicht klar, welches der beiden Ereignisse er damit meinte. »Mach dir nichts draus! So was passiert halt, also gewöhn dich schon mal daran, dass man sich nie sicher sein darf.«
Natürlich machte ich mir was draus. Und mein Großvater wusste das.
Wir waren in einem großen Käfig. Christian und ich konnten so eben über die Betonmauer schauen. Direkt auf der Mauer begann der hohe, grobmaschige Zaun. Wir hielten uns mit beiden Händen am Metall fest, zogen uns ein bisschen am Zaun hoch, wie Klimmzüge. Niemand verbot uns das. Wenn wir gewollt hätten, hätten wir ein Stück daran hochklettern können. Aber nicht drüber, das war bestimmt verboten. Es wäre auch schwierig gewesen, weil der Metallzaun oben einen Knick nach innen machte, in unsere Richtung. Das letzte Stück müsste man also nach hinten gelehnt klettern. Christian würde das sicher nicht schaffen. Ich vielleicht schon. Aber warum hätte ich da drüberklettern wollen? Die Polizisten auf der anderen Seite hätten einen bestimmt erwischt und dann vielleicht bestraft. Außerdem hatten wir von hier aus ja einen guten Blick. Gar nicht so weit entfernt sahen wir auf den kurzgeschnittenen Rasen. Rechts und links von uns standen viele Leute, meistens andere Jungs, die sich wie wir mit beiden Händen am Metallzaun festhielten. Ich konnte nicht genau erkennen, wie weit die Mauer in beide Richtungen weiterging. Zu viele Leute. Ich schätzte, wir standen ungefähr in der Mitte des Blocks. Manche standen mit dem Rücken zum Zaun. Auch ich drehte mich um, blickte hoch zu meinem Vater und Großvater und in Richtung des Eisengittertors, durch das die Aufseher, oder wie die hießen, uns durchgewiesen hatten. Jetzt war das Tor bestimmt geschlossen. Jedenfalls passte hier keiner mehr rein, so viel war sicher. Auf dem Weg, der zum eisernen Eingangstor führte, waren einige Männer ein paar Meter zur Seite getreten und hatten gegen den Zaun seitlich des Zugangsweges gepinkelt. Dann erst gingen sie durch das Eisentor. Gab es hier drin keine Toiletten? Bestimmt gab es Toiletten, bei so vielen Menschen. Wenn ich jetzt hätte pinkeln müssen, hätte ich es sicher nicht bis nach oben zum Eingangstor geschafft, wo die Männer ihre Hosenschlitze öffneten. Bis ich mich durch die Menschenmenge gezwängt hätte, wäre es sicher zu spät gewesen. Aber ich musste nicht, zum Glück. Ich blickte meinen Großvater an. Er nickte mir aufmunternd zu, als wolle er sagen: Wird schon gutgehen. Aber ich sah ihm an, dass auch er nervös war und selbst nicht so recht daran glaubte. Er und mein Vater und auch der Opa von Christian standen gar nicht weit weg von uns, trotzdem konnten wir uns nichts zurufen. Es war einfach zu laut. Die Männer machten einen Mordskrach. Ich fand den Krach noch beengender als das Gedränge.
Ich erinnere mich, dass ich damals dachte: Sie sollten nicht so viele Leute in einen Block stecken. Ich verstand aber auch, dass sie uns alle irgendwie unterkriegen mussten. Die anderen Blöcke waren genauso voll wie unserer. Block A. A1, um genau zu sein. Das ist der Block zwischen der Nordkurve und der Haupttribüne. Auch die Sitzplatztribünen, in Block H und M, waren wie Käfige, die Zäune genauso hoch wie bei uns im A-Block. Nur gemütlichere Käfige eben. Die hatten bestimmt Toiletten. Vielleicht hatten wir auch welche, nur hatten die Männer keine Lust, sich bis dahin durchzudrängeln. Oder sie hatten schon so viel Bier getrunken, dass es schnell gehen musste.
In allen Käfigen gab es Essen und Trinken. Wie bei den Tieren im Neunkircher Zoo. Die waren auch zwischen langen, hohen Zäunen eingepfercht, und in der Mitte der Käfige, in Trögen, lag etwas zum Fressen und es gab Wasser in ausgemusterten Badewannen.
Vielleicht würde ich nachher auch etwas trinken. In der Halbzeit. Eine Limo. Und eine Bratwurst, vielleicht. Mein Opa hatte mir 5 Mark gegeben. Die konnte ich mir aber auch aufheben und sie am Montag aufs Sparbuch bringen. Der Montag nach diesem Wochenende war nämlich der 31. Oktober und da war Weltspartag, und wenn man dann Geld aufs Sparbuch brachte, bekam man von der Sparkasse noch ein Geschenk dazu. Das wäre fein. Aber Limo und Bratwurst in der Halbzeit wären auch fein. Wenn ich jedoch darauf verzichtete, wie viel mehr wären dann die 5 Mark, wenn ich groß bin, oder so alt wie mein Opa? 100 Mark, oder 1000, wer weiß? Und was wären später 100 Mark im Vergleich zu einer Limo und einer Bratwurst jetzt? Dann könnte auch ich, irgendwann einmal, meinem Enkel 5 Mark geben. Mein Opa hatte genug Geld. Er hatte 30 Jahre unter Tage gearbeitet und bekam eine gute Rente von der Knappschaft. Blöd wäre natürlich, wenn wir verlieren und ich außerdem nicht einmal eine Stadionwurst verdrückt hätte. Das wäre ein ganz schlechter Tag. Ich entschied: Wenn wir zur Halbzeit führen, brauche ich keine Limo und Wurst, dann genügt mir das Ergebnis. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass wir zur Halbzeit führten. Das Spiel davor hatten wir 5:1 verloren, gegen Köln. Ich hatte es mit meinem Opa und dem Opa von Christian in der Sportschau gesehen. Aber das war ein Auswärtsspiel gewesen. Jetzt im Ludwigspark feuerten alle unsere Mannschaft an. Allerdings war der Gegner Schalke. Mit Bongartz, Abramczik, Rüssmann und Fischer und allem Drum und Dran. Trotzdem, ich blieb dabei: Liegen wir zur Halbzeit vorn, bringe ich die 5 Mark aufs Sparbuch, wenn nicht, gibt’s Limo und Bratwurst zum Trost. Wenn ich richtig gerechnet hatte, blieb sogar noch Geld für eine weitere Limo oder Cola übrig. Christian mochte Cola. Vielleicht sollte ich ihm dann eine Cola spendieren? Er würde sich bestimmt freuen. Sein Opa hatte ihm keine 5 Mark mitgegeben. Ich fasste in meine Hosentasche, fühlte das runde Silberstück, den Heiermann, wie mein Vater Fünfmarkstücke nannte. Ich konnte sogar die Schrift auf dem Rand fühlen: Einigkeit und Recht und Freiheit. Das konnte ich natürlich nicht Buchstabe für Buchstabe fühlen, aber ich wusste ja, was da stand.
Christian war längst nicht so aufgeregt wie ich. Er war schon zweimal im Ludwigspark gewesen. Ich hatte den FCS in verschiedenen Stadien im Saarland gesehen, in den Jahren davor, aber das hier war mein erstes Bundesliga-Spiel und mein erstes Mal im Ludwigspark.
Christian ist mein Freund, dachte ich damals. Was wusste ich schon. Ich dachte, Freund ist man für immer und das dauert von jetzt bis alle Zeit und in Ewigkeit.
Ein Verleger, der es gut mit mir meinte, hatte mir einmal geraten: »Fang ein Buch nie mit einer Fußballszene an!«
»Wieso denn nicht?«
»Na, weil sonst die Frauen das Buch nicht weiterlesen.«
»Ja und? Ist das schlecht?«
»Und ob das schlecht ist!«
»Wieso, dann ist man ab dem zweiten Kapitel mit den Jungs schön unter sich und kann für den Rest des Buches prima die Sau rauslassen«, entgegnete ich, halb im Scherz.
»Vergiss es! Männer lesen nicht, oder sagen wir: kaum.«
Das Spiel begann mit einem Mordslärm. Die Leute um uns herum brüllten wild durcheinander und schimpften über den Schiri. Gesungen wurde damals noch nicht. Das haben wir erst später in den 80ern gelernt, von den Liverpoolern und den anderen Engländern. Damals im Ludwigspark haben die Leute nur gebrüllt. Bei dem Spiel gegen Schalke habe ich ein paar nützliche neue Schimpfwörter gelernt. Plötzlich war da nur noch Lärm, ohne dass ich einzelne Worte verstand: Luggi Denz hatte das 1:0 geschossen. Christian und ich umarmten uns und hüpften auf und ab. Der Tor-Schrei klang wie eine Erleichterung, ungläubig, wie: Das gibt’s doch nicht! Aber schon wenige Minuten später wich die Zuversicht wieder. Zumindest bei mir. Nur eins zu null, und erst 20 Minuten vorbei. Ich fühlte nach meiner Silbermünze. Vielleicht war sie ja ein Glücksbringer? Ich drehte den Heiermann zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger immer im Kreis herum. Wenn das 1:0 doch wenigstens bis zur Pause hielt. Dann gab’s eben keine Limo und Cola für mich und Christian. Aber ich traute der Sache nicht. Bis das zweite Tor fiel. Fernschuss Niko Semlitsch. Der war damals mein Lieblingsspieler, vielleicht weil er nicht wie ein Held aussah und trotzdem immer ordentlich spielte.
Ich musste mir die Ohren zuhalten. Der komplette A-Block und auch die Nordkurve und sogar die Haupttribüne brüllten: »Hi-ha-ho, Schalke ist k.o.«. Auch die Gegentribüne und der D- und E- und F-Block stimmten ein. So laut, dass ich mir sicher war, dass es bis zur Bahnhofstraße und zum Sankt Johanner Markt zu hören war. Oder sogar bis Primstal? Nein, so weit konnten nicht einmal 30.000 Fußballfans brüllen.
Ich brüllte hi-ha-ho mit, ohne mich selbst hören zu können. Christian neben mir machte die gleiche Mundbewegung. Sicherheitshalber drehte ich mich um, schaute zu meinem Großvater. Er lachte, sagte etwas zu meinem Vater. Und er sah zuversichtlich aus. Sein na-also-geht-doch-Blick. Das hieß schon was. Mein Großvater war ein Pessimist, ein Dauerzweifler, wie meine Oma sagte. Beruhigt drehte ich das 5-Mark-Stück in meiner Hosentasche zwischen den Fingern. Die Chancen standen gut, dass die Münze nicht im Ludwigspark blieb, sondern wieder zurück nach Primstal kam, um dort auf unserer Sparkasse zu einem Vermögen zu werden.
Die Silbermünze in meiner Hosentasche begann sich schneller zu drehen. Meine Finger wurden nervöser. Alle Köpfe reckten sich in Richtung unseres Tores. Leute brüllten: »Nein!« Auch Christian. Ein großer Junge, der links von mir stand, regte sich so auf, dass er mit dem Ellenbogen gegen mich stieß. Ich dachte, ich falle. Riss die Hand aus der Hosentasche. Stützte mich an der Mauer ab. Die Finger hatten das 5-Mark-Stück nicht rechtzeitig losgelassen. Es kam mit der Hand aus der Hosentasche, wirbelte im hohen Bogen an Christians Gesicht vorbei. »Nein, nein!«, schrien die Leute um uns herum und im ganzen Stadion. Aber die Schalker machten das Tor. Ich konnte nicht wegschauen, musste den Ball in unserem Tor zappeln sehen. Konnte die Flugbahn meines Geldstücks nicht verfolgen. Die Leute um uns herum brüllten: »Reißt euch zusammen, verdammt noch mal. Los, weiterkämpfen!«, und alle entlang der Mauer drängten näher an den Zaun, als ob wir so unserer Mannschaft helfen könnten.
Meine Blicke suchten den Boden ab. So gut das ging, bei den vielen Füßen. Christian sagte nichts. »Ich glaube, ich hab was verloren«, murmelte ich, ohne recht zu wissen, was ich damit bezweckte. Sollte Christian mir beim Suchen helfen? Der Boden vor der Betonmauer war übersät mit zerrissenen Stadionzeitschriften, zertretenen Plastikbechern und anderem Dreck. Ich ging kurz in die Hocke, um besser zwischen all den Beinen und Schuhen schauen zu können. Christian ging nicht zur Seite. Warum auch? Schalke hatte gerade wieder eine Chance. Die Leute stöhnten auf. Noch mal gut gegangen. »Was hast du denn verloren?«, fragte Christian, als ich mich wieder aufgerichtet hatte.
»Ach, nichts.« Ich wollte nicht zugeben, dass ich meine 5 Mark verloren hatte. Ich blickte mich zu meinem Opa um. Er sah mich ernst an, als ob er mich die ganze Zeit beobachtet hätte. Mist, ich sollte besser aufpassen.
Halbzeit. Und wir führten. Eigentlich sollten die 5 Mark jetzt in meiner Hosentasche ruhen. Einige der Jungs um uns herum gingen nach oben zum Getränkestand, um sich dort etwas für die Pause zu holen. Oder um mit den Großen oben an den Zaun zu pinkeln. Ich tastete mit meinem Blick die zwei, drei Quadratmeter um Christian herum ab. Der stand unbeweglich da, sah den Ersatzspielern zu, die sich auf dem Rasen warmliefen. Christian konnte ja nicht wissen, dass er beinah eine Cola bekommen hätte, wenn das Spiel anders verlaufen wäre. Und wenn ich besser aufgepasst hätte.
Der Junge neben mir sagte: »Du wirst sehen, wir schießen gleich nach der Halbzeit das dritte Tor und dann halten wir das Ergebnis bis zum Schluss.« Ich erinnere mich, dass ich mir wünschte, ebenso viel trotzigen Optimismus zu haben, wie der Blick dieses Jungen ihn verriet. Seinen schwarz-blauen Schal trug er festgeknotet wie einen Schlips. Er sagte noch etwas, aber ich konnte nicht darauf achten was, denn aus den Augenwinkeln sah ich, wie Christian sich hinkniete, um sich die Schuhe zu binden. Ich nickte dem Jungen, halb abgewandt, zu und murmelte »hoffentlich«. Und während ich vor mich hin nickte, sah ich, wie Christian sich die Schnürsenkel löste und wieder zuband. Dann knickte er den rechten Fuß ein und griff mit der Hand unter seine Sohle. Er richtete sich rasch wieder auf und steckte seine Hand in die Hosentasche. Dort blieb sie die ganze Halbzeit und bis zum Ende des Spiels, und er hatte die Hand auch noch nicht wieder herausgeholt, als wir später den Ludwigsberg runtergingen, zwischen tausenden von Leuten, die den Kopf hängen ließen, und auf der anderen Seite nach Malstatt hochgingen, wo unser alter Simca parkte.
Christian hatte die ganze Zeit auf dem Heiermann draufgestanden. Hat sich nicht mal richtig über das erste Gegentor der Schalker geärgert. Alles für einen Silberling. Ich hatte mich zu meinem Großvater umgeblickt, als Christian sich wieder aufrichtete und seine Hand in der Hosentasche verschwand. Mein Vater reichte Opa gerade ein Stadionbier rüber. Opa nahm es ›Danke‹ murmelnd an, ohne den Blick von mir abzuwenden. Ich war mir sicher, dass er uns die ganze Zeit im Auge gehabt hatte.
Die ganze zweite Halbzeit wartete ich darauf, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Die Schalker schafften schnell den Ausgleich, und das wäre ein guter Moment für Christian gewesen, die Hand aus der Tasche zu nehmen und zu sagen: »Mach dir nichts draus, dafür hab ich deine 5 Mark gefunden«. Ich wäre sofort hoch zum Getränkestand gegangen, Weltspartag hin oder her.
Aufs Spiel konnte ich mich kaum noch konzentrieren. Klaus Fischer schoss das Siegtor für Schalke. Der andere Junge neben mir riss den Knoten seines FCS-Schals auf und schlug damit gegen den Zaun, was natürlich keinen großen Schaden anrichtete.
Und Christian ließ auch diese Chance verstreichen. Obwohl ich maßlos enttäuscht war, dass wir dabei waren, das Spiel zu verlieren, wäre es immerhin ein Trost gewesen, wenn er mir meine fünf Mark zurückgegeben hätte. Aber bis zum Abpfiff geschah nichts mehr, was mich wieder aufmunterte. Nicht einmal das Unentschieden fiel noch.
»Das ist ziemlich dumm gelaufen, was?«, sagte mein Opa, und mir war nicht klar, welches der beiden Ereignisse er damit meinte, das Spielergebnis oder die Sache mit dem 5-Mark-Stück. »Mach dir nichts draus. So was passiert halt, also gewöhn dich schon mal daran, dass man sich nie sicher sein darf.«
Und mein Vater sagte: »Ja, man darf sich nie zu sicher sein, auch wenn du scheinbar klar führst und den Gegner in der Hand zu haben scheinst. Immerhin haben wir gut gekämpft, nicht wahr? Und es ist doch nur Fußball, Jus, Opa hat Recht, mach dir nichts draus.«
Natürlich machte ich mir was draus. Und mein Großvater wusste das.
Es war das letzte Mal, dass ich mit Christian im Stadion war. Obwohl er mich noch ein paar Mal fragte, ob wir wieder zusammen hinfahren. Das einzige Stadion, in dem ich ihn danach noch sah, war das Primstaler Allerschwald-Stadion. Und dort vermied ich es, in seiner Nähe zu stehen.
Und mir wird sicher niemand böse sein, dass ich kein Mitleid hatte, als ihm an der Kirmes Geld gestohlen wurde. Selber schuld, wenn er nicht besser darauf aufpasste. Obwohl ich zugeben muss, dass es etwas anderes ist, ob man im Ludwigspark Geld geklaut kriegt, das auf dem Boden liegt, oder im eigenen Hausflur, nur wenige Schritte vom großen Haus-Bildschirm entfernt.
3
Nein, es lief nicht, wie es sollte für die Kriminalhauptkommissarin. Und jetzt auch noch diese sonderbare Sache im Nordsaarland. Sonst kam es selten vor, dass sie sich außerhalb des Saarbrücker Stadtbezirks bewegen musste. Ausgerechnet Primstal. Sie dachte erst, sie hätte sich versehen, als sie ins Büro kam und auf dem Bildschirm die Liste der anstehenden Fälle sah. Und was für Fälle! Einige der Straftatbezeichnungen waren ihr bisher noch nicht untergekommen. Waren das überhaupt alles ›Fälle‹?
Der Bildschirm schaltete auf die Landkarte des Zuständigkeitsbereichs der Südwest-Polizeibehörde um. Bei Primstal leuchteten so viele Einzelpunkte auf, dass sie wie ein einziger großer Fleck aussahen. Dort war es nun schon seit mindestens 15 Jahren ruhig gewesen. Keine Negativschlagzeilen mehr, seit der Entscheidung damals nach dem Unglück. Und jetzt gleich eine zweistellige Zahl Straftaten in einer Nacht? Das gab es nicht einmal in Saarbrücken. Sollte da eine Bande am Werk gewesen sein? Dazu waren die Straftaten eigentlich zu unterschiedlich. Statistisch gesehen wird in einem Durchschnittsdorf des Nordsaarlandes alle 19,5 Jahre eine Straftat begangen. Denkt man diese Statistik logisch weiter, würde das bedeuten, dass Primstal in den nächsten zweihundert Jahren sicher wäre.
Eigentlich hatte die Kommissarin ganz andere Sorgen. Sie konnte nicht fassen, dass die Beförderung zur ›Ersten Kriminalhauptkommissarin‹, zur EKHK, wieder an ihr vorübergegangen war. »Nur für diesmal«, hatten sie schon wieder zu ihr gesagt, »keine Sorge, Frau Lück, das ist nur noch eine Frage der Zeit.«
Für Paula Lück fühlte es sich an, als verweigerte man ihr einen Buchstaben, der fest zu ihrem Namen gehörte: EKHK Lück. Nicht nur KHK. Und ausgerechnet Johannes hatte die Beförderung bekommen. Ein Mann! Ein Mann, der genauso lange im Dienst war wie sie. Sie hatte natürlich gleich mit ihm Schluss gemacht. War sowieso nichts Ernstes. Sie hätte mit ihm zusammenbleiben und ihm beweisen können, dass sie es trotzdem vor ihm schafft, Kriminalrätin zu werden. Das war sowieso das langfristige Ziel. Sie wollte nicht ewig langweilige Ermittlungskommissionen leiten, egal ob in der Stadt oder in dubiosen Käffern an der Grenze zum Sperrgebiet. Sie war nicht so fürs Praktische, war eher der Verwaltungstyp. Das würde beruflich auch besser passen, falls sie noch eine Familie gründen wollte. Und das wollte sie. Aber dafür musste nun bald der Richtige her. Nun gut, sie war gerade erst 30 geworden. Noch kein Grund zur Panik. Und die Karriere war mindestens genau so wichtig wie Kinder und ein Mann. Jedenfalls wollte sie nicht noch jahrelang Mordkommissionen leiten. Lieber eine Stelle an der Polizeihochschule und von dort irgendwann auf einen Kriminalrätin-Posten, bei dem sie die Arbeit größtenteils vom Schreibtisch aus erledigen konnte.
Sie vermisste Johannes nicht. Anderthalb Jahre war sie mit ihm zusammen gewesen, mit einer nur kurzen Unterbrechung, als sie zwischendurch die Affäre mit dem Typen vom Innenministerium hatte. Der sah längst nicht so gut aus wie Johannes. Roch aber besser. Johannes war ein Kerl wie ein Baum. Kleiderschrankschultern und ein Wahnsinnshintern. Und kantige Gesichtszüge, wunderbar. Sie reichte ihm gerade bis zum Schlüsselbein, wenn sie sich im Stehen an ihn lehnte. Das gefiel ihr. Auch, dass er sich zum Küssen zu ihr herunterbeugen musste und sie dafür ein wenig die Fersen anhob und auf den Fußballen stand. Aber Johannes roch etwas muffig. Und sie verzieh ihm nie, dass er sie nicht vorgewarnt, sondern sie mit seiner Beförderung überrascht hatte. Er erwartete tatsächlich, dass sie sich für ihn freute.
Zum Glück hatten sie nicht zusammen gewohnt, hatten beide ihre eigenen Wohnungen behalten, er in St. Arnual, sie oben auf dem Rodenhof. Ausgerechnet er EKHK! Dabei mochte er, im Gegensatz zu ihr, die anpackende Arbeit in den Ermittlungskommissionen. Sie war eher fürs Delegieren und Organisieren. Aber die Südwest-Polizei hatte eine neue Männerquote. Das war ungerecht!
Und jetzt Primstal. Das passte ihr gar nicht. Ein richtiges Team gab es dafür auch nicht: den Dorfpolizisten vor Ort, dazu ihre Kollegin Müller, die in Saarbrücken im Büro die Stellung hielt und von dort aus das Datenmaterial auswerten sollte. Und eventuell noch eine weitere Kollegin. Das war alles. Es gab die Hausbesetzungen in Völklingen und die angekündigten Demos – da bewilligte das Präsidium ihr, bei der Personalknappheit, kein großes Team, um einer Sache am Rande der Welt nachzugehen. Vielleicht würde sich die eine oder andere der Straftaten ja als nicht weiter tragischer Kirmesscherz entpuppen, hofften manche im Präsidium. Allerdings hatte KHK Lück so eine Ahnung, dass der Fall oder die Fälle kniffliger waren, als ihre Vorgesetzten wahrhaben wollten. Wer weiß, vielleicht bot gerade das Primstal-Mysterium die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Vielleicht kämen ihre Vorgesetzten schon bald nicht mehr an ihr vorbei, wenn es um die nächsthöhere Stufe ging. Aber wenigstens noch eine Person Verstärkung würde nicht schaden, dachte sie, während sie auf der A1 Richtung Norden fuhr.
Die Kommissarin konnte da noch nicht ahnen, dass ausgerechnet ein Vorschlag von Polizeimeister Harald II für diese zusätzliche Verstärkung sorgen sollte. Polizeimeister Harald II hieß weder mit Vor- noch mit Nachnamen Harald. Aber es hatte sich bis Saarbrücken herumgesprochen, dass der bedauernswerte Kollege, der die Dienststelle Primstal besetzte, grundsätzlich Harald genannt wurde. Vielleicht war der Kollege gar nicht bedauernswert. Wenn man keine besonderen Ambitionen hatte, war die Primstaler Dienststelle sicher goldrichtig. Bislang jedenfalls. Auch der Vorgänger des jetzigen Dorfpolizisten hatte Harald geheißen, und zwar in echt. Und immerhin hatte der es damals geschafft, die Primstaler zur Ruhe aufzurufen, als der GAU bekannt wurde. Der erste Harald hatte beinahe den Status einer Polizei-Legende.
Die Kommissarin lenkte den Dienstwagen selbst. Hatte nicht auf die selbstfahrende Automatikfunktion umgeschaltet. Das gab ihr das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben. Es gab kaum Verkehr. Wer wollte schon ins Nordsaarland? Sie betrachtete sich immer wieder im Rückspiegel. Sie habe Rehaugen, hatten sowohl Johannes als auch der Typ vom Innenministerium behauptet. Sie waren nicht die ersten, die ihr das sagten. Und als Kompliment meinten. Paula mochte das nicht, wollte nicht, dass ihre Augen an ein Reh erinnerten. Schöne, dunkelbraune Augen waren das, basta. Ihr Haar hatte die gleiche Farbe. Noch. Kürzlich hatte sie die ersten grauen entdeckt. Ein weiterer Blick in den Rückspiegel verriet ihr: schon wieder so ein Tag, an dem sich ihre Frisur nicht bändigen ließ. Gar nicht wie ein Reh. Ihr Großvater hatte einmal gesagt: »So wild müssen Haare sein.« Paula hatte das gleiche Haar wie ihre Großmutter. »Wenn deine Haare blond und deine Augen blau wären«, meinte ihr Großvater einmal, »würdest du aussehen wie Kylie Minogue.« Der Vergleich gefiel ihr, auch weil sie wusste, dass ihr Opa für die australische Sängerin schwärmte. Tatsächlich hatte Paula den gleichen angriffslustigen Blick wie Kylie. Auch Paulas Figur war ähnlich klasse – und sie war kaum größer als der Schwarm ihres Großvaters. Zum Glück hatte die Polizei vor gut zehn Jahren die Mindestgrößenregelung abgeschafft, die Kommissarin hätte sonst bei ihrer Bewerbung damals zwei Zentimeter darunter gelegen.
Paula hatte ein ungutes Gefühl, als sie die Abfahrt nach Primstal nahm. Nicht, weil sie Angst davor hatte, sie könnte gefährlichen Strahlungswerten ausgesetzt sein. Sie wusste aus internen Quellen – der Innenministeriumstyp roch nicht nur gut, sondern war auch sonst sehr nützlich –, dass die Strahlenbelastung im Rahmen des Vertretbaren lag, wenn man nicht ständig dort lebte. Aber es hieß, die Leute seien dort sehr ›eigen‹, um es freundlich auszudrücken. Gut, wer konnte ihnen das verdenken?
Damals, nach diesem ›Zwischenfall‹ im Atomkraftwerk, gleich auf der anderen Seite der Grenze, in Lothringen, trafen sich Regierungsvertreter der vier betroffenen Länder, in sicherer Entfernung des Katastrophengebietes, und beugten sich über eine Landkarte, auf der aktuelle, hochbrisante Messdaten eingetragen waren. Die obersten Volksvertreter diskutierten zunächst, ob sie den virtuellen Zirkel so einstellen sollten, dass die elektronische Bleistiftspitze genau einen 50-Kilometer-Umkreis einzeichnet, wenn sie die Metallspitze ins ›C‹ von Cattenom spießten.
Einer der Staatschefs hatte angeblich auf nur 20 Kilometer plädiert, was laut Messdaten ein Verbrechen gewesen wäre, sogar wenn die Daten hätten geheimgehalten werden können, und er ließ sich nur mit Mühe auf einen 30-km-Radius hochhandeln. Wenige Tage später musste der Befürworter des 30-km-Radius zurücktreten, und seine Nachfolgerin und die drei anderen beugten sich noch mal über die Karte, diesmal über eine aus echtem Papier, nicht wie zuvor über einen Computerbildschirm. Denn diesmal sollte verhindert werden, dass irgendjemand die Daten anzapfen und an die Presse weitergeben konnte. Wie bei einer Krebsoperation wurde nun nicht nur der Tumor selbst herausgeschnitten, sondern sicherheitshalber auch noch ein Stück nicht befallenes Gewebe weggenommen. Dabei zeigte sich, warum das geschasste Staatsoberhaupt dringend versucht hatte, lediglich einen 30-Kilometer-Radius abzuriegeln – ›bis auf weiteres‹, was, wie jeder wusste, konkret für mindestens ein bis zwei Jahrzehnte hieß. Schon bei 30 Kilometern mussten in Luxemburg, Frankreich und Deutschland Kleinstädte wie Esch-sur-Alzette, Thionville und Merzig dichtgemacht werden, und selbst dem altehrwürdigen Metz wurden einige Außenbezirke amputiert. Die 50-Kilometer-Sicherheitszone aber verdeutlichte das ganze Ausmaß der Katastrophe, weil es nun mit Belgien ein viertes Land betraf und es plötzlich Städte kostete, die überregional bekannt waren. Das machte die Leute in ganz Europa nervös. Die Stadt Luxemburg wurde geräumt, wobei man sich beeilte, mit den tausenden von EU-Beamten zu beginnen – um Frauen und Kinder kümmerte man sich später. Die trotzigen Gebäude des Europäischen Gerichtshofs dienten nun als Lager, wobei nicht genau bekannt ist, was da nun gelagert wird. Auch Metz ist jetzt komplett menschenfrei und seine mittelalterliche Innenstadt wird ebenso von Autoabgasen verschont wie die römischen Baudenkmäler in Trier. Wobei in Trier die nordöstlichen Stadtteile als noch bewohnbar deklariert wurden und sich einige der 20.000 im Stadtbereich Hinterbliebenen ab und zu durch den Zaun bei der Porta Nigra oder hinterm Dom durchzwängen, um ein Stündchen im verwaisten Zentrum zu flanieren. Ein sehr morbides Vergnügen. Saarbrücken entging gerade so eben dem Todesurteil der Bleistiftseite des Zirkels. Lediglich die östlich gelegene Nachbarstadt Völklingen musste geräumt werden. Die 50-km-Linie durchschneidet exakt den Stadtteil Luisenthal, der nun von unten ausgehöhlt und von oben verseucht ist, und die schmalen, rechteckigen Löcher eines auf eine lange Betonmauer gepflanzten Zauns in den alten Bergarbeitersiedlungen in der Püttlinger Straße in Burbach sind der östlichste Punkt, von dem aus man auf das gesperrte Gebiet schauen kann. Wenn man das will.
Alle Völklinger und Westsaarländer mit deutschem Pass wurden, damit die Entwurzelung nicht zu traumatisch wurde, ins Ostsaarland und in die Westpfalz umgesiedelt, was einigen Kleinstädten wie Pirmasens, Zweibrücken, Homburg und St. Ingbert zu deutlich mehr Einwohnern und Einfluss verhalf, zumal etliche Schulen, Krankenhäuser und sogar einige größere Firmen mit der gesamten Belegschaft einfach ein paar Dutzend Kilometer nach Osten zogen. Die Anteilnahme war groß, die finanziellen Hilfsmaßnahmen immerhin ausreichend, und lediglich die Einwohner, die über keine Zugehörigkeit zu einem ordentlichen EU-Land verfügten, wurden rasch in Brüssel abgegeben. Sollten die doch schauen, wo die Leute hin verteilt wurden. In Deutschland, Lothringen, Luxemburg und im wallonischen Teil Belgiens hatte man genug eigene Probleme.
Primstal war ein Sonderfall. Der westliche der beiden Ortsteile, Mühlfeld, lag genau an der Grenze zum Sperrgebiet. Eigentlich fiel das nur anderthalb Kilometer westlich liegende Krettnich auch noch ganz knapp, um wenige hundert Meter, außerhalb des 50-km-Zirkels, aber unglückliche Winde und von Petrus zur falschen Zeit an den falschen Ort gesandte Regenfälle hatten dem Städtchen Wadern und vor allem seinen Ortsteilen Krettnich und Lockweiler eine Strahlenbelastung beschert, die sogar die von Völklingen und Luisenthal übertraf. In Primstal waren die Messwerte kaum besser, aber irgendwo musste ja eine Grenze gezogen werden. Was hatte Gott sich dabei gedacht, ausgerechnet die unschuldigsten seiner Schäfchen mit solchem Unglück auf die Probe zu stellen? Anders als in den östlichen Teilen des Saarbrücker Stadtgebietes, verzichteten die Behörden darauf, zwischen Primstal und Krettnich Absperrzäune zu errichten. Die Behörden hielten es wohl für unnötig, die dicht bewaldeten Hügel und das morastige Tal, durch das sich die Prims schlängelte, gegen Grenzgänger zu sichern. Warum sollte jemand freiwillig über das fast menschenleere Krettnich (nur wenige hatten darauf bestanden, auf eigenes Risiko dort zu bleiben) ins ebenfalls größtenteils entvölkerte Wadern gelangen wollen? Die Straße, die aus Primstal Richtung Wadern hinausführte, zierte nun zwar ein ständig geschlossener Schlagbaum, aber sonst sah es so aus, als ob man hinüberspazieren dürfte. Den Zaun musste man sich denken. Und die Leute dachten sich ihn. Außer den Jungs natürlich, die mit ihren Flinten ihre Streifzüge machten, um am Westhang der Langheck, oberhalb von Krettnich, Wildschweine zu schießen. Die Schweine kümmerten sich einen Dreck um die Sperrzone.
Wenn man die Leute Jahre später fragte, ob sie es bereuten, in Primstal geblieben zu sein, verneinten das die meisten. Dabei hatte es zunächst nicht danach ausgesehen, dass das Dorf gehalten werden könnte. Die Messwerte waren, wie gesagt, ähnlich besorgniserregend wie in der Sperrzone, und dort hatten die Umsiedlungsprogramme gleich nach der Katastrophe begonnen. Dann hatten einige dieser Saarbrücker Bürokraten die grandiose Idee, die beiden Primstaler Ortsteile, die in den 1930ern erst miteinander vereint worden waren, wieder zu trennen, um Mühlfeld der Sperrzone zuzuteilen, während Mettnich der ›sicheren Seite‹ zugeschlagen werden sollte. Der Verwaltungsakt, aus Primstal wieder zwei Dörfer zu machen, war kurz davor, vollzogen zu werden, da traute sich eines der Saarbrücker Kommissionsmitglieder persönlich nach Primstal, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Ihm fiel auf, dass Mühlfeld und Mettnich so ineinander verwachsen waren, dass die Grenze quer durch einige Wohnhäuser verlief. Der Beckersch Matthes zum Beispiel fragte den Herrn von der Kommission, ob er und seine Frau denn nun umgesiedelt werden müssten, da sich das Schlafzimmer im Westteil ihres Einfamilienhauses befand, und ob sie ihre beiden Töchter, deren Kinderzimmer nach Osten, nach Mettnich gingen, alleine zurücklassen sollten. Dann kam noch heraus, dass die Primstaler beider Ortsteile fleißig die Strahlenbelastungen gemessen und die Ergebnisse dokumentiert hatten. So konnten sie dem Kommissionsabgeordneten nachweisen, dass die Werte am Kirchturm – der lag im offiziell ›sicheren‹ Mettnich – um ein, zwei Millisievert höher waren als die direkt unterm weißen Engel, der seine Hände schützend über die Kriegsgefallenen hielt, denen die Primstaler in Mühlfeld ein Denkmal gesetzt hatten.
In Saarbrücken wurden in den Wochen nach dem GAU etliche Steine, Fäkalien, vereinzelt auch Molotov-Cocktails und schließlich sogar strahlenbelastete Dreckklumpen aus der Sperrzone durch die Fenster des Landtages geworfen – vor allem nachdem die Leute hörten, dass die Umsiedlung doch mit deutlich geringeren Kompensationszahlungen über die Bühne gehen sollte, als anfangs versprochen. Die Behörden scheuten wohl deshalb davor zurück, die aufgebrachten Demonstranten verhaften zu lassen, weil es kaum einen Bereitschaftspolizisten gab, der nicht Freunde und Verwandte in der Gruppe der Steinewerfer erkannte.
Um nicht auch noch die hartnäckigen und treffsicheren Nordsaarländer zu motivieren, sich in der Landeshauptstadt den ständigen Protestaufmärschen anzuschließen, unterbreitete eine Sonderkommission ein Angebot, das die Primstaler nicht ablehnen konnten: Sie wurden vor die Wahl gestellt, alle in die Westpfalz umgesiedelt zu werden, zu den üblichen Entschädigungsbedingungen, oder eine sehr ordentliche zweistellige Millionen-Summe als Gemeinschafts-Fonds zur Verfügung gestellt zu bekommen und aus Primstal ein Musterdorf direkt an der Sperrzone zu machen. Die Primstaler entschieden sich für das Geld und die höhere Strahlenbelastung, also gegen die Westpfalz. Inzwischen weiß man, dass die Primstaler Delegation unter der Führung Eugens, des damaligen Bürgermeisters, nachverhandelt und die Summe so hochgetrieben hatte, dass jedem Primstaler pro Kopf ein sechsstelliger Betrag zur Verfügung stand. Theoretisch. Ein erheblicher Teil der ungeheuren Summe wurde nicht pro Kopf ausgezahlt, sondern gemeinschaftlich verwendet.
Natürlich gingen einige Einwohner weg, vor allem die, die Kinder hatten oder noch welche kriegen wollten. Allerdings ging nur, wer anderswo schnell Arbeit fand und genug Geld hatte, um weiter östlich die sprunghaft gestiegenen Immobilienpreise zahlen zu können. Letztlich blieben mehr, als man zunächst dachte. Vor allem die Älteren, deren Nachwuchs sowieso irgendwo weit weg studierte oder arbeitete. Wenn die eigenen, erwachsenen Kinder nicht gerade schwanger waren, konnten sie ihre Eltern beruhigt ein- oder zweimal pro Jahr zuhause besuchen. Sogar die Dorfärztin stellte klar, dass solche kürzeren Aufenthalte in Primstal nicht allzu gesundheitsgefährdend waren, solange man nichts aß, was vor Ort gewachsen war, regelmäßig Jod-Tabletten nahm, und ausschließlich das sichere Importwasser aus Südeuropa trank. Das wurde sowieso im Nachbarort angeliefert und dort in formschöne Glasflaschen abgefüllt. Es wurden also auch noch Arbeitsplätze damit gesichert, dass niemand mehr wie früher aus dem Wasserhahn trank.
Mit den Entschädigungs-Millionen wurde kein Schindluder getrieben, das muss man dem Bürgermeister und dem Stiftungsvorstand, der das Geld verwaltete, lassen.
Und so kam es, dass die Primstaler zu den allerersten Deutschen, ja sogar zu den ersten Europäern gehörten, die eine ordentliche Dorfmensa hatten – die war in der ehemaligen Grundschule untergebracht, mit überdachten Abstellplätzen für Mobilatoren davor. Außerdem verfügte die Dorfgemeinschaft über ein kleines, aber technisch und personell gut ausgestattetes Gesundheitszentrum, eine eigene Polizeistation – obwohl es praktisch keine Sicherheitsprobleme gab –, einen hervorragend funktionierenden Bringdienst für Medikamente, sowie einen Lieferservice für Nahrungsmittel, den Rollenden Mechels, dessen Personal außer Essen und Getränke auch das bis zur Haustür brachte, was man sonst im Alltag brauchte, den neuesten Dorftratsch zum Beispiel. Und es gab bereits früher als anderswo die notwendigen Sonderaufenthaltsgenehmigungen für Pflegepersonal aus Asien und Schwarzafrika.
Eigentlich ein Paradies für alte Leute, wenn es nicht so strahlen würde. Man konnte sich nie ganz sicher sein, ob man z. B. seine Leukämie anderswo nicht doch einige Jahre später gekriegt hätte. Justus ging jedenfalls soweit, seinen Heimatort als den gemütlichsten Wartesaal Gottes zu bezeichnen, den man sich vorstellen könne.
Die Dienststelle des Dorfpolizisten befand sich in dem Gebäude direkt oberhalb der Kirche, auf dem Matzenberg. Pfarrer und Polizist wohnten in exponierter Lage und so war auch räumlich klargestellt, wer hier die Dorfangelegenheiten regelte. Jeder wusste, dass Harald II und Pastor Peter nicht gerade traurig darüber waren, dass Pfarrhaus und Polizeidienststelle, wie übrigens auch das Büro der Bürgermeisterin, nur wenige Schritte voneinander entfernt lagen, denn so ließ es sich problemlos einrichten, Besprechungen und gemeinsame Entscheidungen zu verschiedensten Dorfproblemen mit reichlich Selbstgebranntem zu befördern.
Harald II strahlte eine so unverschämte Gemütsruhe aus, dass die Kommissarin sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, er sei zum Spaß oder gar aus innerer Überzeugung bei der Polizei. Selbst der Pfarrer konnte nicht überzeugender verkörpern, dass er seinen Platz im Leben gefunden hatte. Nichtsdestotrotz umgab den Dorfpolizisten eine Aura der Autorität. Er wirkte nicht, als ob er zuallererst das Gesetz vertrat, sondern vielmehr die Autorität im Allgemeinen.
Unaufgefordert erzählte Harald II der Kommissarin, dass er sich in seinem letzten Dienstjahr befinde und dass sein Nachfolger, Harald III, schon in Aussicht sei: Ein gemütlicher junger Mann, der aus dem Dorf stamme und das Polizeihandwerk im beschaulichen Hermeskeil gelernt habe, von wo er im nächsten Jahr nach Primstal zurückkehren wolle. Was machten schon ein paar Millisievert mehr oder weniger, wenn er dafür auf seiner Traumstelle saß. Bis man hier seinen Krebs hätte, sei man anderswo vielleicht längst erschossen worden, meinte Harald II. Er selbst habe nun seit kurzem auch einen Tumor, aber es bliebe genug Zeit, um das letzte Dienstjahr anständig abzuschließen und Harald III den Posten ordentlich zu übergeben.
Über die Geschehnisse in der Nacht von Freitag auf Samstag verlor er kein Wort.
Wegen ihrer geringen Körpergröße musste Paula, wie zu den meisten Leuten, auch zu Harald II aufschauen. Dennoch wirkte sie angriffslustig wie ein kleiner Terrier, als sie ihre Checkliste abfragte: »Und? Tatort gesichert? Zeugen befragt? Erste Spuren? Die Kollegen von der Spurensicherung sind ja wohl inzwischen auch schon da. Kommen die klar? Oder brauchen die Ihre Unterstützung? Was genau machen Sie gerade im Moment hier in der Dienststelle, Herr …?«
»Nennen Sie mich Harald, Frau Hauptkommissarin. Tja, ich ruhe mich gerade ein bisschen aus von den Strapazen der letzten Stunden. So was erlebe ich ja auch nicht alle Tage, nicht wahr? Ich brauchte mal ’ne Tasse Kaffee. Wollen Sie auch eine? Dazu gibt’s ein Stück Kuchen. Zwetschgenfladen von unserem Bäcker Mörsdorf, altes Traditionsbackwerk, eigentlich reif dafür, als kulinarisches Weltkulturerbe anerkannt zu werden.«
Der Hauptkommissarin gelang es nur mit Mühe – und das war nun wirklich neu für sie –, Harald II in seinen Ausführungen zu unterbrechen. Über den Stand der Ermittlungen erfuhr sie von ihm nichts. Wenigstens die organisatorischen Angelegenheiten ging er mit einem gewissen Enthusiasmus an: Ja, selbstverständlich könne sie das Büro hier im Erdgeschoss der Polizeidienststelle nutzen, jederzeit, sie solle sich wie zuhause fühlen. Als Harald ihr den Zweitschlüssel für die Eingangstür in die Hand drückte, lächelte er so selig, als ob er sich darüber freute, dass sie endlich bei ihm einzog. Paula merkte gleich, dass sie mit diesem Mann nicht arbeiten konnte.
»Gibt es hier vielleicht noch irgendeinen anderen, ähm, Offiziellen, der sich im Dorf gut auskennt und an den ich mich mit allen Detailfragen zu den Verhältnissen im Dorf wenden kann? Das würde Sie ja auch entlasten, und Sie könnten sich intensiver darum kümmern, dass, ähm, alles ruhig verläuft und so.«
Harald dachte lange nach, sehr lange, und machte ein ernstes Gesicht dabei. Die Hauptkommissarin wollte ihre Frage schon wiederholen, so lange währte Haralds Denkpause, da brachte er den Namen Justus hervor. »Ja, Justus, ich sag dem Jus, er soll sich für Sie bereithalten, der kennt sich aus. Da können Sie hier fragen, wen Sie wollen.«
»Justus? Aha, welche Funktion hat der denn?«
»Welche Funktion?«, wieder eine lange Denkpause, »nun, seine Funktion ist es, Primstaler zu sein. Der kennt alles und jeden hier, das ist seine Funktion. Der weiß Bescheid, auch über Dinge, die Generationen zurückliegen.«
»Soweit zurück werden wir bei diesen Ermittlungen wohl nicht gehen müssen«, antwortete Lück darauf so schnell, dass es wie ein Kläffen klang.
»Außerdem hat der Jus früher Krimis geschrieben, so kurze, wissen Sie, die als Heftchen gedruckt wurden und die es im Kiosk zu kaufen gab. Daher hat er viel Erfahrung in so was. Jedenfalls theoretisch.« Er guckte aufrichtig besorgt, als die Kommissarin mit einem gequälten Seufzer deutlich machte, dass auch dieses Argument sie keinesfalls überzeugte.
»Und wo finde ich diesen Justus?«, fragte sie dennoch.
»Um diese Zeit? Wahrscheinlich im CaféKastanienbaum oder in der Mensa. Mehr Möglichkeiten gibt’s nicht. Am besten schauen Sie zuerst im Kastanienbaum vorbei, der ist keine zwei Fußminuten von hier entfernt. Ja, ja, schon gut«, Harald hatte bemerkt, dass die Kommissarin mürrisch dreinschaute, »natürlich schicke ich Ihnen seine Adresse auf Ihren Commi!«
Hoffentlich muss ich mich mit diesem Harald nicht öfter herumschlagen, dachte Lück.
*
»Ich frage mich«, gab die Kommissarin bei ihrem ersten Gespräch mit mir zu bedenken, »wie das gehen soll, dass jemand ungesehen in den Hausflur kommt, den Geldbeutel fast komplett ausräumt, rasch wieder verschwindet, und das alles, während dieser Typ, dieser Meier Christian, in seinem Wohnzimmer sitzt und über den großen Haus-Bildschirm mit seinen Kumpels plaudert?«
»Ja, das ist schon sonderbar«, entgegnete ich, »vor allem, wo der Christian doch einer ist, der immer den Fuß auf dem Geld hat.«
»Sie meinen wohl den Daumen, es heißt: der den Daumen auf dem Geld hat.«
»Wie auch immer, Frau Kommissarin, vergessen Sie das blöde Geld, das Christian geklaut wurde. Das schadet dem gar nichts, glauben Sie mir!«
Sie sah mich zweifelnd an, und ich dachte mir, na gut, gib ihr einen Tipp. Sie wird wohl selbst nicht glauben, dass die Lösung der Fälle im Diebstahl von Christians Bargeld zu finden ist: »Kümmern Sie sich erst um die anderen Fälle, die sind wirklich wichtiger!«
Zugegeben, das war kein besonders bahnbrechender Vorschlag von mir, aber die Kommissarin antwortete: »Ja, Sie haben Recht, wir sollten uns zuerst um die schlimmeren Verbrechen kümmern, vor allem um dieses verschwundene Mädchen und um den ungeklärten Todesfall.«
Ich nickte. Auf Christians geklautes Geld kam die Kommissarin die nächsten Tage nicht wieder zu sprechen. Normalerweise wäre ein Diebstahl von knapp 60 Nord-Euro eine dankbare Mischung aus Skandal und Sensation gewesen, die tagelange Diskussionen in der Mensa befeuert hätte. Aber diese Sache war am nächsten Tag, am Kirmessonntag, bereits wieder vergessen.
4
Nun saßen sie doch im CaféKastanienbaum. Die Kriminalhauptkommissarin ärgerte sich. Sie war zu Justus’ Haus gefahren. Es lag am Hügel, mit Blick aufs Tal und übers Dorf. Der wohnt hier wie in einem Vogelnest, dachte sie.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!