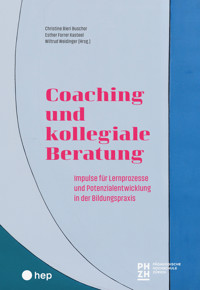
Coaching und kollegiale Beratung (E-Book) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält Bildbeschreibungen zu allen Grafiken. Es wird empfohlen, einen E-Reader zu verwenden, auf dem die Bilder vergrössert werden können. Selbstreguliertes Lernen, Kreativität und Flexibilität sind bedeutende Future Skills. Lehrpersonen und Dozierende begegnen der neuen Herausforderung, indem sie sich zunehmend als Wegbegleiter*innen verstehen, die Lernende in ihrer Kompetenzentwicklung zielführend unterstützen. Dazu benötigen sie Coachingkompetenz. Coaching und kollegiale Beratung dienen als Kompass auf dem Weg dazu, berufliche wie private Ziele zu erreichen und komplexe Probleme zu lösen. Die Autor*innen dieses Sammelbands besprechen Bedeutung, Konzeption, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und Methoden vielfältiger Coachingansätze zur Unterstützung persönlicher Stärken, Ziele und individueller Lern- und Studienwege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christina Bieri Buschor / Esther Forrer Kasteel / Wiltrud Weidinger /
Coaching und kollegiale Beratung
Impulse für Lernprozesse und Potenzialentwicklung in der Bildungspraxis
ISBN Print: 978-3-0355-2862-6
ISBN E-Book: 978-3-0355-2863-3
Die Herausgeber:innen gehören zum Hochschulpersonal der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Urheberrechte am vorliegenden Sammelwerk liegen bei der Hochschule. Die Nutzungsrechte liegen beim hep Verlag.
Bilder: Ausschnitte aus Werken von Jenny Losinger-Ferri
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 hep Verlag AG, Bern
hep Verlag AG
Gutenbergstrasse 31 | Postfach | CH-3001 Bern
[email protected] | hep-verlag.ch
Inhaltsverzeichnis
1 Coaching und kollegiale Beratung – Impulse für Lernprozesse und Potenzialentwicklung in der Bildungspraxis
2 Wahrnehmen, fragen, Perspektive verändern … Coaching mit systemischem Ansatz
3 Der integrativ-systemische Ansatz im Coaching
4 Resilienz und Resilienzförderung in Coaching und Beratung
5 Positive Psychologie und Coaching
6 Achtsamkeit in Mentoring und Coaching
7 Coaching mit Resonanz – wenn Coaching berührt und anklingt
8 Empathisch begleiten: Gewaltfreie Kommunikation im Coaching von Lehrpersonen und Studierenden
9 Transaktionsanalyse im Leadership Coaching
10 Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Wirksamkeit – eine Anregung für das (Selbst-)Coaching und Peer-Coaching von Lehrpersonen
11 Blended Coaching: Das Beziehungsmodell B3 für Begleitprozesse in der Bildung
12 Coaching von Führungspersonen in Konflikten
13 Durch Coaching zielorientiert am Umgang mit Belastung dranbleiben – ein Programm zur Stärkung der Selbstregulation von Lehrpersonen
14 Peer-Learning und Peer-Coaching als Element der Professionalisierung in internationalen Projekten
15 Impulse zur Reflexion und ein Ausblick
Autorinnen und Autoren
1Coaching und kollegiale Beratung – Impulse für Lernprozesse und Potenzialentwicklung in der Bildungspraxis
1.1 Vorwort
Coaching und kollegiale Beratung sind wichtige Future Skills zur kooperativen Problemlösung und Zielverfolgung in anspruchsvollen beruflichen und privaten Situationen. Als Herausgeberinnen verbindet uns das Anliegen, einen Beitrag für die Erweiterung der Coachingkompetenz im Bildungskontext zu leisten. In unserer täglichen Führungs- und Coachingarbeit suchen wir selbst immer wieder nach Impulsen für die ko-konstruktive Bewältigung von Problemstellungen, für das schrittweise Verfolgen von kleinen bis großen Zielen und für die Stärkung der Handlungskompetenz von Menschen in vielfältigen Kontexten.
Wir freuen uns, dass wir die Autor:innen für dieses praxisnahe Buch gewinnen konnten. Es ist ihnen in den 13 Beiträgen gelungen, theoretische Aspekte auf den Punkt zu bringen und sie mit Anregungen anschaulich zum Praxistransfer zu verbinden. Die Autor:innen teilen ihre – teilweise langjährigen – Coachingerfahrungen mit den Lesenden. Ihre Erfahrungen und Impulse für die Coachingarbeit inspirieren uns in unterschiedlichen Rollen: als Lernende, Lehrende, Coaches, kollegiale Berater:innen oder als Führungsverantwortliche. Der Austausch und Dialog über die verschiedenen Coachingansätze und die Verbindung mit der konkreten Coachingpraxis ist für uns – und hoffentlich auch für Sie als Lesende – sehr bereichernd.
Das Werk von Jenny Losinger-Ferri (1902–1993), Schweizer Malerin aus dem Kreis der Konstruktiven, kommt in den Übergängen von einem Beitrag zum nächsten zur Geltung. Max Bill schrieb im Jahr 1979 Folgendes über ihre Bilder (Losinger-Ferri, 1982, S. 13),
die qualität der leichten farbvibrationen ist der persönliche beitrag, den jenny losinger-ferri leistet zur gegenwartsmalerei. eine farb-qualität, die sich in sehr einfachen flächenformen abspielt, oft im gegeneinander von gerader und kurviger kontur, im hellen wie im dunklen klang.
Arco e retta, Bogen und Linie, war eines der Lieblingsthemen von Jenny Losinger-Ferri. Bogen und Linien begegnen sich. Die Bilder stehen in Verbindung mit dem Anliegen dieses Buches: Sie symbolisieren Begegnungen, Räume, Gegenüberstellungen, Wegstrecken und verweisen auf Farbkompositionen, Tiefgang, Perspektivenwechsel und Horizonte. Sie laden uns ein, zu zoomen, also den Blick auf etwas zu richten, was bekannt scheint, und uns doch zu unerwarteten Wahrnehmungen und neuen Perspektiven verhilft. Ein ähnlicher Prozess erfolgt durch das Zoomen im Coaching und in der kollegialen Beratung.
Wir bedanken uns bei Nicola Losinger für die einmalige Gelegenheit, die Bilder von Jenny Losinger-Ferri einzubeziehen. Ann Willemse hat für dieses Buch nicht wie üblich Tiere und Pflanzen fotografiert, sondern Bogen, Linien und Farbkompositionen. Auch ihr sei an dieser Stelle gedankt. Ramona Hürlimann danken wir für das Zusammentragen der einzelnen Teile zu einem Ganzen und die kompetente Überarbeitung des Manuskripts. Ein großer Dank geht an Susanne Gentsch vom hep Verlag, die uns kompetent und vor allem textstark im Prozess begleitet hat. Wir bedanken uns insbesondere bei allen Autor:innen für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Die Kooperation war eine Freude und hat uns – ganz im Sinne der positiven Psychologie – darin gestärkt, mutig dranzubleiben. Danken möchten wir auch vielen Kolleg:innen, Freund:innen und Familienmitgliedern für ihre wertvolle Unterstützung und Ermunterung für dieses Projekt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit den Autor:innen dieses Buches, Inspirationen aus verschiedenen Coachingansätzen mit Interessierten wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu teilen.
Zürich, im März 2025
Christine Bieri Buschor, Esther Forrer Kasteel und Wiltrud Weidinger
1.2Coaching und kollegiale Beratung als Future Skill
Die Ungewissheit der Zukunft erfordert lebenslanges Lernen – mehr denn je. Kompetenzen der Selbstbestimmung wie etwa Selbstwirksamkeit, Selbstregulation oder die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten, sind wichtige Future Skills zur positiven Bewältigung und aktiven Mitgestaltung der Zukunft (Ehlers, 2020). Für die Potenzialentwicklung und die Umsetzung von Zielen sind Orientierungspunkte und Unterstützung unabdingbar: Coaching, Mentoring und kollegiale Beratung gewinnen für die Navigation im zunehmend anspruchsvollen beruflichen und privaten Gelände an Bedeutung. Sie gelten heute als wichtige Elemente der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften.
Die große Bedeutung des selbstregulierten Lernens, der Selbstführung und Selbstreflexion führen zu neuen Anforderungen an Lehrpersonen und Dozierende an (Hoch-)Schulen: Sie sollen sich nicht mehr nur in der vermittelnden Rolle verstehen, sondern zunehmend auch als Wegbegleiter:innen, die Lernende in ihrer Kompetenz- und Potenzialentwicklung zielführend unterstützen. Dazu benötigen sie Coachingkompetenz. Das Interesse in diesem Bereich hat deutlich zugenommen, davon zeugen etwa zahlreiche Publikationen und verschiedene Tagungen zum Thema Coaching, Beratung und Supervision in der Hochschul- und Lehrer:innenbildung (z.B. Bender et al., 2022; Hebecker et al., 2016).
Lehrende an (Hoch-)Schulen sehen sich nicht nur in der Lernbegleitung gefordert, sondern ebenso in der Kooperation mit weiteren Akteur:innen. Lehrpersonen arbeiten beispielsweise mit Kolleg:innen, Eltern und Fachpersonen zusammen, insbesondere rund um Themen wie Diversität, Inklusion und multiprofessionelle Zusammenarbeit (Bender et al., 2022). In diesem Kontext stellt Coaching ein passendes Format für die Entwicklung pädagogischer Professionalität von (angehenden) Lehrpersonen dar, da es ziel- und handlungsleitendes Arbeiten ermöglicht, das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt und die Selbstregulation stärkt (Ryter, 2018). Dies setzt auch eine Veränderung der Haltung voraus, denn Coachingformate führen zu Begegnungen von Lehrenden und Lernenden oder Studierenden und Weiterbildungsteilnehmenden auf Augenhöhe. Das bedeutet, dass die Erfahrungen und Anliegen der Lernenden ernst genommen werden und stärker ins Zentrum rücken.
Coaching lässt sich als Prozessberatung im Spannungsfeld von Person, Rolle und Organisation definieren. Die Beratung baut auf einer kooperativen Beziehung zwischen Coach und Coachee auf, um professionelle Ziele zu erreichen und komplexe Probleme im beruflichen und privaten Kontext zu lösen (Greif et al., 2018). Kollegiale Beratung beruht auf den gleichen Prinzipien, geht jedoch von einer stärker symmetrischen Kooperation aus als das Coaching. Beide Zugänge sind sowohl persönliche Weiterbildung wie auch ein Element der Professionalisierung (Grant, 2014; Jones et al., 2016). Der Fokus der vielfältigen Coachingkonzepte variiert je nach theoretischer Verortung und Hintergrund der Coachenden. In der Tradition der positiven Psychologie basiert Coaching beispielsweise auf Kernprinzipien wie Stärkung des Wohlbefindens, Optimismus, Zuversicht, Zufriedenheit und Dankbarkeit, und es setzt auf Empowerment, Stärken und positive Emotionen (Mangelsdorf, 2019). Gemeinsam ist den in diesem Buch präsentierten Konzepten zum Coaching und zur kollegialen Beratung, dass sie als Kompass zur Ziel- und Problemlöseorientierung dienen.
Das vorliegende Herausgeberwerk stellt vielfältige Inspirationen zu verschiedenen Traditionen, Konzepten, Theorien und Methoden beziehungsweise Anwendungen verschiedener Ansätze zu Coaching und kollegialer Beratung für die Lehre, den Unterricht und die Weiterbildung zur Verfügung. Es ist als theoretisch fundiertes Praxishandbuch für die Lehrer:innenbildung konzipiert und beinhaltet Instrumente zur Navigation, die im weiteren Bildungskontext anschlussfähig sind. Es eignet sich für Lehrende, Dozierende, Studierende und Führungspersonen mit beraterischen Tätigkeiten im weiteren Sinne an verschiedenen (Hoch-)Schulen, Berufsbildungsschulen und weiteren (Bildungs-)Institutionen. Das Buch richtet sich an Lesende mit Interesse an vielfältigen Coaching-Aktivitäten, die nicht nur im klassischen Coaching-Kontext, sondern in verschiedenen Lehr-Lern-Settings ihre Umsetzung finden. Ziel ist es, die Bedeutung von Coaching zur Unterstützung der persönlichen Stärken, Ziele und individuellen Lern- und Studienwege herauszuschälen und Impulse für Coaching-Tätigkeiten zu geben. Das Buch ersetzt weder eine Coaching-Ausbildung noch verfolgt es einen therapeutisch-beratenden Ansatz. Es leistet vielmehr einen Beitrag zur Kulturbildung an Bildungsinstitutionen und verweist auf den zentralen Stellenwert der Stärkung von Persönlichkeitsbildung und Kompetenzentwicklung in den Bereichen Sozialkompetenz, Selbstmanagement und Selbstreflexion. Schließlich verfolgen wir mit diesem Buch auch das Everest-Ziel, Coaching als Prozess und Format vermehrt in die Lehre und den Unterricht zu bringen beziehungsweise weiter zu stärken. Everest-Ziele sind subjektiv wahrgenommene große Ziele, die uns motivieren und inspirieren sollen (Cameron, 2013). Dies ist verbunden mit dem Anliegen, die Coachingkompetenz von Lehrenden und Studierenden respektive Lernenden in unterschiedlichen Kontexten zu unterstützten.
Das Herausgeberwerk versteht sich also als Fundus zur Erweiterung der eigenen Coaching- und der kollegialen Beratungspraxis. Die Beiträge der dreizehn Autor:innen sind so vielseitig wie die Coachingansätze. Sie sind theoretisch, kurz und prägnant verortet. Im Zentrum steht der durch unterschiedliche Methoden und Übungen angereicherte Praxistransfer, der durch ausgewählte Trainingselemente und Reflexionsfragen unterstützt wird.
Zum Aufbau des Buches: Nach der kurzen Präsentation der Beiträge folgt ein theoretisches Kapitel zur Begriffsklärung und Verortung der verschiedenen Coachingansätze und zu Aspekten der Wirksamkeit. Der Ansatz der positiven Psychologie erhält einen zentralen Stellenwert, weil er im Bildungsbereich auf eine hohe Akzeptanz stößt. Den Abschluss bilden ein Kapitel rund um die vielfältigen Möglichkeiten von Coaching und Beratung in der Lehrer:innenbildung beziehungsweise im Bildungskontext mit Blick auf zukunftsorientierte Kompetenzen – die Future Skills – und ein Kapitel zur Wirksamkeit von Coaching.
1.3Die Beiträge in Kürze
Helga Kohler-Spiegel fokussiert im ersten Beitrag Wahrnehmen, fragen, Perspektive verändern … Coaching mit systemischem Ansatz ebenjenen Ansatz. Es geht um vielfältige Erkenntnisse aus der Kommunikationspsychologie wie das aktive Zuhören und das Kommunikationsquadrat. Die Autorin richtet die Aufmerksamkeit auf die Wirkung und Möglichkeiten von Wahrnehmung und Perspektivenwechsel. Sie zeigt zudem auf, mit welchen Methoden und Frageformen Handlungen lösungsorientiert weiterentwickelt werden können – unter Berücksichtigung des Wirkbereichs der Person und des Systems. Das systemische Denken spielt eine zentrale Rolle und findet seine Konkretisierung im Rahmen ausgewählter Gesprächsverläufe, etwa am Beispiel eines Elterngespräches oder handlungsleitender Techniken.
Im zweiten Beitrag zum integrativ-systemischen Ansatz im Coaching legt Jean-Paul Munsch den Schwerpunkt auf das Verstehen der Prinzipien von Systemen als sich zunehmend differenzierende Wahrnehmungsprozesse sowie auf Interventionen. In der Verbindung der integrativen und systemischen Perspektive geht es, so schreibt er, «um Akzeptanz als ein Grundprinzip des humanistisch-integrativen Ansatzes und um das Anwenden von phänomenologisch-systemischen Prinzipien». Er ermutigt uns, neben kognitiven Aspekten und Mustern beispielsweise auch Wahrnehmungen der Atmosphäre oder Unstimmigkeiten einzubringen, überraschende Fragen zu stellen. An einem Praxisbeispiel zeigt er auf, mit welchen Fragen und Übungen dies umgesetzt werden kann.
Im dritten Beitrag Resilienzförderung in Coaching und Beratung präsentiert Jürg Frick wichtige Ergebnisse aus der Resilienzforschung und ihre Bedeutung für Coaching und Beratung in der Lehrer:innenbildung. Er geht vom Verständnis von Resilienz als dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess aus und untersucht die personenbezogenen Resilienzfaktoren. Jürg Frick zeigt Möglichkeiten für den Transfer und die konkrete Arbeit mit Lehrpersonen in der Aus- und Weiterbildung auf. Es kommen Coachingideen für die Arbeit an Grundhaltungen, Copingstrategien, Selbstwirksamkeit, aber auch notwendige Distanzierung und Wertschätzung von Positivem und letztlich Gelassenheit und Humor zur Sprache.
Heike Schwarzgruber zeigt im vierten Beitrag Positive Psychologie und Coaching auf, wie Mentoring und Coaching auf der Basis theoretischer und praktischer Aspekte der positiven Psychologie die Selbstwirksamkeit und damit auch das Wohlbefinden von Lehrpersonen zu stärken vermögen. Coaching setzt bei positiven Emotionen und Stärken an. Ausgangspunkt ist die positive Diagnostik in Verbindung mit einem lösungsfokussierten Kommunikationsrahmen. Die Autorin präsentiert Reflexionsfragen und praktische Übungen zur Arbeit mit positiven Emotionen und Charakterstärken. Ein Fallbeispiel aus dem Coaching mit einer Lehrperson sowie ein Plädoyer für eine stärker ressourcenorientierte Haltung von Akteur:innen im Bildungssystem runden den Beitrag ab.
Im fünften Beitrag Achtsamkeit in Coaching und Mentoring lädt Detlev Vogel uns zur Reflexion unserer eigenen Achtsamkeit in Gesprächen ein. Nach der Unterscheidung des Mentoring- vom Coachingbegriff folgt ein Überblick über theoretische und empirische Aspekte der Achtsamkeit als bewusster Aufmerksamkeitsregulation, also als Hinwendung zum gegenwärtigen Moment, und als Entwicklung einer nicht-urteilenden Haltung sich selbst und der Umwelt gegenüber (Kabat-Zinn, 1999). Vor diesem Hintergrund führt Detlev Vogel mit Praxisbeispielen aus, wie sich die eigene Achtsamkeitspraxis und -haltung in Mentoringgesprächen positiv auswirken. Zudem beschreibt er Achtsamkeitsübungen, die mit Studierenden oder anderen Personen durchgeführt werden können. Schließlich schlägt er vor, Achtsamkeit stärker in der Aus- und Weiterbildung zu integrieren.
Esther Forrer Kasteel vertieft im sechsten Beitrag Coaching mit Resonanz – wenn Coaching berührt und anklingt das Konzept der Resonanz im Kontext der Coachingpraxis. Ihren Beitrag eröffnet sie mit der Erörterung des vom Soziologen Hartmut Rosa entwickelten Konzeptes der Resonanz (2019). Dieses basiert auf drei Resonanzachsen sowie auf vier Merkmalen von Resonanz: auf dem Moment der Berührung, auf der Selbstwirksamkeit, auf der Anverwandlung und auf der Unverfügbarkeit. Die Autorin zeigt verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen der Coachingspraxis auf, insbesondere die Anwendungsmöglichkeiten des Resonanzdreieckes. Den Beitrag rundet sie mit konkreten Resonanzübungen für vielfältige Coachingsituationen ab.
Im siebten Beitrag zur gewaltfreien Kommunikation im Coaching geht Tina Ammann dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation auf den Grund. Es stehen die vier Phasen der «Giraffensprache» beziehungsweise der «Sprache des Herzens» nach Rosenberg (2016) sowie die sieben Phasen des Empathie-Prozesses im Zentrum. Die Autorin geht anschaulich auf die verschiedenen Phasen ein und konkretisiert mit einem eindrücklichen Fallbeispiel, das sich an die eigene Coachingpraxis adaptieren lässt.
Kathrin Rutz beleuchtet im achten Beitrag Transaktionsanalyse im Leadership-Coaching den spezifischen Ansatz der Transaktionsanalyse in der Beratung, insbesondere von Schulleitungen. Nach einer kurzen theoretischen Verortung des Konzepts zeigt sie an einem Beispiel, wie ein Praxistransfer entlang den Grundbotschaften möglich ist. In der Arbeit mit Führungspersonen bedeutet die Transaktionsanalyse die Auseinandersetzung mit Selbstführung, mit Beziehungen und ihrer Gestaltung, aber auch mit der Reflexion von Lebensgrundhaltungen, mit «functional fluency» als Beweglichkeit des eigenen Verhaltensrepertoires sowie mit psychologischen Spielen.
Im neunten Beitrag Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Wirksamkeit – eine Anregung für das (Selbst-)Coaching und Peer-Coaching von Lehrpersonen zeigt Andrea Chlopczik den dynamischen Zusammenhang von persönlicher Entwicklung und beruflicher Wirksamkeit auf. Sie bezieht sich auf die «Theorie U» von Scharmer (2009), ein Prozessmodell für ganzheitliches Vorgehen im Coaching, und verbindet dies mit dem Resonanzkonzept (Rosa, 2019). Ein Fallbeispiel dient der Veranschaulichung. Im Praxisteil stellt sie ein Empathie-Trainingsprogramm für Lehrpersonen und seine Wirkung vor. Schließlich leitet die Autorin konkrete Übungen für die persönliche Entwicklung, Supervision und (Peer-)Coachingpraxis ab.
Dagmar Engfer und Simone Heller-Andrist präsentieren im zehnten Beitrag eine besondere Form des Coachings: Sie beschreiben das Konzept des Blended Coaching in der Hochschulbildung als Verschmelzung von Weiterbildung und Beratung. Ihr Beziehungsmodell beinhaltet die Aspekte Beraten, Begleiten und Beurteilen. Diese überlappen mit der Beziehung als Grundbasis. Wesentlich für die Gestaltung dieser Beziehung sind grundsätzliche Haltungen und die Klärung gegenseitiger Erwartungen von Dozierenden und Teilnehmenden. Das Begleitkonzept der Autorinnen beinhaltet konkrete Übungen für die fragende Haltung im Coachinggespräch.
Elisa Streuli zeigt im elften Beitrag Konfliktmanagement und Coaching/Beratung im Bereich Leadership die vielfältigen Konfliktanlässe im Führungsalltag anschaulich auf. Ein bildhafter Überblick verdeutlicht, dass diese Konfliktanlässe aus vielfältigen Widersprüchen in der Führungsrolle, Konflikten zwischen der Führungsperson und unterschiedlichen weiteren Personen resultieren sowie aus Konflikten zwischen anderen Personen ohne Beteiligung der Führungsperson. Der Konflikt lässt sich auf verschiedenen Ebenen lösen, insbesondere auf den Ebenen Arbeitsorganisation, Rollen und Verhalten. Für den Praxistransfer konkretisiert die Autorin das Vorgehen zur Konfliktlösung mit einem Fallbeispiel.
Christine Bieri Buschor, Zippora Bührer, Simone Berweger, Andrea Keck Frei, Christine Wolfgramm und Nicole Périsset stellen im zwölften Beitrag Zielorientiert am Umgang mit Belastung dranbleiben durch Coaching – ein Programm zur Stärkung der Selbstregulation von Lehrpersonen ein Selbstmanagementtraining mit Praxistransfer durch Onlinecoaching vor. Das Training entstand im Kontext eines großen Projektes zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen. Als Ausgangspunkt dient das zyklische Phasenmodell der adaptiven Zielverfolgung im Coachingprozess. Es geht um die bewusste Entscheidung für ein Handlungsziel als Voraussetzung für selbstreguliertes Handeln sowie um die Bedeutung von Emotionen. Ein Fallbeispiel veranschaulicht, wie durch diesen Prozess wirksame Coachinginterventionen möglich werden. (Peer-)Coaching-Übungen aus der systemischen Beratung und positiven Psychologie zeigen, dass positives Denken und Wünschen erst dann zum Wollen und schließlich zum Handeln führt, wenn ein Handlungsplan zur Implementierung von Zielen und der Antizipation von Hürden integriert wird (Oettingen, 2015). (Online-)Coaching unterstützt diesen Prozess nachhaltig.
Im dreizehnten Beitrag stellt Wiltrud Weidinger das Konzept des Peer-Learning und Peer-Coaching im Rahmen von internationalen Projekten vor. Nach einer Begriffsbestimmung und Differenzierung der Bedeutung von Peer-Learning in der Lehrer:innenbildung stellt sie verschiedene Konzepte dar. Entlang eines konkreten Beispiels aus der internationalen Bildungskooperation diskutiert die Autorin die Umsetzung des Peer-Learning-Ansatzes an verschiedenen Universitäten der Republik Moldau. Konkrete Herausforderungen in der Einführung des Konzepts zeigen sich insbesondere in der Rollenklarheit und -diffusion, der Symmetrie oder Asymmetrie von Beziehungen zwischen Dozierenden und Studierenden beziehungsweise Teilnehmenden sowie in der Überwindung von wahrgenommener Kontrolle oder Beurteilung.
Vor dem Einstieg in die vielfältigen Beiträge skizzieren wir eine Landkarte zum Thema Coaching und Beratung. Wir klären Begriffe und stellen verschiedene theoretische Zugänge kurz vor – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ein spezifischer Fokus liegt auf der positiven Psychologie im Coaching und in der Beratung, weil der stärken- und lösungsorientierte Ansatz im Bildungskontext derzeit auf eine besonders hohe Resonanz stößt.
1.4Coaching, Mentoring und kollegiale Beratung – ein Überblick
In der Diskussion über Formen von Coaching, Mentoring oder kollegialer Beratung im Bildungskontext zeigt sich, dass die Begrifflichkeiten oftmals unscharf sind und mitunter synonym verwendet werden. Welches sind die Unterschiedlichkeiten und Überlappungen? In diesem Buch gilt folgendes Verständnis der Begriffe:
1.4.1Mentoring und Coaching
Mentoring und Coaching sind zentrale Elemente der Aus- und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung und des Workplace Learning. Dieses umfasst Zugänge wie situiertes oder transformatives Lernen, das stark an den Anliegen der Teilnehmenden anknüpft. Workplace Learning ist mit seinen (in-)formalen sowie informellen Lernanteilen auf die vielfältigen Anforderungen und Veränderungen der Arbeitswelt bezogen, und zwar unter Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mentoring und Coaching dienen der Bewältigung dieser Anforderungen (Dochy et al., 2022). Derzeit werden Mentoring und Coaching auch bezüglich der Digitalisierung diskutiert (Greif et al., 2022; Pfaum & Schwalb, 2021). Onlinecoaching beziehungsweise Mentoring kombiniert herkömmliche Methoden mit digitalen Kommunikationsformen wie dem Chat. Diese Formen haben deutlich zugenommen. Sie bieten Vorteile wie örtliche und zeitliche Flexibilität, Niederschwelligkeit, gute Zugänglichkeit, Prozessdokumentation und Verschriftlichung der Reflexion, Schutz der Privatsphäre und Gesundheitsorientierung durch schnelle Interventionsmöglichkeiten (Berninger-Schaefer, 2018; Geissler et al., 2023; Jones et al., 2016). Onlinecoachings und virtuelle Beratungsangebote werden nicht nur als eigene Beratungssettings eingesetzt, sondern vermehrt auch als Ergänzung von kursorischen Weiterbildungslehrgängen angewandt. Die Teilnehmenden können parallel zur Teilnahme vor Ort von niederschwelligen, pragmatischen und individualisierten Onlineberatungen profitieren.
Die Grenzen zwischen Mentoring und Coaching sind fließend. Ein Unterscheidungsmerkmal ist der klare Fokus im Coaching. Er ist meist auf eine bestimmte Problem- oder Fragestellung einer Person in ihrer Laufbahn oder im Privatleben gerichtet, die in der Kooperation mit einem:einer professionellen Coach:in gezielt bearbeitet wird. Das Mentoring hingegen ist im Arbeitskontext eher informell. Der:die Mentee erhält Einblick in nützliches Wissen und Können der Mentorin oder des Mentors innerhalb eines organisationalen Kontexts, beispielsweise im Bereich Führung. Mentoring wie Coaching lassen sich als Konzepte von der psychologischen Beratung abgrenzen, die in einem bestimmten Setting tiefgreifende Probleme bearbeitet (Backhausen & Thommen, 2006; Ramaswami & Dreher, 2010).
Im Kontext der Lehrer:innenbildung meint Mentoring in der Regel die Arbeitsbeziehung zwischen erfahrenen Mentor:innen und angehenden Lehrpersonen. Mentoring bewegt sich zwischen den Polen soziale Unterstützung und Modelllernen (Führer & Cramer, 2020). Es beschränkt sich nicht auf die Weitergabe von Erfahrungswissen, sondern will Unterstützung bieten bei der Sozialisation in den Beruf mit Blick auf die ko-konstruktive und konzeptionelle Durchdringung der Praxis. Dies bedingt ein differenziertes Verständnis von der Dynamik in der Kooperation (Führer & Cramer, 2020). Hier überlappen sich Mentoring und Coaching stark. Coaching bewegt sich in einem Kontinuum von direktiven, instruktionalen Ansätzen bis hin zu kooperativen, reflexiven Zugängen (Kraft et al., 2018). Lehrerbildner:innen, Dozierende und Lehrpersonen anderer Bildungsinstitutionen und Schulen eignen sich Coachingkompetenzen häufig on the job an. Coachingkompetenz meint eine reflexive Haltung. Diese reflexive Haltung zeichnet sich durch eine starke Kooperation zwischen Coaches und Coachees aus, dies im Gegensatz zu einem Lehr-Lern-Verständnis der Vermittlung durch eine Expertin oder einen Experten. Coaching geht mit einem veränderten Rollenverständnis einher: Im Zentrum steht nicht die Wissensvermittlung, sondern das gemeinsame Problemlösen.
1.4.2Kollegiale Beratung
Das Konzept der kollegialen Beratung entspricht in seinem Kern der strukturierten Form von Fallberatung, die in einer Gruppe von nicht mehr als acht Fachpersonen oder Führungspersonen regelmäßig und ohne externe Leitung durchgeführt wird (Ryschka & Tietze, 2011). Die Teilnehmenden folgen einer Struktur oder einem Ablauf, der zur Problemlösung von vorgestellten Fällen oder Situationen, zur Kompetenzentwicklung sowie zur Unterstützung, zum Rückhalt und zur Entlastung in schwierigen Situationen beiträgt (ebd.; Rauschenberger, 2021). Das Vorgehen basiert auf den Prinzipien der Freiwilligkeit, der Gleichberechtigung und der Transparenz. Wesentlich ist im Unterschied zum Coaching die Symmetrie der Beziehungen und die Tatsache, dass für die Bearbeitung der vorgebrachten Fälle, Situationen und Probleme kein Fachwissen aus spezifischen Arbeitsbereichen notwendig ist (Rinmasch, 2017). Ähnlich wie im Coaching geht es auch hier nicht um eine gegenseitige Belehrung, sondern um das Verstehen eines Falls oder einer problematischen Situation sowie darum, Denkanstöße zu geben und letztlich bei der Problemlösung zu helfen. Die kollegiale Beratung, auf Englisch peer counselling, auch als «kollegiale Fachberatung», «kollegialer Austausch», «Intervision», «kollegiale Supervision», «Fallberatung» oder «Teamberatung» bezeichnet, setzt auf die Kraft der Gruppe mit ihren Kommunikationskompetenzen sowie auf den klar strukturierten Ablauf (Rauschenberger, 2021; Schlee, 2019). Zum Ablauf einer kollegialen Beratung gibt es unterschiedliche Modelle (z.B. de Haan, 2005; Franz & Kopp, 2003; Lippmann, 2009; Rotering-Steinberg 2006; Tietze, 2008). «Kollegiale Beratung» taucht verbreitet als Überbegriff auf für jegliche Art von Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Auch wer im Tandem den regelmäßigen Austausch sucht, pflegt die kollegiale Beratung. Im Bildungsbereich wird sie als Instrument der Schulentwicklung eingesetzt (Macha, 2010). In Beratungskontexten im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich gilt die kollegiale Beratung seit langem als «Intervision».
1.5Theoretische Grundlagen: vielfältige Zugänge und Traditionen
In Anlehnung an Greif et al. (2018) verstehen wir Coaching als übergeordnete Profession. Coaching ist geprägt durch vielfältige Konzepte und Zugänge, die sich gegenseitig befruchtet haben. Das Verständnis von Coaching geht Hand in Hand mit dem jeweiligen konzeptionellen Zugang. Die ergebnisorientierte Selbstreflexion und die Hilfe zur Selbsthilfe gelten für verschiedene Ansätze als Kernelemente (Greif et al., 2018).
Maßgeblich geprägt wurden die verschiedenen Coachingansätze in den 1960er- und 1970er-Jahren durch die Bewegung der Civil-Rights- und Selbsthilfebewegung in den USA, durch die Human-Potenzial-Bewegung und die humanistische Tradition. Namhafte Vordenker:innen wie Abraham Maslow, Will Schutz, Carl Rogers, Fritz Perls, Virginia Satir, Timothy Leary, Fritjov Capra, Alexander Lowen, Victor Frankl, Albert Ellis, Eric Berne, Sir John Whitmore und Alan Watts verkehrten im Esalen Institute in Big Sur, Kalifornien (USA). Neben Vertretern und Vertreterinnen empirischer, psychoanalytischer, kognitiv-verhaltensorientierter und konstruktivistischer Ansätze fanden sich auch einige mit spirituellen Zugängen (Greif et al., 2018).
Im Folgenden skizzieren wir in Anlehnung an den Überblick bei Greif et al., (2018) acht Coachingansätze, die wir um vier erweitern: Humanistisches Coaching, Transaktionsanalyse, Körperzentriertes Coaching und Achtsames Coaching.
1.5.1Systemisches Coaching
Ein großer Teil des Coachingangebots folgt systemischen Ansätzen. Einige Autor:innen beziehen sich auf die operativ-konstruktivistische Theorie sozialer Systeme nach Luhmann, andere auf die Personale Systemtheorie nach Bateson oder auf familientherapeutische Ansätze wie etwa jener von Satir (Greif et al., 2018). Die Wurzeln des systemtheoretischen Coachings entstammen der Tradition der Familientherapie. Die Systemtheorie bezieht sich im Wesentlichen auf 1) die Kybernetik erster und zweiter Ordnung, das heißt auf Theorien über beobachtete Systeme, 2) den Radikalen Konstruktivismus, das heißt auf die erkenntnistheoretische Philosophie, die davon ausgeht, dass es keine objektive Erkenntnis gibt, 3) den Sozialen Konstruktivismus mit Fokus auf Beziehungen, 4) die Autopoiesis, das heißt auf selbsterzeugte Systeme, 5) die Synergetik, das heißt auf die Lehre des Zusammenwirkens von Einzelteilen sowie 6) die Systemische Therapie, die aus einer Verbindung von Familientherapie und Kommunikations- und interdisziplinärer Systemtheorie entstanden ist (Ryba & Roth 2019).
1.5.2Psychodynamisches Coaching
Viele Coachingkonzepte haben ihre Wurzeln in psychoanalytischen Therapierichtungen. Sie berücksichtigen unbewusste Prozesse wie Abwehrmechanismen, Ängste und Widerstände. Ebenfalls einbezogen werden unbewusste Konfliktmuster und dominante Charakterausprägungen der Coachees (Giernalczyk & Möller, 2018; Greif et al., 2018; Lohmer & Möller, 2019; Ryba & Roth, 2019). Zentraler Gegenstand sind die Selbstreflexion, Emotionen, Übertragung und Gegenübertragung sowie das Containment. Containment repräsentiert eine psychodynamische Grundhaltung des:der Coach:in. Gemeint ist damit, dass diese:r das Setting hält und Spannungen oder Konflikte aufnimmt, innerlich reflektiert und schließlich in geeigneter Weise an den:die Coachee zurückgibt. Diese Methode vermag in der Regel eine verblüffende Wirkung zu erzielen (Giernalczyk & Möller, 2018; Lohmer & Möller, 2019; Möller & Giernalczyk, 2023). Bei den psychodynamischen Ansätzen geht es im Wesentlichen um das Erkennen persönlicher und organisationaler Muster und um die Stärkung von Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung (Greif et al., 2018; Ryba & Roth, 2019).
1.5.3GROW-Modell und zielorientiertes Coaching
Das GROW-Modell wurde von Jon Whitmore begründet. Das Akronym steht für Goal setting, das heißt für das Setzen kurz- und langfristiger Ziele. Kernelemente des Modells sind die Prüfung der Realisierbarkeit (Reality checking), die Wahlmöglichkeiten (Options) und die durch SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) definierten Zielformulierungen (Will: what, when, who will). Das zielorientierte Coaching wurde unter anderem von Anthony Grant vor dem Hintergrund motivationaler Theorien entwickelt. Es basiert auf kognitionspsychologischen Ansätzen zur Selbstregulation. Es lassen sich verschiedene Ziele wie Leistungs-, Lern- oder Ergebnisziel unterscheiden. Von zentraler Bedeutung für das Coaching sind selbstkonkordante Ziele, die im Sinne der Selbstkongruenz an die zentralen persönlichen Werte und Entwicklungsinteressen der Coachees anschließen (Grant, 2018; Greif et al., 2018).
1.5.4Kognitiv-behaviorales Coaching
Beim kognitiv-behavioralen Coaching liegt der Fokus auf der Analyse und Veränderung des Verhaltens sowie auf den damit verbundenen Kognitionen und Emotionen. Dadurch unterscheidet es sich von der herkömmlichen Verhaltenstherapie (Greif et al., 2018). Der kognitiv-behaviorale Ansatz ist eine Weiterentwicklung des klassisch verhaltenstherapeutischen. Er bezieht Wahrnehmung, Erkennen, Begreifen, Urteilen, Schlussfolgern und Denken mit ein (Ryba & Roth, 2019). Bekannt ist das aus der Therapie stammende ABC-Modell nach Ellis (1993). Ereignisse, die als aktivierend oder als widrig erlebt wurden, und die dazugehörenden irrationalen Überzeugungen werden analysiert, die damit einhergehenden emotionalen Konsequenzen wahrgenommen. Ziel ist es, die irrationalen Überzeugungen und damit die Emotionen positiv zu beeinflussen.
Oftmals integrieren kognitiv-behaviorale Konzepte verschiedene weitere Coachingansätze (Greif et al., 2018). Ausgehend von dysfunktionalen Kognitionen (als Ursache für psychische Beeinträchtigungen) wird auf eine kognitive Umstrukturierung abgezielt. Die Methode ist der sokratische Dialog über irrationale Anschauungen und Deutungen. So können negative Wirkungen aufgezeigt und entsprechende Konsequenzen abgeleitet werden (Ryba & Roth, 2019).
1.5.5Lösungsorientierte Beratung
Der lösungsorientierte Ansatz ist insbesondere bekannt als lösungsfokussierte Beratung nach de Shazer (de Shazer, 1994, 2017; de Shazer & Dolan, 2018; Vogt et al., 2012). Er markiert einen Paradigmenwechsel: Statt Probleme werden nun Lösungen analysiert. In der lösungsfokussierten Beratung liegt die gesamte Aufmerksamkeit auf Lösungen, auf dem Lösungserleben und auf der Lösungsentwicklung unter Einbezug des Potenzials der Coachees sowie weiterer Ressourcen. Damit rückt in den Fokus, was wünschenswert ist. Das zeigt sich in den lösungsorientierten Fragen danach, was sein soll, was sein wird und was schon da ist (Ronzani, 2019). Wenn über Nacht ein Wunder eintreten würde, was wird sich verändert haben? Diese «Wunderfrage», aus der Retrospektive gefragt, ist bekannt geworden (de Shazer & Dolan, 2018; Sparrer, 2021).
1.5.6Positiv-psychologisches Konzept
Das positiv-psychologische Konzept basiert auf der Grundkonzeption der positiven Psychologie nach Seligman (2003, 2015). Die positive Psychologie, die sich als Abwendung von psychischen Störungen und Gesundheitsorientierung versteht, lässt sich in aller Kürze wie folgt beschreiben: «the science of what goes right in life» (Blickhan, 2021, S. 20). Ähnlich wie nach dem lösungsfokussierten Ansatz wird die Energie beziehungsweise der Fokus auf positive Entwicklungen und Potenziale gerichtet (Greif et al., 2018). Ziel ist es, Menschen in der Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen und ihnen zu mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden zu verhelfen (Blickhan, 2021). Neben Stärken und Emotionen stehen auch Grundbedürfnisse, Motivation, Ziele, Umgang mit Stress und Belastung und das Selbstmitgefühl im Zentrum (Blickhan, 2021).
1.5.7Ergebnisorientiertes Coaching
Das ergebnisorientierte Coaching beinhaltet neben Zielklärungen nach SMART-Kriterien auch Reflexionen der Coachees zu ungenauen Zielen sowie zu Identitäts- und Sinnklärungen. Im Unterschied zum Coaching nach den Grundsätzen der positiven Psychologie werden hier auch negative Erlebnisse und Probleme reflektiert. Das ergebnisorientierte Coaching stützt sich zudem auf empirisch abgesicherte Erkenntnisse und bleibt auch anderen Anliegen nicht verschlossen (Greif et al., 2018). Die Selbstreflexion entwickelt sich aus bisherigen Reflexionen hin zu künftigem Handeln. Die Selbstbeobachtung ist ein Schlüssel für das selbstregulierte Handeln der Coachees (Greif & Rauen, 2018).
1.5.8Narratives Coaching
Das narrative Coaching basiert auf der Narrativen Psychotherapie nach White und Epston (1990). Die Familientherapeuten gehen von der Grundannahme aus, dass Geschichten, die Personen über sich und ihr Leben erzählen, deren individuelle Identität formen. Zentral sind die besonders häufig erzählten Geschichten und solche, die starke Emotionen auslösen. Das narrative Coaching ist als offenes und philosophisches Gespräch zu verstehen. Es geht darum, dass die Erzählenden erkennen, dass die Narrationen persönlich konstruiert sind und bewusst wie unbewusst die Identität sowie das Verhalten prägen. Ziel ist es, die Geschichten mit sich selbst in Einklang zu bringen (Greif et al. 2018).
1.5.9Humanistisches Coaching
Ausgangspunkt ist die humanistische Psychotherapie. Das daraus hervorgegangene Coaching folgt der Ganzheitlichkeit, Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung, vielfältigen Begegnungen sowie der Autonomie bei gleichzeitiger sozialer Abhängigkeit. Die zwei Hauptrichtungen bilden die personenzentrierte Therapie von Rogers und die Gestalttherapie nach Perls (Ryba & Roth, 2019). Bei Rogers steht das «wahre Selbst» im Fokus. Dementsprechend begleitet der:die Coach:in die Klientin oder den Klienten im Rahmen eines durch Echtheit, Wertschätzung und Empathie geprägten Gesprächs bei der konstruktiven Persönlichkeitsveränderung. Zentrale Merkmale der Gestalttherapie sind die Wahrnehmung des eigenen Selbst, die Gefühle, Bedürfnisse und Körperempfindungen, die Wahrnehmung der Welt und des Zwischenreichs der Fantasie. Ziel ist die Integration abgespaltener Teile des Selbst. Neben Emotionen und kognitiven Interpretationen spielen auch Gestaltungserfahrungen – insbesondere durch den eigenen Körper – eine bedeutsame Rolle. Die humanistische Psychotherapie bildet eine zentrale Grundlage potenzialorientierter Coachingansätze (ebd.).
1.5.10Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse nach Berne basiert auf der Psychoanalyse. Die Transaktion bezieht sich auf jede Art von Stimulus und Reaktion in der (non-)verbalen Kommunikation (Dehner, 2019). Kern der Transaktionsanalyse ist das Ich-Zustands-Modell. Er besteht aus dem Kind-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Eltern-Ich. Das Kind-Ich referenziert auf kindliche Verhaltensweisen, das Erwachsenen-Ich auf die Informationsverarbeitung und -weitergabe und das Eltern-Ich auf elterliches Verhalten. Für das Coaching sind zwölf Formen verinnerlichter «Einschärfung» von Bedeutung, davon vor allem «Zeig keinen Ärger», «Sei nicht erfolgreich», «Gehör nicht dazu» und «Sei nicht wichtig». Die Transaktionsanalyse bietet ein gutes Diagnose-Instrument, um den Kern des Anliegens der Coachees schnell zu erfassen. Sie kann auch in Kombination mit Coachingtools anderer Ansätze wie etwa der systemischen Interventionen oder dem Embodiment erfolgen (Dehner, 2019, S. 313–341).
1.5.11Körperzentriertes Coaching
Lange Zeit wurde dem Körper als Organ der Wahrnehmung im Coaching wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei ist das «Embodiment» zentral für die Analyse wie für die Problem- oder Lösungsfindung (Ryba & Roth, 2019). Körperrückmeldungen stellen eine wertvolle Ressource für Entwicklungsprozesse dar (Greif et al., 2018; Pullen, 2016). Der Ansatz folgt neurobiologischen Grundlagen und berücksichtigt vor allem den Zusammenhang zwischen Emotionen und körperlichen Zuständen. Das affektiv-emotionale Geschehen und das körperliche System beeinflussen sich gegenseitig, und zwar auf bewusster wie unbewusster Ebene (Ryba & Roth, 2019). Der Einfluss von Emotionen auf die Körperhaltung, die Gestik, Mimik und Stimme sind bedeutsam. Das Ziel besteht darin, Körperwahrnehmung, –kommunikation und -arbeit als Ressource im Coachingsprozess zu integrieren, beispielsweise über die Focusing-Methode (ebd.).
1.5.12Achtsamkeit und Coaching
Durch Achtsamkeit im Coaching können die Coachees die Gegenwart offen, wertneutral und präsent wahrnehmen. Das Konzept entstammt den fernöstlichen Meditationstraditionen und wurde in westlichen Kreisen vor allem durch den Ansatz der Stressreduktion durch Achtsamkeit (engl. mindfulness-based stress reduction, MBSR) von Jon Kabat-Zinn (1999) bekannt. Es geht um die Fokussierung auf den Coachingsprozess und die Emotionen der Coachees sowie der Coaches. Im Zentrum steht der Aufbau einer inneren Haltung zur Regulierung unserer Achtsamkeit. Fürs Coaching bieten sich neben der Grundhaltung einzelne Techniken und Methoden der Achtsamkeit an, und zwar für alle Beteiligten (Bosch & Michel, 2018).
1.5.13Auf die Kombination kommt es an
Das Einüben der verschiedenen Methoden und die Reflexion der Wirkung sind zentral für die Erweiterung der eigenen Coachingkompetenz. Der Einbezug von Methoden aus verschiedenen Konzepten stellt eine interessante Erweiterung zum eigenen Coaching dar, erfordert jedoch eine adäquate Grundhaltung, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. So wird etwa ein lösungsfokussiertes Coaching nur dann wirken, wenn der:die Coach:in oder der Coach konsequent einen lösungsorientierten Zugang in Zusammenarbeit mit den Coachees pflegt. Ähnlich verhält es sich bei der Achtsamkeit: Sie lässt sich nicht einfach als Methode einführen, sondern setzt Übung und eine entsprechende Grundhaltung voraus.
1.6Coaching auf der Grundlage der positiven Psychologie
Das auf der positiven Psychologie basierende Coaching hat viele weitere Ansätze beeinflusst. Es ist im Bildungs- und Schulsystem breit verankert. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman verschob den Fokus von Krankheitsbildern zum Potenzial und den Ressourcen des Menschen, die ihn zu einem gelingenden und erfüllten Leben führen (Seligman, 2003). Der positiven Psychologie liegt ein positives Menschenbild zugrunde (Brohm, 2016). Es bezieht sich genuin auf drei Ebenen: 1) Mit dem angenehmen Leben gehen positive Gefühle und das Streben danach einher, 2) das gute Leben widmet sich dem Einsatz der eigenen Stärken und 3) das sinnvolle Leben stellt den Einsatz der eigenen Stärken in einen größeren Dienst (Seligman, 2003). Menschen sind dann am glücklichsten, wenn sie positive Gefühle wahrnehmen, sich stark einsetzen und so in ihrem Leben Sinn erleben (Seligman, 2015). Positive Emotionen erweitern den geistigen Horizont und erhöhen die Toleranz gegenüber neuen Ideen, Kreativität und Offenheit. Die positive Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die den positiven Emotionen, Stärken und dem Aufblühen (flourishing) auf den Grund geht (Seligman, 2015; Zbinden, 2022). Ihr Hauptinteresse gilt den Bedingungen und den (Wechsel-)Wirkungen, die positive Entwicklungen von Personen, Gruppen und Organisationen ermöglichen (Tomoff, 2018). Der positive Einfluss von Emotionen auf das Wohlbefinden wurde für verschiedene Lebensbereiche (wie Erziehung, Organisationskultur oder Beziehungen) empirisch nachgewiesen. Konzepte und in der Praxis angewandte Instrumente sind etwa das PERMA-Modell sowie die 24 Charakterstärken (Seligman, 2003, 2015).
1.6.1PERMA-Modell
Das PERMA-Modell umfasst fünf Bereiche, die zum Wohlbefinden und zur Weiterentwicklung beitragen. Diese sind positive emotion, engagement, positive relationships, meaning und accomplishment (Blickhan, 2018; Seligman, 2015; Zbinden, 2022). Sie dienen als Ausgangspunkt für die Reflexion im Rahmen von Coaching-Anlässen, Sitzungen oder Gesprächen (z.B. mit Mitarbeitenden) mit Blick auf die Potenzialentwicklung.
P
Positive emotion (positives Gefühl)
Das positive Gefühl umfasst Glück und Lebenszufriedenheit. Es setzt sich aus insgesamt fünf Faktoren zusammen, was bedeutet, dass die Glückstheorie – nach der Glück das alleinige Ziel ist – nicht mehr greift. Positive Emotionen können sich grundsätzlich auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beziehen (Seligman, 2002, S. 111).
E
Engagement (Engagement)
Engagement meint das Involviertsein, das vollkommene Absorbiertsein von etwas oder jemandem.
R
Positive relationships (positive Beziehungen)
Positive Beziehungen sind gemäß Seligman (2015, S. 40) «das beste Gegenmittel gegen die Betrübnisse des Lebens und […] das verlässlichste aller Aufmunterungsmittel».
M
Meaning (Sinn)
In einer Sache oder einer Handlung Sinn zu erkennen, verstärkt die positiven Emotionen.
A
Accomplishment (Zielerreichung)
Gemeint sind selbstgesetzte Ziele, die in engem Zusammenhang mit einem erfolgreichen Leben stehen.
Die Charakterstärken sind zentral für das Flourishing wie für das PERMA-Modell (Blickhan, 2018). Das von Seligman und Peterson entwickelte Erhebungsinstrument VIA Inventory Strength Survey (Values in Action) erfasst 24 Charakterstärken (siehe Tab. 2). Sie sind den sechs zentralen Tugenden Weisheit und Wissen, Mut, Humanität und Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung und Spiritualität sowie Transzendenz zugeordnet (Seligman, 2003, 2015).
Tugenden
Charakterstärken
Weisheit und Wissen
Neugier, Lerneifer, Urteilskraft, Kreativität, soziale Intelligenz, Weitblick
Mut
Tapferkeit, Durchhaltekraft, Integrität
Humanität und Liebe
Menschenfreundlichkeit, Lieben und Sich-lieben-Lassen
Gerechtigkeit
Staatsbürgertum, Fairness, Führung
Mäßigung und Spiritualität
Selbstkontrolle, Klugheit, Bescheidenheit
Transzendenz
Schönheitssinn, Dankbarkeit, Optimismus, Spiritualität, Humor und Begeisterung
Seligman und seine Mitarbeitenden entwickelten unter anderem das evidenzbasierte Penn-Resilienz-Programm für Schulen, das Optimismus, flexible Problemlösung, Durchsetzungsvermögen, kreatives Brainstorming und Entscheidungsfindung nachweislich fördert. Das Programm unterstützt Lernende darin, ihre eigenen Stärken zu erkennen und weiterzuentwickeln (Seligman, 2015).
1.6.2Positives Coaching
Das PERMA-Modell und die Analyse der Charakterstärken sind von besonderem Interesse für das Coaching, da sie es ermöglichen, Wohlbefinden und Leistung nicht gegensätzlich, sondern komplementär zu verstehen (Lichtinger, 2023). Coaching nach dem Grundsatz der positiven Psychologie bezieht sich auf ein «wissenschaftsbasiertes, klientenzentriertes und stärkenfokussiertes Verfahren, welches Theorien und Methoden der positiven Psychologie zur Anwendung bringt und zum Ziel hat, persönliches Wachstum zu befördern über den Prozess der Problemlösung hinaus» (Mangelsdorf, 2020, S. 5). Der:die Coach:in vertritt die Haltung, dass jeder Mensch über ein besonderes Potenzial verfügt, das ihn auf seinem Weg unterstützt. Die zentrale Frage im Coaching lautet: «Wie können wir Menschen unterstützen, auf dem Weg zum Ziel ihren eigentlichen Weg zu finden?» (Mangelsdorf, 2020, S. 3). Der:die Coach:in unterstützt den:die Coachee darin, gewohnte Muster des Denkens, Fühlens und Handelns zu durchbrechen und der Welt neu zu begegnen. Dieser Coaching-Ansatz ist im Wesentlichen geprägt durch (ebd., S. 11–12):
eine positive und lösungsorientierte Grundhaltung,
Positivität beziehungsweise damit einhergehende positive Emotionen bereits während der Kennenlernphase,
explizit formulierte Ziele, die sich jeweils an einem größeren, mit Lebenssinn verbundenen Rahmen orientieren,
positive Diagnostik,
Prozessgestaltung, die sich an den Stärken der Coachees orientiert,
Abschluss und Feedback, welches den Coachees weiterhin Motivation und die positive Überzeugung mit auf den Weg gibt, dass der während des Coachings positiv aufgegleiste Entwicklungsprozess weitergelebt werden kann.
Eine systematische Übersicht über die in der englischsprachigen Literatur verwendeten Übungen findet sich bei Richter et al. (2021). Für den deutschsprachigen Raum haben Schwier und Sohr (2021) 100 Übungen zusammengestellt, die sich gut im Coaching umsetzen lassen. Auch das PERMA-Modell und die Charakterstärken eignen sich für die Arbeit im Coaching. Der Fokus liegt in der Regel auf den Charakterstärken, die im Zusammenhang mit verschiedenen Coachingthemen einbezogen werden können. Dazu kann auch der unentgeltliche Test des Laufbahnzentrums der Stadt Zürich und der Universität Zürich zu den Charakterstärken verwendet werden (Persönlichkeitsstärken Test [persoenlichkeitsstaerken.ch]). Ferner empfiehlt sich die Webseite der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie (DGPP | Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie in Berlin [dgpp-online.de]).
1.7Coaching und kollegiale Beratung in der Lehrer:innenbildung
Coaching und kollegiale Beratung finden in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen auf zwei unterschiedlichen Ebenen statt. Auf der Ebene der Ausbildung von Lehrpersonen steht der kollegiale Austausch unter Studierenden und das Coaching oder Mentoring von Studienanfänger:innen oder Berufseinsteiger:innen durch erfahrene Studierende oder Lehrpersonen im Zentrum. Auf der Ebene der Weiterbildung und Weiterbildung on the job wird kollegialer Austausch mit dem Ziel der nachhaltigen Schulentwicklung als Konzept verfolgt und zur praktischen Umsetzung in Schulen forciert. Im Folgenden werden die wichtigsten Ansätze zu Coaching und kollegialer Beratung auf beiden Ebenen skizziert.
1.7.1Ausbildung
Kollegiale Beratung in der Lehrer:innenausbildung wird insbesondere in Praxisphasen eingesetzt, wobei sich die Zielsetzungen und Formen unterscheiden können. Das spiegelt sich in den verwendeten Begriffen wider. Im deutschsprachigen Raum ist von Peer-Lernen, Peer-Coaching, Peer-Mentoring oder kollegialer Fallbearbeitung dann die Rede, wenn erfahrene Lehrpersonen einzelne Studierende oder auch Studierenden-Tandems im Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbildung begleiten und beraten (z.B. Bennewitz & Grabosch, 2017; Fraefel et al., 2017; Fröhlich, 2014; Greiten & Trumpa, 2017; Krächter, 2018; Preuss et al., 2020; Stroot et al., 2014). In einzelnen Programmen liegt der Fokus von Coaching und kollegialer Beratung auf konkreten Kompetenzen der Studierenden, zum Beispiel in der Schreibberatung (vgl. Henkel & Vollmer, 2014). In der Analyse fällt auf, dass sich die Konzepte der Lehrer:innenausbildung vor allem auf die asymmetrische Beziehung zwischen Expert:innen sowie Noviz:innen im kollegialen Austausch beziehen. Die Grenzen zwischen Mentoring und (Peer-)Coaching sind hier nicht trennscharf. Zudem fällt auf, dass eine symmetrische Beziehung im Peer-Austausch zwischen Noviz:innen nur in wenigen Fällen beschrieben wird (Bennewitz & Grabosch, 2017). Wenn vom symmetrischen Peer-Austausch die Rede ist, so finden sich die Formate des Peer-Tutoring als motivationsfördernde Maßnahme in den Studienprogrammen (ebd.). Das Programm ELF (Erziehungswissenschaftliche Lehr- und Forschungswerkstatt der Universität Münster) zielt beispielsweise auf die gemeinsame Reflexion im Peer-Austausch ab (Bennewitz & Grabosch, 2017). Das Peer-Coaching-Programm KUBex der Pädagogischen Hochschulen St. Gallen, Zürich, Thurgau und Baden-Württemberg initialisiert symmetrische Peer-Gruppen für die gemeinsame Unterrichtsplanung und -beobachtung und die Problemlösung im Austausch nach dem Konzept des kollegialen Unterrichtscoachings (KUC) (Kreis & Staub, 2017). Ein anderes Programm legt den Schwerpunkt im Peer-Learning auf die gemeinsame Unterrichtstätigkeit und sieht das Teamteaching und die Reflexion im Peer-Tandem vor (de Zordo et al., 2017). Dies sind drei exemplarische Ausbildungselemente, die die Kraft der gleichrangigen Peer-Erfahrung als Motivationsinstrument nützen und dabei auch auf die Schulung metakognitiver Fähigkeiten abzielen. Die Programme wurden wissenschaftlich begleitet und hinsichtlich ihrer Wirkungsweise analysiert (Kreis & Schnebel, 2017). Programme, in denen Studierende sich als Mentor:innen beispielsweise für benachteiligte Schüler:innen engagieren, sind selten. In solchen Programmen finden Austausch und Reflexion mit anderen Studierenden im Rahmen von Peer-Learning und Supervision statt (Rumpold et al., 2014). Eine außergewöhnliche Form des Peer-Austausches wird mit der Initiative Kreidestaub verfolgt, einem deutschlandweiten Netzwerk, in dem Studierende in unterschiedlichen Projekten im freiwilligen Peer-Austausch Aspekte wie Haltung, Inklusion, Beziehung oder Digitalität diskutieren oder im Rahmen einer selbst organisierten Studienreise der «Intelligenz der Praxis» auf die Spur gehen (Andresen & Lischke, 2014; www.kreidestaub.net).
1.8Aus- und Weiterbildung
Auch in der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen finden Programme zu Coaching und kollegialer Beratung vor allem zwischen Erfahrenen und Noviz:innen statt und werden zumeist unter dem Begriff «(Peer-)Mentoring» gefasst (Bartonek & Ziegler, 2020; Dammerer, 2020a, 2020b; Meri, 2014; Mewald, 2020; Raufelder & Ittel, 2012). Das fachspezifische Unterrichtscoaching (engl. Content-focused Coaching) – ursprünglich für Schulentwicklungsprozesse konzipiert – kann als praxisbezogenes Element sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung von Lehrpersonen eingesetzt werden (Staub & Kreis, 2013). Studierende oder Lehrpersonen werden darin in konkreten Praxissituationen (schulpraktische Ausbildung oder on the job) durch eine:n Coach:in mit Fachexpertise bei der Unterrichtsplanung, Unterrichtsdurchführung und Reflexion begleitet (Führer & Cramer, 2020). In einem ko-konstruktiven Dialog werden Coachees von den Coaches und Coachinnen zu verschiedenen Handlungsvarianten angeregt (West & Staub, 2003). Bedeutsam daran ist die «von Coach und Coachee gemeinsam verantwortete Unterrichtsgestaltung zur bestmöglichen Unterstützung des Lernens der Schüler:innen in einem bestimmten Fach» (Staub & Kreis, 2013, S. 9). In Ausbildungssettings übernehmen Praxislehrpersonen die Rolle von dem:der Coach:in. In den Schulen werden die Rollen reziprok von unterschiedlichen Kolleg:innen eingenommen (ebd.). Das in Schulteams verwendete Konzept wird oftmals auch als Adaption des kollegialen Unterrichtscoachings bezeichnet (Kreis et al., 2008).
1.8.1Weiterbildung und on the job
Formen der kollegialen Beratung und des Peer-Coaching finden sich in Weiterbildungssettings sowie als Instrument der Schul- und Personalentwicklung in verschiedenen Ausprägungen, beispielsweise als kollegiale Beratung in Gruppen zur strategischen Ausrichtung von Schul- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen oder zur Belastungsreduktion (Macha, 2010). Eine andere Form ist die strukturierte kollegiale Fallberatung (Rauschenberger, 2021; Stephany & Linnemann, 2010). Oftmals wird dazu die kollegiale Supervision in Zielsetzung, Rollenverteilung und Ablauf eingesetzt (Schlee & Mutzeck, 1996). Das kollegiale Feedback unter Lehrpersonen als weitere – niederschwellige – Form der Lehrer:innenkooperation findet zunehmend Eingang als fixes, auch qualitätssicherndes Element von Schulteams (Funk, 2016).
1.9Wirksamkeit von Coaching
Was macht Coaching wirksam? Wirksamkeit bezieht sich auf das Ausmaß an Veränderung im Hinblick auf einen Zielzustand, der durch eine Intervention im Coaching angestrebt wird. Ein solcher Zielzustand kann beispielsweise eine verbesserte Arbeitsbeziehung sein. Die Veröffentlichung des Beitrags zur Wirksamkeit verschiedener psychotherapeutischer Zugänge von Klaus Grawe beeinflusste auch das Coaching im deutschsprachigen Raum stark (Grawe et al., 1994). In den englischsprachigen Ländern wurden Coachingansätze schon früh auf ihre Prozess- und Ergebniswirksamkeit analysiert (Grant, 2013, 2014). In den letzten Jahrzehnten gab es – in Anlehnung an die Psychotherapieforschung – zahlreiche empirische Untersuchungen zur Identifizierung wissenschaftlicher Kriterien der Wirksamkeit von Arbeitsbeziehung zwischen Coach:in und Coachee. Es resultierten folgende Kriterien für den Coaching-Erfolg: 1) affektive Kriterien wie Aspekte der Zufriedenheit, Motivation oder Selbstwirksamkeit, 2) kognitive Kriterien wie vertieftes Wissen über Arbeitszusammenhänge und Reflexion des organisationalen Wissens sowie 3) Kriterien bezüglich des Resultats wie Zielerreichung und Leistung (z.B. Laufbahnschritt) (Collins & Holton, 2004; Grassmann et al, 2020; Jones et al., 2016).
Wirksamkeitsstudien fokussieren entweder die Wirkung von Interventionen im Prozess, das Zusammenspiel von Prozess und Erfolg oder Meta-Analysen. Letztere beinhalten den Vergleich vieler einzelner Längsschnittstudien zur gleichen Fragestellung mithilfe statistischer Methoden (Ely et al., 2010). Die folgenden Wirksamkeitsdimensionen und Effekte stammen aus solchen Meta-Analysen.
Bereich
Effekte
Allgemeine Wirksamkeit
Effekte zeigen sich im Bereich des individuellen Lernens.
Coaching als personalisiertes Lernformat unterstützt v.a. die Zielerreichung im Arbeitsalltag.
Individuelles Coaching zeigt eine stärkere Wirkung im Vergleich zu standardisierten Trainings.
Spezifische
Ziele
Coaching führt zu verbesserten Beziehungen, erhöhter Zielorientierung und Arbeitszufriedenheit.
Stärkste Effekte zeigen sich bei der Selbstregulation, d.h. bei der Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle und Handlungen zielgerichtet zu steuern (Zimmerman, 2006).
Geringere Effekte lassen sich bei Stresserleben beobachten, das sich v.a. durch psychotherapeutisch und medizinisch ausgerichtete Interventionen verbessern lässt (Jones et al., 2016; Theeboom et al., 2013).
Es zeigen sich stärkere Effekte bei Leistungsaspekten als bei Einstellungen (Jones et al., 2016).
Selbst-/Fremd-
einschätzung
Coachees schätzen den Coachingerfolg (z.B. Arbeitsleistung, Strategien, bessere Beziehungen) meist höher ein als die Coaches.
Zeitdauer
Die Anzahl der Sitzungen sowie die Laufzeit sind wenig bedeutsam (Jones et al., 2016; Sonesh et al., 2015; Theeboom et al., 2014).
Kurzzeit-Coachings können einen positiven Effekt haben, jedoch weniger bei der Bearbeitung von komplexeren Entwicklungsaufgaben.
Methoden-
vielfalt
Die Anwendung vielfältiger Methoden – passend zum Anliegen und zur Prozessphase – zeigt einen positiven Effekt.
Die Wahl der Methode spielt eine untergeordnete Rolle (Jones et al., 2016).
Multiperspekti-vität
Der Fokus auf das Feedback anderer kann von den selbstdefinierten Zielen und Aufgaben im Coachingprozess ablenken.
Es können auch negative Effekte entstehen, wenn im Coaching zu viele Themen bearbeitet werden (Jones et al., 2016).
(Online-)Coaching
Sowohl Face-to-Face- als auch Onlinecoaching sind wirksam.
Positive Effekte von Onlinecoaching lassen sich vor allem in den Bereichen Selbstregulation, Zielorientierung, Selbstreflexion und Transfer in den Berufsalltag beobachten (Grant, 2014; Jones et al., 2016).
Arbeitsbe-ziehung
Die Beziehungsqualität zwischen Coach:in und Coachee spielt eine zentrale Rolle für den Prozess und das Resultat (Jones et al., 2015; Sonesh et al., 2015).
Es zeigen sich positive Effekte im emotionalen und kognitiven Bereich (Grassmann et al., 2020).
Coaching-Kompetenz
Die Kompetenzen der Coach:innen sind wichtig. Von Vorteil ist ein multidisziplinärer Hintergrund, d.h. die Kombination einer psychologischen Ausbildung mit einer anderen (Sonesh et al., 2015).
Die Anzahl beruflicher Erfahrungsjahre der Coach:innen scheint weniger entscheidend (Sonesh et al., 2015).
Meta-Analysen zeigen, dass Coaching wirkt: Coaching führt vor allem zu verbesserten Beziehungen, erhöhter Zielorientierung und Arbeitszufriedenheit. Die Kompetenz der Coaches und Coachinnen, vor allem ihre Fähigkeit, eine tragfähige Arbeitsbeziehung zu den Coachees aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ist für den erfolgreichen Prozess zentral. Die Zeitdauer des Prozesses wie auch die Anzahl Sitzungen erweisen sich hingegen als eher unbedeutend. Die Anwendung unterschiedlicher Methoden wirkt sich positiv aus, die Methode scheint hingegen weniger relevant zu sein (Kotte et al., 2018).





























