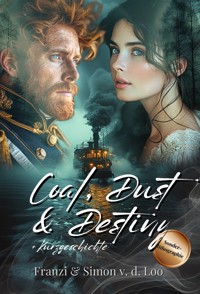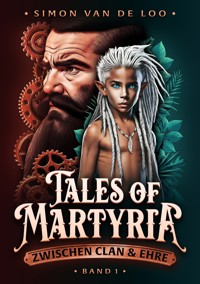Simon & Franzi van de Loo
+
Ein Foddelstitz-Abenteuer
Ahoi-hoi, liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten euch von Herzen für den Kauf und die Unterstützung unserer Sonderausgabe danken. Eure Begeisterung und Wertschätzung für unser Werk bedeuten uns sehr viel.
Wir hoffen, dass euch diese spezielle Ausgabe genauso viel Freude bereitet wie uns die Erstellung.
Auf bald,
Franzi & Simon
Vorwort
Hansestadt Hamburg, Zentralverwaltung der Neuen Hanse im Kaispeicher B, Großer Sitzungssaal
»Sie haben gut reden, Von Rosenthal! Mit der Erfindung dieser Verbrennungsöfen und Ihrer Rosenthaler haben Sie Ihrer Familie doch ein Leben im Luxus für die nächsten sechs Generationen gesichert!« Theodor Themels Stimme klang wütend und aufgeregt. Er war ein Mann am Ende seiner Fünfziger, hatte eine hohe Stirn mit noch höhere Geheimratsecken, von denen aus sein graumeliertes, braunes Haar straff nach hinten pomadisiert war. Sein Gesicht war glattrasiert, was die Falten um seinen Mund umso sichtbarer machte, ebenso wie seine durch ein Leben in Raffgier dauerhaft herunterhängenden Mundwinkel, über deren stetige Schwingung von Negativität nicht einmal der sündhaft teure Anzug hinwegtäuschen konnte.
Ein Raunen ging durch den Sitzungssaal.
»Fassung, Themel, Fassung«, antwortete der Angesprochene streng und geschäftsmäßig. »Die wirtschaftliche Position unserer Vereinigung ist besser denn je, und was noch besser ist: Sie ist absolut sicher.«
Kaspar von Rosenthal war ebenso ein Geschäftsmann wie Themel. Er war älter, sein Gesicht wirkte entspannter und ruhiger. Er hatte weißes Haar und einen sauber gestutzten Vollbart, unter dem die Haut eines Mannes glänzte, der zwar wohlhabend und gepflegt war, in seinem Leben jedoch auch bereits hart gearbeitet hatte. Auch sein Anzug war von exquisiter Qualität, im Gegensatz zu Themels Bekleidung drängte dieser dem Betrachter seinen Preis jedoch nicht auf.
Themel schnaubte. »Es ist nicht die Hanse, die mir Sorgen bereitet. Abgesehen von unserer Organisation müssen aber auch wir selbst zusehen, dass unsere Fabriken befeuert und unsere Handelskontore stets mit Waren gefüllt sind!«
Von Rosenthal zog skeptisch eine seiner buschigen, grauen Augenbrauen in die Höhe. »Soweit ich mich erinnere, ist genau dies der Fall, mein guter Themel.«
»Herr Von Rosenthal, ich muss Theodor teilweise beipflichten«, schaltete sich Valentin Gregorius, der Neuzugang der Hanse-Administration ein. »Die Stimmung in den Fabriken, die meine Brüder und ich von unserem Vater erbten, wird zunehmend schlechter. Die Arbeiter werden dreister und dreister, verlangen höhere Löhne, bessere Arbeitszeiten und teilweise sogar Krankenversicherungen. Sie flüstern über die Gründung von Gewerkschaften und Genossenschaften, ohne je darüber nachzudenken, wer all das bezahlen soll und wohin diese Querelen unsere großartige Hanse führen können. Sie sind Narren, allesamt. Aber gefährliche Narren.«
»Endlich spricht’s einer aus!«, polterte Themel triumphierend, während aufgeregtes Flüstern durch die Reihen der anderen Funktionäre der Hanse ging. »Am schlimmsten sind die Weibsbilder. Viele von ihnen arbeiten in meinen Textilfabriken und ich war immer gerecht. Sie verdienen beinahe die Hälfte von dem, was ihre Männer verdienen, freie Getränke, dürfen ihre Kinder mit zur Arbeit bringen, solange diese mit anpacken, und bekommen sogar Sonderbedingungen, wenn eine von ihnen ein Balg in ihrem Wanst herumträgt.« Er fuhr sich mit einer Hand durch die dünnen, nach hinten pomadisierten Haare. »Sie wollen immer mehr. Bald fressen sie und ihre Gören mir die restlichen Haare von meinem Schädel.«
Von Rosenthal überlegte kurz. »Ich verstehe Ihre Sorgen, meine Herren. Aber versuchen Sie, die Gedanken Ihrer Arbeiter zu verstehen. Auch sie haben Wünsche und Ziele. Um effektiv miteinander zu arbeiten, ist es unerlässlich, dass beide Seiten – das Proletariat und die Industriellen – mit diesem Arrangement zufrieden sind. Bedenken Sie: Ein glücklicher Angestellter ist häufig auch ein motivierter Arbeiter. Was im Übrigen für Frauen ebenso gilt wie für Männer.« Er ließ seinen Blick durch die Reihen schweifen und bemerkte, dass der junge Gregorius Theodor Themel irgendetwas zuflüsterte, was dessen ohnehin schon düsteren Gesichtsausdruck noch weiter verfinsterte.
Wie zu erwarten war, erhob dieser nach wenigen Augenblicken wieder das Wort. »Wie ich soeben von unserem geschätzten Kollegen Gregorius erfahren musste, sind Sie, Rosenthal, möglicherweise gar nicht dazu in der Lage, ein kompetentes und unbefangenes Urteil in dieser Sache abzugeben.«
Von Rosenthal schloss die Augen. Er wusste genau, worauf Themel anspielte. In dem Moment, als der alte Osbert Gregorius gestorben war und sein Handelsimperium an seine drei Söhne vermacht hatte, war Von Rosenthal bereits klar gewesen, dass es Ärger geben würde. Dennoch lächelte er verschmitzt, als er seine Augen wieder öffnete. »Was wollen Sie damit andeuten, Themel?«
Themel prustete. »Das wissen Sie ganz genau, mein Lieber. Sie, dessen Tochter in diese gesamte Scharade derart verwickelt ist. Gregorius hat mir von ihr und diesem lächerlichen ›Emanzipation den Arbeiterinnen‹-Mist erzählt, und jeder weiß, dass er mit ihr eine Liaison geführt hatte. Brandgefährlich! Ich sagte es bereits!«
Verdammt, so findet die Katze aus dem Sack, dachte Von Rosenthal. Hätte Karla diesen Emporkömmling von einem Industriellen doch nie getroffen. Andererseits, musste Von Rosenthal sich eingestehen, war er selbst es gewesen, der ihr Gregorius damals vorgestellt und als Sohn eines Großindustriellen der Hanse für eine gute Partie erklärt hatte.
»Haben Sie dazu nichts zu sagen?«, ätzte Themel mit bebender Stimme. »Ich schwöre Ihnen, die irrsinnige Haltung Ihrer Tochter und der offensichtlich nachlassende Geschäftssinn Ihrer Familie wird die Hanse teuer zu stehen kommen! Und ich werde nicht zögern, Sie beide zu gegebener Zeit zur Rechenschaft zu ziehen.«
Von Rosenthal stand auf. »Die Sitzung ist beendet.« Er schickte sich an, den Saal zu verlassen, doch Themel, der ebenfalls aufgestanden war, stellte sich ihm in den Weg.
»Jetzt können Sie sich aus ihrer Schmach hinausflüchten, aber Ihre Tage als oberster Verwalter der Neuen Hanse sind gezählt. Und Ihre Tochter … sagen Sie ihr, wenn sie weiß, was gut für sie ist, fügt sie sich still und ruhig ins Schema und hört auf, die braven Arbeiterinnen unserer Gesellschaft aufzuwiegeln.«
Von Rosenthal stemmte seine Hände in die Hüften. »Ist das eine Drohung?«
»Lediglich ein gut gemeinter Appell, mein Guter«, antwortete Themel leise, doch jedes seiner Worte vergiftete den Raum zwischen ihnen.
»Ich werde jetzt gehen«, sagte Von Rosenthal mit festerer Stimme, als er sich danach fühlte.
»Tun Sie das. Und denken Sie an die Worte, die einst ihr Vater benutzte, als er die Privilegien der neugegründeten Hanse mit den Unterhändlern des Reichs aushandelte. Wachstum für alle braucht den Egoismus von Visionären.‹«
»Ist das jetzt alles, Themel? Dann gehen Sie mir aus dem Weg«, antwortete Von Rosenthal. Er konnte kein weiteres, ekelerregendes Wort von diesem Mann ertragen. Er musste raus hier.
Kapitel 1
(Konrad)
»Bah, Mist!«, fluchte ich, als sich der herb-klebrige Gerstensaft in meinen zugegeben etwas struppigen Bart
anstatt in das Innere meines Mundes ergoss. Ich nahm einen Schal, den ich irgendwann über die Lehne meines Stuhls geworfen und dann dort vergessen hatte, und trocknete mich damit ab.
»Du musst gar nicht so dämlich grinsen«, raunzte ich Kastor an, meinen Hund.
Er sah mich gelangweilt an und gähnte.
Ich schüttelte den Kopf und tätschelte seinen übergroßen Bulldoggen-Schädel. »’Ne ganz faule Flusskröte bist du, Minjung. Kannst froh sein, dass ich so genügsam bin.«
Ich ging hinüber zu meiner Kommode, an der nützlicherweise ein Spiegel befestigt war, und hob meinen verbogenen und etwas angerosteten Kamm auf, um mir damit die Rückstände des Bieres aus dem Bart zu kämmen.
»Du hast schon bessere Zeiten geseh’n, Konrad«, murmelte ich, während ich mein etwas enttäuschendes Antlitz begutachtete, dem man seine beinahe vierzig Lenzen mittlerweile unleugbar ansah. So stolz war meine Mutter damals gewesen, als ich mich vor fünfzehn Jahren der Handelsmarine der neuen Hanse angeschlossen und meinen ersten Offiziersrang erreicht hatte. Ein rotblonder Jungspund, glatt rasiert und mit blauen Augen, die laut ihr beinahe ebenso hell strahlten, wie die goldenen Insignien meiner Uniformjacke, die ich selbst heute noch häufig trug. Nur konnte ich mit meinen ermatteten, rot geränderten Augen, den Furchen in meiner Stirn und dem roten Bart, in den sich bereits erste graue Haare einschlichen, keinen Blumentopf mehr gewinnen. Auch meine früher wohl frisierten und stets sauber gescheitelten Haare hingen in wilden Wellen auf meine Wangen hinab oder standen den Gesetzen der Physik und Ästhetik widerstehend, ungeordnet in die Höhe. Nein. Mutter wäre außer sich, würde sie mich heute sehen. Ohne Zweifel.
Aber wozu sich bemühen. Wofür ins Korsett einer Gesellschaft schlüpfen, welche die Menschen längst zugunsten des blanken Mammons zurückgelassen hatte. Menschen wie mich.
Ich war kein Teil des Militärs mehr. Wahrscheinlich war ich es nie wirklich gewesen, aufmüpfig und eigenbrötlerisch, wie ich war, jedoch befand sich in meiner Schublade ein Schrieb, der mein Ausscheiden aus den Diensten der Handelsmarine bestätigte und besiegelte. Fehlende charakterliche Eignung … so etwas geschah wohl zuweilen, wenn man seinem Vorgesetzten mitteilte, dass man sich eher von ihm das Gesäß sauberlecken ließe, als die Matrosen der unteren Ränge mit der Peitsche und anderen Perversionen der Hanse-Seefahrtsetikette anzutreiben.
Andererseits durfte ich mich wohl nicht zu sehr beschweren. Ich hatte während der Jahre bei der Marine gutes Geld verdient und da ich nie geheiratet oder Kinder bekommen habe, hatte ich dieses größtenteils ansparen können. Es war genug gewesen, um mir ein Leben ohne die Willkür etwaiger Vorgesetzter zu ermöglichen. Ein Leben, in dem ich mein eigener Herr sein durfte.
Ich hatte mir von meinen Ersparnissen einen von der Hanse ausrangierten, alten Flussdampfer gekauft und ihn mit meiner eigenen Hände Arbeit wieder in Form gebracht. Die ›eiserne Jungfer‹ war ein ganz ordentlicher Kahn für meine Zwecke und die meiner jeweiligen Auftraggeber. Sie ermöglichte es mir, wieder Geld zu verdienen, und war gleichzeitig das Dach über meinem Kopf. Ein wenig störte mich allerdings ihr Name, weil er mich abwechselnd an ein Folterinstrument oder meine noch immer unverheiratete Großtante Annemarie denken ließ, aber bislang war mir auch kein Besserer eingefallen. Alles zu seiner Zeit.
Ich streckte mich, hob meine achtlos aufs Bett geworfene, zerschlissene Uniformjacke auf, die ich streng genommen nicht einmal mehr tragen durfte, und machte mich auf den Weg zur Tür. »Komm mit, Kastor. Geben wir dem Mädel ein paar Schippen, damit es wieder in Wallung kommt.«
Als ich die Tür geöffnet, meine Nase in die frische Luft gehalten und einen tiefen Atemzug genommen hatte, schlenderte ich gemütlich das Deck meines Schiffes entlang, dessen Holz schon lange auf ein Schäferstündchen mit Wischmopp und Eimer wartete. Die Sonne stand hoch im Zenit und spiegelte sich anmutig im Wasser der Elbe. Eigentlich kein schlechter Tag, dachte ich bei mir, wandte mich aber schnell von diesem Anblick ab, während Kastor bereits argwöhnisch den Kohleberg am Heck der Jungfer betrachtete, der sich von einer dafür vorgesehenen Luke zwischen Paddel und Dampfmaschine auftürmte.
Kohle, bemerkte ich schmunzelnd. Eigentlich benutzte niemand innerhalb der Hanse mehr diesen Brennstoff. Das korrekte Wort wäre Rosenthaler gewesen, eine Art Pellet aus Steinkohle, Torf und Basalt, aber weder lernt ein alter Hund neue Tricks noch legt ein sturer Mann seine Gewohnheiten ab. Es war immer Kohle gewesen, es würde immer Kohle bleiben. Basalt hin oder her.
»Hast ja recht, Minjung«, lobte ich den wuchtigen Köter an meiner Seite freundschaftlich, der noch immer aufgeregt den Kohleberg fixierte, und kraulte ihn kurz hinter seinem Ohr. »Die Arbeit wartet, wir haben keine Zeit, das Wasser anzugaffen.«
Am Brennstofflager angekommen, zog ich die schon etwas rostige Schaufel aus den Pellets hervor und begann, die Maschine zu befeuern.
Kastor bellte. Ungewöhnlich. Gerade für ihn.
Ich runzelte die Stirn. Überhaupt verhielt er sich irgendwie seltsam, seit wir hier draußen an der frischen Luft waren.
Ich legte die Schaufel kurz beiseite, kniete mich neben meinen Hund und klopfte ihm auf den massigen Oberschenkel »Was hast du, Minjung. Wenn’s wieder die Blähungen sind, wie letzte Woche, dann werd sie diesmal bitte hier draußen los.«
Er hechelte und starrte ohne Unterlass auf eine Stelle in der Kohle.
Meine Augen folgten seinem Blick und ich kniff sie etwas zusammen, um besser zu erkennen. Da lag etwas zwischen den Pellets. Ein rosafarbener Lappen.
»Regt dich dieses Stück Stoff so auf, Junge?«, lachte ich auf meine übliche brummige Art und legte meine Stirn an sein warmes Fell. »Dann werde ich’s dir wohl mal holen. Vielleicht hast du dann ja deinen Frieden.« Ich sprang auf und tapste mit langen Schritten über die Kohle zu der Stelle, an der sich der Lappen befand. Ich beugte mich hinunter und zog, doch nichts tat sich. Er steckte fest. Ich zog erneut, diesmal etwas stärker. Fehlanzeige. Ich hockte mich hin, im Namen meiner Klamotten darum bemüht, den direkten Kontakt zwischen ihr und den schwarzen Klumpen zu vermeiden, und wühlte mit meinen behandschuhten Händen in ihnen herum, um den Lappen freizuräumen, wo auch immer er festhing. Plötzlich berührte ich etwas, das sich anders anfühlte. War das …?
»Scheiße!«, knurrte ich und grub jetzt vehementer, die Vorsicht wegen meiner Kleidung völlig vergessend, in den Rosenthalern. Das war eine Hand gewesen. Eine verdammte Hand.
»Ruhig, Minjung«, rief ich Kastor zu, den meine Aufregung scheinbar ebenfalls nervös machte, während ich – Pellet für Pellet – immer mehr von einem regungslosen menschlichen Körper freilegte.
Einige Minuten später kniete ich verschwitzt und mit vom Kohlestaub geschwärzter Garderobe auf dem Boden und fühlte den Puls an der Hand einer jungen Frau, deren Hinterkopf von verklebten, blutigen, schwarzen Haaren und einer fiesen Platzwunde verunziert wurde. Sie lebte.
»Sieht wohl aus, als haben wir eine blinde Passagierin, Kastor«, murmelte ich meinem Hund zu, aber ganz wohl fühlte ich mich nicht in meiner Haut. Ich war nicht auf eine Fremde auf meinem Kahn eingestellt gewesen. Nein! Schlimmer noch: Ich mied seit Jahren die Menschen, wie der Teufel das Weihwasser. Ich wollte keine Fremde auf meinem Kahn haben – ob verletzt oder kerngesund.
Ich stöhnte. Ich hatte eine Ladung mit Zeitlimit. Ich konnte es mir nicht erlauben, zurück nach Hamburg zu fahren und sie mit dieser Wunde am Schädel irgendwo am Ufer abzusetzen, kam mir ebenfalls nicht sonderlich vernünftig vor.
Es dauerte einige Minuten, bis ich mich wieder geordnet hatte. Nein. Ich hatte keine Wahl. Das Mädchen war nun einmal am Bord meines Schiffes, wie auch immer sie hier hergekommen war und was sie so verletzt hatte, und es würde mir vorerst nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzupäppeln und ihr Obdach zu gewähren. Zumindest bis ich sicherstellen konnte, dass sie auf ihren eigenen dürren Beinchen zurück nach Hause humpeln konnte. Ich stand enerviert auf und warf meinen Kopf in den Nacken, was eine kleine Wolke Kohlestaub aus meinen Haaren freisetzte. So ein Schlamassel.
»Na dann mal auf, Mindeern«, brummte ich dem bewusstlosen Mädchen zu, während ich es weniger sorgsam als ich vielleicht sollte vom Boden auflas und auf meine Arme stemmte. »Bringen wir dich erst mal rein, damit du deinen Dornröschenschlaf bequemer fortsetzen kannst als im ollen Kohlehaufen.«
Kapitel 2
(Karla)
Meine Glieder waren schwer wie Blei und das Dröhnen in meinem Kopf erschwerte mir das Heben der Lider, als ich mich mit einem Ruck dazu durchrang, mich aufzusetzen … und die Entscheidung sofort bereute. Ein dumpfer Schmerz entlockte mir ein leises Keuchen und zwang mich, mich sofort wieder zurück in eine liegende Position sinken zu lassen. Ein weiches Kissen stütze meinen Kopf und konnte der Schmerz, der meine Gedanken vernebelte, doch nicht dämpfen.
Was war geschehen? Und wo um alles in der Welt war ich hier?
Erneut bemühte ich mich, meine Augen zu öffnen. Trotz dessen die Strahlen der Sonne aufgrund ihres goldenen Lichtes darauf schließen ließen, dass der Nachmittag bereits weiter fortgeschritten war, brauchten meine Augen einen Moment, um sich an das Tageslicht zu gewöhnen.
Ich sah eine helle Zimmerdecke und folgte mit dem Blick einem Riss in der hölzernen Verkleidung, während ich mich schwerfällig, und deutlich langsamer nun, abermals aufsetzte und realisierte, mich an einem Ort zu befinden, den ich garantiert noch nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Sofort spürte ich, wie mein Puls sich beschleunigte und meine Finger zu zittern begannen.
Wie war ich hier hergekommen?
Ich betastete vorsichtig meinen Kopf im Bereich der schmerzenden Stelle. Jemand hatte ihn sorgfältig verbunden. Wer …?
Das Zimmer, ausreichend geräumig für eine Person und ausgestattet mit durchaus passablen und aufeinander abgestimmten Möbeln, wenngleich diese bereits bessere Zeiten gesehen hatten, ließ mich zusammen mit dem sanften, kaum merklichen Schaukeln vermuten …
Moment mal!
Ich schnappte nach Luft und schwang meine Beine aus dem Bett, was mich aufgrund des beißenden Schmerzes, der mich an Knochen in meinem Körper erinnerte, von denen ich bis heute nicht einmal gewusst hatte, dass ich sie besaß, einen kurzen Fluch ausstoßen ließ.
»Das darf doch wohl alles nicht –! «, begann ich, dann stockte ich mitten im Satz, als ich in das Gesicht eines bulligen Hundes blickte, der wahrscheinlich aufgrund meiner Reaktion von seiner Position vor dem Bett aufgesprungen war und mich mit großen Augen ansah.
Der Hund und ich lieferten uns einen Anstarrwettbewerb.
Hatte ich gerade die Luft angehalten? Ich schluckte. »Liebes Hündchen«, begann ich unsicher und sah … dass ich nichts sah. Der Hund reagierte nicht. Weder auf meine Worte noch auf das vorsichtige Heben meiner Hand, als wolle ich ihn damit beschwichtigen, obwohl es absolut nichts zu beschwichtigen gab. »Braves Hündchen.«
Ein leises Schnaufen entwich dem Tier, ehe es sich, vollkommen unbeeindruckt von mir, wieder hinlegte und den Kopf auf seine Pfoten bettete.
Ich hatte Respekt vor Hunden, nachdem ich als Kind einmal von einem gebissen worden war. Ein Gefühl, noch schlimmer bei großen oder besonders bulligen Hunden, wie auch diesem hier, das ich einfach nicht abschütteln konnte, ganz gleich wie sehr ich mich auch bemühte. Dabei spielte es keine Rolle, dass das Tier offenbar nur daran interessiert war, in Ruhe gelassen zu werden und weiterschlafen zu können.
Mit zusammengebissenen Zähnen und möglichst leise erhob ich mich, meine kaltnasige Gesellschaft immer im Blick, und tippelte auf Zehenspitzen und möglichst großem Abstand um ihn herum.
Ich war auf einem verfluchten Schiff! Eindeutig! Aber warum?
Mein Blick schweifte an mir herunter. Mein langes, dunkles Haar, das über meine Schultern nach vorn gefallen war, wirkte wirr. Schwarze Rückstände auf dem Stoff meines Kleides. Überall, schwarz, wie Ruß. Auch meine Arme hatten etwas abbekommen.
Kurz schloss ich meine Augen. »Denk nach, Karla, denk nach«, flüsterte ich leise zu mir selbst.
* * *
»Unsere Arbeitskraft ist nicht weniger wert als die der Männer. Es ist wichtig, dass wir dafür kämpfen, gesehen zu sehen. Respektiert zu werden!« Meine Stimme war energisch. Wenngleich die Frauen, die mir gegenüberstanden, sehr schüchtern oder gar vorsichtig wirkten und es kaum wagten, ihre Stimmen zu erheben, sah ich doch den Hoffnungsschimmer in ihren Augen, als sie meine Worte vernahmen. »Wir müssen zusammenhalten. Zusammen können wir etwas erreichen.«
»Diejenigen, die das Sagen haben, die großen Machthaber, werden niemals –! «, begann eine kleine blonde Frau, die sofort von mir unterbrochen wurde, indem ich sanft eine Hand auf ihrer Schulter bettete.
»Meine Liebe, wenn wir immer nur still bleiben, wird sich nie etwas ändern.« Ich schenkte ihr und den anderen ein aufmunterndes Lächeln. »In wenigen Tagen nehme ich an einer Sitzung teil. Es handelt sich um eine Zusammenkunft, bei der auch mehrere Vertreter des Kaisers und des großdeutschen Reiches zugegen sein werden.«
Zwei der Frauen schnappten nach Luft, eine Dritte starrte mich mit großen Augen an.
»Ich habe vor, mit ihnen über die Rechte der Frauen zu sprechen und darüber, was getan werden kann, um uns in der Gesellschaft einen besseren Stand zu verschaffen. Wir brauchen Frauen in Führungspositionen. Frauen in Vorständen und Betriebsräten. Unsere Stimmen müssen endlich gehört werden! Wir sind ein vollwertiger Teil der Gesellschaft!«
»Das sind wir!«, stimmte nun auch die Blonde zu und unterstrich ihre Worte mit einem kräftigen Nicken.
»Richtig«, ermutigte ich sie weiter. »Und schon jetzt können wir alle etwas tun. Ihr könnt etwas tun. Wir haben unsere Stimmen nicht, um zu schweigen. Wir haben sie, um sie zu nutzen. Um auf uns aufmerksam zu machen und unserem Unmut Luft zu machen. Tut das! Wir allen können einen Teil dazu beitragen, dass –! «
»Frau Von Rosenthal!«
Die Stimme, die mich unterbrach, ließ mich einen tiefen Atemzug nehmen. Kurz mahnte ich mich selbst zur Ruhe. Schließlich durfte ich jetzt nicht die Beherrschung verlieren, ehe ich mich zu dem Mann umdrehte, der mich mit einem aufgesetzten Lächeln betrachtete, hinter dem sich der eigentlich genervte Gesichtsausdruck nicht verbergen ließ.
»Herr Aichler, es ist mir eine Freude, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen?« Ich gab mir keine Mühe, vor dem Aufseher der Abteilung zu verbergen, dass es alles für mich war, doch sicher keine Freude.
»Wunderbar, danke der Nachfrage«, heuchelte der dickliche Mann Mitte Fünfzig und verschränkte die Arme der Brust. »Allerdings würde es mir noch besser gehen, wenn sie die Damen nicht von ihrer Arbeit abhalten und derart anstacheln würden. Wir gehören schließlich zu einer der größten Textilverarbeitungsmanufakturen des Landes und können es uns nicht erlauben –! «
»Ja, ja, sicher, keine Frage, Herr Aichler.« Nickte ich rasch und setzte ein absichtlich überzogenes Lächeln auf. »Wir sind hier fertig und ich werde ihre Arbeiterinnen nicht länger von ihrem Tagewerk abhalten.«
»Gut. Darf ich Sie noch nach draußen begleiten?«
»Nicht nötig, ich finde den Weg allein.«
* * *
Es war bereits Abend geworden, als ich mich von meinen beiden Freundinnen Maria und Deike verabschiedete, das Gasthaus verließ und mich auf den Weg durch die kleinen Gassen der Stadt machte. Ich kannte mich aus und wusste genau, welchen Weg ich gehen musste, um auf dem schnellsten Weg zum Hafen zu gelangen und dort das letzte Licht des Tages glitzernd auf der Oberfläche des Wassers bewundern zu können. Der auffrischende Wind ließ mich meinen Mantel über dem Kleid enger ziehen.
Hamburgs Straßen waren in der Regel immer belebt, selbst zu späterer Stunde, und so schenkte ich den Schritten, die sich mir von hinten näherten, zunächst keine Beachtung. Erst als sie mich beim Namen riefen, erstarrte ich noch in der Bewegung und wandte meinen Kopf schließlich angedeutet über die rechte Schulter in Richtung der Stimmen.
Wenngleich in mir sofort spürbar Nervosität aufstieg, war ich darum bemüht, mir genau diesen Umstand nicht anmerken zu lassen. »Ja bitte?« Möglichst unverfänglich wollte ich klingen und wandte mich schließlich drei Männern zu.
»Karla Elisabeth Von Rosenthal, richtig?«, wollte der größte der drei wissen und baute sich vor mir auf, was mich wiederum lediglich dazu bewog, meine Schultern zu straffen und den Blick, der mich fixierte, direkt zu erwidern.
»Wer möchte das wissen?«, konterte ich die Frage mit einer Gegenfrage und neigte den Kopf kaum merklich in die Schräge.
»Nicht wichtig«, warf der Zweite sogleich ein, der mich mit seiner Statur an einen bulligen Gewichtheber erinnerte und daran, dass es möglicherweise besser war, mein sonst recht loses Mundwerk zu zügeln.
»Hübsch ist sie.« Der letzte des Trios, der seine Worte an seine beiden Freunde richtete, rief mit seinem Tonfall und dem widerlichen, lüsternen Blick eine Mischung aus Wut und Übelkeit in mir hervor. »Vielleicht könnten wir …?! « Er wippte mit den Augenbrauen.
»Du weißt, weswegen wir hier sind, du Volltrottel! Und genau das werden wir tun. Nicht mehr und nicht weniger, klar?« Der Erste, der, der mich auch angesprochen hatte, verpasste seinem Kollegen einen kurzen Schlag in die Seite.
Ich wich einen Schritt zurück. »Was wollt ihr?« Die Hände zu Fäusten geballt, war das mein Versuch, das Zittern meiner Finger zu unterdrücken.
»Dir eine kleine Lektion erteilen.« Der bullige Gewichtheber packte mich schneller mit einem schmerzhaft groben Griff im Haar, als ich zurückweichen konnte, und riss meinen Kopf zurück.
Ich keuchte und meine Nervosität wich Panik.
»Und dich mit besten Grüßen von Theodor Themel daran erinnern, dass ein kleiner Fisch wie du nichts im großen Haifischbecken zu suchen hat!«
Themel. Dieser widerliche …!
Ein Schlag traf mich in die Magengrube und betäubender Schmerz mischte sich mit Übelkeit. Ich wollte meinen Mund öffnen, um Hilfe schreien, doch kein Wort verließ meine Lippen. Mir stockte der Atem.
Ein zweiter Schlag, direkt in mein Gesicht, der meine Ohren dröhnen ließ. Ein metallener Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Blut.
Mit aller Kraft versuchte ich, mich loszureißen. Kraft, die mich zu verlassen drohte, je mehr Schläge ich einsteckte. Das Letzte, was ich hörte, war die Stimme des Mannes, der zuvor schon nach meinem Namen gefragt hatte. »Scheiße, ist sie tot? Beschissene Kacke! Ich glaube, wir haben das Flittchen kaltgemacht!«
Danach verschwamm mein Sichtfeld, meine Knie wurden weich, dann war alles schwarz.
Kapitel 3
(Karla)
Auf leisen Sohlen schlich ich durch den Gang des Schiffes, den ich schnell als eine Art Flussdampfer erkannt hatte, immer mit einem Auge bei dem Hund, der mir mit trägen Schritten folgte.
»Ist dir eigentlich klar, dass du mich damit ziemlich nervös machst?«, nuschelte ich leise vor mich hin, als könne mich das bullige Tier, das mich wahrscheinlich genau in diesem Augenblick skeptisch beäugte, verstehen.
Zu meiner Überraschung erhielt ich einen leisen, grunzenden Laut als Antwort, der mich sofort vor Schreck herumfahren und erkennen ließ, dass lediglich ein herzhaftes Gähnen der Grund für das Geräusch gewesen war.
»Wenn ich dich so sehr langweile, warum musst du mir dann auf Schritt und Tritt folgen?«, murrte ich, während ich mich zum Weitergehen wandte.
Keine Reaktion.
»Ja, ja, schon klar. Ich bin hier auf deinem Schiff schließlich fremd. Verstehe schon.«
Das Schiff hatte sicher schon eine beachtliche Zeit seinen Dienst getan, ganz offensichtlich, war jedoch in einem Zustand, der mich vermuten ließ, dass genau dieser Zustand dem Besitzer am Herzen lag. Und diesen Besitzer, oder vielmehr Kapitän, suchte ich. Jemand, mit dem ich reden konnte. Den ich fragen konnte, wie ich an Bord des Dampfers gekommen und wie lange ich bewusstlos gewesen war.
In Begleitung des trägen Wachhundes kletterte ich zunächst mit schmerzenden Knochen und dröhnendem Kopf eine schräge Leiter hinauf und gelang durch eine Luke aufs Oberdeck, dann machte ich mich auf den Weg zur Ruderkabine, die ich in dem hohen Aufbau am Heck des Schiffes vermutete. Bereits auf dem Weg dorthin war ich verwundert darüber, kein einziges Mitglied der Crew anzutreffen. Nicht ein Mensch. Niemanden. Und das, obwohl es noch deutlich zu früh war, als dass sich bereits alle zur Ruhe hätten begeben haben können. Nicht, dass die Situation nicht ohnehin bereits besorgniserregend und nervenaufreibend gewesen wäre. Die Tatsache, dass es an Bord dieses Dampfers gruselig still war, machte es mir nicht gerade leichter.
Aufgrund der kompakten Größe des Flussdampfers war die steile Treppe zur Ruderkabine nicht schwer zu erreichen, sie allerdings hinaufzusteigen war in meiner jetzigen Situation ein echter Kraftakt.
Was ist hier los?, fragte ich mich, während ich die schmalen, hohen Stufen erklomm. Warum war keine Menschenseele auf diesem Boot, außer diesem Hund, der mich ganz offensichtlich bewacht hatte? Was um alles in der Welt stimmte hier nicht? Hatte man mich entführt?
»Oh Gott, bitte nicht!«, entwich es mir ob meiner eigenen Gedanken, als ich vor meinem geistigen Auge bereits die Schlagzeile in der kommenden Ausgabe der Tageszeitung sah, die über mein Verschwinden, oder noch schlimmer, meinen Tod, berichtete.
Mit Gewalt schüttelte ich die Bilder in meinem Kopf ab, als ich durch das Glas der Ruderkabine einen rothaarigen Mann erblickte, der mit strahlend blauen Augen nach draußen aufs Wasser blickte. Und obgleich er das tat, hatte ich genau wahrgenommen, dass er mich gesehen hatte. Er hatte mich gesehen … und nicht reagiert. Wie höflich!
Kurz betrachtete ich den Mann, den ich mindestens zehn Jahre älter schätzte, als ich es war; dann nahm ich einen tiefen Atemzug und betrat den Raum, dicht gefolgt von Knödel. Auf dem Weg hierher hatte ich beschlossen, dass dies der Name war, der perfekt zu dem plumpen Tier passte, das zuweilen wirkte, als wäre jeder Schritt, den er mir folgen musste, zu viel. Gerade das hatte letztlich dazu geführt, dass es mir gelang, Knödel weitestgehend ignorieren zu können, anstatt aufgrund der kaltnasigen Gesellschaft in Panik auszubrechen.
»Na, ausgeschlafen?« Die raue Stimme des Kapitäns drang zu mir und ließ mich automatisch meine Haltung begradigen.
»Hallo, ich –!« Sofort stockte ich, als Knödel unbeeindruckt an mir vorbei latschte, auf den Mann zu, dessen Vollbart die gleiche Farbe wie sein Haupthaar hatte, und sich mit ein wenig Abstand an dessen Seite niederließ, um dort ein kurzes Tätscheln seines Kopfes zu erfahren.
Hatte der Kerl nicht mit mir, sondern mit dem Hund gesprochen? Denn noch immer beachtete er mich nicht, sondern schenkte stattdessen schnell wieder den trüben Wassern des Flusses seine Aufmerksamkeit.
Zeit, ihn ein wenig direkter anzusprechen. »Hey!«, rief ich in seine Richtung aus und stemmte eine Hand in meine Hüfte. Eine kleine Geste, die mich sofort daran erinnerte, dass mir vor nicht allzu länger Zeit übel mitgespielt worden war. Ein kleiner, aber scharfer Schmerz zog durch meinen Körper, auch wenn ich eine Reaktion darauf bewusst unterdrückte. »Wie bin ich auf dieses Schiff gekommen?«
»Wüsste ich auch gern.« Der kurz angedeutete Blick in meine Richtung genügte, um mir zu zeigen, dass mein unfreiwilliger Gastgeber alles andere als begeistert war.
Tatsächlich wirkte er sogar derart genervt von meiner Anwesenheit, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass er mich entführt haben könnte. Jedenfalls nicht freiwillig.
»Warum bin ich hier?«, fragte ich weiter und trat einen Schritt an das Steuerrad des Schiffes heran.
»Auch das wüsste ich gern.«
Meine Nervosität mischte sich mit Wut, was mich dazu bewog, mit dem kleinen goldenen Anhänger meiner Kette zu spielen, so wie ich es immer tat, wenn ich meine Finger ablenken musste. Es half mir, sie zu beschäftigen, wenn ich aufgebracht war. Der Herzanhänger, ein Geburtstagsgeschenk meines Vaters, das ich seit Jahren nicht abgelegt hatte, war perfekt dafür geeignet.
»Soll das ein Witz sein?«, entfuhr es mir, während ich den Kerl in seiner in die Jahre gekommenen Uniform betrachtete, die ihm – zugegeben – unheimlich gut stand. Eine alte Hanseuniform. Ein Kleidungsstück, das nicht in diesem Zustand sein sollte, sollte er wirklich offiziell für die Handelsmarine arbeiten.
»Wünschte, es wäre so.« Zum ersten Mal wandte sich der Kapitän mir zu und begegnete meinem Blick.
»Ich will ja wirklich nicht unhöflich sein, aber –! «
»Hab’ dich einfach so aus dem Kohlehaufen gezogen«, unterbrach er mich, als hätte er sich in diesem Moment doch dazu entschlossen, mir nicht komplett vor den Kopf zu stoßen, auch wenn sein Blick mir noch immer eine gewisse Missbilligung verriet.
»Aus dem Kohlehaufen?« Das erklärte einiges, vor allem den Zustand meiner Kleidung.
»Jep.« Noch während seiner wortkargen Antwort wandte sich der Kapitän mit den blauesten Augen, die ich je gesehen hatte, erneut dem Ruder zu.
»Sag mal …«, begann er schließlich, als ich bereits mit keiner Reaktion seinerseits mehr gerechnet hatte. »Was is’n dir eigentlich passiert?«
Sollte ich ihm die Wahrheit sagen? »Bin verprügelt worden.«
»Oh.«
»Wohin fahren wir? Wir müssen umdrehen! Ich muss zurück! Ich muss ...! «
»Nix da!«
Bitte, was hatte er gesagt? »Was soll das heißen?« Empört starrte ich ihn an. »Ich muss –! «
»Keine Zeit!«
»Soll das ein Witz sein?«
»Ich hab’ keine Zeit, um dich durch die Gegend zu schippern, Mindeern!« Die Stimme des Kapitäns klang kühl, gelangweilt, ein wenig genervt. »Und wenn ich dich schon mitnehmen muss, mach’s dir irgendwo gemütlich und mach mir einfach keinen Ärger!«
Das konnte doch unmöglich sein Ernst sein!
»Wie ist dein Name?« Kein Grund, diesen dreisten, ungehobelten Kerl zu siezen!
Keine Reaktion.
Wieder stemmte ich unter Schmerzen beide Hände in die Hüften.
»Wie heißt du?«, wiederholte ich, nun deutlich lauter und merklich wütender. Ein Umstand, den ich nicht länger zu verschleiern versuchte. Und dennoch … »Ich bin Karla.«
Keine Reaktion. Dieser verfluchte …!
Mit einem kleinen Schnaufen wandte ich mich zum Gehen …
»Konrad«
… und machte mir keine Mühe, die Tür gediegen hinter mir zu schließen.
Kapitel 4
(Konrad)
Ich blickte dem Mädchen hinterher, während es wütend abrauschte und die Ruderkabine der Jungfer verließ. Frauen. Ein Segen, dass ich mir nie lange eine angelacht hatte. Natürlich gab es Dinge, die ich vermisste. Dinge, wie körperliche Nähe, Berührung oder das Gefühl, dass jemand auf mich wartete, während ich unterwegs war. Über die Jahre waren diese Bedürfnisse jedoch in sich zusammengeschrumpft und eingestaubt, sodass ich mir nicht einmal mehr sicher war, ob die Gesellschaft meines Hundes nicht generell jener der Menschen vorzuziehen war. Mir das Bett mit ihm teilen, das wollte ich allerdings nicht. Zu Frauen hatte ich schon ein paar Mal engere Kontakte und sogar romantische Beziehungen gehabt, damals, zu jüngeren und aktiveren Zeiten. Glück hatte es mir allerdings nicht gebracht.
Ich nickte Kastor zu, der sich zu meinen Füßen breitgemacht hatte und mich aus müden Augen anblickte. »Siehst du doch genauso, oder, Minjung?«, fragte ich ihn, als wäre es ganz selbstverständlich, dass er jeden meiner Gedanken mitgehört und verstanden habe.
Er legte zur Antwort die Ohren an und runzelte seine ohnehin schon faltige Stirn.
Ich tätschelte ihn und stand auf. Ein kleiner Nachtspaziergang würde mir guttun.
Es war schon alles etwas sonderbar mit diesem Mädel. Ein junges, hübsches Ding wie sie, dazu noch in sichtbar teuren Klamotten, und dann prügelt irgendjemand sie einfach zusammen, als wäre nichts dabei. An sich war dabei nichts Seltsames, immerhin trieben sich die Trunkenbolde und sonstiges Gesocks seit jeher am Hamburger Hafen herum, wäre dies aber ein profaner Raub gewesen, so hätte man ihr doch ihre wertvollen Klunker abgenommen … oder?
Ich fuhr mir mit einer Hand nachdenklich durch den Bart, während ich mit der anderen die Tür nach draußen öffnete.
Die Luft war noch mal deutlich abgekühlt, aber sie war frisch und wohltuend in meiner Lunge. Die Sonne war beinahe untergegangen und ein außergewöhnlich heller Vollmond tauchte die Elbe in silbernes Licht.
Es war ruhig draußen. Die Elbe war praktisch nicht befahren. Einzig ein weiteres Schiff, wohl eher ein Kajütboot mit Mast, kam von einiger Entfernung auf uns zu geschippert.
Nicht gerade das größte Abenteuer meiner Laufbahn, schoss es mir in den Kopf. Und doch fühlte sich gerade alles so verworren an. Vielleicht war es auch kein Raub gewesen, überlegte ich. Vielleicht hatte ihr jemand an die Wäsche gewollt und war dabei gestört worden? Das würde erklären, weshalb sie so wenig darüber sagte. Oder aber die hatten sie geschickt. Das wäre ein gewaltiges Problem, allerdings kam es mir auch ziemlich unwahrscheinlich vor. Bislang hatte es nie Anzeichen dafür gegeben, dass jemand von meinen Aktivitäten abseits des Handels Wind bekommen hatte – und dann noch diese Kopfwunde. Ich schüttelte den Kopf. Das war alles irgendwie seltsam.
Ich seufzte. Die Anwesenheit und der Zustand meiner Passagierin hatten mich wohl deutlich mehr aufgewühlt, als mir lieb war. Sie war hübsch, hatte auffallend dunkles Haar, das in einer Weise mit ihren blauen Augen kontrastierte, die viele wohl als anmutig bezeichnen würden.
»Kopf gerade, Tjalling«, ermahnte ich mich leise flüsternd. Mein Innerstes quasselte ja schon wie ein verschossener Gockel. Natürlich war es völlig egal, wie jung oder gut aussehend das Mädchen war. Mein Problem war einzig, dass sie schnell wieder in Form kommen musste. Ihre Anwesenheit auf meinem Kahn konnte problematisch werden, zumal ich trotzdem meinen Auftrag termingerecht ausführen musste. Ich bezweifelte, dass meine Geschäftspartner und insbesondere DeVilliers in meiner Nächstenliebe mehr als eine armselige Ausrede sehen würden.