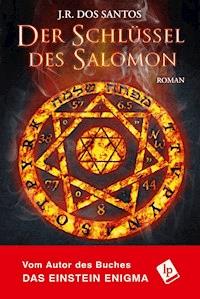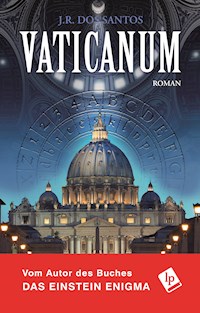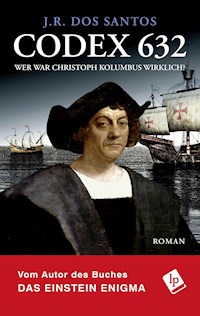
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: luzar publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tomás Noronha-Reihe
- Sprache: Deutsch
Den Geschichtsbüchern zufolge hat ein ungebildeter Seidenweber aus Genua es geschafft, die Spanischen Könige von seinem kühnen Plan zu überzeugen: Er wollte gen Westen segeln, um einen neuen Seeweg nach Indien zu finden. Aber glauben Sie wirklich, dass einem einfachen Seidenweber eine Flotte anvertraut wurde, um in westlicher Richtung nach Indien zu segeln? Wer sich mit den Details befasst, kann die Ungereimtheiten dieser Theorie kaum ignorieren. Doch weshalb waren sowohl Kolumbus selbst als auch zwei konkurrierende Königshöfe daran interessiert, die wahre Identität des großen Admirals und Seefahrers um jeden Preis zu verschleiern? J.R. Dos Santos zeigt anhand zahlreicher Indizienbeweise und handfester Fakten auf, was gegen die offizielle Version der Entdeckung Amerikas spricht und warum dieses Geheimnis seit 500 Jahren so streng gehütet wird. Anhand vielfältigster historischer Fakten interpretiert „Codex 632 - Wer war Christoph Kolumbus wirklich?“ die Geschichte neu. Als Professor Toscano urplötzlich in seinem Hotel in Rio stirbt, soll Historiker und Codespezialist Tomás Noronha dessen Recherchen zur Entdeckung Amerikas abschließen. Daraufhin reist Noronha von Lissabon nach New York, Rio und Jerusalem und kommt einem 500 Jahre alten Rätsel auf die Spur, das noch kein Historiker lösen konnte: Wer war Christoph Kolumbus wirklich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis
Sämtliche in diesem Roman genannten Bücher, Manuskripte und Dokumente gibt es wirklich. Auch den Codex 632.
2007, zwei Jahre nach der Originalausgabe dieses Buches, erschien Manoel de Oliveiras Film Christoph Kolumbus – Das Rätsel.
Die Romanreihe um Tomás Noronha erscheint auf Deutsch in anderer Reihenfolge als im portugiesischen Original. In Absprache mit dem Autor haben wir uns entschieden, zunächst seinen bekanntesten Titel, „Das Einstein Enigma“, zu veröffentlichen und anschließend mit einem verwandten Thema („Der Schlüssel des Salomon“) fortzufahren, anstatt die chronologische Reihenfolge einzuhalten. Das Leben von Tomás Noronha verläuft im deutschsprachigen Raum also nicht linear, aber jeder Roman kann völlig eigenständig gelesen werden.
Die Jahreszahlen geben die Reihenfolge der portugiesischen Originalausgabe an, in Klammern steht das entsprechende Erscheinungsjahr der deutschen Ausgabe:
Codex 632: 2005 (2019)
Das Einstein Enigma: 2006 (2017)
Furia Divina: 2009 (2020/21)
Das letzte Geheimnis Jesu: 2011 (2020)
Der Schlüssel des Salomon: 2014 (2018)
Vaticanum: 2016 (2019)
Zeichen von Leben: 2017 (2021/22)
José António Afonso Rodrigues dos Santos ist TV-Moderator und Sprecher der Abendnachrichten des portugiesischen Senders RTP1, mehrfach ausgezeichneter Kriegsberichterstatter und ehemaliger Dozent für Journalismus an der Neuen Universität Lissabon. Er hat das Talent, selbst anspruchsvollste Sachverhalte leicht und spannend zu vermitteln.
Mit seinen Büchern erreicht er ein Millionenpublikum und regelmäßige Bestsellerauflagen, insbesondere mit Das Einstein Enigma (470.000 Exemplare in Frankreich, 220.000 Exemplare in Portugal), für das die Filmrechte bereits verkauft sind. 19 Romane und 8 Essays liegen mittlerweile von ihm vor. Insgesamt wurden mehr als 3,3 Millionen seiner Bücher verkauft, in bis zu 20 verschiedenen Sprachen.
José Rodrigues dos Santos lebt in Lissabon.
Der Autor informiert regelmäßig über aktuelle Ereignisse unter: www.joserodriguesdossantos.com
J.R. Dos Santos
Codex 632
Wer war Christoph Kolumbus wirklich?
Aus dem Portugiesischen von Viktoria Reich
Im Original erschienen unter dem Titel „O Codex 632“
© José Rodrigues dos Santos/Gradiva Publicações, S.A., 2005
Copyright der deutschen Übersetzung
© 2019
luzarpublishing
www.luzarpublishing.com
Redaktion: Brigitte Caspary, Egloffstein
Coveridee: Olivier Faÿ, lampyre.fr
Umschlagfotos: Portrait von Sebastiano del Piombo; Karavellen: Shutterstock / Michael Rosskothen
Umschlagadaptation und Satz: Röser MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe
ISBN: 9783946621072 eBook by ePubMATIC.com
Für Florbela, Catarina und Inês: die drei Frauen in meinem Leben
Kolumbus hat kein Riff und keine Insel entdeckt, die so einsam waren wie er selbst.
Ralph Waldo Emerson
INHALT
PROLOG
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
DANKSAGUNG
PROLOG
RIO DE JANEIRO, 30. November 1999
Vier.
Der alte Professor konnte nicht ahnen, dass er nur noch vier Minuten zu leben hatte.
Die weit geöffneten Türen des Hotelaufzugs schienen nur darauf zu warten, ihn in eine Falle zu locken und sich hinter ihm zu schließen. Er machte einen Schritt nach vorn und drückte den Knopf für den zwölften Stock. Während der Fahrt betrachtete er sein Spiegelbild an der Rückwand der Kabine und musste zugeben, dass er dem Klischee eines überarbeiteten Historikers perfekt entsprach: fast kahlköpfig, mit ein paar verstreuten Haarbüscheln oberhalb der Ohren und am Hinterkopf. Und die wurden allmählich so weiß wie der spärliche Bart, der seine eingefallenen, faltigen Wangen bedeckte. Nicht ahnend, was ihm bevorstand, verzog er seine Lippen zu einem Lächeln und besah sich seine Zähne, die, mit Ausnahme der elfenbeinfarbenen Prothesen, schief und gelblich in seinem Mund standen.
Drei.
Das leise Ding des Aufzugs teilte ihm mit, dass er im zwölften Stock angekommen war. Als die Türen sich geöffnet hatten, trat er in den Flur, wandte sich nach links und suchte in seiner Jackentasche nach der Schlüsselkarte. Er steckte sie in den Schlitz an seiner Zimmertür, bis ein grünes Licht aufleuchtete. Dann drückte er die Klinke herunter und trat ein.
Zwei.
Ein kalter, trockener Luftstrom der Klimaanlage stellte ihm die Nackenhaare zu Berge. Nach der mittäglichen Gluthitze draußen war die hermetische Kühle im Raum mehr als wohltuend. Er holte eine Flasche Saft aus der Minibar seines Zimmers und trat an das riesige Fenster. Mit einem Seufzer bewunderte er die Aussicht auf die schlanken Hochhäuser der Skyline von Rio. Unmittelbar gegenüber seines Fensters stand ein kleineres, fünfstöckiges Gebäude, auf dessen Dach das Wasser eines Swimmingpools in der Mittagssonne türkis schimmerte. Die Hügel jenseits des Stadtrands bildeten eine natürliche Grenze zwischen dem Grau des städtischen Betons und dem üppigen Grün des umgebenden Dschungels. Auf dem Gipfel des Corcovado, des höchsten Berges der Stadt, stand mit ausgebreiteten Armen die elfenbeinfarbene Statue des Cristo Redentor, die trotz ihrer enormen Größe von dreißig Metern aus der Entfernung zerbrechlich und klein wirkte. Eine weiße Wolke, die wie Watte aussah, schien sich an den Querbalken des Kruzifix zu klammern.
Der Historiker dachte an die letzten Monate zurück und was er in dieser Zeit alles entdeckt hatte – seinen großen Durchbruch. Jetzt galt es, seine nächsten Schritte gut zu planen. Es war entscheidend, was er mit all den Informationen, die er gesammelt hatte, anfangen würde. Er musste vorsichtig sein.
Eins.
Nachdenklich hob er die Flasche an den Mund und trank. Der Saft rann seine Kehle hinab, süß und kühl. Mango war seine Lieblingssorte. Die Saftbars in Rio verwendeten stets frische Früchte, sodass der Saft leicht faserig und erfrischend war. Er leerte die Flasche langsam bis auf den letzten Tropfen, genoss mit geschlossenen Augen die herbe Süße der exotischen Frucht. Dann öffnete er die Augen wieder und betrachtete zufrieden das schimmernde Türkis des Swimmingpools auf dem gegenüberliegenden Gebäude. Es war das Letzte, was er in seinem Leben sah.
Schmerzen.
Ein stechender Schmerz durchzog seine Brust. Er zuckte zusammen, krümmte sich, von unkontrollierbaren Krämpfen geschüttelt. Der Schmerz wurde unerträglich. Er fiel zu Boden. Seine Augen schienen aus den Höhlen treten zu wollen, bevor sie starr einen Punkt an der Decke fixierten. Da lag er mit weit von sich gestreckten Armen und Beinen auf dem Rücken, als sein Körper sich ein letztes Mal aufbäumte.
Sein Mund formte einen stummen Schrei. Er würde mit niemandem mehr über seine Entdeckungen sprechen.
I
LISSABON, 6. Dezember 1999
Wenn jemand Tomás Noronha an diesem Morgen gesagt hätte, er würde die nächsten Wochen damit verbringen, durch die Welt zu reisen, um eine fünfhundert Jahre alte Verschwörung zwischen den beiden einstigen Weltmächten Spanien und Portugal aufzuklären und in die esoterische Welt der Kabbala und der Tempelritter einzutauchen, hätte er vermutlich gelacht. Und doch stand ihm genau das bevor.
Er parkte auf dem Parkplatz der Universität, der um 9:30 Uhr noch relativ leer war. Dann ging er in die Halle des Vorlesungsgebäudes, in dem die Studenten in Grüppchen zusammenstanden und sich über die Ereignisse des Vorabends austauschten. Als Tomás an ihnen vorbeiging, hörte er zwei der jungen Frauen aufgeregt flüstern; Tomás Noronha war groß und schlank, mit seinen fünfunddreißig Jahren ein gutaussehender Mann, dessen leuchtend grüne Augen das Auffälligste waren, das er von seiner französischen Urgroßmutter geerbt hatte. Er öffnete die Tür zu Hörsaal T9, betätigte mehrere Lichtschalter und legte seine Aktentasche auf das Pult.
Sofort strömten Studenten in kleinen Gruppen in den Saal und setzten sich an ihre üblichen Plätze neben den üblichen Sitzpartnern. Tomás nahm seine Unterlagen aus der Aktentasche, setzte sich ebenfalls und wartete, bis auch einige Nachzügler ihre Plätze eingenommen hatten. Die meisten von ihnen waren junge Frauen. Manche von ihnen wirkten noch schläfrig, andere vom Morgenkaffee eher aufgekratzt und putzmunter.
Nach ein paar Minuten stand er auf und begrüßte seine Zuhörerschaft, die mit einem dissonanten „Guten Morgen“ antwortete.
„Bisher haben wir eine Stele zu Ehren des Gottes Marduk untersucht“, kam Tomás gleich zur Sache, „und die Keilschriften der Akkader, Assyrer und Babylonier miteinander verglichen. Außerdem haben wir über die Ägypter und ihre Hieroglyphenschrift gesprochen, ein paar Passagen aus dem Ägyptischen Totenbuch übersetzt sowie die Inschriften des Karnak-Tempels und einige Papyrustexte gelesen. Heute schließen wir unsere Betrachtungen Ägyptens ab. Dazu möchte ich Ihnen erzählen, wie es gelang, die Hieroglyphenschrift zu entschlüsseln.“ Er hielt inne und blickte sich um. „Hat jemand von Ihnen eine Idee?“
Einige Studenten lächelten. Sie kannten die ungeschickte Art ihres Dozenten, sie am Unterricht zu beteiligen.
„Mit dem Stein von Rosette“, sagte jemand.
„Ja“, stimmte Tomás zu. „Der Stein von Rosette hat eine Rolle gespielt, aber er war nicht der einzige Faktor. Und er war auch nicht der entscheidende.“
Die Studenten schauten überrascht. Die junge Frau, die geantwortet hatte, war sogar ein wenig enttäuscht, nicht die richtige Antwort gegeben zu haben.
„Der Stein von Rosette war also nicht der Schlüssel zum Entziffern der Hieroglyphenschrift?“, fragte eine kleine, pummelige Studentin in der zweiten Reihe.
Tomás lächelte. Die Bedeutung des Steins von Rosette herabzusetzen hatte den gewünschten Effekt gezeigt. Seine Zuhörerschaft blickte ihn gespannt an.
„Er hat dabei geholfen“, räumte Tomás ein, „aber er war bei Weitem nicht alles. Wie Sie wissen, waren die Hieroglyphen über Jahrhunderte ein großes Rätsel. Die ersten von ihnen stammen aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus wurden die Hieroglyphen dann plötzlich nicht mehr verwendet, und nur eine Generation später war quasi niemand mehr in der Lage, sie überhaupt zu lesen. Weiß jemand, warum?“
Niemand antwortete.
„Haben die Ägypter etwa kollektiven Gedächtnisschwund bekommen?“, witzelte einer der wenigen männlichen Studenten.
„Grund war die christliche Kirche“, klärte Tomás auf. „Die Christen verboten den Ägyptern die Verwendung ihrer Hieroglyphenschrift, damit sie ihre heidnische Vergangenheit und die Vielgötterei vergessen sollten. Diese Maßnahme wurde so drastisch umgesetzt, dass das Wissen um die alte Schreibform in kürzester Zeit einfach erlosch. Das Interesse für die Hieroglyphenschrift wurde erst Ende des 16. Jahrhunderts wiederbelebt, als Papst Sixtus V. auf den Plätzen Roms ägyptische Obelisken aufstellen ließ.“
Die Vorlesung wurde vom leisen Knarzen der Tür unterbrochen, als eine junge Frau den Raum betrat. Tomás blickte irritiert auf. Dann schaute er näher hin. Er hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie war blond, hatte türkisfarbene Augen und eine milchweiße Haut. Sie ging nach hinten und setzte sich etwas abseits in die letzte Reihe. Dabei bewegte sie sich mit einer Selbstsicherheit, die zeigte, dass sie sich ihrer umwerfenden Schönheit bewusst war.
Nach kurzem Zögern fuhr Tomás fort: „Die Gelehrten versuchten daraufhin, die Hieroglyphen zu entschlüsseln, aber ohne Erfolg. Als Napoleon in Ägypten einfiel, folgte ihm eine Gruppe von Wissenschaftlern und Historikern, die den Auftrag hatte, alles, was sie fand, zu kartografieren, zu registrieren und zu vermessen. Dieses Team landete 1798 in Ägypten und wurde im folgenden Jahr ins Nildelta beordert, um ein Steinfragment zu untersuchen, das die dort stationierten Soldaten nahe der Stadt Rosette entdeckt hatten.“
Die junge Frau musste Ausländerin sein, dachte sich Tomás. Portugiesinnen hatten nicht so helle Haut und Haare.
„Die französischen Gelehrten identifizierten drei Arten von Zeichen: griechische und demotische sowie Hieroglyphen. Sie schlussfolgerten daraufhin, dass der Stein ein und denselben Text in drei Sprachen enthielt und erkannten seine immense Bedeutung. Doch dann fielen britische Truppen in Ägypten ein und besiegten die Franzosen, und der Stein, der eigentlich nach Paris geschickt werden sollte, gelangte ins British Museum nach London. Wie die Übersetzung des griechischen Textteils ergab, handelte es sich bei der Inschrift um einen Beschluss des Priesterrates, in dem bekannt gegeben wurde, welche Vergünstigungen Pharao Ptolemaios V. dem ägyptischen Volk als Ausgleich für die ihm anerkannten Ehren gewährte. Die Engländer schlussfolgerten daraus, dass es nicht allzu schwer sein dürfte, die demotische Schrift zu entschlüsseln, wenn es sich wirklich dreimal um den gleichen Text handelte. Aber dabei tauchten drei Probleme auf.“ Tomás hielt den rechten Daumen in die Höhe. „Erstens war der Stein beschädigt. Der griechische Text war noch relativ gut erhalten, nicht aber der demotische Teil und vor allem nicht die Hieroglyphen. Mehr als die Hälfte des Hieroglyphentextes fehlte, und selbst die verbliebenen vierzehn Zeilen waren in einem schlechten Zustand.“ Er hob auch den Zeigefinger. „Zweitens waren die beiden zu entschlüsselnden Schriften in Ägyptisch verfasst, einer Sprache, die seit mindestens achthundert Jahren nicht mehr gesprochen worden war. Die Engländer konnten zwar die Hieroglyphen bestimmten griechischen Wörtern zuordnen, aber sie wussten nicht, wie diese Hieroglyphen ausgesprochen wurden.“ Tomás hob nun auch den Mittelfinger. „Drittens glaubten die Gelehrten, dass die Hieroglyphen Ideogramme waren, also Bildzeichen, bei denen jedes Zeichen ein ganzes Wort oder einen Begriff darstellt, im Gegensatz zu Phonogrammen, bei denen jedes Zeichen einen Laut abbildet, wie das bei unserem Alphabet der Fall ist.“
„Und wie wurden die Hieroglyphen dann entziffert?“, fragte eine der Studentinnen.
„Den ersten erfolgreichen Ansatz lieferte ein hochbegabter Engländer namens Thomas Young. Schon im Alter von vierzehn Jahren beherrschte er Griechisch, Latein, Italienisch, Hebräisch, Chaldäisch, Syrisch, Persisch, Arabisch, Äthiopisch, Türkisch und … was war es noch gleich…?“
„Chinesisch“, schlug ein Witzbold vor und wurde mit Gelächter belohnt.
„Samaritisch“, erinnerte sich Tomás. „Young nahm 1814 eine Kopie der drei Inschriften des Rosettesteins mit in seine Sommerferien und untersuchte sie in allen Einzelheiten. Mehrere Hieroglyphen in einer Art Ring, einer sogenannten Kartusche, erregten seine Aufmerksamkeit. Er nahm an, dass diese Kartusche dazu diente, etwas Wichtiges hervorzuheben. Dank des griechischen Textes wusste er bereits, dass dieser Teil von Ptolemaios handelte. Er zählte also zwei und zwei zusammen und kam zu dem Schluss, dass die Kartusche den Namen Ptolemaios enthielt. Dann tat er etwas Bahnbrechendes: Anstatt darauf zu beharren, dass die Schrift aus Ideogrammen besteht, dachte er, dass das Wort auch phonetisch geschrieben sein könnte. Er stellte Mutmaßungen an, wie die einzelnen Hieroglyphen in der Kartusche wohl ausgesprochen worden sein könnten.“ Tomás ging eilig zum Whiteboard und zeichnete ein Quadrat an. „Er nahm an, dass dieses Symbol, das erste in der Kartusche, dem ersten Laut im Namen des Pharaos entsprach, also einem P.“
Daneben zeichnete Tomás einen unten geschlossenen Halbkreis. „Dieses Zeichen, das zweite in der Kartusche, interpretierte er als t.“ Als nächstes zeichnete er eine Schlaufe , gefolgt von einem liegenden Löwen im Profil. „Die Schlaufe übersetzte er als o, den Löwen als l.“
Anschließend malte Tomás zwei waagerechte, parallele Linien, die am linken Ende geschlossen waren. „In diesem Symbol vermutete er ein m.“ Darauf folgten zwei nebeneinander aufrecht stehende Messer. „Diese Messer deutete er als i.“ Zuletzt zeichnete er einen aufrecht stehenden Haken. „Und das hier hielt er für ein s.“
Tomás drehte sich um und blickte seine Zuhörer an.
„Sehen Sie?“ Er zeigte auf seine Hieroglyphen, während er sie aussprach. „P, t, o, l, m, i, s. Ptolmis. Ptolemaios.“
Auf den Gesichtern der Studenten machte sich erstauntes Erkennen breit.
„Wir wissen heute, dass er mit den meisten Annahmen recht hatte“, fuhr Tomás fort und trat einen Schritt von der Tafel weg. „Und hier, meine Damen und Herren, endet die Bedeutung des Steins von Rosette.“ Er ließ die Idee ihre Wirkung entfalten. „Der erste, wichtige Schritt war getan, das stimmt, aber es stand noch viel Arbeit bevor. Nachdem er die erste Hieroglyphe entschlüsselt hatte, suchte Thomas Young nach einer Bestätigung seiner Hypothese. Im Karnak-Tempel von Theben fand er eine weitere Kartusche und nahm an, dass diese den Namen Berenikes IV., einer Königin aus dem Geschlecht des Ptolemaios, enthielt. Und er hatte wieder recht. Allerdings glaubte Young, dass die phonetische Transkription nur für nicht-ägyptische Namen gelte, wie bei der ptolemäischen Herrscherfamilie, die übrigens von einem General Alexanders des Großen abstammte. Jedenfalls verfolgte Young diesen Ansatz nicht konsequent genug, sodass der Code nicht geknackt, sondern nur angekratzt wurde.“
„Und wer hat dann das Rätsel gelöst?“
„Der Franzose Jean-François Champollion.“
Tomás schaute die Blondine in der hinteren Reihe des Hörsaals an und fragte sich, was sie dort machte. Sie sah deutsch aus oder vielleicht holländisch. Jedenfalls blickte sie ihn aus ihren türkisfarbenen Augen aufmerksam an und schien ihm gespannt zuzuhören.
„Champollion wandte Youngs Ansatz auf andere Kartuschen an, die die Namen Ptolemaios und Kleopatra enthielten. Mit Erfolg. Außerdem entschlüsselte er einen Hinweis auf Alexander den Großen. Allerdings waren all diese Namen nichtägyptischen Ursprungs, was seine Überzeugung festigte, dass die phonetische Umschrift nur für Begriffe außerhalb des traditionellen ägyptischen Wortschatzes galt. Das änderte sich schlagartig im September 1822.“
Er machte eine bedeutungsvolle Pause.
„Um 1822 erhielt Champollion Zugang zu Abbildungen aus einem Tempel in Abu Simbel, dessen Inschriften aus einer Zeit vor der griechisch-römischen Epoche stammen und somit nur ägyptischen Ursprungs sein konnten. Nachdem er alle Hieroglyphen genau untersucht hatte, beschloss er, sich auf eine bestimmte Kartusche zu konzentrieren.“
Tomás ging erneut ans Whiteboard und schrieb vier Hieroglyphen in einem länglichen Kasten an:
Er deutete auf die letzte der vier Hieroglyphen. „Dieses Zeichen entspricht einem s.“
Tomás schrieb die entsprechenden Laute aus dem lateinischen Alphabet unter die Hieroglyphen, wobei er an die ersten beiden Stellen jeweils ein Fragezeichen setzte. Auf dem Whiteboard stand somit ein rätselhaftes ?-?-s-s. Er drehte sich wieder zu seiner Zuhörerschaft um und tippte auf die beiden Fragezeichen.
„Die ersten beiden Hieroglyphen fehlten also noch“, sagte er. „Was konnten sie bedeuten? Wie könnten sie klingen?“ Er zeigte auf die erste von ihnen. „Nach intensiver Betrachtung erinnerte diese runde Hieroglyphe mit einem Punkt in der Mitte Champollion an die Sonne. Entsprechend dieser Hypothese versuchte er herauszufinden, wie das Zeichen wohl ausgesprochen wurde. Da er wusste, dass im Koptischen das Wort Sonne ra heißt, schrieb er an die Stelle des ersten Fragezeichens ein ra.“ Er wischte das erste Fragezeichen weg und ersetzte es durch ra, sodass jetzt ra-?-s-s am Whiteboard stand.
„Und jetzt? Wie ließe sich die zweite Lücke füllen? Champollion kam schließlich zu dem Schluss, dass es etwas ganz Simples sein müsse. Die Tatsache, dass der betreffende Name in einer Kartusche stand, war ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um den Namen eines Pharaos handelte. Und welcher Name eines Pharaos beginnt mit ra und endet auf ein doppeltes s?“
Die Frage schwebte einige Sekunden im Raum.
„Die Antwort war ebenso kühn wie einfach.“ Tomás hielt abermals kurz inne. „Warum nicht ein m?“
Er wischte nun auch das zweite Fragezeichen weg und schrieb an die Stelle ein m.
„Ramses. Und so veränderte die Entdeckung eines Schriftgelehrten von einer Sekunde auf die andere unser Verständnis der Weltgeschichte.“
II
Kaum hatte Tomás die Vorlesung beendet, erfüllten lebhafte Geräusche den Saal. Stühle wurden gerückt, Notizblöcke zugeklappt, und die Studierenden strebten fröhlich plaudernd dem Ausgang zu. Wie üblich kamen auch diesmal ein paar von ihnen auf Tomás zu, während er seine Unterlagen einräumte.
„Herr Noronha, ich habe einen Teilzeitjob und konnte nicht zu den letzten Vorlesungen kommen. Steht der Termin für die Abschlussprüfung schon fest?“
„Ja, sie findet am letzten Tag unserer Vorlesungsreihe statt.“
„Welcher Tag ist das?“
„Auswendig weiß ich das auch nicht. Schauen Sie doch bitte in den Seminarkalender.“
„Und wie läuft die Prüfung ab?“
„Nun, es wird ein praktischer Test werden.“ Tomás klappte seine Aktentasche zu. „Sie werden einige Dokumente analysieren und alte Texte entziffern müssen.“
„Hieroglyphen?“
„Ja, unter anderem. Vielleicht müssen Sie aber auch sumerische Tafeln mit Keilschrift, griechische Inschriften, hebräische oder aramäische Texte übersetzen. Vielleicht aber auch nur ein paar Manuskripte aus dem Mittelalter oder dem
Der Studentin blieb der Mund offen stehen.
„Kleiner Scherz“, sagte Tomás lachend. „Nur einige allgemeine Übungen und …“
„Aber das kann ich doch alles gar nicht“, sagte die Studentin entsetzt.
Tomás schaute sie an. „Ich weiß. Deshalb sind Sie ja auch hier in der Vorlesung, nicht wahr? Um es zu lernen.“
Nur noch zwei Frauen standen vor ihm, eine Studentin mit kurzen, schwarzen Locken und die schöne Blondine. Er wandte sich zuerst der anderen zu, um anschließend mehr Zeit für die Unbekannte zu haben.
„Das müssten Sie bitte unterschreiben“, sagte die Schwarzhaarige und legte ihm ein Blatt Papier vor.
Von der unbekannten Schönen verwirrt, tat Tomás, was von ihm verlangt wurde. Dann stutzte er.
„Was habe ich da eigentlich unterschrieben?“
„Das ist eine Bescheinigung, die ich mit zur Arbeit nehmen muss, weil ich eine Schicht versäumt habe, um zur Vorlesung zu kommen.“
Tomás nickte geistesabwesend, während die Studentin den Zettel rasch wegsteckte.
Endlich konnte er mit ihr sprechen, ohne dass jemand anderer im Saal war. Wahrscheinlich war sie das von Männern so gewohnt, dachte er. Zwar fühlte Tomás sich durch ihre Schönheit und ihre Größe – sie war fast so groß wie er selbst – etwas verwirrt, aber er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Er lächelte, und sie lächelte zurück.
„Guten Morgen, Herr Professor.“ Sie hatte einen ungewohnten Akzent. „Ich bin neu hier.“
Tomás unterdrückte ein Grinsen.
„Das habe ich schon gemerkt. Wie heißen Sie?“
„Lena Lindholm.“
„Lena?“ Er tat überrascht, als hätte er erst jetzt gemerkt, dass sie Ausländerin war. „Das ist die Kurzform des portugiesischen Namens Helena.“
Sie kicherte taktvoll. „Ja, aber ich bin Schwedin.“
„Aaaah!“, rief Tomás aus. „Natürlich.“ Er zögerte und überlegte kurz. „Warten Sie … ähm, … hej, trevligt att träffas?“
Lena machte große Augen. „Entschuldigung“, sagte sie und blickte angenehm überrascht. „Talar du svenska?“
Tomás schüttelte den Kopf und antwortete lächelnd: „Jag talar inte svenska.“ Dann fügte er noch hinzu: „Das ist alles, was ich auf Schwedisch sagen kann.“
Sie schaute ihn bewundernd an. „Nicht schlecht! Nur Ihre Aussprache müsste noch etwas melodischer sein, sonst klingt es wie Dänisch. Wo haben Sie Schwedisch gelernt?“
„Als Student war ich vier Tage in Malmö. Da habe ich ein paar Brocken aufgeschnappt, zum Beispiel Var är toaletten?“
Sie lachte.
„Hur mycket kostar det?“, legte Tomás nach. „Äppelkaka med vaniljsås.“
Bei seinem letzten Satz seufzte sie auf.
„Professor, erinnern Sie mich nicht an äppelkaka.“
„Ich bin noch nicht habilitiert, nennen Sie mich also bitte nicht Professor“, entgegnete Tomás. „Und warum soll ich Sie nicht an äppelkaka erinnern?“
Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über ihre vollen Lippen.
„Er ist köstlich. Und ich vermisse ihn so sehr …“
Tomás lachte und hoffte, seine wahre Reaktion auf ihre Geste kaschieren zu können.
„Es tut mir leid, kaka ist ein komisches Wort für ein Dessert. In Portugiesisch heißt caca nämlich … nun ja, Scheiße.“
„Ja, in anderen Sprachen klingt es seltsam, aber ich schwöre Ihnen, schwedischer Apfelkuchen ist einfach herrlich.“
Lena schloss ihre Augen und sah aus, als würde sie sich an das erste Mal erinnern, als sie diese Köstlichkeit aß.
Tomás war von der jungen Frau fasziniert, auch wenn er es gewohnt war, von hübschen Studentinnen umgeben zu sein. Außerdem war er verheiratet und nie fremdgegangen. Und doch stellte er sich einen Augenblick lang vor, Lena an sich zu ziehen und sie zu küssen. Nur mit Mühe gelang es ihm, seine erotischen Gedanken zu unterdrücken. Er räusperte sich.
„Wie heißen Sie doch gleich?“
„Lena.“
„Ah, Lena.“ Er zögerte. „Sagen Sie, Lena, wo haben Sie so gut Portugiesisch gelernt?“
„Mein Vater war Botschafter in Angola, und ich habe fünf Jahre lang dort gelebt.“
Tomás schloss seine Aktentasche und wandte sich zum Gehen.
„Und hat es Ihnen gefallen?“
„Es war großartig. Wir haben in einem eigenen Haus in Miramar gewohnt und die Wochenenden in Mussulo verbracht. Einfach traumhaft.“
„In welchem Teil von Angola war das?“
Sie schaute ihn erstaunt an, als müsste jeder Portugiese mit der Geografie Angolas vertraut sein.
„In Luanda natürlich, der Hauptstadt. Miramar ist der Stadtteil, in dem wir gewohnt haben, mit Blick auf den Strand, die Festung und die Halbinsel Ilha do Cabo. Und Mussulo ist eine Insel südlich von Luanda. Waren Sie noch nie in Angola?“
„Nein.“
„Wie schade!“
Tomás steuerte auf die Tür zu und bedeutete Lena, ihm zu folgen. Sie kam ihm auffallend nah. Ihr weicher, blauer Pullover passte hervorragend zu ihren blauen Augen und den blonden Locken, die über ihre Schultern fielen. Tomás zwang sich, nicht tiefer als bis zu ihrer feinen Halskette zu schauen.
„Was führt Sie nun in meine Vorlesung?“, fragte er und trat zur Seite, um Lena den Vortritt zu lassen.
„Ich bin über das Erasmus-Programm hier“, antwortete sie und streifte ihn leicht mit der Schulter.
„Wie bitte?“
„Ich bin über das Erasmus-Programm hier“, wiederholte sie und drehte sich zu ihm um.
Sie gingen nebeneinander durch das Foyer.
„Über das Erasmus-Programm?“
„Ja. Kennen Sie das etwa nicht?“
Tomás schüttelte den Kopf.
„Nein. Äh … ach so, Erasmus.“ Er zögerte, bis ihm endlich ein Licht aufging. „Natürlich! Sie sind also über das Erasmus-Programm hier.“
Lena lächelte amüsiert. Sie merkte genau, wie nervös sie ihn machte.
„Ja, das habe ich bereits gesagt.“
Erasmus war ein europäisches Förderprogramm, über das Studenten bis zu einem Jahr lang in einem anderen EU-Land ein Auslandssemester absolvieren konnten. Die meisten Gaststudenten, die an das Institut für Geschichtswissenschaften der Neuen Universität Lissabon kamen, waren Spanier. Einige stammten jedoch aus Nordeuropa.
„An welcher Universität studieren Sie?“
„Stockholm.“
Sie gingen die letzten Stufen hinauf, dann standen sie vor Tomás’ Büro. Er suchte in seiner Jackentasche nach dem Schlüssel.
„Und warum wollten Sie ausgerechnet nach Portugal?“
„Aus zwei Gründen“, sagte Lena. „Zum einen wegen der Sprache. Ich spreche fließend Portugiesisch, sodass ich den Vorlesungen gut folgen kann.“ Sie blieb unmittelbar hinter ihm stehen. „Zum anderen, weil ich meine Dissertation über das Zeitalter der Großen Entdeckungen schreiben möchte. Ich würde gern die Parallelen zwischen den Reisen der Wikinger und den Entdeckungen der portugiesischen Eroberer herausarbeiten.“
Tomás stieß die Tür auf und bat Lena mit einer ausholenden Geste in sein Büro. Der Raum war unaufgeräumt, auf dem Tisch stapelten sich Prüfungsunterlagen, die er korrigieren musste. Auch auf dem Boden lag Papier verstreut.
„Die portugiesischen Entdeckungen sind ein weites Feld“, sagte Tomás und blickte aus dem Fenster, durch das die Wintersonne auf sein Gesicht fiel. „Wissen Sie, wie viel Arbeit da auf Sie zukommt?“
„Kein Aal ist so klein, als dass er nicht hoffen würde, ein Wal zu werden.“
„Wie bitte?“
„Das ist eine schwedische Redensart. Und die bedeutet, dass ich auf jeden Fall bereit bin, hart zu arbeiten.“
Tomás lächelte. „Das glaube ich, aber es ist wichtig, dass Sie das Thema Ihrer Arbeit klar definieren. Welcher Zeitraum interessiert Sie denn am meisten?“
„Ich möchte alles wissen, was bis zu Vasco da Gamas Reise im Jahr 1498 passierte. Ich habe ein Jahr lang alles darüber gelesen, was ich finden konnte.“ Sie sah ihn mit blitzenden Augen an. „Glauben Sie, ich könnte die Originalchroniken einsehen? Die Berichte der Chronisten, die bei den Reisen dabei waren?“
„Sie meinen De Zurara und Seinesgleichen?“
„Genau.“
Tomás seufzte.
„Das ist schwierig. Die Originaldokumente sind sehr wertvoll und empfindlich, und die Bibliothekare hüten sie wie ihren Augapfel.“ Er schüttelte nachdenklich den Kopf. „Aber Sie können Abschriften und Kopien davon haben. Das ist doch fast das gleiche.“
„Ach, aber ich würde so gern die Originale sehen.“ Lena blickte ihn mit ihren blauen Augen unverwandt an und schlug die Wimpern auf. „Können Sie mir nicht dabei helfen? Bitte …“
Tomás schluckte nervös.
„Na ja, ich könnte es zumindest versuchen, nur …“
„Großartig!“, rief Lena und strahlte ihn an.
Ihm war vage bewusst, dass er gerade manipuliert wurde, doch war er so von Lena verzaubert, dass ihm das nichts ausmachte.
„Aber können Sie denn das Portugiesisch des 16. Jahrhunderts lesen?“
„Ein Dieb findet den Gral schneller als ein Küster.“
„Was?“
Lena lachte über Tomás’ entgeisterten Gesichtsausdruck. „Das ist auch eine schwedische Redensart. Und die heißt so viel wie, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“
„Davon bin ich überzeugt“, räumte Tomás ein. „Aber das ändert nichts an der Frage, ob Sie das Portugiesisch des 16. Jahrhunderts mit seiner schwierigen Kalligrafie lesen können.“
„Nicht wirklich.“
„Wozu wollen Sie dann die alten Texte sehen?“
Lena schaute ihn verschmitzt an, als wolle sie ihm ein Geheimnis anvertrauen.
„Ich bin sicher, Sie helfen mir ein wenig dabei.“
Tomás erkannte, dass die ganze Geschichte kein gutes Ende nehmen würde. Wenn er eine Sache über das Unterrichten an der Universität gelernt hatte, dann dass ein Mann nie seinen weiblichen Studierenden zu nahe kommen sollte. Warum, so fragte er sich, zog Lena ihn derart an? Sein Interesse an ihr ließ sich nicht leugnen. Etwas an ihr machte ihn extrem neugierig, mehr über sie zu erfahren. Viel mehr.
III
Der Nachmittag war ausgefüllt mit einer Institutsversammlung und ihren üblichen Intrigen, Machtspielchen und endlosen Tagesordnungspunkten. Als Tomás endlich nach Hause kam, war es bereits dunkel, und Constanze und Margarida saßen beim Essen: Frikadellen mit Spaghetti und Ketchup, das Lieblingsgericht seiner Tochter. Tomás hängte seinen Mantel auf, gab beiden einen Kuss und setzte sich an den Tisch.
„Endlich mal wieder Frikadellen und Spaghetti“, sagte er trocken.
Constanze schaute ihn an und zuckte mit den Achseln. „Das macht sie glücklich.“
„Hmmm, Spaghetti“, plapperte Margarida fröhlich und saugte geräuschvoll die Nudeln ein.
„Nun, wenn sie glücklich ist, bin ich es auch“, sagte Tomás resigniert, während er sich eine Portion auf den Teller tat. Er wandte sich an seine Tochter und streichelte ihr glattes, schwarzes Haar. „Hey, meine Süße, was hast du denn heute gelernt?“
„A wie Auto, B wie Buch.“
„Aber das hast du doch schon im vorigen Jahr gelernt, weißt du nicht mehr? Hast du heute nichts Neues gelernt?“
„C wie China, D wie danke.“
„Merkst du was?“, fragte er seine Frau. „Sie macht Rückschritte.“
„Ich weiß“, antwortete Constanze. „Für nächste Woche habe ich einen Termin bei der Schulleiterin vereinbart.“
„E wie Ei.“
Vor einem Jahr war Margarida in die Schule gekommen. Ihre Klasse wurde anfangs von einem Sonderpädagogen unterstützt, der sie ständig motivierte. Allerdings war seine Stelle wegen Budgetkürzungen gestrichen worden, sodass der Klassenlehrer die Kinder allein unterrichtete und den Schülern mit Lernschwierigkeiten nicht gerecht werden konnte. Obwohl Margarida offensichtlich viel von dem, was sie im ersten Schuljahr gelernt hatte, wieder vergaß, würde es schwierig werden, die Schulleitung davon zu überzeugen, dass sie wieder einen Sonderpädagogen brauchte.
Tomás versuchte, seine Tochter mit den Augen eines Fremden zu sehen, mit ihrem runden Gesicht, den mandelförmigen Augen, ihrem feinen, schwarzen Haar und den kurzen Gliedmaßen. Wurde sie von den Mitschülern gehänselt? Bestimmt. Kinder konnten so grausam sein.
Er dachte zurück an jenen Frühlingstag vor neun Jahren, in der Entbindungsstation. Überglücklich war er mit einem Sträußchen Jelängerjelieber in das Zimmer seiner Frau geeilt, hatte sie und seine neugeborene Tochter geküsst. Er war gerührt über dieses kleine Bündel mit rosaroten Wangen und weicher Haut, das ihn an einen kleinen, schlafenden Buddha erinnerte, so weise und friedlich lag es da. Er hatte seine Tochter in den Arm genommen wie eine Kostbarkeit.
Dieser Moment reiner Glückseligkeit dauerte keine halbe Stunde. Dann kam die Ärztin ins Zimmer und bat ihn dezent in ihr Büro. Mit ernster Miene erklärte sie ihm, dass es aussah, als habe Margarida das Downsyndrom, auch Trisomie 21 genannt.
Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Der Boden unter Tomás’ Füßen schien zu beben und ihn in ein dunkles Loch zu reißen. Als er seiner Frau von dem Verdacht erzählte, sagte sie kein Wort und weigerte sich lange Zeit, überhaupt darüber zu sprechen. All ihre Pläne für ihre Tochter waren wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Eine Woche lang durften sie noch hoffen, dass alles ein Fehlalarm war. Doch dann lagen die Ergebnisse der Genanalyse vor und bestätigten ihre Befürchtungen.
Es war ein Schock. Monatelang hatten sie ihre Hoffnungen auf ihre künftige Tochter projiziert und Träume gehegt, wie das Mädchen ihrem Leben einen neuen Sinn geben würde. Jetzt blieb ihnen nur ungläubige Verzweiflung, sie fühlten sich verraten und ungerecht behandelt. Sie suchten die Schuld beim Frauenarzt, der nichts gemerkt hatte, bei den Krankenhäusern, die auf solche Situationen nicht vorbereitet waren, und bei den Politikern, die sich nicht um die wahren Probleme der Bürger scherten. Kurz: Jeden machten sie für ihr Leid verantwortlich, nur nicht sich selbst.
Danach folgte ein Gefühl des Verlusts, tiefen Kummers und schier unerträglicher Scham. Sie lagen nachts wach und fragten sich, was sie falsch gemacht hatten, suchten nach Fehlern, Gründen, Erklärungen für die Behinderung ihrer Tochter.
Doch irgendwann hörten sie auf, nur an sich selbst zu denken. Sie machten sich Gedanken über die Zukunft ihrer Tochter. Wie würde sie sich entwickeln? Würde sie glücklich sein? Was wäre, wenn ihnen beiden etwas zustieße: Wer würde für die Kleine sorgen?
Aber schon ein einfaches Gähnen oder Lächeln ihres Babys genügte, um alles zu verändern. Endlich akzeptieren sie Margarida so, wie sie war, und erkannten, wie sehr sie sie liebten.
Als die Ärzte ihnen eines Tages mitteilten, ihre Tochter könne an einem Herzfehler leiden, verwandelte sich ihr Leben in eine Odyssee. Sie pilgerten von einer Klinik zur anderen, ließen schier unzählige Untersuchungen und Tests durchführen.
Tomás schaffte seinen Doktorabschluss in Geschichte nur mit einem riesigen Kraftakt. Es war purer Stress, neben all den Arztbesuchen noch die Kryptographie in der Renaissance mit den komplexen Chiffren Albertis, Portas und Vigenères zu studieren. Außerdem mangelte es ihnen an Geld. Tomás’ Doktorandenstelle und Constanzes Gehalt als Kunstlehrerin reichten mehr schlecht als recht aus, um die laufenden Kosten zu decken.
All diese Belastungen wirkten sich zwangsläufig auf ihre Ehe aus. In ihren jeweiligen Sorgen gefangen, berührten sie einander kaum noch. Sie hatten keine Zeit. Keine Zeit und kein Geld. Und dieser Mangel forderte seinen Tribut: Ihre Beziehung litt. Zwar gingen sie noch herzlich miteinander um und sorgten füreinander, aber ihre Ehe bestand vor allem aus Gewohnheit und Pflichten. Vorbei waren die ersten schönen Jahre, und vorbei war es mit dem Leben, das sie sich gemeinsam ausgemalt hatten. Sie wussten es beide, sahen aber keinen Ausweg. Resigniert machten sie einfach weiter.
Tomás spießte ein Stück Frikadelle auf und trank einen Schluck Rotwein. Margarida hatte inzwischen ihren Nachtisch beendet und stand auf, um den Tisch abzuräumen.
„Du kannst doch auch nachher abräumen“, sagte Tomás. „Nein“, widersprach sie ernst und stellte die dreckigen Teller in die Spülmaschine. „Muss saubermachen, muss saubermachen.“
„Du kannst nachher saubermachen.“
„Nein. Es ist dreckig. Igitt. Muss saubermachen!“
„Du wirst wohl später mal einen Reinigungsservice aufmachen“, scherzte Tomás und hielt seinen Teller fest, damit Margarida ihn nicht mitnehmen konnte.
Putzen und Aufräumen waren Margaridas Obsession. Wann immer sie einen Fleck oder Krümel erblickte, setzte sie alles daran, ihn zu entfernen. So hatte sie ihre Eltern schon mehrfach in peinliche Situationen gebracht, wenn sie beim Anblick eines Spinnennetzes oder von etwas Staub auf den Möbeln schreiend darauf zustürzte und „diesen Dreck wegmachen“ wollte. Sie wies dabei mit einer so abgrundtiefen Verachtung auf den ,Schandfleck‘, dass die Freunde der Noronhas mittlerweile eine ausgiebige Reinigungsaktion starteten, bevor die Familie zu Besuch kam. Zu einigen Bekannten war der Kontakt aus diesem Grund sogar ganz abgebrochen.
Nach dem Abendessen ging Margarida ins Bett. Tomás half ihr beim Zähneputzen und bereitete ihre Sachen für den nächsten Tag vor, während Constanze ihr den Schlafanzug anzog und anschließend eine Gutenachtgeschichte vorlas: Der gestiefelte Kater. Als Margarida eingeschlafen war, machten Tomás und Constanze es sich auf dem Sofa bequem.
„Ich bin hundemüde“, sagte Constanze nach einer Weile und blickte zur Decke.
„Ich auch.“
Das Wohnzimmer war klein, aber geschmackvoll eingerichtet. An den Wänden hingen farbenfrohe Bilder, die Constanze während ihres Kunststudiums gemalt hatte. Auf dem Regal aus hellem Buchenholz standen zwei Vasen mit kräftig roten Blüten und üppigen, grünen Blättern.
„Was für Blumen sind das?“, fragte Tomás.
„Kamelien.“
Er lehnte sich hinüber und roch an einer der Blüten.
„Die duften ja gar nicht.“
„Natürlich nicht“, lachte Constanze. „Kamelien sind geruchlos.“
„Aha“, sagte Tomás. Er lehnte sich zurück und streichelte Constanzes Handfläche. „Erzähl mir mehr über Kamelien.“
Constanze war verrückt nach Blumen. Diese Leidenschaft war einer der Faktoren gewesen, die sie zusammengebracht hatten. Tomás liebte Rätsel und Wortspiele, Symbole und verschlüsselte Botschaften, und er war ständig damit beschäftigt, Codes und Chiffren zu knacken. Als er Constanze kennenlernte, öffnete sie ihm die Tür zu einer ganz anderen Welt von Symbolik: der Bedeutung der Blumen. Sie erzählte ihm, wie die Frauen in türkischen Harems einst mit Hilfe eines genialen Blumencodes in Kontakt mit der Außenwelt getreten waren. Und indem die ursprüngliche türkische Bedeutung mit alten Mythen und traditioneller Folklore verflochten wurde, entwickelte sich daraus die Floriographie, die Blumensprache, die im 19. Jahrhundert extrem populär wurde.
Zu Tomás’ Freude eröffneten die Blumen, die er bis dahin lediglich als schön empfunden hatte, nun ungeahnte Möglichkeiten der Kommunikation. Sie erlaubten es, Dinge auszudrücken, die man nicht in Worte fassen wollte oder konnte. So war es beispielsweise für einen Mann unvorsichtig oder gar undenkbar, einer Frau beim ersten Date zu sagen, dass er in sie verliebt war; aber er konnte ihr sehr wohl einen Strauß Gloxinien schenken – das Symbol für Liebe auf den ersten Blick.
Die Floriographie fand unter anderem Eingang in die Juwelierkunst, die Werke der Präraffaeliten und in die Mode. Das Gewand, das Königin Elisabeth II. bei ihrer Krönungszeremonie trug, war mit Olivenzweigen und Weizenähren bestickt, als Zeichen der Hoffnung, dass ihre Regierungszeit von Frieden und Überfluss geprägt sein würde. Constanze, die von Menschen und von der Natur geschaffene Kunstwerke gleichermaßen liebte, entwickelte sich zu einer Spezialistin für die Nuancen der Blumensprache.
„Kamelien stammen aus China, wo sie sehr geschätzt wurden“, begann sie ihre Erklärung und fuhr sich über das Haar. „Im Westen wurden sie durch Alexandre Dumas und seinen Roman Die Kameliendame bekannt, der auf der wahren Geschichte einer Pariser Kurtisane aus dem 19. Jahrhundert beruht. Dieses Fräulein Marie Duplessis war allergisch gegen Blumendüfte und ertrug nur Kamelien, weil sie eben geruchlos sind.“ Sie warf Tomás einen schelmischen Blick zu. „Ich nehme an, du weißt, was eine Kurtisane ist?“
„Mein Schatz, ich bin Historiker.“
„Nun gut. Fräulein Duplessis trug also stets ein Sträußchen Kamelien – fünfundzwanzig Tage lang in Weiß, als Zeichen ihrer Verfügbarkeit, und rot an den anderen Tagen, wenn sie indisponiert war. Dieser Roman hat übrigens Verdi zu La Traviata inspiriert. Darin verkauft die Opernheldin zugunsten ihres Liebhabers all ihre Juwelen und trägt stattdessen Kamelien.“
„Oh je, die Arme“, sagte Tomás mitfühlend. Er blickte die Blumen an, die seine Frau im Wohnzimmer verteilt hatte. „Und der Farbe der Kamelien hier nach zu urteilen, wird es wohl heute nichts mehr?“
„Stimmt“, seufzte Constanze. „Ich bin groggy.“
Tomás schaute seine Frau an. Sie hatte immer noch diese leicht melancholische Art, die ihn bei ihrem ersten Treffen so fasziniert hatte. Er studierte damals Geschichtswissenschaften, und ein Freund schwärmte ihm von der Schönheit der jungen Frauen an der Kunstfakultät vor. „Wahre Meisterwerke“, pflegte Augusto zu sagen. „Glaub’s mir. Die musst du sehen.“
Eines Tages ließ Tomás sich überreden und begleitete ihn in die Cafeteria. Er fand das Gerücht bestätigt: An keiner anderen Fakultät war so viel Schönheit zu finden. Doch als die beiden jungen Männer versuchten, mit zwei elegant gekleideten Blondinen ins Gespräch zu kommen, kassierten sie eine Abfuhr. Gestresst suchten sie mit ihren Tabletts in der Hand einen freien Platz. Sie wählten letztlich einen Tisch am Fenster, an dem bereits drei junge Frauen saßen, eine von ihnen eine üppige Brünette. „Die Natur ist großzügig“, raunte Augusto Tomás mit einem Augenzwinkern zu.
Die Brünette fand Gefallen an Tomás’ grünen Augen, aber er sah nur eine ihrer Freundinnen, eine junge Frau mit milchweißer Haut, einigen Sommersprossen auf der Nase und braunen Augen mit einem verträumten, etwas abwesenden Ausdruck. Ihre geschmeidigen Gesten deuteten auf eine sanftmütige Natur hin, auch wenn dieser Eindruck täuschte, wie Tomás bald merkte. Unter der ruhigen Oberfläche brodelte ein Vulkan. Hinter der verspielten Katze verbarg sich eine ungezähmte Löwin. Tomás ging nicht eher, bis Constanze ihm ihre Telefonnummer gegeben hatte. Zwei Wochen später schenkte er ihr seinen ersten Strauß Jelängerjelieber, von denen er inzwischen wusste, dass sie ein Zeichen unsterblicher Liebe waren. Dann hatte Tomás Constanze zum ersten Mal geküsst, und sie waren Hand in Hand über den weitläufigen Sandstrand von Carcavelos spaziert.
Tomás wandte seinen Blick nach rechts, wo neben einer der Blumenvasen ein Foto seiner Tochter stand, die ihn anstrahlte. Wie im Zeitraffer gelangte er zurück in die Gegenwart.
„Wir müssen nächste Woche mit ihr zu Doktor Oliveira“, sagte Constanze.
„Diese Arztbesuche machen mich fix und fertig“, antwortete Tomás.
„Sie machen auch Margarida fix und fertig“, erwiderte seine Frau. „Und vergiss nicht, dass sie bald auch operiert werden muss.“
„Erinner’ mich bloß nicht daran.“
„Ich bitte dich, Tomás, ob es dir gefällt oder nicht, du musst mir dabei helfen.“
„Ist ja schon gut.“
„Ich bin es einfach leid, alles allein zu machen. Sie braucht Hilfe, und ich auch. Du bist nun mal ihr Vater.“
Tomás blickte zu Boden. Seine Frau hatte alle Hände voll mit Margaridas Problemen zu tun, und egal, wie sehr er sich bemühte, erreichte er allenfalls halb so viel wie sie. Constanze war einfach viel praktischer veranlagt.
„Es tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich gehe mit euch zu Doktor Oliveira.“
Constanze wirkte besänftigt. Sie lehnte sich auf dem Sofa zurück und gähnte.
„Zeit, ins Bett zu gehen“, sagte sie und stand auf. „Bleibst du noch auf?“
„Ein bisschen. Ich möchte noch ein paar Seiten lesen.“
Sie beugte sich zu ihm, gab ihm einen Kuss und stand auf. Der warme Duft ihres Parfums blieb im Raum zurück. Einen Moment später stand Tomás ebenfalls auf, ging zum Bücherregal und verharrte einen Moment unschlüssig davor. In diesem Augenblick klingelte sein Handy.
„Hallo?“
„Spreche ich mit Mister Noronha?“
Der etwas näselnden Stimme nach zu urteilen war der Anrufer Amerikaner, dessen Portugiesisch einen brasilianischen Akzent hatte.
„Der bin ich. Und wer sind Sie?“
„Ich heiße Nelson Moliarti und bin Vorstandsassistent der Stiftung für die gesamtamerikanische Geschichte. Tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe.“
„Keine Ursache, was kann ich für Sie tun?“
„Ich weiß nicht, ob Ihnen unsere Stiftung bekannt ist?“, fragte Moliarti.
„Nein.“
„Nun, wir sind eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in New York und unterstützen Forschungsarbeiten über die Geschichte Amerikas. Zurzeit betreiben wir ein Großprojekt, das jedoch Probleme bereitet und unsere gesamte Arbeit gefährdet. Der Vorstand hat mich daher vor zwei Wochen gebeten, eine Lösung zu finden. Vor einer halben Stunde habe ich meine Empfehlung vorgestellt. Sie wurde angenommen, und deshalb rufe ich Sie an.“
Es entstand eine Pause.
„Ja, und?“, fragte Tomás.
„Mister Noronha?“
„Ja, ich höre.“
„Sie sind unsere Lösung.“
„Wie bitte?“
„Sie sind die Lösung für unser Problem. Was denken Sie, wann Sie frühestens in New York sein können?“
IV
NEW YORK
Eine Dampfwolke fauchte über den Boden, als sei ein unter dem Asphalt verborgener Vulkan ausgebrochen. Sie löste sich in der kalten Nachtluft schnell auf und verbreitete den unangenehmen Geruch von Frittiertem. Tomás schlug seinen dünnen Mantel enger um sich, vergrub die Hände tief in den Taschen und versuchte, sich so gut es ging vor dem beißenden Wind zu schützen. Es ist ungemütlich in New York, wenn der Wind durch die Straßen pfeift, erst recht, wenn man nicht entsprechend warm angezogen ist, wie Tomás nun am eigenen Leib erfuhr.
Er war wenige Stunden zuvor am JFK Airport gelandet. Dann hatte ihn eine imposante schwarze Limousine, die ihm die Stiftung für die gesamtamerikanische Geschichte zur Verfügung gestellt hatte, zum Waldorf-Astoria gebracht, dem überwältigenden Luxushotel an der Park Avenue. Er war zu aufgeregt gewesen, um die großartigen Details der Dekoration und Architektur richtig zu würdigen und hatte daher nur schnell sein Gepäck ins Zimmer gebracht, sich vom Hotelpagen einen Straßenplan geben lassen und war nach draußen gestürmt, ohne die Dienste seines Chauffeurs in Anspruch zu nehmen.
Das war ein Fehler gewesen. Anfangs hatte ihm die Kälte nicht viel ausgemacht, als er die East Fiftieth Street entlangging, tief beeindruckt von den ihn umgebenden Wolkenkratzern. Aber kaum hatte er die Avenue of the Americas überquert und die Seventh Avenue erreicht, kroch ihm die Kälte regelrecht in die Knochen. Er hatte oft gehört, dass man New York nur zu Fuß wirklich kennen lernen könne, aber niemand hatte ihm gesagt, dass es um diese Jahreszeit hier so kalt sein würde. Er hatte das Gefühl, dass alles um ihn herum zu Eis erstarrte. Seine Ohren litten am meisten. Es war, als bearbeite sie jemand mit einer Rasierklinge.
Er bereute inzwischen, nicht früher umgekehrt zu sein, doch die Neugier hatte gesiegt, und der Anblick des Times Square zog ihn wie magisch an. Die Neonlichter der riesigen Leuchtreklamen blinkten und flackerten in allen Farben, heischten Aufmerksamkeit. Die Straße mit ihrem chaotischen Verkehr war fast taghell erleuchtet. Die Fußgänger rempelten nicht nur einander, sondern auch die Autos, die bestenfalls im Schritttempo vorankamen. Manche Passanten gingen zielstrebig, andere schlenderten gemütlich dahin. Es war ein Feuerwerk der Farben, eine wahre Orgie des Lichts.
Plötzlich spürte Tomás, dass sein Handy vibrierte. Eine Sekunde später hörte er es auch klingeln. Widerstrebend zog er seine Hand aus der schützenden Manteltasche.
„Hallo?“
„Mister Noronha? Hier ist Nelson Moliarti. Wie war Ihr Flug? Sind Sie gut gelandet?“
„Ja, danke, alles bestens.“
„Hat der Fahrer sich gut um Sie gekümmert?“
„Fünf-Sterne-Service, wie das Hotel.“
„Sehr gut. Haben Sie schon gegessen?“
„Nein, noch nicht.“
„Mögen Sie nicht in eines der Hotelrestaurants gehen? Lassen Sie einfach alles auf Ihre Zimmernummer schreiben, die Stiftung übernimmt die Kosten.“
„Danke, aber das ist nicht nötig. Ich werde hier am Times Square eine Kleinigkeit essen.“
„Sie sind am Times Square?“
„Ja.“
„Aber es ist doch eiskalt draußen. Ist der Fahrer bei Ihnen?“
„Nein, den habe ich nach Hause geschickt.“
„Wie sind Sie dann dahin gekommen?“
„Zu Fuß.“
„Aber es ist fünf Grad unter null, und bei dem Wind fühlt es sich noch viel kälter an. Soll ich Ihnen den Fahrer schicken, damit er Sie abholt?“
„Nicht nötig, vielen Dank. Ich nehme ein Taxi.“
„Nun gut, wie Sie meinen“, brummte Moliarti kopfschüttelnd. „Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir Sie morgen früh um neun im Büro erwarten. Der Fahrer holt Sie um halb neun in der Hauptlobby ab.“
„In Ordnung. Dann also bis morgen früh.“
Die fünfstündige Zeitdifferenz zwischen New York und Lissabon ging nicht spurlos an Tomás vorüber. Um sechs Uhr morgens wachte er auf. Draußen war es noch dunkel, und er hätte gern etwas länger geschlafen. Aber nachdem er sich eine halbe Stunde lang im Bett gewälzt hatte, gab er es auf. Zu Hause war es jetzt halb zwölf, und Constanze musste erst am Nachmittag arbeiten.
Er blickte sich im Zimmer um. Die Wanddekoration war burgunderfarben mit goldenen Zierleisten, den Boden bedeckte ein dicker Plüschteppich. In den Ecken standen echte Topfpflanzen, und auf dem Nachttisch wartete eine Flasche Cabernet darauf, geöffnet zu werden. Schade, dass Constanze dies nicht auch genießen konnte.
Er beschloss, sie anzurufen.
„Hallo, meine Raubkatze“, begrüßte er sie. „Alles in Ordnung?“
„Hallo Tomás. Wie ist es in New York?“
„Eiskalt!“
„Und sonst?“
„Na, ich habe noch nicht viel davon gesehen.“
„Was bringst du mir mit?“
„Wie wäre es mit der Freiheitsstatue?“
„Ach nein, die ist mir zu groß“, lachte sie. „Ein paar Bilder aus dem MoMA wären mir lieber.“
„Aus dem was?“
„MoMA. Museum of Modern Art.“
„Aha.“
„Bring mir doch bitte Van Goghs Sternennacht und Monets Wasserlilien. Ach ja, und Picassos Fräulein von Avignon und Divan Japonais von Toulouse-Lautrec.“
„Klar, ist notiert.“ Dann wurde er ernst. „Wie geht es Margarida?“
„Gut. Das heißt“, sie hielt inne und überlegte kurz, „gestern hat sie mir gesagt, dass sich ihre Brust merkwürdig anfühle. Ich habe Angst, dass ihr Herz wieder Probleme macht.“
Tomás atmete tief durch. Die bittere Realität platzte in sein kleines Urlaubsidyll. Nach einem Augenblick sagte er: „Wir werden sie wohl noch einmal zu einem Herzspezialisten bringen müssen.“
„Und du solltest mitkommen.“
„Ich bin gerade in New York.“
„Ja, jetzt hast du eine gute Ausrede“, stimmte sie zu und wechselte dann schnell das Thema. „Haben die Amerikaner schon gesagt, was sie von dir wollen?“
„Nein, ich treffe mich erst nach dem Frühstück mit ihnen.“
„Bestimmt brauchen sie deine Meinung zu irgendeinem Manuskript.“
„Wahrscheinlich.“
Tomás hörte, wie am anderen Ende der Leitung die Türglocke ging.
„Meine Kollegin“, sagte sie. „Ich muss gehen. Dieser Anruf kostet ohnehin bestimmt ein Vermögen. Ich liebe dich. Bis bald.“
„Ich liebe dich auch. Und mach dir keine Sorgen. Margarida wird es bald besser gehen.“
„Ich weiß. Vielmehr, ich hoffe es. Und denk dran, mir Blumen mitzubringen.“
Tomás beendete sein Frühstück um kurz vor halb neun. Dann begab er sich in die Hauptlobby, wo ein imposanter Kronleuchter den in Mosaik gelegten Marmorboden erhellte.
„Guten Morgen, mein Herr. Wie geht es Ihnen heute Morgen?“
Tomás drehte sich um und erkannte den Chauffeur vom Vorabend wieder.
„Guten Morgen“, antwortete er. „Danke, gut.“
„Fahren wir?“
Die Morgenluft war kalt, aber die Sonne schien in all ihrer Pracht über der Stadt und vermittelte das Gefühl von Wärme. Tomás nahm auf der Rückbank Platz, der Chauffeur hinter dem Steuer. Dann fuhr die Sicherheitstrennwand summend herab, und der Fahrer deutete auf ein kleines TV-Set, neben dem je eine Flasche Glenlivet und Moët sowie eine Karaffe mit frischem Orangensaft auf Eiswürfeln standen. „Genießen Sie die Fahrt“, sagte er.
Die Limousine fuhr los, und Tomás schaute zu, wie New York vor seinen Augen dahinglitt. Sie fuhren die stark frequentierte Madison Avenue entlang, bis sie das Sony Building mit seiner charakteristischen Dachkonstruktion erreichten. Dort hielt der Wagen an einer Ecke an.
„Hier ist der Sitz der Stiftung“, sagte der Chauffeur. „Mister Moliarti erwartet Sie.“
Tomás stieg aus und bewunderte das moderne, aerodynamisch wirkende Gebäude. Es war siebenunddreißig Stockwerke hoch und mit rosafarbenem Granit verkleidet. Ein kalter Wind pfiff über den Gehweg und ließ Tomás schaudern, als ein Mann in einem dicken Mantel aus dem Gebäude trat und auf ihn zukam.
„Mister Noronha?“
Tomás erkannte das brasilianische Portugiesisch mit amerikanischem Akzent.
„Bom dia.“
„Bom dia. Ich bin Nelson Moliarti. Schön, Sie kennen zu lernen.“
„Die Freude ist ganz meinerseits“, sagte Tomás, während sie einander die Hände schüttelten.
Moliarti war schlank und nicht sehr groß und hatte kurze, graue Locken. Mit seinen schmalen Händen und einer leichten Hakennase erinnerte er Tomás an einen Raubvogel.
„Willkommen in New York“, grüßte Moliarti.
„Danke“, antwortete Tomás. „Verflixt kalt heute, nicht wahr?“
„Allerdings!“ Moliarti deutete auf die Eingangstür. „Lassen Sie uns hineingehen.“
Drinnen war es angenehm warm, und Tomás bewunderte die Eleganz der marmornen Eingangshalle mit ihrer ungewöhnlichen Skulptur – einem Granitblock, der in einem Stahlbehälter zu schweben schien. Moliarti bemerkte Tomás’ Blick und lächelte.
„Merkwürdig, nicht wahr?“
„Sehr interessant.“
„Kommen Sie. Unsere Büros sind im dreiundzwanzigsten Stock.“
Moliarti schien es eilig zu haben.
Der Aufzug war auffallend schnell. Nach nur wenigen Sekunden öffneten sich seine Türen, und die beiden betraten die Etage der Stiftung für die gesamtamerikanische Geschichte. Deren Haupteingang bestand aus milchigem Glas, auf dem das Logo der Stiftung eingraviert war: ein goldener Adler, der in einer Klaue einen Olivenzweig und in der anderen ein Band mit einer lateinischen Aufschrift hielt. Darauf stand Hos successus alit: possunt, quia posse videntur. Tomás murmelte den Satz vor sich hin und versuchte, sich zu erinnern, von wem er stammte.
„Vergil“, sagte er schließlich.
„Bitte?“
„Dieser Satz“, erklärte Tomás und zeigte auf das Band in den Klauen des Adlers, „er ist ein Zitat aus Vergils Aeneis.“ Und er übersetzte: „Sie können alles tun, weil sie denken, dass sie es können.“
„Ah ja, das ist unser Motto“, sagte Moliarti lächelnd. „Erfolg führt zu mehr Erfolg, kein Hindernis ist so groß, als dass es nicht überwunden werden könnte.“ Er schaute Tomás respektvoll an. „Sie können Latein?“
„Latein, Griechisch und Koptisch, aber ich bin etwas aus der Übung gekommen“, seufzte Tomás. „Und ich würde gern meine Kenntnisse in Hebräisch und Aramäisch vertiefen. Das würde mir ganz neue Möglichkeiten eröffnen.“
Der Amerikaner pfiff anerkennend, sagte jedoch nichts. Er hielt Tomás die Tür auf und führte ihn am Empfang vorbei den Flur entlang in ein modernes Büro, in dem eine streng blickende Frau von Mitte sechzig sie empfing.
„Hier ist unser Gast“, sagte Moliarti. Die Frau stand auf und nickte Tomás zu. „Und das ist Teresa Racca, die Assistentin des Vorsitzenden.“
Die beiden schüttelten einander die Hände.
„Ist John da?“, fragte Moliarti.
„Ja.“
Moliarti klopfte an die Tür, dann öffnete er sie. Hinter einem Schreibtisch aus Mahagoniholz saß ein fast kahler Mann mit Doppelkinn, dessen wenige grauen Haare nach hinten gekämmt waren. Als er Tomás sah, sprang er auf.
„Kommen Sie herein!“
Moliarti stellte die beiden einander vor.
„Das ist Tomás Noronha aus Lissabon“, sagte er. „Mister Noronha, das ist John Savigliano, der Vorstandsvorsitzende unserer Stiftung.“
Savigliano breitete beide Arme aus und strahlte Tomás mit breitem Lächeln an.
„Herzlich willkommen in New York.“
„Vielen Dank“, sagte Tomás auf Englisch, während Savigliano enthusiastisch seine Hand schüttelte.
„Hatten Sie einen guten Flug?“
„Ja, danke.“
„Ausgezeichnet! Ausgezeichnet!“ Savigliano deutete auf eine bequeme Sitzecke. „Setzen Sie sich doch bitte.“
Tomás nahm auf dem edlen Ledersofa Platz und sah sich um. Das Büro war konservativ eingerichtet, mit einer Vertäfelung aus Eichenholz und gediegenem Mobiliar aus dem 18. Jahrhundert. Eine riesige Fensterfront bot einen beeindruckenden Blick über das Häusermeer von Manhattan. Links erkannte Tomás das Chrysler Building, weiter rechts sah er das Empire State Building. Der Parkettfußboden des Büros war aus hochwertigem Walnussholz. In den Ecken standen üppige Grünpflanzen, und an einer der Wände hing ein abstraktes Gemälde, das er nach kurzem Überlegen als einen Franz Marc erkannte.
„Möchten Sie etwas trinken?“, unterbrach Savigliano seine Betrachtungen.
„Nein, danke.“
„Wie wäre es mit einem Kaffee? Wir haben einen ausgezeichneten Cappuccino.“
„Nun, dann bitte einen Cappuccino.“
Savigliano schaute zur Tür. „Teresa!“, rief er.
„Ja, Sir.“