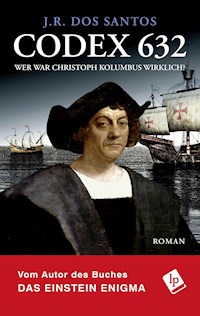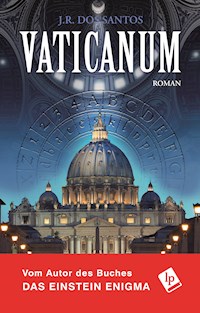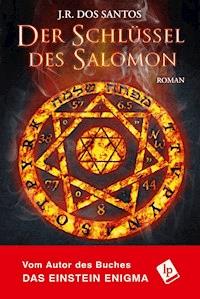
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: luzar publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tomás Noronha-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum, findet ein Jahrhundert-Experiment zur Entstehung des Universums statt. Es muss jedoch wegen einer schrecklichen Entdeckung jäh abgebrochen werden: In einem Teilchendetektor liegt die Leiche von Frank Bellamy, dem Wissenschaftsdirektor der CIA. Das einzige Indiz weist auf Tomás Noronha als Täter hin. Und die CIA ist fest entschlossen, den Mörder zu fassen. Um sein Leben zu retten, muss der berühmte Codespezialist den wahren Täter überführen. Seine Ermittlungen führen ihn in die geheimnisvolle Welt des Mikrokosmos sowie an die Grenzen des menschlichen Wissens und darüber hinaus, dorthin, wo das Bewusstsein und das Universum miteinander verschmelzen. Der Folgeroman von "Das Einstein Enigma".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis
Alle in diesem Buch enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben sind wahr,
und alle hier abgehandelten Theorien und
Die Romanserie um Tomás Noronha erscheint in Deutsch in anderer Reihenfolge als im portugiesischen Original. In Absprache mit dem Autor haben wir uns entschieden, zunächst seinen bekanntesten Titel, Das Einstein Enigma, zu veröffentlichen und anschließend mit einem verwandten Thema fortzufahren, anstatt die chronologische Reihenfolge einzuhalten. Das Leben von Tomás Noronha im deutschsprachigen Raum verläuft also nicht linear, wobei jeder Roman völlig eigenständig gelesen werden kann.
José António Afonso Rodrigues dos Santos ist TV-Moderator und Sprecher der Abendnachrichten des portugiesischen Senders RTP1, mehrfach ausgezeichneter Kriegsberichterstatter und ehemaliger Dozent für Journalismus an der Neuen Universität Lissabon. Er hat das Talent, selbst anspruchsvollste Sachverhalte leicht und spannend zu vermitteln.
Mit seinen Büchern erreicht er ein Millionenpublikum und regelmäßige Bestsellerauflagen, insbesondere mit Das Einstein Enigma (420.000 Exemplare in Frankreich, 210.000 Exemplare in Portugal), das zudem in Kürze verfilmt werden soll. 18 Romane und 7 Essays liegen mittlerweile von ihm vor. Insgesamt wurden mehr als 3 Millionen seiner Bücher verkauft, in bis zu 20 verschiedenen Sprachen.
Folgende Werke sind oder werden in Kürze bei luzar publishing veröffentlicht: Das Einstein Enigma; Vaticanum; Codex 632; Das letzte Geheimnis Jesu und das vorliegende Der Schlüssel des Salomon, die thematische Fortsetzung von Das Einstein Enigma.
José Rodrigues dos Santos lebt in Lissabon.
Der Autor informiert regelmäßig über aktuelle Ereignisse unter:
www.joserodriguesdossantos.com
J.R. Dos Santos
Der Schlüssel des Salomon
J.R. Dos Santos
Der Schlüssel des Salomon
Aus dem Portugiesischen von Vikoria Reich
Für meine Frau Florbela
und meine Töchter Catarina und Inês.
Der Sinn, der sich aussprechen lässt,
ist nicht der ewige Sinn.
Der Name, der sich nennen lässt,
ist nicht der ewige Name.
„Nichtsein“ nenne ich den Anfang von Himmel und Erde.
„Sein“ nenne ich die Mutter der Einzelwesen.
Darum führt die Richtung auf das Nichtsein
zum Schauen des wunderbaren Wesens,
die Richtung auf das Sein
zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten.
Beides ist eins dem Ursprung nach
und nur verschieden durch den Namen.
In seiner Einheit heißt es das Geheimnis.
Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis
ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten.
Tao Te King, 1. Buch, Kapitel 1,
von Laotse im 6. Jh. v. Chr.
übersetzt von Richard Wilhelm
VORGESCHICHTE
2014
Dynamischen Schrittes durchquerte Frank Bellamy die Eingangshalle, wobei ihm zahlreiche Überwachungskameras auffielen, die er bei seinem letzten Besuch im CERN noch nicht gesehen hatte. Doch eine riesige Trikolore in der Halle erinnerte ihn daran, dass in der nächsten Woche der französische Präsident das Europäische Zentrum für Kernforschung besuchen würde und die Sicherheitsmaßnahmen sicherlich auch seinetwegen verschärft worden waren.
„Verdammte Franzosen“, murmelte er.
Genervt ignorierte er das Förderband, auf das er eigentlich den Inhalt seiner Taschen legen sollte, und ging direkt zum Metalldetektor. Ein Sicherheitsangestellter, auf dessen Namensschild ,Jean-Claude Bloch‘ zu lesen war, winkte ihn heran. Als Bellamy zwei Schritte nach vorn machte, schlug der Detektor Alarm.
„Breiten Sie bitte die Arme aus“, sagte der Sicherheitsmann.
Der Besucher gehorchte. Kaum hatte der Wachmann seinen Scanner auf Höhe der Hüften angesetzt, piepte und blinkte das Gerät. Bellamy fuhr mit den Händen in die Taschen, wie ein Kind, dem man seine Bonbons wegnehmen wollte.
„Das sind nur meine Schlüssel, ein paar Münzen und mein Mobiltelefon“, brummte er. „Nichts Außergewöhnliches, wie Sie sehen.“
Bloch blickte ihn missbilligend an und deutete auf das Förderband.
„Das nächste Mal, wenn Sie hierher kommen, legen Sie bitte alle Metallgegenstände auf das Band.“
Bellamy murrte etwas Unverständliches, während der Wachmann ungerührt seine Arbeit fortsetzte. Er fuhr mit dem Scanner über die Beine des Besuchers und forderte ihn auf, seine Schuhe auszuziehen. Dann ließ er das Gerät über Schultern und Arme gleiten. Als er bei der Brust angekommen war, schlug das Gerät erneut an.
„Mist!“, rief Bellamy. „Ich habe mein kleines Spielzeug vergessen.“
Er fuhr mit der Hand in die Innentasche seiner Jacke. Dem Wachmann gingen fast die Augen über, als er sah, dass dort ein Revolver steckte. Er machte einen Sprung zur Seite und zückte prompt seine eigene Waffe.
„Keine Bewegung!“, schrie er, während er auf den Besucher zielte. „Bleiben Sie, wo Sie sind!“
Von den Rufen ihres Kollegen alarmiert, stürzten weitere Sicherheitsangestellte mit gezückten Waffen herbei. Dazu dröhnte der Alarm durch die Halle und steigerte die allgemeine Verwirrung. Einige Menschen fingen an zu schreien, andere rannten zum Ausgang. In nur einem Augenblick war die Ruhe dem Chaos gewichen.
„Jetzt übertreiben Sie mal nicht, das ist nur mein alter Colt. Wie soll sich ein ehrlicher Bürger denn sonst in dieser gewalttätigen Welt verteidigen?“
„Keine Bewegung“, wiederholte Bloch, der seine Glock weiter auf den Eindringling gerichtet hielt. „Gehen Sie langsam in die Hocke und legen Sie Ihre Waffe auf den Boden.“ Dazu schwenkte er seine Pistole. „Ganz langsam, verstanden? Bei der geringsten verdächtigen Bewegung schieße ich.“
„Ist ja schon gut“, erwiderte Bellamy, den die ganze Aufregung ziemlich kalt ließ. „Ich kenne das Prozedere, keine Sorge.“
Langsam ging er in die Hocke und legte seinen Colt auf den Boden. Dann richtete er sich mit erhobenen Händen auf. Der Sicherheitsmann kickte den Revolver mit der Fußspitze ein Stück weit weg und deutete sichtlich erleichtert auf den Boden.
„Hinlegen! Die Hände in den Nacken!“
Bellamy entgegnete gelangweilt: „Hören Sie, finden Sie nicht, dass Sie etwas übertreiben? Das ist doch nur ein kleiner …“
„Hinlegen!“
Nach einem langen Augenblick, während dem er die Sicherheitsleute mit ihren gezückten Waffen herablassend musterte, seufzte er schließlich und senkte langsam die Arme. Alle erwarteten, dass er sich auf den Boden legen würde, doch der alte Mann blieb stehen.
„Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe?“, fauchte Jean-Claude Bloch ihn an. „Legen Sie sich endlich hin!“
Der Besucher hielt seinen eisigen Blick nach wie vor auf das Wachpersonal gerichtet, während er aufreizend langsam erneut in seine Jackentasche griff.
„Keine Bewegung!“, brüllte Bloch, der fürchtete, er würde eine weitere Waffe hervorholen. „Hände hoch, oder ich schieße!“
Bellamy ignorierte auch diesmal die Drohung und zog eine Karte aus seiner Jackentasche, die er dem Sicherheitsmann hinhielt. Dieser warf trotz der Anspannung einen Blick auf das Dokument. Er verglich das Foto mit dem Gesicht des Mannes vor ihm. Die stahlblauen, berechnenden Augen waren die gleichen, ebenso wie die Falten in seinen Augenwinkeln, das lange, hagere Gesicht, das kantige Kinn und die schlohweißen Haare. Es bestand kein Zweifel: Dieser Ausweis gehörte dem Besucher.
Dann betrachtete er die Karte genauer. Rechts war der Kopf eines Adlers auf blauem Hintergrund zu sehen, im unteren Teil ein langer Strichcode. Zwischen dem Foto im linken Teil der Karte und dem blauen Kreis rechts standen die persönlichen Daten des Inhabers. Oben war zu lesen ,Mitarbeiter 1123-x0‘, darunter der Status Directorate of Science and Technology, Director und darunter der Name und die Sicherheitsstufe 5.
„Bellamy“, sagte der Alte mit der Sicherheit dessen, der gewohnt ist, Befehle zu erteilen. „Frank Bellamy.“
Der schweizerische Sicherheitsangestellte betrachtete den Ausweis mit offenem Mund.
„Sie sind von der …“
„Der CIA“, bestätigte Bellamy schneidend. „Herzlichen Glückwunsch, mein Junge, Sie können lesen. Sie sind ein echtes Genie.“
Im Kontrollraum des CERN herrschte hektische Betriebsamkeit. Die Ingenieure, Informatiker und Physiker starrten teils gebannt auf die Kontrollbildschirme, teils kommentierten sie nervös flüsternd das Geschehen. Die Spannung war geradezu greifbar. Das war wenig überraschend, denn sie bereiteten sich gerade auf ein Experiment von höchster Bedeutung vor. Ein Experiment, das einige der grundlegenden Fragen der Menschheit beantworten könnte: Wie ist das Universum entstanden? Wie viele Dimensionen gibt es? Gibt es ein Antiuniversum?
Die Computer und Klimaanlagen liefen auf vollen Touren, und ihr Brummen erfüllte den Raum. Ein konstanter Lärm, nur unterbrochen von der trockenen Stimme des Forschungsleiters, der die Vorbereitungen überwachte, sowie vom Stakkato der Antworten seiner Mitarbeiter.
„Der Booster?“, erkundigte sich der Leiter, eine Kaffeetasse mit dem Logo des CERN in der Hand. „Läuft er mit voller Leistung?“
„Negativ“, antwortete der Mann am Kontrollpanel. „Er ist noch in der Beschleunigungsphase.“
„Welches Niveau?“
„Energie: 70 MeV steigend.“
„Die nächste Injektion erfolgt in Schleife eins, Segment eins. Zwei Energiepakete.“
„Ich verifiziere.“
Der Leiter schwieg. 70 Megaelektronenvolt waren ein relativ schwaches Energieniveau. Aber die Mikropartikel verließen den Linearbeschleuniger mit 50 MeV, und es dauerte eine gewisse Zeit, bis der Booster 1,4 GeV, also Gigaelektronenvolt, erreichte, die Energie, die notwendig war, um die Protonen in den ältesten Teilchenbeschleuniger des CERN, das Protonen-Synchrotron, zu leiten. Er trank einen Schluck Kaffee, während er die Anzeigen auf dem Bildschirm beobachtete.
„Paul, was ist mit den Magneten? Sind sie mit dem Protonenbeschleuniger in Phase?“
„Positiv“, antwortete Paul, dessen Aufgabe darin bestand, die Magneten aus Niob und Titan zu überwachen. „Das Magnetfeld ist aufgebaut und steigt entsprechend der Protonengeschwindigkeit. Keine Schwierigkeiten in diesem Bereich.“
Der Leiter wandte seinen Blick nicht vom Bildschirm, auf dem die Zahlenwerte in rascher Folge anstiegen.
„Max, das Helium?“, fragte er einen weiteren Techniker. „Ist es stabil?“
„Positiv.“
Hochkonzentriert beobachtete der Leiter eine Zahlenkolonne und schüttelte missbilligend den Kopf. Er brummte etwas, stellte seine Kaffeetasse ab und drehte sich um.
„Was macht der PS, Heinrich?“, erkundigte er sich ungeduldig nach dem Stand des Protonen-Synchrotrons. „Ist er bereit?“
„Negativ, Herr Direktor. Die 1,4 GeV sind noch nicht erreicht.“
„Wie ist das aktuelle Niveau?“
„290 MeV steigend.“
„Herrje!“, rief er aus, da ihm bewusst war, wie wichtig das Timing für den Erfolg der gesamten Operation war. „Der Beginn der nächsten Phase duldet keinen weiteren Aufschub. Beschleunigen Sie! Ich will, dass der PS bereit ist, wenn die Protonen 1 GeV erreicht haben, verstehen Sie?“
„Jawohl, Herr Direktor.“
Frank Bellamy hatte das deutliche Gefühl, dass ihm jemand folgte. Er blieb stehen und schaute sich um, suchte nach verdächtigen Bewegungen oder Schatten, konnte jedoch nichts Auffälliges feststellen. Der Lärm des Teilchenbeschleunigers übertönte zudem jedes Geräusch eines potentiellen Verfolgers.
„Das kann ja wohl nicht sein!“, schimpfte er. „Entweder werde ich senil, oder der Typ, der mir folgt, ist wirklich gut.“
Er bog um eine Ecke des verlassenen Gangs und setzte seinen Weg aufmerksam fort. Er wusste, dass seine Intuition ihn selten trog. Wenn er sich verfolgt fühlte, hieß das, dass tatsächlich jemand hinter ihm her war. Er kannte dieses Gefühl bereits aus Addis Abeba und aus Ostberlin zu Zeiten des Kalten Krieges. Damals war es ihm dank seiner Eingebung gelungen, seine Verfolger rechtzeitig auszuschalten.
Er versuchte, sich wieder zu fassen. Bestimmt trug auch der ungewöhnliche Ort dazu bei, ihm die Sinne und den Verstand zu trüben. Wer weiß, ob nicht die von den mächtigen Elektromagneten erzeugte Feldstärke ihn narrte? Er wusste nur zu gut, dass oberhalb eines bestimmten Niveaus der Magnetismus das menschliche Denkvermögen beeinträchtigen konnte. Vielleicht war dies ja gerade der Fall.
Am Ende des Ganges befand sich eine Tür mit der Aufschrift ,Hadronen-Speicherring‘. Bellamy wusste, dass der Zugang nur Mitarbeitern des CERN gestattet war, keinesfalls jedoch während eines Experiments, wie das, das gerade im Gange war. Doch von solchen Nebensächlichkeiten ließ sich der verantwortliche Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technologie, einem der fünf Leitungsorgane des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, nicht abhalten. Er gab die Zahlenkombination, die er wenige Tage zuvor von den Verantwortlichen des CERN erhalten hatte, auf der Codetastatur an der Wand ein. Auf dem kleinen Bildschirm erschienen zwei englische Worte: Access denied.
„Scheiße!“, fluchte der CIA-Agent und versetzte der Wand einen Tritt. „Scheiße! Scheiße! Scheiße!“
Die blinkende Anzeige auf dem Bildschirm schien sich über ihn lustig zu machen, aber er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. Der Code, den er erhalten hatte, gewährte ihm offenbar nur Zugang zum allgemeinen Komplex, aber niemand konnte sich dem Großen Hadronen-Speicherring nähern, während dieser in Betrieb war.
Er würde improvisieren müssen. Er tastete nach dem Holster unter seiner Jacke, merkte jedoch, dass es leer war, und erinnerte sich, dass die Sicherheitsleute seinen Revolver konfisziert hatten. Dann holte er einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und begann, mit dessen Spitze die Abdeckung der Tastatur aufzuschrauben. Keine fünf Minuten später hatte er das Gehäuse abmontiert, und die Versorgungsdrähte lagen offen vor ihm.
Anschließend nahm Bellamy sein Mobiltelefon zur Hand und drückte auf eine Taste, die eine kleine Klinge hervorspringen ließ. Der CIA-Agent lächelte. Er packte die Kabel, durchtrennte sie und hielt ihre Enden aneinander.
„Voilà!“
Lautlos öffnete sich die Tür.
Bevor er eintrat, suchte Bellamy erneut den Gang hinter sich ab. Das Gefühl, jemand sei in seiner Nähe, hatte sich noch verstärkt.
In dem Maße, wie die Protonenpakete von einem Beschleuniger in den nächsten injiziert wurden, stieg die Spannung im Kontrollraum. Die Physiker hatten ihr Murmeln eingestellt, und die Atmosphäre war zum Zerreißen angespannt. Der entscheidende Augenblick stand kurz bevor.
„Heinrich“, rief der Leiter des Experiments. „Welches Niveau haben die Protonen?“
„405 GeV steigend, Herr Direktor.“
„Maurice, ist der Große Speicherring bereit für die Ladung?“
„Ja.“
„Paul, was machen die Magneten?“
„Das Magnetfeld steigt entsprechend der Beschleunigung der Protonen, Sir.“
Durch die von den Supermagneten erzeugte Feldstärke wurden die Protonen beschleunigt und abgelenkt und so im Großen Hadronen-Speicherring gehalten. Das Experiment hatte nun seine kritische Phase erreicht.
„Heinrich, ist alles bereit?“
„Beinahe, Herr Direktor.“
„Starten Sie die letzte Phase.“
„Energie: 415 GeV steigend … 420 GeV steigend … 425 GeV steigend …“
„Achtung … Injektion der Energiepakete … Bereiten Sie die Rampe vor.“
„Energie: 430 GeV steigend … 435 GeV steigend … 440 GeV steigend …“
„Achtung … Pakete, Rampe. Starten Sie den Injektor. Drei, zwei, eins.“
„Energie: 445 GeV steigend … Energie stabil bei 450 GeV.“
„Injektion!“
Kaum hatte Maurice den Auslöser gedrückt, wurden die Protonen in die Röhre des Großen Hadronen-Speicherrings eingespeist. Die finale Beschleunigungsphase hatte begonnen.
„Injektion abgeschlossen!“, rief der französische Ingenieur. „Energie auf dem flat top stabil.“
„Teilchenpakete anpassen“, ordnete der Leiter an. „Wir haben zwanzig Minuten, um auf 7 TeV zu kommen.“
Sieben Teraelektronenvolt waren ein ungeheuerliches Energieniveau, wie schon die Abkürzung TeV andeutete: Das ,T‘ leitete sich ab von Tera, dem griechischen Wort teras für Monster, Ungeheuer.
Mit dem letzten Beschleunigungsschritt würden die Protonen also das ungeheure Niveau von sieben Billionen Elektronenvolt erreichen. In anderen Worten, die Masse der Protonen würde sich um mehr als das Siebentausendfache erhöhen, so dass die Zeit für die Protonen 7460 Mal langsamer als für ihre Beobachter abliefe. Ein Energieniveau, das dem der subatomaren Teilchen unmittelbar nach dem Big Bang, der Entstehung des Universums, entsprach. Bei 7 TeV würden die Protonen mehr als 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit erreichen, während sie durch das 27 Kilometer lange Netz des Großen Speicherrings jagten, durch eine Röhre, nicht dicker als ein Haar. Die Ausmaße des Forschungszentrums in der Nähe von Genf waren gigantisch. Und es enthielt die wohl komplexeste und perfekteste Maschine, die jemals von Menschen entwickelt wurde.
„Paul, sind die Magneten noch in Phase?“
„Positiv, Sir. Sie werden in etwa zwanzig Minuten ihr Maximum erreicht haben.“
Auf höchster Leistungsstufe generierten die Supermagneten ein Magnetfeld, das einhundertsiebzigtausend Mal stärker als das der Erde war – eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass die Protonen annähernd mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein konnten. Sollte das Energieniveau der Protonen 7 TeV übersteigen, wäre es nicht mehr möglich, ihre Flugbahn innerhalb des Speicherrings zu halten, und sie würden sich verlieren.
Der Experimentleiter drückte auf den Knopf eines internen Kommunikationssystems.
„CMS Beta. Bereit?“
„Positiv“, erklang die Antwort des Ingenieurs, der den schwersten jemals gebauten Teilchendetektor überwachte. „Wir sind bereit, die Kollision zu starten.“
Der Leiter drückte eine andere Kommunikationstaste.
„ATLAS Beta“, fragte er. „Bereit?“
Aus dem Lautsprecher war zunächst nur ein Rauschen zu hören, doch dann ertönte die Stimme eines spürbar verwirrten Mitarbeiters.
„Wir … haben hier … ein Problem.“
In diesem Moment fingen auch die roten Kontrollleuchten im Raum zu blinken an. Die Wissenschaftler tauschten entgeisterte Blicke aus, ohne den Ursprung oder die Reichweite des Problems zu verstehen. War im Detektor ATLAS ein Feuer ausgebrochen? Sollte der Große Hadronen-Speicherring aufgrund der ungeheuren Energiebelastung geborsten sein? Waren sie in Gefahr?
Der Leiter des Experiments reagierte als Erster. Maßlos enttäuscht hob er die Arme und gab mit sorgenvoller Stimme das gefürchtete Kommando.
„Abbruch!“, rief er. „Alles abschalten.“
Die Tastatur gab erst wieder ein Lebenszeichen von sich, als das Magnetfeld deaktiviert war. Dann tippte Jean-Claude Bloch den Zahlencode ein, und die Tür öffnete sich mit einem Seufzen.
„Gehen wir?“, fragte sein Kollege, mehr, um sich selbst Mut zu machen, als weil er wirklich eine Antwort erwartete.
Die beiden Wachmänner betraten den Hochsicherheitsbereich, in dem sich der Große Hadronen-Speicherring befand. Im Tunnel zögerte Bloch einen Moment lang aus Respekt vor den schier unvorstellbaren Naturgewalten, die hier gebündelt waren. Er betrachtete die riesige Stahlröhre, die inmitten des Tunnels verlief, und suchte nach Auffälligkeiten. Wie die beiden Männer wussten, ging bei einem Defekt die größte Gefahr vom Inneren dieser Röhre aus, in der sich die Injektoren, die Niob- und Titanmagneten und ganz besonders das Kühlsystem befanden, das die Magneten auf eine Temperatur von unter zwei Kelvin oder minus 271 Grad Celsius, nur knapp über dem absoluten Nullpunkt, kühlte, eine Temperatur, die nötig war, um die Supraleitfähigkeit der Magneten zu gewährleisten. Falls die Leitungen ein Leck hatten und flüssiges Helium aus ihnen austrat, würden sie einen schnellen Tod sterben. Eilig setzten die beiden ihre Gasmasken auf.
Bloch schaltete sein Funkgerät ein.
„Falke 1 an Nest. Wir sind drin. Bitte kommen.“
Es ertönte ein Rauschen.
„Nest an Falke 1. Wie ist die Situation?“
„Alles scheint ruhig zu sein, es ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Was machen wir jetzt?“
„Gehen Sie zu ATLAS, Falke 1, dort ist das Problem aufgetreten. Ende.“
Der Tunnel war gut erleuchtet, aber die beiden Sicherheitsmänner hielten ihre Taschenlampen eingeschaltet, um die Röhre von allen Seiten zu inspizieren. Während sie ihren Weg fortsetzten, tanzten die Lichtkegel über den kalten Stahl.
„Brrr“, machte Jean-Claude Bloch. „Ist das unheimlich.“
Sein Kollege schüttelte sich.
„Du sagst es.“
Gut zehn Minuten schritten sie so voran, aufmerksam in alle Richtungen schauend. Dann erweiterte sich der Tunnel zu einer riesigen Halle. Darin stand mit einem Durchmesser von 25 Metern eine ungeheure Maschine, die aus einer Folge konzentrischer Zylinder bestand – ein wahrer Stahlriese, der unter der Erde zu schlafen schien.
Sie hatten ihr Ziel erreicht. ATLAS war einer der wichtigsten Teilchendetektoren des CERN, in dem bereits das berühmte Higgs-Boson oder ,Gottesteilchen‘ entdeckt worden war. Hier war es auch, wo die Kollision der Protonenpakete bei einer Geschwindigkeit nur knapp unter der des Lichts stattfinden sollte, und bei diesem Zusammenprall der Teilchen entstanden Myriaden von Mikroteilchen wie Quarks, Elektronen, Myonen, Gluonen, Neutrinos, W- und Z-Bosonen, Photonen und vielleicht sogar Gravitonen, die es möglich machten, die grundlegenden Kräfte und Bestandteile der Natur zu erforschen.
Bloch schaltete das Funkgerät wieder an.
„Falke 1 an Nest“, sagte er. „Wir sind am Ziel. Wohin jetzt? Kommen.“
„Nest an Falke 1, dem Computer zufolge befindet sich das Problem in der Nähe des äußeren Myonen-Detektors. Schauen Sie nach.“
Die beiden Männer blickten augenblicklich in Richtung des großen Rades mit dem äußeren Myonen-Detektor. Dort stimmte in der Tat etwas nicht. Ohne sich einen weiteren Schritt vorwärts zu wagen, richteten sie ihre Taschenlampen dort hin und entdeckten mit Entsetzen eine Dampfwolke.
„Das Helium!“, rief Bloch. „ATLAS verliert Helium!“
„Was machen wir jetzt?“, fragte der andere. „Rufen wir Verstärkung?“
„Welche Verstärkung, Idiot? Wir sind die Verstärkung!“, herrschte ihn Bloch an, der seine Nervosität nur schwer verbergen konnte. „Wir müssen da hingehen, um zu sehen, wo exakt das Leck ist.“
Mit größtmöglicher Vorsicht näherten die beiden Männer sich dem Detektor. Neben der riesigen Maschine fühlten sie sich wie Zwerge. Sie umrundeten das große Rad des äußeren Myonen-Detektors und hielten argwöhnisch die Dampfwolke im Blick.
„Ist da nicht etwas in der Wolke?“
„Wo?“
Jean-Claude Bloch richtete den Kegel seiner Lampe darauf.
„Da. Siehst du es jetzt?“
Auf die Entfernung und mit all dem Dampf konnten sie unmöglich erkennen, was es war. Sie mussten noch näher herangehen. Trotz ihrer Schutzmasken kostete sie jeder Schritt enorme Überwindung, als näherten sie sich dem Krater eines aktiven Vulkans. Der Schein ihrer Lampen flackerte unsicher über die Dampfwolke.
Zwei Meter vor ihrem Ziel blieben sie stehen, um dem Helium nicht zu nahe zu kommen. Es war kalt. Im Kontakt mit der Luft dehnte sich das Gas aus und verdrängte den Sauerstoff. Wer sich ihr ohne Schutzmaske zu sehr näherte, würde ersticken.
Bloch rang mit der Kälte, die ihn zu lähmen drohte, und erhellte das Objekt, das er vorher gesehen hatte.
„Heilige Scheiße!“, entfuhr es ihm.
Dort lag ein Mensch, sein Oberkörper im Inneren der Maschine, die Beine ragten daraus hervor, das Gesicht war blau angelaufen. Der Mann war offensichtlich tot; entweder aus Sauerstoffmangel erstickt oder den inneren Verbrennungen erlegen, die das Einatmen von Heliumdampf verursachte. Die Autopsie würde die genaue Todesursache klären.
Als er das Gesicht des Opfers erhellte, zuckte Jean-Claude Bloch erstaunt zusammen.
„Das ist der Alte, der Typ von der CIA!“
„Wer?“
„Der Typ, der heute Vormittag mit einer Waffe hier rein wollte.“
„Bist du dir sicher?“
„Absolut! Ich hatte mit ihm am Eingang zu tun. Frank … Frank Sowieso.“ Er überlegte einen Augenblick. „Bellamy! Das ist es. Frank Bellamy. Ich glaube, der ist ein hohes Tier bei der CIA.“
„Und was hatte der hier zu suchen?“
Bloch machte sich nicht die Mühe zu antworten. Er untersuchte den Körper im Schein seiner Lampe und bemerkte, dass der linke Arm ausgestreckt war und zwischen den Fingern ein Stück Papier hervorschaute.
„Was ist das denn? Siehst du das Papier?“
Sein Kollege schaute in die angegebene Richtung und nickte.
„Ja. Da steht etwas geschrieben.“
Die beiden Männer drehten ihren Kopf, um die Schrift lesen zu können.
„Was soll das denn bedeuten?“
Bloch richtete seine Lampe auf die Leitung, aus der das Helium austrat. Das Kühlsystem hatte ein Loch, und ein Hochtemperaturperforator lag direkt daneben.
„Schau dir nur das an!“, rief er aus.
„Mein Gott!“, sagte sein Kollege entsetzt. „Das Loch … das flüssige Helium, das hat jemand absichtlich gemacht.“
Bloch nahm abermals sein Funkgerät zur Hand.
„Falke 1 an Nest. Wir haben die Ursache des Problems identifiziert. Im hinteren Teil des äußeren Myonen-Detektors liegen eine Leiche und ein Hochtemperaturperforator neben dem Heliumleck. Das war kein Unfall. Ich wiederhole, das war kein Unfall. Erwarte Anweisungen. Bitte kommen.“
Einige Sekunden lang war nichts als Rauschen zu hören.
„Nest an Falke 1. Können Sie das wiederholen?“
„Wir haben in ATLAS eine Leiche gefunden und ein Gerät, mit dem die Heliumleitung absichtlich beschädigt wurde. Der Tote hat einen Zettel mit einem Namen in der Hand. Ich nehme an, das ist der Name des Mörders.“
Diesmal dauerte das Rauschen noch länger. Die Verantwortlichen im Sicherheitszentrum mussten diese Informationen sicher erst einmal verarbeiten.
„Nest an Falke 1“, kam schließlich die Antwort. „Kommen Sie umgehend zurück. Wir wollen einen vollständigen Bericht. Die Feuerwehr soll sich um das Helium und die Leiche kümmern. Bis auf Weiteres bleibt der Zugang zu ATLAS und der Maschinenhalle untersagt. Ende.“
Die beiden Sicherheitsangestellten warfen einen letzten Blick auf den Toten und stürzten dann zum Ausgang. Sie umrundeten erneut das große Rad des Myonen-Detektors und gingen auf dem gleichen Weg, den sie gekommen waren, durch den Tunnel zurück.
Bloch dachte wieder an den Vorfall, der sich am Vormittag in der Eingangshalle abgespielt hatte und an das Verhalten des alten CIA-Direktors.
„Wer auch immer dieser Tomás Noronha sein mag“, murmelte er, „die CIA wird über ihn herfallen. Dem werden sie die Hölle heißmachen.“
Aber das war nicht sein Problem. Er zuckte mit den Schultern und beschleunigte seinen Schritt. Je schneller sie hier draußen waren, umso besser für sie.
I
Irgendwann wurde der Sprinkler abgestellt, und das feuchte Gras glänzte in der Sonne. Eine Aktentasche in der Hand, überquerte Tomás Noronha den Rasen und betrat das hochmoderne Gebäude der Gulbenkian-Stiftung. Gut gelaunt summte er eine Melodie, die er gerade im Radio gehört hatte. Er grüßte die Dame am Empfang, dann ging er in Richtung eines Büros am Ende des Flurs und öffnete die Tür.
„Guten Tag, Albertina“, sagte er.
Die Sekretärin schaute von ihrem Bildschirm auf.
„Professor Noronha, hatten Sie eine gute Reise?“
„Ausgezeichnet“, antwortete der Mann mit den grünen Augen und betrat den Raum, in dem er als wissenschaftlicher Berater der Stiftung arbeitete. „Ich bin gestern Nachmittag in Lissabon gelandet. Das war früher als gedacht, aber so bin ich gerade noch vor dem Streik der spanischen Fluglotsen nach Hause gekommen.“
„Wie war es in Genf? Ist es da nicht sehr kalt?“
Der Historiker fuhr mit einer Hand in seine Tasche.
„Eisig“, sagte er, während er seiner Sekretärin eine kleine rote Schachtel reichte. „Hier, ich habe Ihnen echte Schweizer Schokolade mitgebracht.“
Albertina nahm das Geschenk und lächelte.
„Oh, Professor. Das wäre doch nicht nötig gewesen!“
Tomás stellte seine Aktentasche ab.
„Es ist mir ein Vergnügen“, sagte er, während er seinen Mantel auf einen Bügel hängte. Dann fragte er: „Gibt es etwas Neues?“
Albertina nahm augenblicklich eine professionelle Haltung ein und blätterte in ihrem Kalender.
„Ja. Jemand von der Neuen Universität Lissabon hat angerufen. Ich habe ihm erzählt, dass Sie unterwegs seien und er sich morgen wieder melden solle. Er hat mir nicht gesagt, worum es ging.“
Tomás konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
„Das ist auch nicht nötig. Die Kollegen nerven mich schon, dass ich wieder an die Fakultät komme.“
„Meiner Meinung nach zu Recht“, erklärte Albertina tadelnd. „Seit wann gibt es denn so etwas, dass ein Gelehrter wie Sie, einer der besten Kryptologen der Welt, der zig alte Sprachen beherrscht, keine Vorlesungen an der Uni hält? Ganz ehrlich, das ist eine Schande.“
Tomás wollte das Thema beenden. Er rückte seinen Stuhl zurecht, setzte sich und schaltete seinen Computer ein.
„Sonst noch etwas?“
„Ein Ingenieur Ferro möchte Sie um 15 Uhr sprechen. Es geht um den Kauf, wegen dem Sie in Genf waren.“ Sie warf ihm einen fragenden Blick zu. „Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?“
Tomás beugte sich zu seiner Aktentasche hinab.
„Ja, es hat geklappt.“
Die Sekretärin fixierte ihn mit unverhohlener Neugier.
„Wirklich? Kann ich es sehen?“
Tomás öffnete sein Köfferchen und zog ein verschnürtes Bündel daraus hervor.
„Hier ist es“, sagte er. „Sie ahnen gar nicht, wie viel Arbeit mich das gekostet hat.“
Er strich zärtlich über das Päckchen. Die Verhandlungen mit dem Genfer Antiquar waren sehr schwierig gewesen. Es ging um ein seltenes Manuskript, dessen Ankauf er der Gulbenkian-Stiftung ans Herz gelegt hatte. Nach einer eingehenden Untersuchung des Dokuments hatte er ein Angebot unterbreitet, und zu guter Letzt war der Handel zu einem Preis zustande gekommen, der kaum über seinem ersten Angebot lag. Tomás war derart aus dem Häuschen, dass er die Besprechung mit Ferro kaum abwarten konnte; der Museumsdirektor würde bestimmt begeistert sein.
„Kann ich es sehen?“, wiederholte Albertina. „Oder muss Ihr kleiner Schatz eingewickelt bleiben?“
Tomás lachte herzlich.
„Ich kenne niemanden, der so ungeduldig ist wie Sie! Aber gern, ich zeige es Ihnen.“
Er löste das Klebeband des Päckchens und zog ein altes, vergilbtes Manuskript heraus, das zum Schutz vor der Umgebungsluft in Plastik eingeschweißt war. Er hielt seiner Sekretärin das Werk hin und deutete auf den Titel, unterhalb dessen die ersten Zeilen in mittelalterlicher Kalligraphie zu lesen waren.
„Tabula Samri … Smiragda … na?“, versuchte Albertina, den Text zu entziffern.
„Tabula Smaragdina“, korrigierte Tomás, „was soviel heißt wie ,Smaragdene Tafel‘. Der Text wird Hermes Trismegistos zugeschrieben. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört.“
„Aber sicher doch. Das war ein Magier der Antike, nicht wahr?“
„Sozusagen. Hermes Trismegistos war ein berühmter Alchemist, dessen wahre Identität ein Rätsel ist. Es heißt, er sei das Ergebnis der Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes und des ägyptischen Gottes Thot, zwei Gottheiten der Magie und des Schreibwesens. Es wird angenommen, dass sich hinter Hermes Trismegistos der große Ägypter Imhotep verbirgt. Den verehrten auch die Griechen, zusammen mit ihrem Gott der Medizin, Asklepios, als sie im griechisch-ptolemäischen Zeitalter Ägypten besetzt hielten. Trismegistos bedeutet ,der dreifach größte Hermes‘; er soll ein Heiliger und Verfasser zahlreicher Texte gewesen sein. Zu den berühmtesten gehören die nach ihm benannten hermetischen Schriften aus dem 2. bis 4. Jahrhundert, eine Sammlung von Dialogen, in denen ein Meister – Hermes Trismegistos – seinem Schüler die Gesetze der menschlichen und göttlichen Weisheit sowie der Entstehung der Welt erklärt.“
„Sind diese Texte heute noch erhalten?“
„Selbstverständlich. Ursprünglich waren sie auf Papyrus geschrieben, doch es gibt Übersetzungen in Latein aus dem 15. und 16. Jahrhundert.“ Er zog die entsprechenden Unterlagen, die er in den letzten Wochen vor seiner Reise nach Genf zusammengetragen hatte, aus seiner Aktentasche. „Das Corpus Hermeticum enthält tiefe, noch heute gültige Weisheiten.“ Er suchte eine bestimmte Stelle in seinen Notizen. „Nehmen wir nur dieses Zitat aus dem 14. Buch: ,Und ich bin von mir aufgegangen in einem unsterblichen Leibe, und ich bin nun nicht derjenige, der ich zuvor war, sondern geboren in dem Gemüte.‘”
„,Sondern geboren in dem Gemüte?‘ Was soll das heißen?“
Tomás wiegte den Kopf.
„Das ist die hermetische Weisheit. Es bedeutet, dass wir es mit einer Geheimlehre zu tun haben. Dieser Satz ,Ich bin geboren in dem Gemüte‘ scheint auszudrücken, dass die wahrhaftige Wirklichkeit die des Gemütes ist. Wir sind das, was unser Gemüt empfindet. Es gibt keine Wirklichkeit jenseits des Gemüts.“
Diese Idee war für Albertina zu sonderbar, als dass sie sie ernst nehmen konnte.
„Das ist also das Manuskript, das Sie in Genf erworben haben?“, fragte sie mit Blick auf das eingeschweißte Schriftstück in Tomás’ Händen. „Wovon handelt es?“
„Die Smaragdene Tafel ist der Text, auf dem die gesamte Alchemie beruht, die islamische ebenso wie die westliche. Ihm verdankt Hermes auch seinen Namenszusatz Trismegistos, denn er schreibt darin, die drei Teile der Weisheit des Universums zu kennen. Eine davon ist übrigens die Alchemie, die Kunst der Umwandlung von Elementen.“
„Noch so ein Humbug …“
Tomás schnitt eine Grimasse.
„Täuschen Sie sich nicht“, entgegnete er. „Die Alchemie ist die Wissenschaft von der Umwandelbarkeit von Metallen und anderen Elementen. Eines der größten alchemistischen Ziele bestand lange Zeit darin, Eisen in Gold umzuwandeln. Wir wissen heute, so unglaublich es klingen mag, dass eine solche Umwandlung tatsächlich möglich ist. Der erste Wissenschaftler, dem dies gelungen ist, war der Brite Ernest Rutherford. Er wandelte Stickstoff durch Bestrahlung mit Alphateilchen in Sauerstoff um, und er trug zum Verständnis des Prozesses bei, wie die Sterne Kohlenstoff, Eisen und Gold mittels Umwandlung aus anderen Atomen produzieren.“
Albertina nickte und zeigte wieder auf das Manuskript.
„Und hier steht, wie die Alchemie funktioniert?“
„In der Smaragdenen Tafel geht es zwar um die Alchemie, aber eher um die allgemeinen Prinzipien des hermetischen Wissens.“ Tomás nahm das betreffende Werk zur Hand und las die ersten Zeilen daraus vor: „Verum, sine mendatio, certum et verissimum. Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab Uno, mediatione unius, sic omnes res natæ fuerunt ab bac una re, adaptatione.“
Albertina lachte.
„Professor, ich verstehe kein Wort. Mein Latein ist etwas eingerostet, wissen Sie?“
„,Wahrhaftig, ohne Täuschung, gewiss und wahrheitsgetreu: Was unten ist, gleicht demjenigen, das oben ist, und was oben ist, wiederum demjenigen, das unten ist, auf dass sie gemeinsam das Wunder des Einen Dinges vollbringen. Und ebenso wie alles aus dem Einen entstammt: ebenso werden auch alle Dinge aus diesem Einen Ding in gleicher Art und Weise gezeugt.’“
„Ich verstehe immer noch nicht …“
„Wie gesagt, haben wir es mit einer Geheimlehre zu tun“, erklärte Tomás, während er das Manuskript wieder in seiner Aktentasche verstaute. „Die Bedeutung des zweiten und dritten Satzes ist zweideutig, aber Hermes Trismegistos scheint damit sagen zu wollen, dass die Wirklichkeit einzigartig ist und die Unterschiede zwischen den Atomen, uns und den Sternen eine Illusion sind. Wir sind alle Teile einer großen Einheit. ,Was unten ist, gleicht demjenigen, das oben ist, und was oben ist, wiederum demjenigen, das unten ist.‘ Alles, uns Menschen eingeschlossen, ist ,das Eine Ding‘, weil ,alle Dinge aus diesem Einen Ding in gleicher Art und Weise gezeugt werden‘. Mit anderen Worten, der Eindruck, wir seien unabhängige Individuen, ist nichts als eine Täuschung. In Wirklichkeit ist alles mit allem verbunden, alles ist Teil des Ganzen, alles ist eins.“
Als Tomás die grundlegenden Aussagen des Hermes Trismegistos genauer erläutern wollte, ging die Tür auf, und eine Mitarbeiterin reichte Albertina einen Umschlag, der gerade mit der Post gekommen war. Die Sekretärin warf einen Blick auf die Anschrift und wandte sich an ihren Chef.
„Professor, das ist für Sie.“
„Ah, das muss das Buch über die althebräische Schrift sein, das ich bestellt habe. Kommt es aus Jerusalem?“
Albertina betrachtete den Umschlag.
„Es steht kein Absender darauf, Professor. Aber den Briefmarken nach zu urteilen, kommt es aus der Schweiz.“
Tomás zog die Augenbrauen hoch.
„Aus der Schweiz?“, fragte er und nahm Albertina den Umschlag ab. „Aber da war ich doch gerade erst.“
Die Sekretärin legte den Kopf schief und lächelte vielsagend.
„Bestimmt haben Sie dort eine neue Verehrerin …“
II
Ein violetter Streifen zeigte sich am Morgenhimmel über Bethesda, vor dem sich die großen amerikanischen Rotkiefern abzeichneten. Die Sonne bereitete sich darauf vor, die Nacht zu vertreiben, aber Walter Halderman war noch nicht einmal zu Bett gegangen. Er hatte die letzten acht Stunden damit verbracht, einen Bericht, den er noch am Morgen ans Weiße Haus schicken musste, zu schreiben und zu überarbeiten. Er war überzeugt davon, dass sein Einsatz für die Agency eines Tages erkannt und entsprechend belohnt würde.
Sein Mobiltelefon klingelte.
Es war viel zu früh für ein übliches Gespräch, aber Halderman war nicht überrascht. Er glaubte zu wissen, woher der Anruf kam, und ein Blick auf die Anzeige bestätigte ihm, dass er recht hatte.
„Halderman.“
„Guten Morgen“, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. „Entschuldigen Sie bitte die Störung zu dieser frühen Stunde, aber unser Mann an der Botschaft von Bern sagt, es sei dringend und er müsse Sie sprechen.“
„Stellen Sie ihn durch.“
Wenige Augenblicke später meldete sich eine neue Stimme.
„Hallo?“
„Hier ist Halderman, stellvertretender Leiter der Direktion für Wissenschaft und Technik der CIA. Sie wollen mich dringend sprechen?“
„Ja, genau. Ich bin Paul Zelazny von der Informationsabteilung der amerikanischen Botschaft in Bern. Die Genfer Polizei hat mir gerade eine schlechte Nachricht übermittelt. Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass vor ungefähr einer halben Stunde Ihr Direktor, Frank Bellamy, unter … wie soll ich sagen … merkwürdigen Umständen tot aufgefunden wurde.“
„Frank Bellamy ist tot?“
„Ja.“
Halderman ballte die Hand zur Faust.
„Wie?“
Sein Gesprächspartner atmete tief ein und seufzte.
„Seine Leiche wurde im CERN gefunden, in einem riesigen Teilchenbeschleuniger. Es scheint, als sei er erstickt. Die Polizei hat mit den Untersuchungen begonnen und glaubt, es handelt sich um Mord.“
„Mord? Was veranlasst Sie zu dieser Annahme?“
„Nun, man hat mir gesagt, dass Frank Bellamy einen Zettel mit dem Namen seines Mörders hinterlassen habe.“
„Tatsächlich? Wer ist es?“
„Der Mörder soll ein gewisser Thomas Norona sein. Sagt Ihnen das was?“
„Thomas Norona? Nicht vielleicht Tomás Noronha?“
„Ja, gut möglich.“
„Den kenne ich. Hat die Polizei ihn schon verhaftet?“
„Sie ist an der Sache dran.“
Halderman schaute kurz auf seine Uhr. Es war beinahe 6 Uhr morgens.
„Hören Sie, Herr …“
„Zelazny. Paul Zelazny.“
„Hören Sie, Paul. Sobald Ihnen eine Kopie der Notiz vorliegt, schicken Sie sie mir umgehend nach Langley. Ich will, dass sie auf meinem Schreibtisch ist, wenn ich ins Büro komme. Ich werde mich persönlich um die Angelegenheit kümmern. Danke für Ihren Anruf und schönen Tag noch.“
Ohne auf eine Antwort zu warten, legte Halderman auf. Er blickte aus dem Fenster und genoss die Schönheit des jungen Tages, ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen.
Jetzt, da Frank Bellamy beseitigt war, lag der Weg in eine goldene Zukunft endlich frei vor ihm.
III
Wer, zum Teufel, hatte ihm bloß diese Sendung geschickt, fragte sich Tomás, und das auch noch per Eilpost. Er betrachtete den Umschlag von allen Seiten, inspizierte die Briefmarken und den Poststempel und sah, dass er am Tag zuvor in einer Postfiliale in Genf abgegeben worden war.
„Was für ein Zufall …“
Dieses Timing überraschte ihn. Warum hatte der Absender ihm den Umschlag nicht persönlich übergeben? Vielleicht wusste er nicht, wo er ihn erreichen konnte? Das war jedenfalls die einzige einleuchtende Erklärung, die ihm in den Sinn kam. Dann riss er den Umschlag auf.
Als er den Inhalt herauszog, glaubte er zunächst, es handele sich um eine CD, doch kaum hatte er die Schutzfolie entfernt, erkannte er, was es war.
„Verdammt und zugenäht!“, entfuhr es ihm.
Eine Art großes Jojo aus Kupfer mit einem Rand aus Leder füllte seine gesamte Handfläche aus. Auf einer der beiden Seiten war eine geometrische Figur eingraviert, umgeben von einem Ring aus hebräischen und lateinischen Schriftzeichen. In ihrer Mitte war ein Davidstern mit vergoldetem Rand zu sehen.
Tomás’ erstaunter Gesichtsausdruck machte Albertina neugierig.
„Was ist los, Professor? Gibt es ein Problem?“
Der Historiker untersuchte das Objekt und dessen Verzierung. Dann wandte er sich an seine Sekretärin.
„Schauen Sie, man hat mir ein Pentakel geschickt.“
„Und was ist das?“
„Ein Pentakel ist ein Amulett, das für magische Beschwörungen verwendet wurde.“ Er fuhr mit dem Zeigefinger über die geometrischen Linien. Dann deutete er auf die Schriftzeichen המלש תתפמ oberhalb des großen Sterns. „Hier steht Maphteah Shelomo. Das ist Hebräisch. Ich nehme mal an, Ihr Hebräisch ist ähnlich gut wie Ihr Latein …“
Albertina lachte.
„Haargenau.“
„Nun, Maphteah Shelomo ist die hebräische Bezeichnung für die Clavis Salomonis, ein Handbuch für Magie, das üblicherweise dem König Salomon zugeschrieben wird.“ Er senkte geheimnisvoll die Stimme. „Das besagt zumindest die Legende. In Wahrheit ist die Clavis Salomonis im 14. und 15. Jahrhundert in Italien entstanden. Sie soll vielmehr von anderen magischen Schriften wie dem Lemegeton oder der Clavicula Salomonis Regis inspiriert sein.“
Albertina schaute etwas verwirrt.
„Aha, und wieso hat man Ihnen dieses Amulett geschickt?“
Tomás suchte auf der Verpackung nach einem Hinweis auf den Absender, schaute im Inneren des Umschlags nach einem Brief oder zumindest einer handschriftlichen Notiz, die ihm Aufschluss über die Herkunft des Amuletts geben konnte, aber vergeblich.
„Ich weiß es nicht“, gestand er. Doch dann kam ihm eine Idee. „Ah, es muss von Herrn Perrin stammen. Wer sonst sollte mir etwas Derartiges schicken?“
„Ist das einer Ihrer Bekannten?“
„Das ist der Antiquar, von dem ich die Tabula Smaragdina gekauft habe.“
„Und wieso sollte er Ihnen dieses Amulett schicken?“
„Ich habe nicht die geringste Idee“, antwortete er. „Vielleicht will er es verkaufen, und seine Taktik besteht darin, mich auf diese Weise neugierig zu machen.“
„Er hat Ihnen also eine Kopie geschickt?“
Das war eine gute Frage, dachte Tomás. Er begutachtete das Amulett aufmerksam. Er fühlte die Textur des Materials, roch daran, und fuhr über die lederne Einfassung. Es schien echt zu sein. Wenn es tatsächlich eine Kopie sein sollte, war sie jedenfalls hervorragend gemacht.
„Vielleicht, ich bin mir nicht sicher.“
Er dachte einen Moment lang nach. Warum um alles in der Welt hätte ihm der Antiquar ein Original geschickt, ohne eine Garantie, dass er es auch kaufen würde? Das ergab keinen Sinn, es musste einfach eine Kopie sein. Entschlossen steckte er das Pentakel in seine Hosentasche.
„Darum kümmere ich mich später. Ich werde die Jungs aus dem Labor nach ihrer Meinung fragen. Vielleicht können sie eine Radiokarbonanalyse oder etwas Ähnliches machen.“
„Aber wenn Sie doch gestern erst in Genf waren, warum hat der Antiquar Ihnen das Amulett nicht dort gegeben? Warum sollte er es Ihnen per Post schicken, und dann auch noch ohne eine Erklärung?“
„Das ist wirklich zu seltsam. Wie schon gesagt, es könnte eine Verkaufstaktik sein. Aber ich werde ihn einfach anrufen und fragen.“
Tomás suchte in seinem Notizbuch die Telefonnummer des Händlers, tippte sie umgehend auf der Tastatur seines Telefons ein und lauschte ungeduldig dem Freizeichen. Nach dem fünften Klingeln verkündete der Anrufbeantworter, dass leider gerade niemand erreichbar sei.
Notgedrungen beschloss Tomás, später eine Antwort auf all diese Fragen zu finden. Bis dahin hatte er genug andere Dinge zu erledigen.
Er startete sein E-Mail-Programm und beantwortete einige der Nachrichten. Anschließend loggte er sich in das Intranet der Stiftung ein, ging auf die Seite ,Berichte über Objektankäufe‘ und trug in der Rubrik ,Objekt‘ Tabula Smaragdina ein. Dann machte er sich daran, das Formular auszufüllen.
„Professor Noronha?“
Er war ganz in seine Arbeit vertieft und rief sich noch einmal alle Einzelheiten des Verhandlungsgesprächs in Erinnerung, die Werte seines ersten Angebots, den Gegenvorschlag des Händlers, die folgenden Argumentationen auf beiden Seiten, die …
„Professor Noronha?“
Tomás schaute Albertina abwesend an.
„Was ist?“
Die Sekretärin hielt ihren Telefonhörer in der Hand.
„Ein Anruf für Sie. Frau Sequeira aus Coimbra möchte Sie sprechen.“
Beim Anblick des Telefonhörers schossen Tomás im Bruchteil einer Sekunde gleich mehrere Gedanken durch den Kopf. Da war zunächst das Klingeln des Apparats, das zuvor gar nicht bis in sein Bewusstsein vorgedrungen war; dann die Erinnerung, dass er erst am Vortag, kaum dass er in Lissabon gelandet war, mit Maria Flor telefoniert hatte; er war es leid, ständig von einer Frau zur nächsten zu ziehen, er brauchte Ruhe und Beständigkeit, wollte mit ihr aber nichts überstürzen; der dritte Gedanke war fast lächerlich, wenn auch nicht ohne praktischen Hintergrund, nämlich, dass der Akku seines Handys leer war und er ihn schnellstmöglich aufladen musste, weil Maria Flor ihn sonst nur auf seiner Festnetznummer erreichen konnte.
Dann hatte er seine Lethargie überwunden und winkte seiner Sekretärin.
„Stellen Sie sie bitte durch.“
„Sofort.“
Bevor er antwortete, stand Tomás auf und schloss die Tür seines Büros.
„Hallo Flor“, sagte er sanft. „Sag mir nicht, dass du es kaum erwarten kannst, mein Geschenk zu öffnen, das ich dir …“
„Tomás“, fiel sie ihm mit nervöser Stimme ins Wort. „Setz dich hin und hör mir zu. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich.“
Bei diesen Worten hielt Tomás die Luft an. In Anbetracht der Umstände konnte nur seine Mutter gemeint sein. Sie lebte seit ein paar Jahren in dem Seniorenheim von Coimbra, das Maria Flor leitete, und ihr Ton verhieß nichts Gutes.
„Es geht um meine Mutter?“, fragte Tomás nach einer Schrecksekunde. Ihm zogen sich die Eingeweide zusammen. „Ist ihr etwas zugestoßen?“
Maria Flor schwieg einen Moment und suchte nach Worten.
„Deine Mutter hatte einen Herzinfarkt. Sie ist im Krankenhaus“, sagte sie so ruhig wie möglich. „Komm schnell her. Schnell, hast du gehört?“
Tomás saß wie betäubt da. Er hatte vor acht Jahren bereits seinen Vater verloren und wusste natürlich, dass er eines Tages auch seine Mutter verlieren würde. Dennoch hoffte er, die Dinge würden sich langsamer entwickeln, das Unvermeidliche könne sich noch aufschieben lassen.
„Sie hatte …“, stammelte er. Das schreckliche Wort wollte ihm nicht über die Lippen kommen. „Sie hatte einen …“
Er hörte ein resigniertes Seufzen.
„Sie liegt im Koma. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit.“
IV
Er hatte schon immer Schwierigkeiten damit gehabt, seine Krawatte ordentlich zu knüpfen, wie auch diesmal ein Blick in den Spiegel bestätigte. Er löste den Knoten und fing erneut an. Danach war er mit dem Ergebnis zufrieden. Er schaute auf seine Uhr. Fast 7 Uhr morgens.
Er nahm sein Mobiltelefon zur Hand und suchte in der Kontaktliste den Namen des Direktors der CIA. Als er ,Harry Fuchs‘ gefunden hatte, drückte er die Kurzwahltaste.
„Halderman, alter Gauner“, scherzte die Stimme am anderen Ende der Leitung. „Was verschafft mir das Vergnügen?“
„Bellamy ist tot.“
„Ich weiß. Gute Nachricht, nicht wahr? Diesen Dinosaurier brauchte die Agency schon lange nicht mehr.“
„Die Schweizer fahnden wegen Mordes, und das kann die Sache verkomplizieren. Glaubst du, die haben einen Verdacht?“
Die Antwort ließ einen Moment auf sich warten, als wählte der Direktor seine Worte mit besonderem Bedacht.
„Spielst du darauf an, dass mein Dienst den Alten liquidiert hat?“, fragte er enigmatisch. „Stell dir vor, dass ich mich auch schon gefragt habe, wer ein Interesse an seinem Verschwinden haben könnte. Und rate mal, wer mir zuerst eingefallen ist. Du!“
„Denk gar nicht daran, mir den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben!“, brauste Halderman auf. „Das steht außer Frage!“
„Irgendjemanden muss es wohl treffen, mein Lieber. Er ist getötet worden, soviel steht fest, aber ich habe schon vorgesorgt, um ruhig schlafen zu können.“
„Auch ich habe mein Alibi vorbereitet, also pass auf, was du tust und sagst, verstanden?“
Das Gespräch stockte kurz; beide Seiten versuchten, die Position des anderen zu durchschauen.
„Hör zu, der Zettel, den der Alte noch geschrieben hat, kann die Lösung des Problems sein“, schlug Fuchs in versöhnlichem Ton vor. „Hast du ihn schon gesehen?“
„Die Botschaft in Bern hat ihn mir ins Büro geschickt, wo er auf mich wartet. Was hast du vor?“
„Auf dem Zettel steht ein Name, nicht wahr? Das ist ein Glückstreffer! Diesen Typen müssen wir unbedingt zu fassen kriegen. Weißt du, wer er ist?“
„Ja, ein portugiesischer Geschichtsprofessor und Kryptologe, der schon für uns gearbeitet hat, wenn auch unfreiwillig. Ganz schön ausgebufft, sag ich dir. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen.“
„In Acht nehmen? Machst du Witze? Seit wann versetzt irgendein kleiner Professor die CIA in Angst und Schrecken?“
„Erinnerst du dich nicht, dass er die Ajatollahs im Iran ordentlich ausgetrickst hat?“
„Die Iraner? Warte mal, sag mir nicht, dass das dieser Portugiese ist, der …“
„Doch, genau der. Die Sache war damals top secret, und es ging um die nationale Sicherheit. Das ist ein cleveres Kerlchen, sag ich dir. Den sollten wir nicht unterschätzen.“
„Okay, okay… Ich frage mich nur, was sein Name auf dem Zettel zu suchen hat.“
„Ich habe mir auch schon das Hirn zermartert. Bellamy war zwar nicht gerade nett zu ihm, aber ich weiß, dass er ihn respektiert hat. Warum in drei Teufels Namen hat er kurz vor seinem Tod noch an ihn gedacht?“
Fuchs machte eine kurze Pause. Dann hatte er eine Idee.
„Schick mir eine Kopie dieses Zettels, sobald du im Büro bist“, sagte er bestimmt. „Ich schicke ein Sonderkommando los und werde ihn brauchen.“
„Einverstanden.“
„Und mach dir keine Sorgen. Ich werde schon dafür sorgen, dass das nicht auf uns zurückfällt, verlass dich auf mich.“
Sie legten auf. Halderman schaute wieder aus dem Fenster und war überrascht, wie schnell das Tageslicht die Landschaft verwandelt hatte. Dann zog er seinen Mantel an, nahm seine Aktentasche und warf einen Blick in den Spiegel. Sein ganzes Leben lang hatte er die Stiefel seiner Vorgesetzten geputzt und sich von den Mächtigen demütigen lassen. Jetzt, wo Bellamy von der Liste gestrichen war, lag nur noch ein letzter Schritt vor ihm, um Leiter der Direktion für Wissenschaft und Technologie der CIA zu werden. Wenn er die Karten geschickt spielte und Fuchs das tat, was er zu tun hatte, wären alle Hindernisse beseitigt, und er könnte den Platz des verstorbenen Leiters übernehmen. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare und ging zur Tür. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Alles lief bestens, der Portugiese hatte den Schwarzen Peter gezogen.
V
Langsam öffnete Tomás die Autotür und ließ sich in den Fahrersitz fallen. Dann startete er den Wagen. Mit einem Kloß im Hals rollte er vom Parkplatz der Stiftung und fädelte sich in den Straßenverkehr Lissabons ein, um so schnell wie möglich auf die Autobahn in Richtung Norden zu kommen.
Während der zweistündigen Fahrt nach Coimbra wiederholte Tomás in einer Art Endlosschleife sein Gespräch mit Maria Flor. Er versuchte ein ums andere Mal, den Ton ihrer Stimme zu interpretieren, um vielleicht herauszuhören, ob noch Hoffnung bestand. Doch die vernichtenden Worte ,Herzinfarkt‘ und ,Koma‘ holten ihn stets auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Zeit drängte.
Koma. In ihrem Alter bedeutete dies höchstwahrscheinlich, dass sie dem Tod nahe war. Vielleicht war es sogar schon zu spät. Er würde es noch nicht einmal sofort erfahren, da er ja am Abend zuvor vergessen hatte, den Akku seines Handys aufzuladen.
„Was bin ich nur für ein Idiot!“, schimpfte er und versetzte dem Lenkrad einen Schlag.
Er wollte mit Maria Flor sprechen, wollte wissen, wie es seiner Mutter ging und was die Ärzte über ihren Zustand dachten. Er wollte seiner Mutter noch einmal nahe sein und sich von ihr verabschieden, auch wenn sie ihn nicht mehr hören können würde. Doch er saß im Auto und musste sich vor allem gedulden.
„Ich muss an etwas anderes denken“, murmelte er, „sonst werde ich noch verrückt.“
Das Pentakel. Er versuchte, sich vorzustellen, was der Antiquar sich dabei gedacht haben mochte, ihm das Amulett einfach so zu schicken. Er ging ein gewaltiges Risiko ein, denn niemand garantierte ihm, dass die Stiftung das Objekt tatsächlich kaufen würde. Wenn Tomás unehrlich wäre, könnte er es sogar für sich behalten, denn die Sendung war noch nicht einmal als Einschreiben geschickt worden. Es gab also keinerlei Nachweis, der belegte, dass er den Umschlag erhalten hatte.
War das Pentakel überhaupt echt? Er hatte zwar den Eindruck gehabt, aber das ergab keinerlei Sinn. Wieso hätte der Händler ihm ein solches Wertobjekt ohne jeglichen Kommentar schicken sollen, und das auch noch unversichert?! Es musste einfach eine Kopie sein. Die Laboranalyse der Stiftung würde es sicher bestätigen, doch würde dies bis zu seiner Rückkehr aus Coimbra warten müssen, wo seine Mutter …
,Sie liegt im Koma, und ihr bleibt nicht mehr viel Zeit.‘ Die letzten Worte von Maria Flor hallten in seinem Kopf wider. ,Sie liegt im Koma.‘ Was war inzwischen passiert? Und was genau bedeutete ,ihr bleibt nicht mehr viel Zeit‘? Ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage? Würde sie noch am Leben sein, wenn er endlich nach Coimbra käme?
„Ah, geht das schon wieder los!“, rief er ärgerlich und schlug erneut mit der flachen Hand aufs Lenkrad. „Ich werde diesen Gedanken einfach nicht los!“
Der Anblick der Stadt, die von der alten Universität überragt wurde, ließ ihn aufatmen. Bald würde er Coimbra erreichen.
Er stürmte die Stufen des Pflegeheims hoch und eilte die Gänge entlang, in denen es nach Desinfektionsmitteln roch. Gleich würde er endlich wissen, wie es um seine Mutter stand.
„Vierzehn … fünfzehn … sechzehn“, zählte er die Zimmernummern. „Hier ist es.“
Ohne zu klopfen, riss er die Tür auf und trat ein. Maria Flor saß am Fußende des Bettes, hübsch wie immer. Sie lächelte.
„Tomás!“, rief sie erleichtert aus. „Endlich!“
Mit unsicherem Blick näherte er sich dem Bett seiner Mutter. Als er sie sah, traute er seinen Augen nicht.
Sie lächelte.
„Mein Sohn. Schön, dich zu sehen.“
Den Blick fest auf seine Mutter geheftet, öffnete und schloss Tomás seinen Mund, ohne einen Ton zu sagen. Er hatte sich auf das Schlimmste vorbereitet, und jetzt lächelte sie ihn fröhlich an.
„Mutter“, sagte er schließlich. „Geht es dir gut?“
„Selbstverständlich“, antwortete sie. „Was machst du nur für ein Gesicht!“
Entgeistert schaute Tomás von seiner Mutter zu Maria Flor und versuchte, die Situation zu verstehen. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit.
„Du hattest also doch keinen … äh …“ Er zögerte, das verhasste Wort ,Herzinfarkt‘ auszusprechen. „… keine Schwierigkeiten?“
Graça Noronha verzog ihre Lippen und winkte ab.
„Oh, das war gar nichts“, sagte sie. „Maria Flor hat sich zwar Sorgen gemacht, aber um ehrlich zu sein, war das wohl ziemlich übertrieben. Viel Lärm um nichts.“ Sie drohte Maria Flor spielerisch mit dem Zeigefinger. „Wirklich übertrieben, glaub mir.“
,Übertrieben‘ schien auch Tomás der passende Ausdruck zu sein. Wie konnte sie ihn glauben machen, seine Mutter stünde kurz vor dem Tod, wenn sie nur zwei Stunden später offenbar in bester Verfassung war? Er warf Maria Flor einen tadelnden Blick zu, dass sie ihm einen unnötigen Schrecken eingejagt hatte.
Doch die junge Heimleiterin ließ sich nicht beeindrucken. Sie stand auf und sagte zu Tomás: „Kann ich kurz mit dir sprechen?“
Sie verließen das Zimmer und suchten einen Ort, an dem sie ungestört miteinander reden konnten.
„Deine Mutter hat sich heute früh nicht wohl gefühlt und wenig später das Bewusstsein verloren“, begann Maria Flor. „Während die Pfleger versucht haben, sie wiederzubeleben, habe ich den Notarzt gerufen, der einen Herzinfarkt diagnostiziert hat. Daraufhin haben wir sie umgehend ins Krankenhaus gebracht, und der diensthabende Kardiologe hat sie sofort in den Schockraum gebracht. In der Zwischenzeit habe ich mehrmals versucht, dich auf dem Handy zu erreichen, aber es war immer nur der Anrufbeantworter dran.“
„Ja, tut mir schrecklich Leid, ich hatte vergessen, den Akku …“
„Nach einer Viertelstunde kam Doktor Colaço zu mir und bestätigte, dass deine Mutter einen Herzinfarkt hatte“, fuhr sie fort. „Die Versuche, sie zu reanimieren, waren ohne Erfolg geblieben. Doktor Colaço sagte, sie sei eigentlich schon gestorben, auch wenn er den Tod noch nicht offiziell bestätigen könne. Er sagte, das Herz habe aufgehört zu schlagen, und das Elektroenzephalogramm sei schon seit ein paar Minuten flach. In dem Moment kam eine Krankenschwester auf ihn zugestürzt und rief ,Doktor Colaço, kommen Sie, schnell!‘ Ich stand also wieder allein auf dem Flur, und mir war klar, dass ich unbedingt mit dir sprechen musste. Deshalb habe ich in der Stiftung angerufen. Eigentlich wollte ich dir schon sagen, dass deine Mutter tot sei, habe es aber nicht über mich gebracht. Und letztlich hatte ich auch noch einen Funken Hoffnung. Jedenfalls habe ich es vorgezogen, dir zu sagen, sie liege im Koma.“
Tomas zeigte in Richtung des Zimmers seiner Mutter.
„Aber ganz offensichtlich ist sie nicht tot …“
„Stimmt, aber bitte vergiss nicht, dass deine Mutter technisch gesprochen bereits tot war und dann wieder zurück ins Leben kam“, beharrte Maria Flor. „Es ist wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, wenn du mit ihr sprichst, verstehst du?“
„Heißt das, dass ihr Gehirn Schaden genommen hat?“
„Nicht wirklich. Sie macht vielmehr einen klareren Eindruck als vorher. Auch ihr Sprachvermögen hat sich anscheinend verbessert, und ich würde fast sagen, dass es deiner Mutter für jemanden, der schon seit einigen Jahren an Alzheimer leidet, ungewöhnlich gut geht.“
„Aber das sind ja … großartige Neuigkeiten!“
„Sicher, aber denk daran: Sie war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Vergiss das nicht, hörst du?“
Tomás schürzte die Lippen.
„Was willst du mir damit sagen? Wenn sie klarer im Kopf ist als sonst und wenn ihr Sprachvermögen sich verbessert hat, worin genau besteht das Problem?“
Maria Flor atmete tief durch.
„Wenn du mit ihr sprichst, wirst du es verstehen …“
Als sie wieder ins Zimmer kamen, lag seine Mutter nach wie vor im Bett. Auf ihrem Gesicht lag ein unverändert glückliches Strahlen. Sie schien ihren Frieden gefunden zu haben.
„Nun, mein Sohn, wie geht es dir?“, fragte sie. „Reist du immer noch um die ganze Welt?“
„Ja. Ich bin erst gestern von meiner letzten Reise zurückgekehrt.“
„Erzähl mir bloß nicht, dass du wieder in einem dieser Länder warst, wo alle Nase lang eine Bombe explodiert und die Leute anderen den Kopf abschneiden“, begann sie mit sorgenvoller Stimme ihre übliche Litanei. „Wann kommst du nur endlich zur Vernunft, Junge? Dein Vater hat mir aufgetragen, gut auf dich aufzupassen, aber du weißt, ich bin alt und habe nicht mehr die Kraft, dir zu helfen …“
„Mach dir keine Sorgen um mich“, entgegnete Tomás und versuchte, das Thema zu wechseln. Er streichelte ihre Hand. Sie war erstaunlich warm und weich. „Und du, wie geht es dir?“
Ein zufriedenes Lächeln erhellte erneut das Gesicht von Graça Noronha.
„Ausgezeichnet! Um ehrlich zu sein, geht es mir so gut wie schon lange nicht mehr.“
„Wirklich? Und wie kommt das?“ Er zwinkerte ihr zu. „Sag mir nicht, dass du heimlich Schokolade genascht hast.“
Seine Mutter lachte.
„Was für eine Idee! Es geht mir gut, weil ich deinen Vater gesehen habe, endlich wieder, nach all den Jahren. Du weißt, wie sehr er mir fehlt. Ihm geht es übrigens auch gut.“
„Ach, ja? Hast du die alten Fotoalben angeschaut?“
Graça schaute ihn mit großen Augen an.
„Wieso Fotoalben? Ich war bei ihm, ich habe ihn gesehen. Wir haben sogar ein wenig zusammen gesprochen.“ Sie seufzte. „Schade nur, dass es so schnell vorbei war …“
„Ja, die schönsten Träume sind immer viel zu schnell vorbei. Dabei hätte man so gern, dass sie noch länger dauern, dass sie nie zu Ende gehen.“
„Aber was redest du da!“, ereiferte sich seine Mutter. „Ich sage es dir noch mal: Ich war wirklich bei deinem Vater. Glaubst du mir etwa nicht?“
Tomás streichelte seiner Mutter erneut die Hand. Alzheimer war für die Angehörigen so schwer zu ertragen.
„Mutter“, setzte er an. „Vater ist nicht mehr bei uns. Er ist vor einigen Jahren gestorben, weißt du nicht mehr?“
„Natürlich weiß ich das. Ich erinnere mich noch haargenau an seine Beisetzung. Aber ich sage dir, dass ich gerade eben bei ihm war.“
„Gerade eben?“
„Heute morgen, vor etwa zwei Stunden.“
Tomás tauschte einen erstaunten Blick mit Maria Flor, die wieder auf dem Stuhl am Fußende des Bettes saß. Sie zuckte mit den Achseln, als wollte sie sagen, ,Ich habe dich gewarnt.‘
„Es war wundervoll“, murmelte Graça. Ein Leuchten erhellte ihre grünen Augen. „Ich bin gestorben und habe deinen Vater getroffen … Es war wundervoll.“
VI
,Tomás Noronha‘ stand unübersehbar auf dem Deckblatt der Akte mit dem Vermerk top secret unter dem Logo der CIA, die seine Sekretärin ihm auf den Tisch legte.
„Das ist alles, was wir über ihn haben, Sir.“
„Sind das die Unterlagen, die Halderman geschickt hat?“
Die Sekretärin öffnete die Akte.
„Ja, Sir.“
Harry Fuchs schaute den Ausdruck aufmerksam an.
„Das ist also die Spur, die der Alte hinterlassen hat?“, sagte er mit einem hinterhältigen Lächeln. „Den Namen dieses Tomás Noronha und eine Art Kreuz.“ Er wiegte den Kopf, zufrieden mit dem, was er sah. „Ausgezeichnet.“
„Ist das alles, Sir?“
Der Direktor nahm die Akte zur Hand und betrachtete ihren Inhalt. Auf der ersten Seite blickte ihm der portugiesische Historiker entgegen, der lächelnd in die Kamera schaute.
„Noch etwas, Tish“, sagte Fuchs. „Rufen Sie unseren Mann in der Botschaft von Lissabon an. Es ist dringend.“
„Sofort, Sir.“
Die Sekretärin verließ das Büro und schloss die Tür. Harry Fuchs las derweil den Bericht über Noronhas unfreiwilligen Einsatz im Iran1. Dann nahm er die zweite Akte zur Hand, die von Frank Bellamy, und untersuchte die Liste der kleinen technischen Schätze, die die Direktion für Wissenschaft und Technologie ihren Geheimdienstagenten zur Verfügung stellte. Eine dieser Erfindungen, die der verstorbene Direktor nie mit seinen Kollegen geteilt hatte, war das Quantum Eye, das Quantenauge.
„Jetzt ist Schluss mit deinen kleinen Geheimnissen, alter Mistkerl“, murmelte Fuchs. „Wo du endlich die Radieschen von unten betrachtest, übernehme ich hier das Ruder.“
Sein Telefon klingelte.
„Ich habe unseren Mann in Lissabon in der Leitung, Sir“, teilte seine Sekretärin mit. „Er heißt James Krongard.“
Dann stellte sie das Gespräch durch.
„Mister Krongard“, sagte Fuchs anstelle einer Begrüßung. „Wir haben ein Problem mit der Installation, und ich will, dass Sie sich darum kümmern. Ich hoffe, Sie sind ein guter Klempner…“
„Genau deshalb bin ich hier, Sir. Worum geht es?“
„Die Zielperson heißt Tomás Noronha. Er hat in Genf den Verantwortlichen unserer Direktion für Wissenschaft und Technologie umgebracht. Man hat uns darüber informiert, dass dieser Verrückte sich in Lissabon aufhält. Kümmern Sie sich um ihn.“
„Wie soll ich mit der portugiesischen Polizei umgehen, Sir? Soll ich ihr die Information weitergeben und verlangen, dass sie den Fall unverzüglich übernimmt?“
„Ich will die Polizei nicht in die Sache hineinziehen. Und auch sonst niemanden außerhalb der Agency. Die Operation muss mit höchster Diskretion durchgeführt werden, und ich will, dass niemand außer Ihnen davon erfährt.“
„Aber Sir, unsere Politik in Portugal und den anderen NATO-Ländern war immer …“
„Dieser Hurensohn hat einen CIA-Direktor auf dem Gewissen!“, brüllte Fuchs. „Finden Sie, dass man den mit Samthandschuhen anfassen sollte? Ich nicht! Der Mistkerl muss für seine Tat bezahlen. Finden Sie ihn und machen Sie ihn dingfest.“
„Und danach? Soll ich ihn zu Ihnen schicken? In dem Fall müssten Sie ein Transportflugzeug autorisieren, das …“
„Ich kümmere mich um die Autorisation, verlassen Sie sich drauf“, fiel Fuchs ihm ärgerlich ins Wort. „Ich lasse Ihnen außerdem eine Akte und einen vertraulichen Befehl zukommen. Aber das ist nichts als Papier, verstehen Sie? Ich will nicht, dass unser Mann hier ankommt. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?“
Krongard zögerte erneut einen Moment lang.
„Äh … um ehrlich zu sein, nicht ganz. Könnten Sie es bitte etwas deutlicher formulieren, Sir?“
Harry Fuchs polterte los.
„Sind Sie bescheuert, oder wollen Sie mich verarschen? Nehmen Sie diesen Typen fest und lassen Sie ihn entwischen, verstanden? Dieser Drecksack hat einen von uns umgebracht, und ich will nicht, dass er hier herkommt, damit man ihn in Seidenpapier wickelt.“
Am anderen Ende der Leitung herrschte ungläubiges Schweigen.
„Ich soll ihn entwischen lassen?“, fragte Krongard schließlich.
Der CIA-Direktor seufzte gequält.
„Damit Sie ihn niederschießen können!“, zischte er in den Hörer. Seine Geduld war am Ende. „Ist Ihnen jetzt klar, was Sie zu tun haben?“
„Glasklar.“
VII
Im Gesicht von Graça Noronha spiegelte sich trotz der Falten ein engelsgleicher Ausdruck. Sie wirkte heiter, gelöst; sie sprach bedächtig, als genieße sie jedes Wort und jeden Gedanken. Dabei drückte sie sich so klar und verständlich aus wie schon lange nicht mehr.