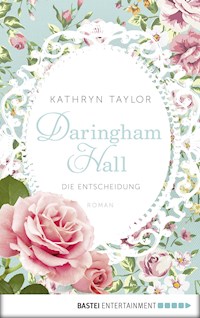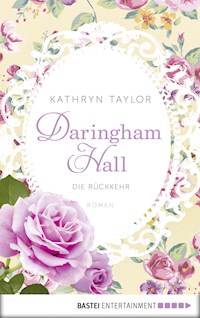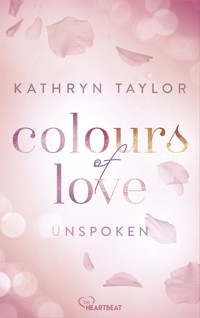7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colours of Love
- Sprache: Deutsch
Sophie Conroy trifft in der Ewigen Stadt Rom auf den attraktiven Kunstprofessor Matteo Bertani. Diese überraschende Begegnung erschüttert ihr ganzes Leben. Matteo lässt die junge Britin Dimensionen der Lust entdecken, die für sie bisher undenkbar waren. Schon bald droht Sophie sich rettungslos in ihren Gefühlen zu verlieren - und ignoriert alle Bedenken. Aber als Matteo trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft seltsam distanziert bleibt, muss sie sich fragen, ob sein Herz frei für sie ist.
Sinnlich, emotional und voller Leidenschaft: Die COLOURS OF LOVE Reihe von Kathryn Taylor macht süchtig!
Die Romane der Reihe:
Colours of Love - Entfesselt
Colours of Love - Entblößt
Colours of Love - Erlöst (Kurzgeschichte)
Colours of Love - Verloren
Colours of Love - Verführt
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Weitere Titel der Autorin
Colours of Love – Entfesselt
Colours of Love – Entblößt
Colours of Love – Verführt
Colours of Love – Erlöst
Dunmor Castle – Das Licht im Dunkeln
Dunmor Castle – Der Halt im Sturm
Wo mein Herz dich findet
Wildblumensommer
Mission Mistelzweig
Daringham Hall – Das Erbe
Daringham Hall – Die Entscheidung
Daringham Hall – Die Rückkehr
Über dieses Buch
Sophie Conroy trifft in der Ewigen Stadt Rom auf den attraktiven Kunstprofessor Matteo Bertani. Diese überraschende Begegnung erschüttert ihr ganzes Leben. Matteo lässt die junge Britin Dimensionen der Lust entdecken, die sie bisher für undenkbar gehalten hätte. Bald droht Sophie sich rettungslos in ihren Gefühlen zu verlieren – und ignoriert alle Bedenken. Aber als Matteo trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft seltsam distanziert bleibt, muss sie sich fragen, ob sein Herz frei für sie ist.
Über die Autorin
Kathryn Taylor begann schon als Kind zu schreiben – ihre erste Geschichte veröffentlichte sie mit elf. Von da an wusste sie, dass sie irgendwann als Schriftstellerin ihr Geld verdienen wollte. Nach einigen beruflichen Umwegen und einem privaten Happy End erfüllte sich mit dem Überraschungserfolg von Colours of Love – Entfesselt ihr Traum. Spätestens mit ihrer Trilogie Daringham Hall über große Gefühle auf einem englischen Landgut etablierte sie sich endgültig in der Riege sicherer Bestsellerautorinnen.
KATHRYN TAYLOR
COLOURSOFLOVE
VERLOREN
Digitale Neuausgabe
beHEARTBEAT in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2014 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Übersetzung des Gedichtes von John Keats stammt von Gisela Etzel, Leipzig: Insel, 1910 [zit. n.d. Berliner Ausgabe 2013]
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by BBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covergestaltung: Sandra Taufer unter Verwendung von Motiven von © Phatthanit / shutterstock; Kawin K / shutterstock; tomertu / shutterstock; LI CHAOSHU / shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0296-6
be-heartbeat.de
lesejury.de
Für S. und C.Wo wäre ich, wenn ihr nicht wärt?
1
Ich schwebe. Und obwohl ich weiß, dass ich diesen Zustand dringend ändern muss, kann ich nicht. Noch nicht. Erst muss sich mein Herz wieder beruhigen, das beängstigend schnell schlägt. Aber ich dachte ja vor einer Sekunde noch, dass ich mir beim Sturz von der Treppe den Hals brechen werde.
Atmen wäre auch gut, tief durchatmen, weil mir nichts passiert ist. Geht nur gerade leider nicht. Ich scheine aus irgendeinem Grund vergessen zu haben, wie man seinen Brustkorb mit Luft füllt. Eigentlich kann ich nichts anderes tun, als den Mann anzustarren, der mit gerunzelter Stirn auf mich herunterblickt.
Das Licht der Abendsonne, die durch das Fenster hereinscheint, lässt seine dunkelblonden Haare golden schimmern, und das passt absolut perfekt zu seinen ungewöhnlichen Augen, die in einem warmen Bernstein-Ton leuchten. Und dieses Gesicht … wie gemeißelt, ehrlich. Hohe Wangenknochen, gerade Nase, geschwungene Lippen. Wie eine von diesen Männerstatuen aus Marmor, von denen es hier in Rom so viele gibt. Okay, seine Haare sind vielleicht ein bisschen zu lang, fallen ihm in die Stirn. Aber trotzdem … so wahnsinnig gut sieht doch in Wirklichkeit niemand aus. Was mich kurz befürchten lässt, dass ich vielleicht doch gefallen bin und längst im Koma liege.
»Tutto a posto?«, fragt der Mann mit tiefer, sehr realer Stimme und wendet leicht den Kopf, um an mir herunterzusehen – vermutlich um sich selbst davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist mit mir. Und als er das tut, bemerke ich eine Narbe seitlich an seinem Hals. Sie ist gezackt und hell und beginnt tief, kurz über dem Schlüsselbein. Sehen, wie weit sie sich über seine Brust zieht, kann ich nicht, weil sie im offenen Kragen seines weißen Hemdes verschwindet, aber die entsprechende Wunde ist keine Kleinigkeit gewesen. Irgendwas muss ihn da mal übel erwischt haben. Die Narbe entstellt ihn allerdings nicht. Sie macht ihn eigentlich nur – echter.
Er ist ja auch echt, Sophie, erinnere ich mich, und schlucke, als das Gefühl, das mir der Schock kurzfristig geraubt hat, mit einem Schlag in meinen Körper zurückkehrt. Plötzlich spüre ich deutlich die großen Hände des Mannes im Rücken, die mich halten, und merke zum ersten Mal, dass ich meine eigenen Hände aus Reflex in den Ärmel und das Revers seines beigefarbenen Anzugsakkos gekrallt habe.
Und erst jetzt, mit einigen Sekunden Verzögerung, wird mir wirklich klar, was passiert ist und wie leichtsinnig es von mir war, mich auf der Treppe auf Zehenspitzen zu stellen, ohne mich festzuhalten. Ich wollte mir das Bild genauer ansehen, das an der Wand hängt, doch als ich dann noch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht habe, bin ich auf den Stoff meines langen Kleides getreten, umgeknickt und gefallen. Und jetzt liege ich in den Armen dieses Mannes, der hinter mir die Treppe raufgegangen ist und mich zum Glück aufgefangen hat, bevor irgendetwas Schlimmes passieren konnte. In den Armen dieses fremden Mannes, dem ich verstörend nah bin und der mir problemlos tief in mein Dekolletee blicken kann. Was mich endlich wieder zu Atem kommen lässt.
»Ja, alles in Ordnung«, murmele ich und versuche, mit brennenden Wangen zurück auf die Füße zu kommen. Er hilft mir dabei, doch als ich stehe, hält er mich weiter an den Oberarmen fest, so als würde er mir nicht zutrauen, dass ich das auch alleine kann. Eine korrekte Einschätzung, leider, denn ich fühle mich ganz schön zittrig. Neben uns gehen weitere Gäste die Treppe nach oben, wo der Empfang bestimmt schon in vollem Gange ist, und sehen mich und ihn neugierig an.
Na super, Sophie, denke ich, frustriert darüber, dass dieser wichtige Abend gleich mit so einem peinlichen Ausrutscher anfängt. Ich kann gar nicht sagen, was mich mehr aus der Bahn geworfen hat – der Sturz an sich oder die Tatsache, dass ich überhaupt gefallen bin. So was passiert mir sonst nie. Ich bin nicht tollpatschig und ich gehöre auch nicht zu diesen Frauen, die Männern gerne hilflos in die Arme sinken – ganz sicher nicht. Das lag nur an dem Kleid, dessen dünne Träger ich unglücklich wieder zurechtrücke, weil sie verrutscht sind.
Es ist eigentlich ein Traum – rot und lang und aus weich fallendem Chiffon. Deshalb konnte ich nicht widerstehen, als ich es heute Morgen in der Nähe der Via Nazionale in einer Boutique entdeckt habe. Zu Hause in London hätte ich so ein Modell wahrscheinlich nicht gekauft. Da trage ich zu solchen geschäftlichen Terminen eher schlichte, elegante Etuikleider oder Kostüme, von denen ich auch welche mithabe. Aber hier in Rom kamen mir die alle so langweilig vor. Und außerdem war es auf einen wirklich erschwinglichen Preis heruntergesetzt, und ich fand, dass das Rot sehr gut zu meinen dunklen Haaren passt, deshalb musste ich es einfach haben. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich der ungewohnt lange Rock als eine so üble Stolperfalle erweisen würde.
»Sie können mich jetzt loslassen«, sage ich einen Hauch zu ungehalten zu dem Mann, der mich interessiert betrachtet, und schiebe schnell ein freundlicheres »Danke« hinterher. Er kann schließlich nichts dafür, dass ich mich über meine eigene Ungeschicklichkeit ärgere. Außerdem schulde ich ihm wirklich was. Ich hätte mir übel wehtun können bei dem Sturz, den seine schnelle Reaktion verhindert hat.
Erst dann fällt mir auf, dass ich das alles auf Englisch gesagt habe und er mich vielleicht gar nicht verstanden hat. Auch wenn er nicht aussieht wie der typische Italiener, sagt mein Gefühl mir, dass er einer ist – seine Aussprache klang gerade nämlich ziemlich authentisch. Doch als ich ansetzen will, den Satz – zur Sicherheit – noch einmal in der Landessprache zu wiederholen, lächelt er, was ein extrem attraktives Grübchen auf seiner rechten Wange erscheinen und mich schon wieder starren lässt.
»Auf Ihre Verantwortung«, sagt er in lupenreinem Englisch – so viel dazu – und nimmt die Hände von meinen Armen. Dann bückt er sich und hebt meine Clutchbag auf, die auf den Stufen liegt. Er reicht sie mir und beugt sich leicht vor, und jetzt, wo ich wieder atme, nehme ich den Duft seines Aftershaves wahr, das herb ist und sehr angenehm und mir ein bisschen zu Kopf steigt. »Passen Sie nur auf«, fügt er hinzu und sein ohnehin schon sehr charmantes Lächeln vertieft sich. »Kunst ist etwas Wunderbares, aber Ihr Leben sollten Sie dafür nicht riskieren.«
Er flirtet mit mir, das ist ziemlich eindeutig, und ich bin anfälliger dafür als sonst, wahrscheinlich weil mir der Schock noch so in den Gliedern sitzt. Deshalb bin ich froh, dass er von sich aus einen Schritt zurücktritt und nach oben zu dem Bild an der Wand sieht, das ich gerade so intensiv betrachtet habe. Offenbar will er sich davon überzeugen, was es war, das meinen Fast-Sturz verursacht hat. Als ich seinem Blick folge, spüre ich, wie mich erneut Aufregung erfasst.
Das Bild ist eins von vielen Kunstwerken – Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen –, die die Eingangshalle schmücken. Jedes einzelne lässt mein Herz höher schlagen, aber das da oben hat es mir ganz besonders angetan. Wenn es das ist, was ich vermute, dann hat sich der weite Weg von London nach Rom schon gelohnt.
»Ich schätze, das verstehen Sie nicht, aber Kunst ist mein Leben«, erkläre ich dem Mann lächelnd, ohne den Blick von dem Bild zu wenden. »Und für einen Joseph Severn muss man schon mal was riskieren.«
Ganz sicher bin ich natürlich nicht, dafür müsste ich das Gemälde genauer in Augenschein nehmen. Aber ich könnte schwören, dass es von dem englischen Maler stammt, an den man sich vor allem deshalb erinnert, weil er der beste Freund von John Keats war, einem der bedeutendsten Dichter der englischen Romantik – und meinem Lieblingsdichter. Niemals hätte ich erwartet, hier, in dieser Villa in Rom, ein Bild von Severn zu finden, aber es steigert meine Vorfreude auf das, was ich vielleicht noch entdecken werde.
Oh, hoffentlich klappt es, denke ich und schicke schnell ein Stoßgebet zum Himmel, dass unser Auktionshaus den Zuschlag erhält und wir die Kunstwerke aus diesem Haus versteigern dürfen. Nicht, dass es uns schlecht ginge, das nicht. Aber wir erholen uns gerade von einem schwierigen finanziellen Engpass und können einen neuen, attraktiven Auftrag sehr gut gebrauchen. Die Lage auf dem Kunstmarkt ist derzeit generell angespannt, und ohne interessante Angebote, die Bieter anlocken, funktioniert es nun mal nicht. Außerdem könnten wir unsere Kontakte nach Italien dadurch endlich entscheidend auszubauen – eine Gelegenheit, auf die ich schon lange warte. Auf internationaler Ebene müssen wir nämlich unbedingt aktiver werden, damit uns die Konkurrenz auf Dauer nicht übertrumpft. Nur wie soll das gehen, wenn Dad und ich nie länger als ein paar Tage von zu Hause weg sein können?
Hastig beiße ich mir auf die Lippe und zwinge meine Gedanken in andere Bahnen. Weil ich weiß, dass es ungerecht ist, und weil ich Selbstmitleid hasse. Die Dinge sind nun mal, wie sie sind, und es hilft nichts, darüber zu jammern.
Mit einem leisen Seufzen wende ich mich wieder dem Mann zu, der auf meine Bemerkung noch nichts gesagt hat. Er betrachtet wieder mich, und der Ausdruck in seinen Augen ist anders. Sein Interesse, das vorher trotz seines strahlenden Lächelns eher beiläufig war, ist jetzt echt, das spüre ich – und mein Herz klopft ein kleines bisschen schneller, als unsere Blicke sich begegnen. Es würde helfen, wenn ich ihn nicht so attraktiv fände. Aber zum Glück habe ich jahrelange Übung darin, mir nicht anmerken zu lassen, wie es tatsächlich in mir aussieht, deshalb kann ich das hoffentlich verbergen.
»Sie kennen sich mit Kunst aus?« Es ist eher eine Feststellung als eine Frage.
»Eine Grundvoraussetzung für meinen Beruf, ja«, bestätige ich ihm.
Im ersten Moment überrascht das viele. Offenbar trauen sie einer Fünfundzwanzigjährigen auf diesem Gebiet nicht unbedingt viel Wissen zu. Aber wenn man wie ich zwischen Gemälden und Skulpturen aller Art aufgewachsen ist und das Familieneinkommen davon abhängt, diese richtig zu bewerten und einzuschätzen, dann lernt man das schnell. Wo andere Kinder über Ausmalbüchern saßen, hat mein Vater mir die Pinselführung von van Gogh erklärt, und ich konnte die Unterschiede zwischen Impressionisten und Expressionisten aufzählen, bevor ich lesen konnte. Die Kunst hat also schon immer mein Leben bestimmt. Und wenn es nach mir geht, dann bleibt das auch so.
Aber dann erkenne ich, dass der Mann gar nicht überrascht guckt. Eher grimmig. Sein eben noch herausforderndes Lächeln ist jedenfalls verschwunden. Stattdessen ist die Stirnfalte von eben wieder zu sehen, steiler als zuvor, was mich irritiert.
»Was machen Sie denn beruflich?«, will er wissen.
Ich registriere erst jetzt, wie groß er ist. Er überragt mich ein Stück, dabei steht er eine Stufe unter mir, und unter seinem feinen hellen Anzug und dem offenen weißen Hemd, das er trägt, hat er breite Schultern und eine Figur, die durchtrainiert wirkt. Deshalb konnte er mich wahrscheinlich auch so problemlos auffangen. Ich schlucke. Beeindruckendes Gesamtpaket, wirklich. Wenn er mich mit diesen ungewöhnlichen Bernstein-Augen nur nicht die ganze Zeit so intensiv fixieren würde …
Reiß dich zusammen, Sophie, ermahne ich mich. Seit wann lässt du dich von einem Mann so aus dem Konzept bringen? Ich räuspere mich, um endlich auf die Frage zu antworten und mich ihm vorzustellen.
»Ich führe zusammen mit meinem Vater ein Auktionshaus in London. Ich bin …«
»Sophie Conroy«, beendet der Mann den Satz für mich, als ich gerade die Hand ausstrecken will, um ihn zu begrüßen.
Es ist wieder eine Feststellung. Und es klingt wie ein Vorwurf.
2
Ich lasse meine Hand wieder sinken, sehe ihn verwirrt an.
»Kennen wir uns?« Hektisch überprüft mein Gehirn jeden Winkel meiner Erinnerung. Kann ich diesem Mann schon mal irgendwo begegnet sein – und weiß es nicht mehr? Nein. Unmöglich. Ich hätte ihn nicht vergessen, ganz sicher nicht.
Er schüttelt den Kopf, was mich ziemlich erleichtert. Dement bin ich also noch nicht. Doch dann setzt meine Verwirrung sofort wieder ein. Wenn er mir noch nie begegnet ist, wieso sieht er dann so aus, als bereue er zutiefst, ausgerechnet mich vor einem Treppensturz bewahrt zu haben?
Ich will ihn das fragen und ich will auch noch mehr wissen, zum Beispiel, wer er eigentlich ist, doch ich komme nicht mehr dazu, weil wir unterbrochen werden.
»Matteo?«
Die Stimme kommt von oben, und als wir beide aufblicken, steht eine dunkelhaarige Frau am Treppenabsatz. Sie sieht sehr gut aus und trägt zu ihrem smaragdgrünen Abendkleid teuren Brillantschmuck, gehört also offenbar zu den betuchteren Gästen.
»Da bist du ja endlich«, ruft sie dem Mann auf Italienisch zu – ich verstehe diese Sprache besser, als ich sie spreche – und lächelt mich entschuldigend an. »Kommst du?«
Der Mann – Matteo heißt er also – hat es plötzlich sehr eilig.
»Entschuldigen Sie mich.« Er knurrt es fast und wirft mir noch einen letzten langen Blick zu, den ich überhaupt nicht deuten kann. Dann eilt er die Treppe rauf, nimmt die Stufen dabei so schwungvoll, dass er wenige Augenblicke später bei der Frau im grünen Kleid ist. Er begrüßt sie mit einer festen Umarmung, nicht mit den sonst hier üblichen Wangenküssen, und sie strahlt ihn an, offenbar überglücklich, ihn zu sehen.
Sie ist älter als er – ich schätze ihn auf Anfang, sie eher auf Ende dreißig –, und ich frage mich unwillkürlich, ob die beiden wohl ein Paar sind. Müssen sie eigentlich, sie wirken jedenfalls sehr vertraut miteinander.
Die Frau blickt noch einmal neugierig nach unten zu mir und sagt etwas, wahrscheinlich erkundigt sie sich, wer ich bin. Doch der Mann winkt nur unwillig ab, ohne noch mal zu mir herunterzusehen, so als könnte ich unwichtiger gar nicht sein. Dann hakt er die Frau unter und zieht sie weiter, weg von der Treppe. Weg von mir.
Krass, denke ich, als die beiden aus meinem Blickfeld verschwunden sind. Der Kerl hat eigentlich kaum noch etwas gesagt, seit er erraten hat, wer ich bin. Trotzdem war die Botschaft eindeutig: Er will nichts mit mir zu tun haben. Und kein Wort der Erklärung, kein Wort darüber, wer er ist, nichts. Das war schon mehr als unhöflich. Und es erschüttert mich, obwohl ich es nicht will. Was um Himmels willen kann ich ihm denn nur getan haben?
Erst, als die nächsten Gäste an mir vorbeikommen – auf dem Weg nach oben, wie alle anderen –, wird mir klar, dass ich immer noch auf der Treppe stehe und dem Mann und der Frau hinterherstarre. Verärgert über mich selbst raffe ich meinen Rock und gehe – vorsichtiger diesmal und ohne Zwischenstopps – weiter die Treppe hinauf.
Dieser Abend ist wichtig, auch wenn er mit einem kleinen Fehltritt angefangen hat, und ich werde mir von diesem Mann nicht den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Keine Ahnung, was er für ein Problem hat – das muss mich nicht interessieren. Deshalb tue ich genau das, was ich getan hätte, wenn ich nicht gestürzt wäre: Ich nehme auch noch die übrigen Bilder in Augenschein, die im Treppenhaus hängen, versuche mich darauf zu konzentrieren, aus welcher Epoche sie stammen. Doch die Euphorie von vorhin will sich jetzt nicht mehr einstellen. Stattdessen erwische ich mich dabei, wie meine Gedanken immer wieder zurückwandern zu dem mysteriösen Matteo und seiner plötzlichen Feindseligkeit.
Weil ich das einfach nicht verstehe. Wir hatten im Auktionshaus seit längerer Zeit mit niemandem Ärger. Im Gegenteil. Unser Ruf ist ausgezeichnet, was wichtig ist in unserem Geschäft, deshalb kann es damit nicht zusammenhängen. Bleibt also nur, dass es an mir liegt. Doch was kann ich ihm getan haben, wenn wir uns – wie er selbst zugegeben hat – bis gerade nicht mal kannten? Ich bin sicher nicht der überschwängliche Typ, eher etwas reserviert, aber als unfreundlich würde mich wohl niemand bezeichnen. Was kann ihn also so gegen mich aufgebracht haben? Oder vielleicht interpretiere ich da auch etwas hinein. Vielleicht fand er mich ja einfach nur unattraktiv und langweilig und ist deshalb schnell geflüchtet?
Energisch verdränge ich das schale Gefühl, das dieser Gedanke in mir hinterlässt, und münze es in Zorn um. Schließlich brauche ich den Fehler nicht bei mir zu suchen, wenn dieser Kerl sich nicht benehmen kann. Und da ich sprunghafte Menschen ohnehin nicht leiden kann, ganz egal, wie attraktiv sie sein mögen, sollte ich wirklich lieber zusehen, dass ich …
Überrascht bleibe ich oben am Treppenabsatz stehen und vergesse für einen Moment meinen Sturz und alles, was danach passiert ist. Die beiden Räume, die sich vor mir öffnen – zwei ineinander übergehende große Salons, geschmackvoll mit Antiquitäten eingerichtet und wieder mit zahlreichen Gemälden und Kunstgegenständen dekoriert – sind nämlich voller Menschen. Dass es so viele Gäste sein würden, hatte ich nicht erwartet. Es hieß, es wäre nur ein kleiner Empfang, und ich dachte, ich würde genug Gelegenheit haben, den Gastgeber in Ruhe zu sprechen. Aber wird Giacomo di Chessa überhaupt Zeit für mich haben, wenn er sich auch um so viele andere kümmern muss?
Andererseits ist es natürlich ein Vorteil, wenn die Mitglieder der römischen Kunstszene sehr zahlreich seiner Einladung gefolgt sind. Als ehemaliger Dekan des Kunsthistorischen Instituts an der Universität Rom wird er viele Experten und potentielle Käufer kennen – und wenn ich Glück habe, dann kann ich hier eine Menge neuer Kontakte knüpfen. Allerdings nicht allein, deshalb lasse ich den Blick suchend über die Menge gleiten.
Eigentlich hatte ich gehofft, dass Andrew mich schon erwartet. Er ist der Einzige, den ich hier kenne, und ich brauche ihn dringend, denn er hat mir versprochen, mich den wichtigen Leuten vorzustellen – allen voran unserem Gastgeber.
Von Andrew ist jedoch nichts zu sehen. Dafür entdecke ich erneut meinen abweisenden Retter. Er steht zusammen mit seiner Begleiterin vor einem der Fenster im hinteren Teil des Raumes bei einigen anderen Leuten und unterhält sich.
Ich könnte mir einreden, dass er mir nur auffällt, weil ich gerade erst mit ihm zusammengetroffen bin. Aber das wäre gelogen. Ich hätte ihn sicher auch so bemerkt, schon weil er durch seine Größe und die dunkelblonden Haare aus der Menge heraussticht. Er ist einfach kein Typ, den man übersehen kann – und ich wette, das weiß er. Deshalb lächelt er schon wieder dieses lässig-entspannte Lächeln. Das er für mich nicht mehr übrig hatte, sobald er wusste, wer ich bin …
»Sophie!«
Die erfreute Stimme, die meinen Namen ruft, lässt mich herumfahren. Ein Mann um die Sechzig mit schulterlangen, graumelierten Haaren kommt auf mich zu. Er trägt zu seinem unauffälligen grauen Anzug wie immer einen sehr auffälligen Schal – heute einen aus dunkelroter Seide – und seine hellblauen Augen leuchten freundlich.
»Andrew!«
Ich bin unglaublich froh, ihn zu sehen, und erwidere erleichtert sein breites Lächeln, das sofort jeden meiner trüben Gedanken verfliegen lässt. So geht es mir oft in seiner Gegenwart, und nicht nur mir – Andrew Abbott ist neben seinem unbestrittenen Kunstverstand bekannt für seinen Humor und sein einnehmendes Wesen. Deshalb hat er einen wirklich großen Freundeskreis, zu dem mein Vater schon gehört, seit die beiden vor über dreißig Jahren gemeinsam in Oxford Kunstgeschichte studiert haben.
Andrews Begrüßung fällt – für einen Briten – sehr überschwänglich aus, denn er küsst mich herzlich auf beide Wangen. Wahrscheinlich lebt er einfach schon zu lange in diesem Land und hat sich die körperbetonte Art der Italiener angewöhnt.
»Du siehst bezaubernd aus«, sagt er dann und blickt bewundernd an mir herunter. »Tolles Kleid.«
»Danke.« Sein Kompliment lässt mich strahlen, denn es nimmt mir zumindest einen Teil meiner Verunsicherung. Nicht, dass ich sonst immer auf Bewunderung aus wäre. Im Gegenteil. Obwohl ich weiß, dass ich mit meiner zierlichen Figur, meinen blaugrauen Augen und den langen schwarzen Haaren, die ich heute ausnahmsweise mal offen trage, ganz passabel aussehe, machen mich Bemerkungen über mein Äußeres meist eher verlegen. Vielleicht weil in meinem Leben so viele andere Dinge wichtiger sind als ich und meine Wirkung. Aber diesmal freut mich das Lob, sehr sogar, und ohne es zu wollen, gleitet mein Blick zurück zu dem großen dunkelblonden Mann, der für meinen verunsicherten Zustand verantwortlich ist.
Da, wo er vorhin stand, ist er jedoch nicht mehr, und ich kann ihn auch nirgends entdecken, was mich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mich gerne erkundigt, wer er eigentlich ist.
Andrew, der das bestimmt gewusst hätte, hakt sich bei mir ein. »Okay, beginnen wir mit der Vorstellungsrunde – versprochen ist versprochen«, sagt er, und während wir durch die Menge gehen, muss ich daran denken, dass er einer der ganz wenigen Menschen ist, die nach diesem Grundsatz leben. Was Andrew Abbott verspricht, das hält er auch, und diese Verlässlichkeit schätze ich sehr an ihm.
Früher, als er noch in England wohnte, war er oft bei uns. Ich war damals noch klein und mochte seine Besuche, weil er mir stets mitbrachte, was ich mir beim Mal zuvor von ihm gewünscht hatte. Es waren nur Kleinigkeiten – ein Armband, eine Zopfspange oder eine bestimmte Sorte Schokolade –, aber er hatte versprochen, dran zu denken, und hat es nie vergessen, nicht ein einziges Mal.
Deshalb habe ich mich immer an ihn erinnert, auch als er längst in Italien war und wir ihn kaum noch persönlich zu Gesicht bekamen. Aber er hielt trotzdem den Kontakt zu meinem Dad und war sofort bereit, uns zu helfen, als er erfuhr, dass wir unsere Geschäftstätigkeiten in Italien ausweiten wollen. Seitdem lässt er seine Beziehungen spielen, wenn ich selbst nicht weiterkomme, und wie es aussieht, stehen wir jetzt tatsächlich vor einem echten Durchbruch – wofür ich ihm dankbarer nicht sein könnte.
»Und, wie ist das Hotel?«, will er wissen, während wir uns langsam einen Weg durch die Gruppen von Leuten bahnen, die zusammenstehen, Wein und Champagner trinken und reden. »Ist es bei den Binis immer noch so nett und gemütlich, wie ich es in Erinnerung habe?«
»Oh ja«, versichere ich ihm. »Signora Bini ist die Beste, sie liest mir jeden Wunsch von den Augen ab, und ihr Mann kocht so gut, dass ich wahrscheinlich nur noch heute in dieses Kleid passen werde. Ich wünschte bloß, du hättest mir diesen Tipp schon früher gegeben.«
»Du hast nicht gefragt«, sagt er grinsend, und ich muss mir eingestehen, dass das stimmt. Es erschien mir bei meinen bisherigen Besuchen einfach immer günstig und praktisch, in diesen größeren Hotels etwas außerhalb des Stadtzentrums zu wohnen. Dabei ist das kleine, familiär geführte Hotel »Fortuna«, das Andrew mir empfohlen hat und das mitten in der historischen Altstadt im aufstrebenden Monti-Viertel liegt, erstaunlicherweise gar nicht teurer. Dafür könnte der Unterschied zwischen den eher anonymen modernen Bettenburgen und dem liebevoll und sehr individuell eingerichteten »Fortuna« größer nicht sein. So nett mitten in der Stadt zu wohnen, versüßt mir definitiv meinen Aufenthalt, und ich habe beschlossen, die Zeit hier in vollen Zügen zu genießen. Es könnte nämlich ein sehr kurzes Vergnügen werden – falls Giacomo di Chessa sich entscheidet, dem »Conroy’s« die Versteigerung seiner Sammlung nicht anzuvertrauen. Dann fliege ich morgen schon zurück nach Hause. Bei dem Gedanken seufze ich tief.
»Keine Sorge, Giacomo wird dich lieben«, versichert mir Andrew, der zu ahnen scheint, was mich bewegt, und schiebt mich weiter zielstrebig durch die Menge.
»Ich weiß nicht.« Skeptisch zucke ich mit den Schultern. »Wieso bist du dir da eigentlich so sicher?«
»Weil ich ihn kenne. Und weil er mir vertraut.« Er zwinkert mir zu. »Sei einfach du selbst, Sophie, dann kann gar nichts schiefgehen, glaub mir.«
Ich bin immer noch nicht überzeugt und sein kryptischer Hinweis hilft mir nicht weiter. »Wie bin ich denn?«
Er bleibt stehen, offenbar überrascht ihn meine Frage. Als er sieht, dass ich sie ernst meine, legt er den Kopf ein bisschen schief und denkt nach. »Du bist das netteste Mädchen, das ich kenne. Immer freundlich und unglaublich tüchtig. Und klug und ehrlich – alles Eigenschaften, die eine Kunsthändlerin unbedingt mitbringen sollte.«
»Aha.« Skeptisch runzle ich die Stirn. Ich weiß, dass das ein Kompliment war, aber ein paar aufregendere Adjektive als »nett« und »tüchtig« wären mir irgendwie lieber gewesen. »Und was sind meine Fehler?« Vielleicht sind ja wenigstens die ein bisschen spannend.
»Du hast keine«, versichert er mir, charmant wie immer. »Oder doch – manchmal bist du ein bisschen zu ernst«, schränkt er dann ein und streicht mir über den Arm. »Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie früh du schon Verantwortung übernehmen musstest.«
Unwillkürlich sehe ich das blasse Gesicht meiner Mutter vor mir, die Augen, die blicklos sind, nach innen gekehrt und dann wieder fast fiebrig funkeln. Die hilflose Traurigkeit, die dabei in mir aufsteigt, unterdrücke ich jedoch hastig wieder. Aber es stimmt, denke ich. Ich bin wohl ernster als die meisten. Ernst und nett. Na toll.
Während ich noch darüber nachdenke, warum mich seine Einschätzung so stört, redet Andrew, dem meine gedrückte Stimmung total entgeht, schon weiter.
»Auf jeden Fall liebst du die Kunst genauso leidenschaftlich wie Giacomo«, erklärt er mir strahlend. »Das spürt er, ganz sicher – und das wird er zu schätzen wissen. Ganz einfach dürfte dieser Auftrag nämlich nicht werden.«
Das Letzte sagt er beiläufig und nimmt dabei dem Kellner, der gerade an uns vorbeigeht, zwei Gläser mit Champagner vom Tablett. Eins davon reicht er mir.
»Wie meinst du das – nicht ganz einfach?«, hake ich nach.
Als Antwort nimmt Andrew einen Schluck aus seinem Glas und setzt sich dann wieder in Bewegung. Ich folge ihm und halte ihn am Ärmel fest, zwinge ihn stehen zu bleiben.
»Andrew?«
Er lächelt und legt den Arm um mich, aber nur, um mich mit der Hand, die er in meinen Rücken legt, sanft weiterzuschieben. »Lernt euch erst mal kennen, Sophie. Der Rest wird sich dann schon finden.«
Mir bleibt keine Zeit mehr, länger über seine Worte nachzudenken, denn Andrew führt mich sehr zielstrebig weiter auf ein zierliches Chippendale-Sofa an der Wand zu, das Platz für zwei Personen bietet. Auf der rechten Seite sitzt eine alte Frau in einem wunderschönen, weit geschnittenen Seidenkleid, dessen buntes Muster mir irgendwie bekannt vorkommt.
Die Tatsache, dass sie dort allein sitzt, irritiert Andrew sichtlich, denn er runzelt die Stirn.
»Er war gerade noch hier«, erklärt er mir entschuldigend und sieht sich um. Dann wendet er sich an die Frau. »Valentina, carissima, dov’è Giacomo?«
Die Frau – sie sieht trotz ihrer vielen Falten wirklich gut aus und muss früher mal eine echte Schönheit gewesen sein – lächelt.
»Er kommt gleich zurück«, informiert sie Andrew auf Italienisch, dann betrachtet sie mich neugierig – eine Aufforderung, der er sofort nachkommt.
»Valentina, darf ich vorstellen, das ist Sophie Conroy aus England«, sagt er, diesmal auf Englisch. »Und das ist Valentina Bertani, eine gute Freundin von Giacomo.«
»Freut mich sehr.« Die alte Dame hat jetzt ebenfalls ins Englische gewechselt, das ihr trotz ihres starken Akzents offensichtlich geläufig ist. Sie streckt mir die Hand entgegen, die ich auch ergreife, doch meine Antwort kommt verzögert, weil ich noch damit beschäftigt bin, meine Eindrücke zu sortieren. Den Namen kenne ich. Und das Muster auf dem Stoff …
»Bertani? Haben Sie etwas zu tun mit den Bertanis, die …«
»… die hübschen Schuhe und Taschen machen?« Die Frau, die offenbar mit der Frage gerechnet hat, lacht erfreut. »Oh ja. Das Unternehmen gehört unserer Familie und wird heute von zwei meiner Enkel geleitet. Kennen Sie unsere Produkte?«
»Natürlich! Die Sachen sind wunderschön«, versichere ich ihr sofort und fast entrüstet. Wer kennt den italienischen Design-Konzern schließlich nicht, dessen Logo eine stilisierte Möwe ist und der – im Luxussegment – weit mehr produziert als nur Schuhe und Taschen. Der Name Bertani steht auch für exklusive Designermöbel und gemusterte Stoffe, die seit einiger Zeit zudem das Herzstück einer eigenen Modekollektion bilden. Das Muster auf dem Kleid der Frau ist typisch für das Label, deswegen kam mir das auch so bekannt vor – neben der Kunst habe ich nämlich auch ein Faible für Design. Und auf diesem Gebiet spielt Bertani definitiv in der ersten Liga, weshalb ich ehrlich fasziniert bin, jemanden aus dem Unternehmen kennenzulernen.
Für Signora Bertani scheint das Gespräch über ihre Firma jedoch abgehakt, denn ihr Interesse gilt jetzt mir.
»Und was tun Sie hier in Rom, meine Liebe?«
Es ist keine Höflichkeitsfloskel, sie will das wirklich wissen, denn ihre grünen Augen funkeln aufmerksam, was ich sehr sympathisch finde. Und sie wirkt auch noch erstaunlich fit für ihr Alter, das ich auf achtzig schätze.
»Ich bin Kunsthändlerin«, erkläre ich ihr bereitwillig und will noch mehr sagen. Doch bevor ich das tun kann, stößt Valentina einen kleinen Schrei aus.
»Oh ja, natürlich – Sophie Conroy«, sagt sie und schüttelt den Kopf, sichtlich verärgert über sich selbst. »Sie kommen von diesem englischen Auktionshaus und sollen Giacomo helfen, seine Sammlung zu verkleinern, nicht wahr? Er hat es uns erzählt – ich hatte es nur vergessen. Verzeihen Sie, ich werde alt.« Sie lächelt entschuldigend und deutet dann auf den freien Platz neben sich. »Bitte, setzen Sie sich doch einen Moment zu mir.«
Etwas unsicher blicke ich mich zu Andrew um, doch der ist mittlerweile in eine angeregte Diskussion mit einem anderen Mann vertieft. Deshalb folge ich der Aufforderung und nehme auf dem zierlichen Sofa Platz.
»Ich freue mich so, Sie kennenzulernen«, versichert mir Valentina Bertani und tätschelt meine Hand. »Nach allem, was Andrew uns von Ihnen erzählt hat, war ich nämlich schon sehr neugierig auf Sie.«
Ein bisschen verlegen drehe ich das Champagner-Glas in meiner Hand. »Ich hoffe, es war nur Gutes.«
Sie nickt vehement. »Absolut. Er hat Sie in den höchsten Tönen gelobt, und so etwas tut er nur, wenn er von jemandem sehr überzeugt ist. Deshalb bin ich ganz sicher, dass Sie das mit Giacomos Bildern ganz hervorragend machen werden.«
»Noch haben wir den Auftrag nicht bekommen«, widerspreche ich ihr, doch sie winkt ab, so als wäre das lediglich eine Formsache. Dann beugt sie sich ein bisschen vor, sodass nur ich sie hören kann.
»Sie wissen, warum Giacomo die Bilder verkaufen will?«
Ich nicke, denn das war tatsächlich das Erste, was Andrew mir über unseren potentiellen neuen Auftraggeber erzählt hat: dass Giacomo di Chessas Frau vor gut einem Jahr verstorben ist und er jetzt, kurz nach seiner Pensionierung, Rom verlassen und zu seiner Tochter ziehen will, die mit ihrer Familie in England wohnt.
Mit einem Seufzen lehnt Valentina Bertani sich zurück.
»Er braucht diesen Neuanfang, wissen Sie. Francescas Tod hat ihn sehr mitgenommen. Es wird leichter für ihn sein, wenn er bei Anna und seinen Enkeln lebt anstatt hier zwischen all den Erinnerungen. Deshalb bin ich so froh, dass er sich entschieden hat, es zu wagen und dieses Haus und alles, was darin ist, zu verkaufen. Aber er hadert noch damit. Und außerdem …« Sie zögert, beendet ihren Satz nicht. »Ach, nichts. Auf jeden Fall ist es gut, wenn Sie ihn bei der Abwicklung unterstützen.«
»Das tue ich gern«, versichere ich ihr und blicke zu den Bildern hoch, die über uns die Wände schmücken und unter denen ich wieder einige ungewöhnliche Raritäten entdecke. »Ich kann verstehen, dass es Signore di Chessa schwerfällt, sich von diesen schönen Werken zu trennen. Seine Sammlung scheint wirklich etwas Besonderes zu sein.«
Signora Bertani folgt lächelnd meinem Blick. »Ja, das ist sie. Die Prachtstücke haben Sie bestimmt schon entdeckt, nicht wahr?«
Ich schüttele den Kopf und ärgere mich wieder darüber, dass ich nach dem Vorfall auf der Treppe so viele Gedanken an den mysteriösen Matteo verschwendet habe. Ich hätte meine Konzentration wirklich für andere Dinge gebraucht.
»Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir alles genauer anzusehen.« Entschuldigend zucke ich mit den Schultern. »Ein Gemälde im Treppenhaus ist mir allerdings schon aufgefallen, das ich besonders interessant fand. Ich glaube, es ist von Joseph Severn …«
»Das ist es in der Tat«, sagt ein Mann mit schlohweißen Haaren, der plötzlich vor dem Sofa steht. Er ist klein und ziemlich hager, hat eingefallene Wangen und sehr viele Falten. Seine Augen blicken freundlich, aber auch ein bisschen müde, und es liegt eine Traurigkeit in seinem Blick, die selbst sein Lächeln nicht überdecken kann.
Schon eine Sekunde bevor Valentina »Giacomo!«, ruft, begreife ich, dass unser Gastgeber zurückgekehrt ist, und springe sofort von dem kleinen Sofa auf. Schließlich war das sein Platz.
»Vielen Dank«, sagt er, als ich zur Seite trete, und lässt sich, sichtlich dankbar, nicht mehr stehen zu müssen, wieder zurück auf die Polster sinken. Er sieht älter aus, als er ist, denke ich bestürzt. Ich weiß, dass er erst Mitte sechzig sein kann, da er gerade pensioniert wurde, doch schätzen würde ich ihn auf Mitte siebzig. Sein angeschlagener Zustand ist ihm sichtlich unangenehm. »Entschuldigen Sie, ich bin im Moment leider ein bisschen schwach auf den Beinen, ich hoffe, das gibt sich bald wieder«, sagt er zerknirscht.
Andrew, der Giacomo di Chessas Rückkehr auch bemerkt hat, verabschiedet sich schnell von dem Mann, mit dem er die ganze Zeit über im Gespräch war, und stellt sich wieder zu uns.
»Giacomo, darf ich vorstellen – das ist Sophie Conroy, von der ich Ihnen schon so viel erzählt habe«, sagt er und deutet auf mich.
Ich schlucke kurz, weil ich weiß, dass viel davon abhängt, wie ich mich in den nächsten Minuten schlage.
»Freut mich sehr, Signore di Chessa«, sage ich und strecke ihm lächelnd die Hand hin.
»Ah, die junge Dame aus London.« Für jemanden, der so fragil wirkt, ist sein Händedruck erstaunlich fest, und auch sein Blick ist jetzt sehr viel wacher und ganz auf mich konzentriert. Er mustert mich einen langen Augenblick, und ich fange gerade an, nervös zu werden, als ein breites Lächeln auf seinem Gesicht erscheint.
»Sie verstehen wirklich etwas von Kunst, wenn Ihnen das Severn-Bild sofort aufgefallen ist. Für eine so schnelle Zuordnung braucht es ein gutes Auge.« Sein Kompliment freut mich, und ich will etwas erwidern, doch er kommt mir zuvor. »Allerdings muss ich Sie enttäuschen, falls Sie daran Interesse hatten. Das Gemälde gehört nicht mehr zu den Dingen, die ich versteigern lassen will«, fügt er bedauernd hinzu.
Verdutzt sehe ich ihn an. »Warum nicht?«
»Weil Giacomo es mir gerade verkauft hat«, sagt eine dunkle Stimme und lässt mich erschrocken herumfahren.
3
Der große dunkelblonde Mann steht hinter mir, ziemlich dicht sogar, und sieht mit seinen schönen Bernsteinaugen auf mich herunter, was mein Herz kurz aus dem Tritt kommen lässt.
»Oh«, stoße ich hervor, weil ich so überrascht bin, fange mich dann aber sofort wieder. »Wie … schade.«
Die Gedanken in meinem Kopf fallen hektisch übereinander und lassen mir keine Zeit, sie zu ordnen. Er sieht so verdammt gut aus! Vergiss das, Sophie, sofort! Wieso spricht er plötzlich doch mit mir – ich dachte, ich wäre seine persönliche Persona non grata? Wer ist er überhaupt und ist es Zufall, dass er ausgerechnet das Bild gekauft hat, über das wir vorhin auf der Treppe gesprochen haben? Und wieso lächeln ihn alle außer mir an, wenn er sich einfach in unser Gespräch einmischt? Bin ich wirklich die Einzige, die ihn nicht kennt?
»Matteo!«, ruft Valentina Bertani erfreut, doch sie wirkt plötzlich nervös, blickt ein bisschen hektisch zwischen dem Mann und mir hin und her. »Das ist Sophie Conroy – Andrew hat sie Giacomo für die Versteigerung empfohlen, erinnerst du dich?«
Okay, denke ich. Damit wäre dann zumindest das Rätsel gelöst, woher Bernstein-Auge meinen Namen kannte. Wenn ich hier schon Thema war, dann hat er einfach eins und eins zusammengezählt, als er hörte, dass ich für ein Auktionshaus in London arbeite.
»Und das ist mein Enkel, Matteo Bertani«, fährt die alte Dame – für einen Augenblick sichtlich stolz – mit ihrer Vorstellung fort.
Er ist ein Bertani, denke ich erstaunt und runzele die Stirn, weil gleichzeitig irgendwo in meinem Unterbewusstsein Alarmglocken klingeln, laut sogar. Aber ich schaffe es einfach nicht, die Erinnerung festzuhalten, die bei der Nennung seines Namens kurz aufgeflackert ist.
»Wir kennen uns schon, Nonna«, informiert Matteo Bertani seine Großmutter, wieder in diesem akzentfreien Englisch, und reißt mich aus meinen Gedanken. Als ich ihn irritiert ansehe, wird sein Lächeln eine Spur süffisanter, und fast sofort sehe ich wieder das Bild vor mir, wie ich auf der Treppe in seinen Armen lag, spüre, wie mein Magen auf Talfahrt geht, während unsere Blicke sich treffen. Aber nur für eine Sekunde oder so, dann wende ich den Kopf ab.
Dieser Kerl mag mich auf der Treppe zurück ins Gleichgewicht gebracht haben, aber für meinen Seelenfrieden bewirkt er seitdem eher das Gegenteil. So etwas kommt bei mir ziemlich selten vor – und gebrauchen kann ich das gerade überhaupt nicht.
»Du kennst Signore Bertani? Davon hast du mir ja gar nichts erzählt!«, mischt sich Andrew ein, der offenbar findet, dass ich ihm diese Information keinesfalls hätte vorenthalten dürfen.
»Wir sind uns nur ganz kurz begegnet, vorhin am Eingang. Aber er hatte es eilig, deshalb blieb für eine richtige Vorstellung keine Zeit.« Ich schicke ein paar wütende Blicke in Richtung Mr. Perfect. Wir kennen uns schon – pah! Er hatte es ja nicht mal nötig, mir seinen Namen zu nennen, bevor er weg war.
Ein schlechtes Gewissen scheint Matteo Bertani deswegen nicht zu haben. Meine Bemerkung amüsiert ihn eher, denn sein unverschämt attraktives Lächeln vertieft sich noch.
»Das holen wir ja jetzt nach«, erklärt er und hält mir die Hand hin, so dass mir gar nichts anderes übrig bleibt als sie zu ergreifen. »Willkommen in Rom, Miss Conroy.«
Die Berührung unserer Hände und die Tatsache, dass er mich plötzlich so charmant anstrahlt, werfen mich schon ziemlich aus der Bahn, doch das wird noch viel schlimmer, als er sich vorbeugt und mir die in Italien üblichen Küsse auf die Wangen gibt. Davon habe ich seit meiner Ankunft gestern wirklich schon einige bekommen, aber bei ihm fällt mir auf, dass seine Wange sich warm anfühlt an meiner und sein After-Shave immer noch ziemlich aufregend duftet. Deshalb bin ich froh, als er wieder einen Schritt zurückmacht und meine Hand loslässt.
»Danke«, sage ich kühl.
Ich meine, was glaubt er denn? Dass ich sofort zu seinem Fan mutiere, nur weil er mich gerade mal wieder nett anlächelt? So funktioniert das vielleicht bei anderen Frauen, aber ganz sicher nicht bei mir. Im Gegenteil. Wenn ich eins hasse, dann Menschen, die sprunghaft ihr Verhalten ändern.
Valentina Bertani scheint die Tatsache, dass ihr Enkel so freundlich zu mir ist, jedoch zu beruhigen, sie lächelt jetzt ganz entspannt, und auch die anderen sind sichtlich zufrieden, vor allem Andrew, dem ich ansehen kann, wie er innerlich ein Häkchen auf seiner Liste macht.
Insgeheim stöhne ich auf, ohne mein etwas mühsames Lächeln zu unterbrechen. War ja klar, dass Matteo Bertani zu denen gehört, die er mir vorstellen wollte – als Mitglied des Bertani-Clans ist er ein potentieller Käufer und damit natürlich ein wichtiger Kontakt. Also sollte ich nett zu ihm sein – und wie es aussieht, jetzt gleich, denn offenbar wird von mir erwartet, dass ich Konversation mit ihm betreibe. Andrew hat nämlich zu meinem Entsetzen auf Italienisch ein Gespräch mit Valentina und Giacomo begonnen. Es geht um den Mann, mit dem er gesprochen hat, bevor er wieder zu uns kam, und das scheint gerade wichtiger zu sein als alles andere, denn die beiden anderen lauschen ihm aufmerksam und achten gar nicht mehr auf mich und Matteo Bertani.
Na super, denke ich ein bisschen verzweifelt. Lasst mich ruhig alle allein mit Signore Ich-rede-nicht-mit-Frauen-diesich-mit-Kunst-auskennen. Dessen Fluchtreflex ist allerdings vollkommen abgeklungen, denn er bleibt, wo er ist, und macht mich mit diesen durchdringenden Bernstein-Augen lieber weiter nervös.
Smalltalk, Sophie, erinnere ich mich. Frag ihn irgendetwas. Das fällt dir doch sonst nicht schwer. Aber sonst sind meine Gesprächspartner ja auch berechenbarer als dieser, bei dem man offensichtlich nie weiß, was einen als Nächstes erwartet.
Ich räuspere mich. »Wie ich hörte, leiten Sie den Design-Konzern Ihrer Familie. Das ist sicher eine sehr interessante Aufgabe.«
Selbst in meinen Ohren klingt diese Bemerkung gezwungen, aber ich lächele tapfer weiter. Etwas anderes bleibt mir ja auch nicht übrig.
»Das ist es bestimmt«, antwortet Matteo Bertani. »Aber ich fürchte, Sie sind falsch informiert. Die Firma führen meine beiden älteren Brüder.«
Als er sieht, wie überrascht ich über diese Antwort bin, hebt er amüsiert einen Mundwinkel – wodurch wieder dieses sexy Grübchen auf seiner Wange erscheint, das ich aus gegebenem Anlass zu ignorieren versuche.
»Und Sie?«, hake ich nach.
Ich hasse es, dass er mir irgendwie immer einen Schritt voraus ist – und dass er mich so rumraten lässt. Aber ihm macht das Spaß, so viel steht fest.
Er zuckt mit seinen breiten Schultern. »Ich habe mich sehr intensiv mit dem beschäftigt, was mir schon immer besonders am Herzen lag: der Kunst und ihrer geschichtlichen Entwicklung«, sagt er, und wieder drängt etwas an die Oberfläche meines Gedächtnisses.
Kunstgeschichte. Matteo Bertani. Denk nach, Sophie.
Und dann – viel zu spät – macht es endlich klick in meinem heute so unzuverlässigen Gehirn, und ich erinnere mich plötzlich an einige Artikel, die ich in Vorbereitung auf meine Reise über die römische Kunstszene gelesen habe. Und an die Schwärmereien meiner Freundin Sarah, die vor gut zwei Jahren mal für eine Weile in Rom studiert hat. Oh mein Gott!
»Sie sind das?«
Matteo Bertani – natürlich! Er war in den Artikeln mehrfach zitiert – als international anerkannter Experte für italienische und englische Kunstgeschichte. Der junge Professore mit den schönen Augen und den ungewöhnlichen Thesen zur Malerei, den Sarah damals so toll fand, das Enfant terrible des Kunsthistorischen Instituts der La Sapienza. Und zudem, wie ich jetzt weiß, Mitglied einer der reichsten Familien Italiens.
Verdammt.
Wichtiger Kontakt ist gar kein Ausdruck. Er ist wahrscheinlich eher so was wie der Jackpot. Und er lächelt mich so selbstzufrieden an, dass ich ihm wirklich gerne in sein bestimmt unglaublich durchtrainiertes Sixpack boxen möchte.
»Dann kennen wir uns also doch?« Spöttisch hebt er die Brauen.
»Nein, aber ich … äh … habe von Ihnen gehört«, stottere ich. Noch etwas, das ich sonst nie tue. Hastig räuspere ich mich. »Sie arbeiten an der La Sapienza, nicht wahr?« Eine ganz normal gestellte Frage – geht doch, Sophie.
»Ich habe dort einen Lehrauftrag, ja«, bestätigt er mir.
Was wiederum eher ein bisschen zu bescheiden klingt. Laut Sarah war und ist er nämlich der Star-Dozent der Uni, und zahlreiche, vor allem weibliche Studenten belegen angeblich Kunstgeschichte nur seinetwegen. Dabei muss er sicher nicht arbeiten, er ist ein Bertani und damit auf jeden Fall reich. So reich, dass er sich mal eben ein Gemälde kaufen kann, für das man mehr als ein paar Pfund hinlegen muss. Was mich zurück zu einer anderen Frage bringt, die ich vor lauter Schreck darüber, dass er plötzlich doch mit mir sprechen wollte, ganz verdrängt hatte.
»Warum haben Sie eigentlich das Severn-Gemälde gekauft?«
Das kommt mir – ganz abgesehen davon, dass ich ziemlich enttäuscht darüber bin, dass ich jetzt keine Gelegenheit mehr haben werde, es genauer zu studieren –, doch ein bisschen komisch vor. Schließlich war es das Bild, unter dem wir uns vorhin »begegnet« sind. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass beides zusammenhängt, und dieser Verdacht scheint sich zu bestätigen, denn er zögert mit der Antwort, hebt zuerst das Glas mit Champagner, das er in der Hand hält, und trinkt einen Schluck. Als er es wieder absetzt, lächelt er weit weniger strahlend, und der Ausdruck in seinen Augen wird wieder reserviert, fast schon kühl.
»Das sollte ich Ihnen lieber nicht sagen.« Sein Blick wandert zu seiner Großmutter hinüber, die sich immer noch mit Giacomo und Andrew unterhält, so als müsse er kurz überprüfen, ob sie ihn hört.
Jetzt bin ich es, die die Brauen hebt. »Ach, und wieso nicht?«
»Weil Ihnen die Antwort nicht gefallen wird«, erklärt er mir, und in seinen Bernstein-Augen liegt jetzt ganz klar eine Herausforderung.
»Lassen wir es darauf ankommen.«
Er glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich das auf sich beruhen lasse? Ich will wissen, was sein Problem ist. Denn auch, wenn er plötzlich seinen Charme spielen lässt, hat er ja offenbar eins mit mir. Und ich wette, dieser spontane Kauf kam nicht von ungefähr. »Es hatte etwas damit zu tun, dass ich es mir angesehen habe, als wir uns vorhin in der Eingangshalle begegnet sind, nicht wahr?«
Er schweigt einen langen Moment.
»Sagen wir es so: Ihr taxierender Blick hat mich daran erinnert, dass hier bald alles unter den Hammer kommt. Und da mir das Severn-Bild sehr am Herzen liegt, habe ich es mir lieber gesichert, bevor Sie damit anfangen, Giacomos Sammlung zu zerschlagen.«
Ich umklammere mein Glas und starre ihn an, erschrocken über den Zorn, der in seiner Stimme mitschwingt. Aber er redet schon weiter, ist noch gar nicht fertig.
»Nehmen Sie es nicht persönlich, Miss Conroy. Es geht nicht gegen Sie. Aber ich gehöre nun mal nicht zu denen, die es für eine gute Idee halten, dass Giacomo Rom verlassen will. Deshalb vielleicht eine Warnung: Mit meiner Hilfe bei dieser Auktionsgeschichte brauchen Sie nicht zu rechnen, und sollte ich eine Möglichkeit sehen, die ganze Sache zu verhindern, werde ich sie ohne zu Zögern ergreifen.«
In seinen Bernstein-Augen brennt jetzt ein Feuer, aber das in meinen Augen kann da sicher locker mithalten. Was glaubt dieser Kerl eigentlich?
»Oh, ich nehme das aber persönlich, Signore Bertani. Weil ich nun mal zu denen gehöre, die mit unhöflichen Menschen nichts anfangen können«, erkläre ich ihm mit einem süßlichen Lächeln, das meine Wut auf ihn nur schlecht verbirgt. »Soviel ich weiß, ist es Signore di Chessas ausdrücklicher Wunsch, seine Sammlung zu verkleinern, und da die Kunstwerke ihm gehören und dies ein freies Land ist, kann er damit tun, was immer er will. Dafür braucht er Ihr Einverständnis nicht. Und was unser Auktionshaus angeht: Das ›Conroy’s‹ gehört zu den renommiertesten seiner Art. Vor uns muss man nichts ›in Sicherheit bringen, und wenn bei uns etwas ›unter den Hammer‹ kommt, dann geht alles mit rechten Dingen zu. Wir arbeiten immer im Sinne unserer Kunden und erzielen bei den Versteigerungen die besten Preise für die uns anvertrauten Werke.« Ich muss kurz Luft holen. »Und im Übrigen habe ich das Bild nicht taxiert, es hat mich einfach interessiert, weil ich Joseph Severn zufällig auch sehr schätze«, füge ich noch hinzu, mittlerweile richtig in Rage.
Matteo Bertani hebt – überhaupt nicht beeindruckt – einen Mundwinkel, und sein schiefes Lächeln hat etwas Herablassendes, was mich noch zorniger macht, als ich ohnehin schon bin.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihnen die Antwort nicht gefallen wird«, erinnert er mich. »Außerdem hat Giacomo auch ohne Sie einen guten Preis für das Bild erzielt, glauben Sie mir.«
»Das ist schön für Signore di Chessa. Wenn Sie jetzt allerdings jedes Werk kaufen wollen, das ich mir heute noch ansehe, könnte das ein teurer Abend für Sie werden – ich habe nämlich vor, hier alles sehr gründlich zu taxieren. Ach ja, und vielleicht noch eine Warnung, damit Ihr Ego keinen Schaden nimmt: Tun Sie, was immer Sie müssen, aber sollte das ›Conroy’s‹ diesen Auftrag erhalten, kommen wir ganz sicher auch ohne Ihre Hilfe aus.«
Ich zwinge mich, die Hände wieder locker zu lassen, die ich zu Fäusten geballt hatte, und halte Matteo Bertanis Blick stand, in dem für einen Moment Erstaunen steht – zumindest bilde ich mir das ein. Dann grinst er plötzlich, und zum ersten Mal am heutigen Abend habe ich das Gefühl, dass es keine Routine ist, sondern echt.
»Touché, Miss Conroy. Aber wie ich schon sagte …«
»Du streitest dich doch nicht mit Miss Conroy, oder? Matteo?«, erkundigt sich Valentina Bertani bei ihrem Enkel und lässt uns beide fast schuldbewusst auseinanderfahren. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich mich quasi vor ihm aufgebaut habe und uns dadurch nur noch wenige Zentimeter trennten.
Als ich mich umblicke, sehe ich, dass die drei ihr Gespräch unterbrochen haben und uns aufmerksam beobachten – Valentina und Giacomo di Chessa besorgt, Andrew dagegen mit neugierigem Interesse.
»Nein, wir unterhalten uns nur, Nonna«, versichert ihr Matteo Bertani, ohne mit der Wimper zu zucken, und lächelt wieder dieses extrem charmante, strahlende Lächeln. Offenbar will er sie nicht aufregen, denn sie wirkt auf einmal ein bisschen blass.
Wieso hat sie das überhaupt gefragt, wundere ich mich. Es klang fast so, als hätte sie einen Streit zwischen uns erwartet, und auch ihren Blick von vorhin deute ich jetzt als Sorge, wie ihr Enkel und ich wohl aufeinander reagieren werden. Wahrscheinlich kennt sie seine Einstellung und hatte schon befürchtet, dass es Stress zwischen uns geben könnte.
Erst dann merke ich, dass plötzlich alle Augen auf mich gerichtet sind, gespannt darauf, ob ich die Aussage meines Gesprächspartners bestätige. Und da brauche ich tatsächlich nicht lange zu überlegen. Dieser Abend ist bis jetzt überhaupt nicht so gelaufen, wie ich ihn mir ausgemalt hatte, und ich muss mich auf gar keinen Fall auch noch dabei erwischen lassen, wie ich mich öffentlich mit einem sehr einflussreichen Mitglied der römischen Kunstszene zanke.
»Wir haben über das Severn-Bild gesprochen«, bestätige ich deshalb und bemühe mich um ein halbwegs glaubwürdiges Lächeln. »Und … über die Vorzüge des Auktionswesens«, füge ich dann noch hinzu, weil ich mir diesen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen kann, und werfe Matteo Bertani einen schnellen Blick zu.
Giacomo di Chessa entgeht das nicht, denn er lächelt auf einmal breit.
»Hört, hört. Also, wenn Sie sogar Matteo davon überzeugen können, dass eine Auktion genau das Richtige ist, dann sollte wir wohl schleunigst ins Geschäft kommen, Miss Conroy.«
Diese Bemerkung schmeckt Matteo Bertani ganz und gar nicht, denn sein eben noch so charmantes Lächeln verliert deutlich an Strahlkraft.
»Ich habe nicht gesagt, dass …«, will er widersprechen, wird jedoch von Valentina Bertani unterbrochen, die sich unvermittelt erhebt.
»Ich möchte jetzt etwas essen«, verkündet sie resolut, als sie – ein bisschen wacklig – steht, und sieht ihren Enkel an. »Begleitest du mich bitte zum Büffet, Matteo?«
Er lässt die Hand sinken, die er erhoben hatte, um das, was wir jetzt nicht mehr hören werden, mit einer Geste zu unterstreichen.
»Natürlich.« Mit zwei großen Schritten ist er bei seiner Großmutter und hält ihr den Arm hin, damit sie sich bei ihm einhaken kann.
»Wir sehen uns noch«, sagt die alte Dame im Gehen, und ich überlege, ob das wohl auch für mich und Matteo Bertani gilt, der mir über die Schulter einen letzten Blick zuwirft.
Wünschen sollte ich mir das wohl lieber nicht, denn immer, wenn er auftaucht, bringt er mich völlig durcheinander. Und vielleicht sollte ich ihm auch nicht so hinterherstarren, damit er das nicht errät. Deshalb wende ich rasch den Kopf ab – und sehe in Giacomo di Chessas immer noch lächelndes Gesicht.
»Setzen Sie sich zu mir, Miss Conroy«, fordert er mich auf und klopft auf den Platz, den Valentina Bertani frei gemacht hat. »Wir haben noch eine Menge zu besprechen, und ich denke, jetzt wäre eine gute Gelegenheit dazu.«
Andrew versteht den Wink und verabschiedet sich, nachdem er mir noch einmal kurz zugezwinkert hat, ebenfalls in Richtung Büffet, sodass wir einen Augenblick später allein sind.
Ein bisschen befangen lächle ich den alten Herrn an, der so viele Jahre lang die Geschicke des Kunsthistorischen Instituts an der La Sapienza geleitet hat, nicht sicher, wie ich das Gespräch beginnen soll, das wahrscheinlich darüber entscheidet, ob meine Reise nach Rom ein Erfolg wird oder nicht. Ich bin einfach noch zu beschäftigt mit dem, was gerade passiert ist, aber das scheint meinem potentiellen neuen Auftraggeber ähnlich zu gehen.
»Sie haben sich mit Matteo gestritten, nicht wahr?« Sein Blick sagt mir, dass er es ohnehin weiß, deshalb zucke ich hilflos mit den Schultern.
»Er ist …« Ich kann das gar nicht in Worte fassen, deshalb stoße ich seufzend die Luft wieder aus.
»Unmöglich?«, beendet Giacomo di Chessa den Satz für mich, und ich nicke heftig, weil es das ziemlich genau trifft. An dem nachsichtigen Lächeln meines Gegenübers erkenne ich jedoch, dass er das nicht so schlimm findet wie ich.
»Er will nicht, dass Sie Rom verlassen?« Ich formuliere es als Frage, weil ich das alles immer noch nicht verstehe.
»Nein.« Giacomo di Chessa schüttelt den Kopf. »Er ist gegen alles, was mit meinem Umzug zusammenhängt – auch und vor allem dagegen, dass ich meine Sammlung zu großen Teilen aufgeben will.«