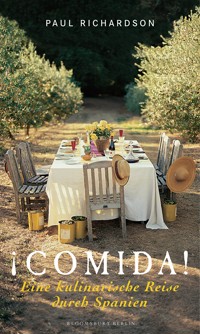
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob die mediterrane Küche der Küstenregionen, die einfachen Mahlzeitender Schafhirten in den Bergen oder Fast Food und Haute Cuisine in den quirligen Städten - Paul Richardsons atmosphärischer und informativer Reisebericht zeigt, dass spanische Küche mehr zu bieten hat als Paella, Gazpacho und Sangría. Ein Jahr lang reiste Richardson quer durchs Land, half bei der Olivenernte in Jaén und der matanza, dem traditionellen Schweineschlachten, in Caceres, besuchte Starköche wie Ferran Adrià an der Costa Brava, aber auch unbekannte Restaurants mit regionalen Spezialitäten.Gespickt mit vielen Insidertipps, interessanten Informationen zu Kultur und Geschichte und einem umfangreichen Adressteil ist dies ein einzigartiger Reiseführer durch Spanien und seine Küche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Die Küche eines Volkes kann, allgemein gesprochen, als Teil seiner Kultur gelten. Die Qualität des Essens, die Art seiner Zubereitung, wie viel Zeit seinem Verzehr gewidmet wird, die Manieren bei Tisch: All dies ist eng verbunden mit der ästhetischen Entwicklung eines Volkes und spiegelt diese häufig wider.
Angelo Pellegrini, The Unprejudiced Palate (1948)
EINFÜHRUNG
Reisen erweitert den Horizont – wer möchte das bestreiten. Doch mit einem kurzen Zwischenstopp im Rahmen einer Rundreise oder einem Wochenendausflug mit dem Billigflieger wird dies kaum gelingen. Um ein Land und seine Kultur wahrhaft zu erfassen, bedarf es schon längerer Zeiträume; der Erfahrung vieler Jahre, wenn nicht gar eines ganzen Lebens.
Das Erste, was uns in einem fremden Land auffällt, ist das Vordergründige, das uns angenehm, merkwürdig, ungewöhnlich oder zumindest harmlos vorkommen kann; entweder bestätigen diese Eindrücke unsere Vorurteile oder werfen Fragen auf, die uns zu näherer Betrachtung einladen. Also knabbern wir eifrig an den Rändern des Landes herum und reden uns bei jedem Bissen ein, dass seine Mitte ganz genauso schmecken wird – nur, um uns gegen die Fülle von Kulturschocks abzusichern, die einen als Fremden im Ausland erwarten. Doch nach und nach kommen wir auf den Geschmack und machen ihn uns, wer weiß, am Ende schließlich sogar zu eigen. Ich wählte dieses Bild ganz bewusst, um eine interessante und tiefsinnige These ins Spiel zu bringen; nämlich, dass der Genuss von Essen mehr ist als ein Spektakel, etwas, das außerhalb unserer selbst liegt. Vielmehr kann dieser Vorgang letzten Endes verinnerlicht und zum ureigenen Besitz werden, bis er einen Teil unserer selbst bildet. Der spanische Romancier Manuel Vicent geht so weit, Essen als mystischen Akt zu bezeichnen; das, was man verzehrt, wird umgewandelt in einen selbst.
Als ich als Teenager im Nachtzug aus Paris kommend die Grenze bei Port Bou passierte, war dies mein erster Abstecher nach Spanien. Bis dahin hatte ich, als Spross einer Mittelstandsfamilie aus dem wohlhabenden Süden Englands, meine Sommerferien in der Regel in Italien oder Frankreich verbracht. Spanien als Reiseziel stand in unseren gutbürgerlichen Kreisen nicht eben hoch im Kurs. Im Gegensatz zu Italien und Frankreich, Ländern mit stabilen sozialen Verhältnissen und solider Infrastruktur, wirkte Spanien – mit seinen endlosen Bettenburgen für anspruchslose Pauschaltouristen längs der Küsten und einem Landesinneren, das so beängstigend fremd war wie das tiefste Afrika – irgendwie unsolide. Kurz gesagt: Es besaß einen zweifelhaften Ruf. Vielleicht war es gerade das, was mich anzog.
Meine ersten Erfahrungen mit Spanien, seiner Lebensart und seiner Küche, sammelte ich eines Sommers auf einer zweimonatigen Reise per Interrail, diesem großartigen frühen Experiment in innereuropäischen Beziehungen. Interrail, das bedeutete kostengünstiges Reisen zu einer Zeit, als es noch keine Billigfluglinien gab, keine Handys und kein Internet, um Kontakt mit daheim zu halten. Papiere und Geld trug man in einem Gürtel am Leib, und ging einem das Geld aus, steckte man ganz schön in der Patsche, denn Geldautomaten waren zu jener Zeit in Südeuropa noch unbekannt, und über eine Kreditkarte verfügte ich als neunzehnjähriger Grünschnabel selbstverständlich noch nicht. Folglich ernährte ich mich hauptsächlich von preiswerter Imbisskost: tortilla de patatas, Fleischbällchen aus der Dose, patatas bravas mit pikanter Soße (bei Studenten sehr beliebt) und, wie ich sie gerne nenne, Bahnhofs-bocadillos – ein mit Käse, Schinken oder Chorizo belegtes Stangenbrot, pappig, reizlos und trocken, das nie mit Olivenöl, Tomaten oder dergleichen aufgepeppt wurde.
Meine Kenntnisse der spanischen Küche beschränkten sich auf die üblichen Touristenklischees: Paella und Gazpacho, Gazpacho und Paella. Was mir an typisch spanischen Zutaten bekannt war, hätte bequem Platz auf der Rückseite einer Ansichtskarte gefunden, einer jener seinerzeit beliebten Kitschpostkarten etwa, geziert von einer Flamencotänzerin mit plastisch appliziertem Kleid. Oliven, Apfelsinen, Safran, Knoblauch … was noch? Der ausgezeichnete spanische Schinken war mir unbekannt – kein Wunder, wie ich heute weiß, denn nach einem Ausbruch der Schweinepest Anfang der Achtzigerjahre kam der Export ins Ausland fast zehn Jahre zum Erliegen. Von Manchego-Käse hatte ich bestimmt schon einmal gehört. Dass es andere Käsesorten gab, konnte ich mir nur schwerlich vorstellen. Spanischer Wein war für mich Rioja oder Sherry, Sherry oder Rioja.
Was ich von der spanischen Küche kennen lernte, wurde nicht zuletzt durch meine spärlichen Sprachkenntnisse bestimmt; mein Wortschatz war eher gering, und unbekannte Gerichte zu bestellen, erschien mir zu riskant. So begrenzt mein Budget als Rucksacktourist auch war, zum Tagesausklang gönnte ich mir gerne ein Glas Sherry und ein Tellerchen Mandeln, vermutlich, weil ich dies für zutiefst spanisch hielt. In Anbetracht meiner Jugend und Unbedarftheit, ganz zu schweigen von der reizlosen Umgebung für diesen Aperitif, Bahnhofskneipen und Hotelcafés, wären Bier und ein Tütchen Chips womöglich angemessener gewesen.
Dennoch gab es Mahlzeiten, die sich mir nachdrücklich einprägten. Auf der Terrasse einer kleinen pensión im mallorquinischen Städtchen Deià, auf der es spätsommerlich nach Pinien und Meer duftete, wurde mir ein aromatisches Reisgericht serviert – mein erster »richtiger« spanischer Reis, mit Hühnchen und Paprika, zubereitet in der Pfanne, der paella, reichlich gewürzt mit goldfarbenem Safran. Dazu trank ich ganz allein eine Flasche eiskalten rosado und blickte verzückt und zunehmend beschwipst hinab aufs dunkle Meer.
Es war August, und Spanien befand sich im üblichen sommerlichen Ausnahmezustand: die Städte wie ausgestorben, die Strände übervölkert, Geschäfte und Restaurants, die sich auf Schildern in ihren Fenstern bis September von ihren Kunden verabschiedeten. Ausgerüstet mit einer Liste diverser Kontaktadressen, durchstreifte ich das Land mit den billigsten Bummelzügen. Spanien befand sich gerade inmitten einer demokratischen Revolution, wovon ich allerdings wenig ahnte; selbst 1982 noch mutete das Land unterentwickelt und aufregend exotisch an.
Die Züge waren rührend altmodisch und muffig, mit Abteilen und Fenstern, die sich so weit hinunterschieben ließen, dass man sich hinauslehnen konnte. Die Seife auf den Toiletten rieselte fein gemahlen aus einem Spender, wie Pfeffer aus einer Pfeffermühle. In jenen unschuldigen Tagen war es ganz normal, dass Zugreisende ihren Nachbarn von ihrem Essen anboten. Bei meiner Anreise im Nachtzug aus Paris nahm mich eine spanische Familie unter ihre Fittiche und lud mich ein, an ihrem nächtlichen Schmaus teilzuhaben: kalte panierte Lammkoteletts, Brot mit Tortilla, in Alufolie eingeschlagener jamón serrano in dünnen Scheiben und Gazpacho, der aus einer Thermosflasche in Plastikbecher gegossen wurde. Am Morgen darauf, bis Barcelona hatten wir noch eine Stunde Fahrt vor uns, wurde der Picknickkorb erneut geöffnet, und es gab café con leche und süße María-Kekse. Besonders eindrucksvoll fand ich, mit welcher Begeisterung die Familienmitglieder ihre Kekse in den Kaffee tunkten und die Tasse zum Mund hoben, um sich das kaffeegetränkte Gebäck auf kürzestem Wege zu Gemüte zu führen. Dies war mein erster Kontakt mit der vernünftigen spanischen Sitte, Festes zum Befördern von Flüssigem zu benutzen: Soße wird automatisch mit Brot vom Teller aufgestippt, Biskuitkuchen mit süßem Wein getränkt, heiße Schokolade vor allem zum Eintunken für knusprige, fettige churros frisch aus der Fritteuse genutzt.
Um unnötige Hotelausgaben zu vermeiden, richtete sich meine Reiseroute danach, wann meine Bekannten zu Hause anzutreffen waren. Von Mallorca aus reiste ich nach Madrid weiter, wo ein Schulfreund mit seiner Familie lebte, der mir seine Adresse gegeben hatte. Dort jedoch, im vornehmen Stadtteil Salamanca, traf ich niemanden an; die Concierge klärte mich darüber auf, dass die Familie den Sommer in ihrem Feriendomizil in Santander verbrachte. Es sei ein großes Haus mit weitläufigem Garten direkt am Strand, im Stadtteil El Sardinero, ich könne es gar nicht verfehlen. Also nahm ich den nächsten Zug nach Norden, fand das Haus tatsächlich und verlebte eine Woche mit der jeunesse dorée von Santander, abendliche Spritztouren durch die Stadt in den Nobelkarossen der reichen jungen Leute inklusive.
Meinen letzten Abend im Ort begingen wir mit einem späten Abendessen. Da ich noch nie um Mitternacht gespeist hatte, fand ich die Idee hinreißend dekadent. Wir aßen im Fischereihafen, wo kantinenartige Lokale Scharen von Gästen, die dort nach einem langen Tag am Strand ausgehungert einkehrten, frische Meeresfrüchte vorsetzten. Zinkplatten voller Garnelen a la plancha, Tintenfisch in eigener Tinte, knusprig frittierte calamares im Teigmantel, saftige gedünstete Muscheln, Venusmuscheln a la marinera mit Petersilie und Weißwein, riesige gekochte Krabben und haufenweise kleine schwarze Strandschnecken tauchten scheinbar aus dem Nichts auf und landeten in einem wüsten Durcheinander auf der weißen Papiertischdecke, die sich im Nu in ein fleckiges, zerknittertes Etwas verwandelte. Das Lokal hallte wider von den Stimmen der hundert zufriedenen Schlemmer, die sich beim Essen lautstark unterhielten. Man quetschte Zitronenhälften aus, knackte die Panzer und Scheren von Schalentieren, saugte und schlürfte und lutschte nach Herzenslust, stippte Brot in die Soßen und Tunken und trank krügeweise süßen Sangria mit Eis dazu. Was hier stattfand, war ein richtiges spanisches Festmahl, lärmend laut und auf den ersten Blick anarchisch, dabei aber im Grunde ganz kontrolliert. Immer neue Platten wurden serviert, und wir schlemmten bis tief in die Nacht. Für mich, den nüchternen, zurückhaltenden Engländer, war es eine wahre Offenbarung. Nie zuvor hatte ich geahnt, dass es möglich war, so viel Spaß zu haben.
Die Jahre vergingen, ich studierte und ließ mich dann in London nieder. Nachdem ich mich zunächst als Kellner und Gehilfe eines Weinhändlers versucht hatte, ergatterte ich eine Stelle als Redakteur bei einer Zeitschrift mit dem zwar mutigen, rückblickend aber auch ein wenig peinlichen Namen Taste, Geschmack, die für wenig Geld in einer ehemaligen Autowerkstatt in Fulham produziert wurde, unweit der alten Docks.
Die wirklich entscheidenden Momente im Leben ereignen sich meist dann, wenn man, wie John Lennon so treffend in Watching the Wheels sang, gerade anderweitig beschäftigt ist. Eines Freitagabends räumte ich gerade meinen Schreibtisch auf, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende war eine Frau von der spanischen Botschaft in London, Abteilung Lebensmittelexporte. Ganz atemlos trug sie mir ihr Anliegen vor: Am Wochenende fände in Madrid eine Messe rund ums Essen und Trinken statt, an der alle Küchenchefs teilnehmen würden, die derzeit in Spanien Rang und Namen hätten. Ein Pressevertreter sei in letzter Minute abgesprungen; ob ich Lust hätte, an seiner Stelle hinzureisen? Dazu müsste ich den ersten Flug in aller Frühe am Samstagmorgen nehmen. Alle Kosten und Spesen würden übernommen; ich dürfe mich als Ehrengast der spanischen Regierung betrachten.
Ich zögerte einige Sekunden lang. Fürs Wochenende hatte ich eigentlich noch nichts Besonderes vor. Und der Vorschlag klang reizvoll. In den späten Achtzigern mutete in London schon die Vorstellung eines spanischen Küchenchefs ungewöhnlich, wenn nicht gar abwegig an. Damals, nach den Umwälzungen der Nouvelle Cuisine, war Kreativität in der Restaurantküche nach wie vor die unangefochtene Domäne der Franzosen, während die zu der Zeit am höchsten geschätzte bodenständigere Kost fraglos aus Italien kam und die gastronomische Avantgarde eindeutig in Kalifornien zu Hause war. In dieser Hinsicht war Spanien schlicht und einfach ein weißer Fleck auf der Landkarte.
Dieses Wochenende im Mai bescherte mir mindestens zwei einschneidende Erlebnisse. Am Samstag war ich zu Gast bei einer Geburtstagsfeier an einem See, bei der ich den Menschen kennen lernte, der später mein Lebensgefährte werden sollte. Nacho war als Agronom beim Landwirtschaftsministerium tätig, als Experte für die Genetik von Saatgut; über den Anbau von Gemüse, Getreide und Obst wusste er besser Bescheid als jeder andere Mensch, dem ich bis dahin begegnet war – und seither begegnet bin. Mit Nacho ließ ich mich schließlich auch in Spanien nieder, zunächst in einem Haus auf Ibiza, und mit ihm lebe ich bis heute zusammen, auf einem Bauernhof in der Extremadura, wo wir beide, gestützt auf Nachos Fachwissen und meine eigenen über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren gesammelten Erfahrungen als Landwirt, unsere Nahrung fast vollständig selbst erzeugen.
Nacho ist in einer Familie mit sieben Kindern aufgewachsen, in der das Leben ein einziger Wirbel von Lärm und Erregung war. Das Zepter in der Familienküche schwang Nachos Mutter, María Teresa, eine bemerkenswerte Köchin und Frau, die mir über die Jahre viel über die schlichte und dabei abwechslungsreiche Kunst spanischer Hausmannskost beigebracht hat. Seit beinahe einem halben Jahrhundert kocht sie zwei Mahlzeiten am Tag, bestehend aus zwei oder gar drei Gerichten, bestimmt für ein wild fluktuierendes Publikum, je nachdem, welches ihrer Kinder nebst Ehegatten, Nachwuchs und Freunden gerade in der kleinen Wohnung der Familie in Alicante vorbeischaut.
María Teresa lässt sich beim besten Willen nicht davon überzeugen, dass ihre Gerichte irgendetwas Besonderes seien. Ich jedoch finde an ihrem Kochen gerade den Umstand bemerkenswert, den sie nicht der Rede für wert erachtet – ihr intuitives Verständnis dafür, dass es bei den Speisen, die man für eine Familie zubereitet, weniger um aufsehenerregende Knalleffekte oder exotische Zutaten, als vielmehr um den stetigen Rhythmus einer ausgewogenen Ernährung geht, Mahlzeit für Mahlzeit. Sie kocht sorgfältig, sparsam und schmackhaft. Ausgefallene Kost ist ihre Sache nicht, ausgenommen an ein paar wenigen Festtagen, vor allem an Weihnachten. Am ehesten könnte man ihre Kochkünste wohl als spanische Hausmannskost bezeichnen, die unterschiedliche Regionalküchen in sich vereint – wobei ihre Reisgerichte, ihr Geschick bei der Zubereitung verschiedener Artischockensorten und ihre levantinischen Spezialitäten wie pelotas de pava (Putenfleischbällchen) durchaus ihre Wurzeln in den Gemeinden der Südostküste, Alicante und Murcia, verraten. Ihre ursprünglich aus Asturien im Norden stammende Familie ist 1910 in den Süden gezogen, nach Santa Pola, um sich dort in der Salzgewinnung zu verdingen, und nie in die alte Heimat zurückgekehrt.
Nach diesem für mein Gefühlsleben so entscheidenden Samstag in Madrid sollte mir die Messe am Tag darauf die Augen dafür öffnen, dass sich in der spanischen Kochkunst Bemerkenswertes ereignete. Köche aus allen Ecken des Landes waren angereist, um ihre Region in einem Wettbewerb hochfliegender kulinarischer Ambitionen zu vertreten. Es waren vorwiegend Männer und Frauen in meinem Alter, die mit enormer Ernsthaftigkeit in Feldküchen überall auf der Messe zugange waren und raffinierte Gerichte zauberten, bei denen spanische Zutaten auf radikal neue Art und Weise verarbeitet wurden. Es haperte zwar an sprachlichem Verständnis bei mir, doch die sinnlichen Eindrücke sprachen auch so für sich: Da gab es Gazpacho aus Roter Bete mit Safranschaum, Reis mit Ziegenkäse, Tintenfisch, Spargel und Paprika oder auch Essenz von frischen Erbsen mit gelierten Entenmuscheln und salzigem Butterkaramell. Alles, was ich an jenem sonnigen Frühsommertag zu sehen und zu kosten bekam, war voller Wärme und Farbe. An einem Stand wurde feiner jamón serrano in Scheiben geschnitten und kredenzt – noch nie hatte ich einen derart kräftigen, aromatischen Schinken genossen, gegen den sich Parmaschinken geradezu fade ausnahm. Eine unübersehbare Fülle von Käsesorten, Weinen, Würsten und Eingemachtem war zu bestaunen. Kurzum, alles in allem drängte sich mir ein Gedanke auf, den ich nie zuvor in Betracht gezogen hatte – dass nämlich spanisches Essen, was Vielfalt der Zutaten und Reichtum der kulinarischen Regionaltraditionen betraf, den Vergleich mit den berühmteren Küchen Frankreichs und Italiens keineswegs zu scheuen brauchte. Dieses Wochenende bescherte mir ganz neue Einsichten und zeichnete für mein Leben Wege vor, denen ich noch heute, über fünfzehn Jahre später, folge.
Im Jahr 1991, als sich über meine britische Heimat der Grauschleier einer wirtschaftlichen Rezession legte, verließ ich London in einem braunen Mini Cooper. Was zunächst als einjährige Auszeit geplant war, wurde bald zu einem neuen Leben.
Über die Jahre ist mir das Kochen auf spanische Art in Fleisch und Blut übergegangen; seine Techniken und Rhythmen sind zu einem Teil meines Lebens geworden. Wenn ich nicht gerade im Land umherreiste, um Fischer und Bauern, Käsemacher und Küchenchefs zu treffen, bekochte ich Freunde, unterhielt mich über spanisches Essen oder verspeiste es. Meine Vorratskammer füllte sich mit spanischen Zutaten, meine Bibliothek mit spanischen Kochbüchern.
Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts befand sich Spanien an einem Scheideweg; die Nation vereinte in sich solche Extreme von Alt und Neu, von hergebrachter Tradition und wahnwitzigem Futurismus, dass es schon fast schizophren anmutete. Einerseits schien den Spaniern die eigene Vergangenheit fast egal; der Abschied von der Peseta und die Einführung des Euro war völlig reibungslos vonstatten gegangen. Gleichwohl fußte die Kultur im Alltag jedes Einzelnen, in Familien und Gemeinschaften nach wie vor unverkennbar auf dem Fundament der Geschichte, und zwar in Form von Traditionen. Die Beibehaltung althergebrachter Sitten und Gebräuche, in Moralfragen, Sprache, Festen, Religion, Landwirtschaft, Architektur oder auch Kochkunst, bildete weiterhin den zentralen Dreh- und Angelpunkt spanischer Lebensart. Doch wie lange mochte dieses heikle Gleichgewicht aufrechterhalten bleiben?
Nach und nach reifte in mir ein ehrgeiziger Plan heran: eine einjährige Rundreise, die mich ins Herz des kulinarischen Universums namens Spanien führen würde. Ich würde mich von außen nach innen vorarbeiten, ganz so, wie ich das Land auch selbst kennen gelernt hatte, dabei aus prägenden Erfahrungen mit spanischem Essen und spanischer Lebensart schöpfen und die Menschen und Landschaften aufsuchen, die die Essgewohnheiten der Nation geprägt hatten. Im Laufe dieses Jahres würde ich mich im ländlichen Landesinneren auf Spurensuche nach regionalen Traditionen begeben, aber auch die Begegnung mit der kreativen Kochkunst der modernen spanischen Großstädte suchen. Mindestens einen Sommer lang jedoch würde ich mich ganz auf die Küsten konzentrieren. Anfangen würde ich im touristischen Herzland von Alicante und mich von dort nordwärts nach Valencia begeben, an den Ort, der indirekt die Wahrnehmung der spanischen Küche in der Welt bestimmt, denn dort hat ihr Sinnbild, das landestypische Gericht überhaupt, die Paella, seine Wurzeln. Weiter nördlich an der Costa Brava, unweit der französischen Grenze, würde Touristenkost in ihrer schamlosesten Form, aber auch alta cocinaauf höchstem Niveau zu finden sein. In den Küstenorten des tiefen Südens, reich an Tradition, aber stark vom Tourismus gezeichnet, könnte ich womöglich feststellen, dass zwischen der Küche für Touristen und der für Einheimische gar kein so großer Unterschied besteht. Aber Spanien hat nicht nur eine Mittelmeerküste. Da gibt es auch noch die Atlantikküste mit einer sehr andersartigen kulinarischen Kultur, die gleichwohl gewisse entscheidende Gemeinsamkeiten aufweist. Oben im äußersten Nordwesten, in Galicien, gab es ein berühmtes Fest zu Ehren von Meeresfrüchten aller Art, das ich schon seit Jahren einmal hatte besuchen wollen. Dorthin wollte ich im Herbst reisen, vorausgesetzt, dass mir Fisch bis dahin noch nicht zum Hals heraushing.
Es war Mitte Juni, eine Jahreszeit, zu der bereits Temperaturen herrschten, die man in nördlicheren Breiten als hochsommerlich empfunden hätte, in Spanien jedoch bloß den ersten, noch angenehmen Auftakt des viermonatigen Höllenritts durch den Sommer bilden. Ich belud mein Auto mit Straßenkarten und Restaurantführern, Büchern über Geschichte und Geografie und traditionelle Küche der verschiedenen Regionen, nicht zu vergessen die Notizhefte, in denen ich jeden jemals geschlossenen Kontakt vermerkt hatte, jeden neuen Freund, dessen Telefonnummer ich mir nach einer in welcher Bar auch immer durchzechten Nacht aufgeschrieben hatte. Ich besorgte mir ein Handy, einen iPod voller Musik – und eine Schachtel Tabletten gegen Sodbrennen, für den Fall, dass es mal wirklich hart auf hart käme. Und dann tat ich das, was Zehntausende von Urlaubern im selben Moment taten: Ich packte reichlich Sonnenlotion ein und machte mich auf den Weg nach Benidorm.
KÜSTE
Levante
Wenn sich ein schlechter Ruf so hartnäckig hält, dass er schon annähernd mythische Dimensionen annimmt, spricht man in Spanien von einer leyenda negra. Und es gibt wohl wenige Legenden, die schwärzer wären – einmal abgesehen von der Inquisition, der Vertreibung der Juden unter den katholischen Königen und natürlich den Gräueltaten der spanischen Conquistadoren in der Neuen Welt – als der miserable Ruf des Essens, das einem in den fondas und posadas Spaniens angeblich vorgesetzt wird. Was Schriftsteller und Künstler anderer Nationalität seit jeher an Spanien reizte, diesem Land, das dem übrigen Europa in so vieler Hinsicht hinterherhinkte, waren die exotischen Archaismen – seine wilden und menschenleeren Landschaften, sein ungeheurer Reichtum an Kunstschätzen und eindrucksvollen Bauwerken –, doch nie, oder so gut wie nie, die Qualität seiner Küche.
Wenn Schriftsteller, die über Spanien schrieben, ihr Augenmerk der Landesküche zuwandten, dann in den meisten Fällen, um sie in den Schmutz zu ziehen. Quer durch die Epochen zählen reisende Literaten die immer gleiche Liste von Mängeln auf, als da wären miserable Hygiene, primitive Gerätschaften und eine im Ganzen unterentwickelte Kochkultur. Spanisches Essen galt allgemein als eintönige, unter unappetitlichen Bedingungen dürftig zubereitete, in ranzigem Öl schwimmende und nach Knoblauch stinkende Kost.
In Frankreich war man zwar fasziniert von der heißblütigen Wildheit des Nachbarn im Süden, blickte auf die Küche Spaniens jedoch seit jeher hochmütig herab. Des milliers de prêtres, et pas un cuisinier (Tausende Priester, aber kein einziger Koch), wie es ein geflügeltes Wort des neunzehnten Jahrhunderts auf den Punkt brachte. Der Priester und Diplomat Jean Muret war einer der ersten Franzosen, die über die spanische Küche geschrieben haben; er hat der Nachwelt die Schilderung einer Mahlzeit in einer posada in Tolosa im Jahre 1666 hinterlassen, die Züge einer tragikomischen Farce trägt: Als Vorspeise wird eine Schale voll wässriger Suppe gereicht, die nicht getrunken, sondern mit Brot aufgestippt werden soll. Dabei verbrennt sich der Priester prompt den Mund. Der zweite Gang besteht aus einem mit Essig und Öl angemachten Salat aus »Gräsern«, gefolgt von einem Stück Ziegenfleisch, so zäh, dass es erst nach halbstündigem Kauen hinuntergeschluckt werden kann.
Der einige Jahre später verfasste Reisebericht der Comtesse d’Aulnoy, einer tonangebenden Aristokratin ihrer Zeit, übte großen Einfluss auf die schreibende Nachwelt aus und trug maßgeblich zur Beliebtheit Spaniens und spanischer Sitten und Gebräuche unter mehreren Generationen französischer Romantiker bei. Die Gräfin fand la cuisine espagnole so abstoßend, so übermäßig mit Safran, Knoblauch und anderen Gewürzen versetzt, dass sie auf ihrer Reise durch Spanien wohl hungers gestorben wäre, hätte sie nicht ihren französischen Leibkoch dabeigehabt. Gnade allerdings fand vor ihren Augen das Obst, vor allem die Feigen; sie war überaus angetan vom Muskateller und bescheinigte dem spanischen Kopfsalat, er sei erfrischend und von süßem Geschmack. Kulinarischer Glanzpunkt ihrer Reise war das Mahl, das ihr im Hause einer Familie der gehobenen Madrider Gesellschaft kredenzt wurde; bei diesem Anlass labte sie sich an eingemachten Früchten, die auf Goldpapier gereicht wurden, und schlürfte heiße Schokolade mit Milch und Eigelb. Ansonsten jedoch fand die Comtesse an fast allem etwas auszusetzen. In Spanien, hielt sie fest, sei das geröstete Rebhuhn »in der Regel« schwarz verkohlt. Das Lamm sei recht zart (das hiesige Lammfleisch wird von frühen Reiseschriftstellern häufig gelobt), durch die Zubereitung in unsauberem Öl aber vollkommen verdorben. Hellauf entsetzt war die Gräfin über die spanischen Tischsitten, oder vielmehr den Mangel an ihnen: In manchen Gaststätten fand sie weder Besteck noch Servietten vor, ihre Tischgenossen stießen beim Essen ungeniert laut auf und stocherten sich hinterher mit Holzstäbchen zwischen den Zähnen herum, was sie scharf verurteilte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























