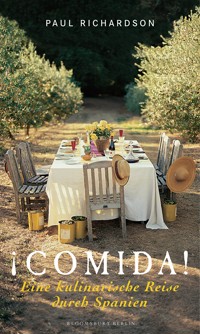21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Unsere geographischen Vorstellungen von der Welt erscheinen uns klar – doch viele entpuppen sich schnell als Mythen: Wir glauben zu wissen, was Kontinente sind – aber wo genau endet Europa, wo beginnt Asien? Bilden Nord- und Südamerika einen Kontinent, oder sind es zwei? Was ist mit der Antarktis oder Ozeanien? Wie fest (oder veränderlich) sind Grenzen? Was macht eigentlich eine Nation zu einer Nation? Dieses wunderbar originelle und leidenschaftliche Buch zeigt anhand vieler überraschender Geschichten: Die wirkliche Welt ist viel bunter und überraschender, als wir sie oft sehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem Englischen von Katja Hald
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Myths of Geography bei The Bridge Street Press, London
Copyright © Paul Richardson 2024
© der deutschsprachigen Ausgabe
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: plainpicture/Thordis Rüggeberg
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Einleitung: Imaginäre Geografien
1 Der Mythos von den Kontinenten
2 Der Mythos von der Grenze
3 Der Mythos von der Nation
4 Der Mythos von der Souveränität
5 Der Mythos vom messbaren Wachstum
6 Der Mythos vom russischen Expansionismus
7 Der Mythos von Chinas Neuer Seidenstraße
8 Der Mythos vom unweigerlichen Scheitern Afrikas
Fazit: Jenseits von Mythen
Dank
Literatur
Bildnachweis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
In Erinnerung an John Richardson
Einleitung: Imaginäre Geografien
Steht die Welt Kopf?
[1]
Vor gar nicht allzu langer Zeit lauerten an den Rändern unserer Landkarten noch geheimnisvolle Kreaturen. Drachen und Monster streiften durch die Landschaft, und Seeungeheuer zertrümmerten die Boote und Knochen all jener, die sich zu weit in ihre Gewässer vorwagten. In den Untiefen der Ozeane warteten Leviathan und der Kraken darauf, Schiffe in ihr Verderben zu ziehen; Sirenen, Schlangen, gigantische Seegurken und Riesenhummer bevölkerten die Albträume der Seeleute. Durch die Köpfe der Kartografen des Mittelalters und der Renaissance spukten fantastische Bestien, wenn sie die Berichte von schrecklichen Ungeheuern draußen im Meer auf ihren Karten zu gedruckten Legenden machten. Mythos und Realität verschmolzen, als diese Karten Abenteurer noch in ferne Länder lockten, um die Existenz der Bestien und der Schätze, die vermutlich unentdeckt in deren Gefilden lagen, zu beweisen. Sollten die Geschichten sich als wahr herausstellen, waren Ruhm und Reichtum gewiss.[1]
Doch dann verschwanden die Kreaturen und Monster nach und nach von den Landkarten, bis sie Ende des 17. Jahrhunderts schließlich ganz ausstarben. Dank der Fortschritte in Schiffsbau und Navigationstechnik hatten Europas Kartografen einiges über die Welt erfahren und gelernt, diese akkurater darzustellen. Ein Zeitalter der Wissenschaft und Vernunft war angebrochen und verdrängte die frühen künstlerischen Ausschmückungen und fantasievollen Geografien.[2] Dennoch sind die alten Karten bis heute von großer Bedeutung, weil ihre akribisch gezeichneten Ungeheuer uns einen bemerkenswerten Einblick in die Köpfe der Kartenmacher, Weltreichgründer, Abenteurer und Seefahrer gewähren, die einst die Meere durchkreuzten und den Globus kartierten. Sie enthüllen uns deren Hoffnungen und Ängste, bevor Fortschritt und Technik diese zähmten und aus einer bis dahin unbekannten die bekannte Welt wurde.
Doch diese Darstellungen unerforschter Landstriche und ihrer mysteriösen Bewohner hatten auch einen entscheidenden Einfluss darauf, was die Menschen über die Welt dachten, wie sie darüber sprachen oder sie sich erträumten. Kartografische Abbildungen verwischten Fakten und Fiktion zu Weltbildern, die sich wiederum auf das Verhalten der Menschen in und gegenüber der Welt auswirkten. Heute erscheinen uns diese Karten oft wie Hirngespinste, die von Mythen und Übertreibungen nur so strotzen. Aber vielleicht sollten wir mit den mittelalterlichen Meistern, die sie schufen, nicht allzu hart ins Gericht gehen. Denn wer garantiert uns, dass unser heutiges Weltbild nicht genauso von Mythen geprägt ist wie das damalige? Und dass uns die Karten und Systeme, die wir heute benutzen, um uns in der Welt zurechtzufinden, nicht genauso in die Irre führen?
Mythen gehören traditionell ins Reich des Übernatürlichen und Spirituellen, wo Erzählungen von der Geburt, dem Leben, den Abenteuern oder dem Tod menschlicher Protagonisten eng verwoben sind mit jenen von Göttern, Helden, Nymphen, Najaden, Elfen, Trollen oder auch Tieren und Pflanzen, um der Welt eine Bedeutung zu geben.[3] Mit dem Aufstieg der organisierten Religion gefolgt von einem Zeitalter der Wissenschaft und Vernunft verloren Mythen zwar an Rätselhaftigkeit und Bedeutung. Geht es jedoch darum, die Welt zu ordnen, sind sie so lebendig wie eh und je. Mythen der Geografie befasst sich mit einer ganzen Reihe dieser für unser Zeitalter relevanten Mythen und offenbart dabei deren anhaltende Macht und weshalb sie grundlegend sind für unser Verständnis der Welt und deren Geografie.
Wie die Mythen der Antike sind auch diese Narrative so tief in unserem Bewusstsein verwurzelt, dass wir sie häufig schon gar nicht mehr als Produkte unserer eigenen Fantasie erkennen. Die heutigen imaginären Geografien sind vielleicht nicht mehr dieselben wie die der Vergangenheit, doch auch sie können der Grund dafür sein, dass wir uns wie Don Quijote auf die Suche nach El Dorado machen oder losziehen, um einen Drachen zu töten, den es nie gegeben hat. Dieses Buch beschäftigt sich mit einigen fundamentalen Überzeugungen, die unser Leben definieren und unsere Wahrnehmung der Welt formen.[4] Es zeigt, dass Mythos und Geografie in vielerlei Hinsicht ein und dasselbe sind.[5]
Die Mythen, um die es hier geht, sind imaginäre Geografien: Auffassungen von der Erde, ihren Ländern, Kontinenten, Grenzen und Regionen, die in den Köpfen von uns allen existieren. Sie bilden die Welt nicht so ab, wie sie tatsächlich ist, sondern lediglich eine Vorstellung von ihr. Überall um uns herum tauchen sie auf und werden permanent wiederholt, in Bildern, Büchern, Geschichten, Karten, Schulbüchern, Reden, Theateraufführungen, Filmen, den Medien. Jeder dieser Mythen prägt, wie wir die Welt wahrnehmen und in ihr leben. Aber genau wie die Furcht einflößenden Monster, die einst die Landkarten bevölkerten, spiegeln sie nicht immer wider, was dort draußen tatsächlich existiert, sondern unsere Sorgen, Wünsche und Ängste. Diese Mythen sind Linsen, durch die wir uns selbst sehen.[6]
Die acht in diesem Buch beschriebenen Mythen nehmen wir in uns auf, seit wir als Kinder fasziniert einen Globus bestaunt oder Karten und Flaggen bunt ausgemalt haben. Jedes der nachfolgenden Kapitel nimmt sich eine dieser tief sitzenden Vorstellungen, die wir von der Welt haben, vor, krempelt sie um und zeigt, dass Mythen leichter Berge versetzen oder Kontinente erschaffen können als jeder geophysikalische Prozess. Sie setzen sich intensiv mit den Märchen, die wir uns über die Welt erzählen, auseinander und fragen: Welche Auswirkungen hat es, wenn unsere für selbstverständlich erachteten geografischen »Realitäten« plötzlich gar nicht mehr so real sind? Und wenn selbst einige der angesehensten Kartografen der damaligen Zeit die Welt »auf dem Kopf« gezeichnet haben, welche alternativen Betrachtungsweisen mag es dann noch geben? Könnte es sein, dass manche der grundlegendsten Vorstellungen, die wir von der Welt haben, nichts weiter sind als eine Täuschung? Und welche Konsequenzen hat es, in einer Welt zu leben, die nicht ist, wie sie ist, sondern so, wie wir sie uns vorstellen?
Dieses Buch stellt das lange vorherrschende Weltbild des Geodeterminismus infrage, dessen Ursprünge im alten Griechenland liegen und dem die Idee zugrunde liegt, dass Klima und physikalische Umgebung Einfluss auf die menschliche Intelligenz und gesellschaftliche Entwicklungen haben.[7] Eine Überzeugung, die später dann ausgezeichnet zum rassistischen und hierarchischen Denken des Kolonialismus passte und die notwendige Rechtfertigung für die imperiale Herrschaft über ferne Länder und deren Menschen lieferte. Jahrhunderte deterministischen Denkens haben bewirkt, dass auch die darin enthaltenen Vorurteile über Geografie und Umwelt sich als erschreckend hartnäckig erweisen.[8] Sie haben zu der falschen Annahme geführt, dass Geografie Schicksal ist und in gewisser Weise die Erklärung für den Aufstieg oder Niedergang einer Zivilisation, die vorherrschende Weltordnung und unsere geopolitische Zukunft. In diesem essenzialistischen Weltbild ist die Geografie gegeben und die Karten folgen ihr.
Die Beziehung zwischen dem Menschen und der Geografie ist jedoch wechselseitig. Wir haben Einfluss auf die Gestaltung unserer Welt wie beispielsweise an der Nordsee, wo wir eine neue Landschaft geschaffen haben, indem wir dem Meer Boden abgerungen und die Grenzen der Niederlande neu gezogen haben, oder im Amazonasgebiet, wo durch das Abholzen der Regenwälder große Anbauflächen entstanden sind. Auch die Erfindung neuer Technologien zeugt von der Wechselseitigkeit dieser Beziehung, angefangen bei Atomwaffen und modernen Drohnen, die einst strategisch wichtige Gebiete plötzlich unbedeutend machen, bis hin zum Klimawandel mit seinen tiefgreifenden Veränderungen für Landschaften und Meere, bei dem der Mensch ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Dieses Buch sieht uns, unsere Vorstellungen und unseren Erfindungsreichtum als Teil der Geografie und zeigt, dass diese uns gar nicht so sehr einschränkt, wie wir vielleicht glauben, und dass die Weltkarten und Atlanten, über denen wir seit unserer Schulzeit brüten, weder unveränderlich noch akkurat sind. Vielmehr sind wir zu Gefangenen bestimmter Ideen und Darstellungen von der Welt geworden.
Dieses Buch zeigt eine Welt, in der geografische Fakten nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Es begibt sich auf eine Reise durch Zeit und Raum, angefangen bei der Entstehung der Kontinente über den Aufstieg Chinas bis zum Krieg in der Ukraine; von Korea nach Japan, Bhutan, Simbabwe, China, Russland, Mexiko, in die Vereinigten Staaten, die Antarktis, die Sahara, das Südchinesische Meer und nach Zentralasien. Es möchte die im wahrsten Sinne des Wortes fesselnden Geschichten und Mythen, die wir uns über die Welt erzählen, offenlegen und uns von ihnen befreien. Dabei geht es weder um reine intellektuelle Neugier, noch ist es als Experiment gedacht. Es geht vielmehr darum, dass wir nur, wenn wir diese Mythen als das erkennen, was sie sind, in der Lage sein werden, uns den sehr realen Ungerechtigkeiten, der gesellschaftlichen Spaltung und den Umweltkatastrophen zu stellen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem vielleicht größten geografischen Mythos überhaupt: den Kontinenten. Deren Umrisse sind uns allen so vertraut, dass wir nur die Augen schließen müssen, und schon sehen wir sie, klar definiert durch die sie umgebenden Gewässer, deutlich vor uns. Aber sobald wir auch nur eine ganz einfache Frage stellen, werden die Konturen brüchig. Wie viele Kontinente gibt es? Darauf sollte es eigentlich eine klare Antwort geben, doch sie hängt davon ab, ob man Nord- und Südamerika als separate Kontinente betrachtet und die Antarktis als eigenständig. Und was ist mit Ozeanien? Welche Teile Asiens zählen dazu und welche nicht? Auch die Frage nach der Grenze zwischen Asien und Europa ist, ohne ein helfendes Meer dazwischen, nicht ganz so leicht zu beantworten, insbesondere da der Ural an seinem südlichen Ende ins Nichts ausläuft. Es mutet schon ein wenig merkwürdig an, dass wir weder in der Lage sind, die Anzahl der Kontinente eindeutig zu benennen, noch zu sagen, wo genau die Grenzen zwischen ihnen verlaufen.
Letztendlich sind es die Einfachheit der Idee und ihre ständige Wiederholung auf Bildern und Karten, die dem Mythos der Kontinente seine Macht verleihen. Es ist die Tatsache, dass sie die einzige Möglichkeit darstellen, unsere Welt zu unterteilen. Aber den Kontinenten mangelt es an ihnen innewohnenden Charakteristika, und ihre Abgrenzung wird dem Anspruch wissenschaftlicher Exaktheit nicht gerecht. So sind sie beispielsweise nicht durch die Plattentektonik oder geologische Merkmale definiert. Denn wäre dies der Fall, wäre es logischer, Indien Asien wieder abzuerkennen und Ozeanien zuzuordnen. Wäre die Welt hingegen entsprechend ihren Tier- oder Pflanzenarten unterteilt, würde die Sahara als kontinentale Grenze zwischen Asien und Europa sehr viel mehr Sinn ergeben als das Mittelmeer. Die Küste des eng vernetzten Mittelmeerraums wird nur durch zwei winzige Meerengen – die Straße von Gibraltar und den Bosporus – unterbrochen, die im Vergleich zu den gefahrvollen Weiten der Sahara fast lächerlich erscheinen. Durch die willkürliche Unterteilung in Kontinente werden unzählige Verbindungen, Schnittpunkte und Beziehungen, die unsere Welt ausmachen, unsichtbar. Genau wie die übrigen Mythen in diesem Buch verschleiern die Kontinente sehr viel mehr, als sie offenbaren.
Grenzen sind überall, von den Kontinenten bis zu den Rändern der Länder. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Mythos von der Grenze und den Mauern, die wir zwischen uns errichten, sowie der Frage, warum Grenzmauern nicht funktionieren. In seinen Präsidentschaftswahlkämpfen 2016 und 2024 machte Donald Trump den Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu einem zentralen Thema. Sein erster Versuch, eine Barriere hochzuziehen, erwies sich jedoch als wenig beeindruckend. Teile davon liegen schon jetzt vor sich hin rostend in der Sonora-Wüste herum, und 2021 haben Monsunregen große Abschnitte einfach weggespült. Häufig findet man an der Mauer auch die Leitern von Migranten, während andere mit Trennschleifern einfach Löcher hineingeschnitten haben. Schaut man genauer hin, sind diese Grenzmauern weniger massiv und unüberwindbar, als sie zunächst scheinen. Ihre Effektivität wird der einschüchternden Symbolik und ihren Ausmaßen nur selten gerecht, genauso wenig wie sie den Menschen das von ihren Architekten versprochene Gefühl von Sicherheit und klarer Abgrenzung geben. Aber das alles hat dem Glauben an den Mythos der Grenzmauern und daran, dass sie unverzichtbare Trenn- und Kontrolllinien darstellen, keinen Abbruch getan.
Solche enormen technischen Leistungen und Anstrengungen wie Trumps Grenzmauer, der Hadrianswall im Norden Englands oder die Chinesische Mauer werden in der Regel als eine sichere Verteidigungslinie zwischen »uns« und »denen« betrachtet. Aber in der Praxis funktioniert das so meist nicht. Vielmehr sprießen und gedeihen im Schatten dieser gigantischen Mauern oft die unterschiedlichsten Grenzkulturen. So bewachten am Hadrianswall einst Migranten aus dem heutigen Syrien und Rumänien Britanniens Nordgrenze, während China mehrfach von Dynastien jenseits seiner großen Mauer regiert wurde. Grenzen ziehen mindestens genauso viele Menschen an, wie sie abstoßen, und vermitteln so schnell ein Gefühl der Unsicherheit statt Sicherheit. Entgegen dem Mythos, der sie umgibt, symbolisieren Grenzen und ihre Mauern nicht Stillstand, sondern Bewegung. Der Hadrianswall war keine unüberwindbare Barriere – kurz nach seiner Erbauung wurde er gleich wieder aufgegeben und neu besetzt. Und auch Trumps Mauer hat wenig dazu beigetragen, den Strom der Migranten – und Drogendealer – zu stoppen. Im Gegenteil, je höher und länger die Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko wird, umso mehr Ängste werden in den USA geschürt und umso verzweifelter versuchen Migranten, diese Grenze zu überwinden. Wenn das Verantwortungsgefühl für das Leben anderer an der Grenze endet, bringt das keine Sicherheit, für niemanden. Auf diese Weise schützen wir uns nur vor unserer eigenen Menschlichkeit.
Grenzen werden heute vor allem in Zusammenhang mit der Nation gesehen, die angeblich auch dann noch existieren wird, wenn wir selbst schon lange nicht mehr da sind. »Ein England wird es immer geben«, heißt es in einem patriotischen Kriegslied aus dem Jahr 1939 – oder auch jedes andere Land, dem wir uns zugehörig fühlen. Dieses Gefühl von Ewigkeit bildet den Kern des Mythos der Nationen und der Überzeugung, dass diese nicht nur uralt, sondern auch natürlich gewachsen sind. Um eine Nation zu erschaffen, braucht es jedoch viel Fantasie, ein selektives Gedächtnis und die Fähigkeit, unschöne Wahrheiten auszublenden. Moderne Nationen sind ein Kaleidoskop vergangener und gegenwärtiger Migration, das Ergebnis von Konflikten, Kolonisierung und der Vermischung von Kulturen. Je weiter man sich auf der Suche nach dem Ursprung einer Nation in die Vergangenheit begibt, umso vager wird dieser. Das ist auch der Grund, warum moderne Nationen immer wieder neu erfunden, präsentiert, interpretiert und erlernt werden müssen. Das endlose Sich-neu-Erfinden der Nationen ist mittlerweile derart selbstverständlich geworden, dass ein Denken, Handeln, Regieren und Lehren außerhalb des Rahmens der Nationalstaaten nahezu unmöglich geworden ist.
Dass die Idee der Nation so formbar ist, bedeutet jedoch auch, dass bestimmte Menschen – seien es die Nachfahren eines obskuren deutschen Adelsgeschlechts, Ex-KGB-Agenten oder New Yorker Bauunternehmer – sie leicht für sich vereinnahmen können. Sie definieren sie nach ihren Vorstellungen einfach neu und verhalten sich, als wäre sie schon immer so gewesen. Dahinter steckt oft die Absicht, auf Kosten anderer Macht, Wohlstand und Einfluss von Eliten zu erhalten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir den größten Teil der Menschheitsgeschichte auch ohne Nationalstaaten ausgekommen sind und unsere Loyalität und Identität an andere Gemeinschaften, Religionen oder Institutionen gebunden waren. So wie Imperien einst unendlich erschienen, wird auch die heutige Organisation der Welt in Nationen nicht unweigerlich in Zukunft Bestand haben. Werden wir uns zwischenzeitlich selbst dazu verdammen, ständig irgendwelche Konflikte um Gebiete und Grenzen auszutragen? Verfolgen und marginalisieren wir weiterhin Minderheiten, die den vorherrschenden, vermeintlich »ewigen« Werten der Nation nicht entsprechen? Und hält uns unsere Besessenheit von der Nation davon ab, gemeinsam Probleme wie Pandemien oder den Klimawandel anzugehen, die keine internationalen Grenzen kennen?
Nach dem Problem der Nation stellt sich mit dem vierten Mythos eine weitere unangenehme Frage: Wem gehört eigentlich die Welt? Auf politischen Weltkarten ist jedes Fleckchen Erde in der Farbe eines bestimmten Landes schraffiert. Es gibt jedoch ein paar mysteriöse Orte, an denen unsere Vorstellungen von Territorium, Besitz und Autorität nicht ganz so einfach greifen. So ist Bir Tawil in der östlichen Sahara beispielsweise der einzige bewohnbare Ort der Erde, auf den kein Staat aktiv Anspruch erhebt. Im Mittelmeerraum wiederum gibt es einen religiösen Orden, der eigene biometrische Pässe ausstellt, Briefmarken druckt, Münzen prägt, Nummernschilder ausgibt, einen Botschafter in der EU sowie einen offiziellen Status bei den Vereinten Nationen hat und diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Ländern unterhält, obwohl er weder Land noch Grenzen besitzt. Auch die Antarktis stellt hierbei eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Die riesige Landmasse ist weder Eigentum eines einzelnen Staates, noch wird sie von einem solchen verwaltet. All diese Kuriositäten verbindet ein langer roter Faden, der, wenn man an ihm zieht, offenbart, dass der Anspruch eines Landes auf die Souveränität über ein bestimmtes Gebiet keine zwingende Notwendigkeit ist.
Seit Sommer 2016 führt man zudem ein Experiment im großen Stil durch, bei dem es darum geht, herauszufinden, was Souveränität im 21. Jahrhundert bedeutet. Großbritanniens Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, basierte auf dem Mythos der Souveränität. Das heißt auf der Vorstellung, dass die Grenzen eines Gebiets festgelegt sind und die Kontrolle darüber ganz einfach zurückgefordert werden kann. Das vierte Kapitel untersucht die Diskrepanz zwischen dieser Idee und einer Welt, die viel zu komplex ist, um entweder komplett innerhalb – oder außerhalb – der Autorität eines einzelnen Staates zu liegen.[9]
Obwohl sich Souveränität durch Grenzmauern und Infrastrukturen konkretisieren lässt, bleibt sie letztendlich ein abstraktes Konstrukt. Sie variiert von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit und selbst von Person zu Person. Sobald idealisierte Vorstellungen von Souveränität mit der chaotischen Realität kollidieren, sind ihre Komplexität und Widersprüchlichkeit jedoch erstaunlich präsent. Aber wenn wir die räumliche und zeitliche Fluktuation der Souveränität anerkennen, eröffnet uns dies dann nicht auch Möglichkeiten, eine andere Weltordnung zu formulieren? Welche Alternativen zu unserer aktuell von Grenzen durchzogenen Welt ergeben sich aus der Tatsache, dass die Souveränität überall um uns herum bröckelt?
Wenn Kontinente, Länder, Grenzen und Souveränität – die wir für selbstverständliche Bausteine unserer Welt erachten – nur Auswüchse fiebriger geografischer Fantasien sind, dann muss uns doch zumindest etwas so Greifbares und Solides wie die nationale Wirtschaft garantieren, dass nicht alles in dieser Welt nur ausgedacht ist. Sollte man meinen. Aber unglücklicherweise ist selbst die Art, wie wir Wachstum und Entwicklung der Wirtschaft messen – anhand des Bruttoinlandsprodukts (BIP) –, nichts weiter als eine erfundene Tradition. Warum also bestimmt das BIP, wie wir uns selbst und unsere Länder einstufen? Gibt es keine bessere Methode, Menschen und Orte zu beurteilen? Insbesondere wenn man bedenkt, dass in manchen Teilen der Welt diverse Gemeinschaften seit Jahren – oder gar Jahrzehnten – ein deutlich gesünderes Leben führen als ihre reicheren Landsleute.
Wenn Wirtschaftswachstum allein also kein verlässlicher Indikator für Wohlbefinden und Wertigkeit ist, darf ein steigendes BIP dann als Zeichen für Fortschritt gewertet werden, oder ist es vielmehr eine tickende Zeitbombe? Sind wir einem Mythos verfallen, wenn wir glauben, Wachstum messen zu können? Messen wir Fortschritt womöglich in Zahlen, die uns nur sehr wenig über den Zustand der Menschen und der Welt sagen? Obwohl schon seit Längerem bekannt ist, dass die Berechnung des Wirtschaftswachstums anhand des BIP erhebliche Mängel aufweist, hat dieser mysteriöse Wert uns erstaunlicherweise nach wie vor fest im Griff. Aber das Streben nach einem immer größeren Wirtschaftswachstum kann dauerhaft unmöglich zu mehr Wohlstand und Sicherheit führen, wenn sich gleichzeitig durch das Roden der Regenwälder und das Trockenlegen von Feuchtgebieten Klimanotstand und Massenaussterben von Arten beschleunigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die menschliche Gesellschaft – getrieben von ihrer unersättlichen Gier nach Ressourcen – es mit dem derzeitigen Kurs des ewigen Wachstums auf katastrophale Weise versäumt, die akute Bedrohung ihrer Umwelt zu erkennen. Aber es könnte das letzte Mal sein. Angesichts des rasant voranschreitenden Klimawandels und steigender Meeresspiegel wirft das fünfte Kapitel die Frage auf: Wie kommt es, dass BIP und Wirtschaft wachsen und wir trotzdem untergehen?
Mit den noch verbleibenden Mythen, denen hier nachgegangen wird, widmet sich dieses Buch drei großen Regionen, die vom Westen historisch missverstanden wurden. Bei der ersten handelt es sich um Russland und die sehr aktuelle Frage, warum das Land immer wieder bei seinen Nachbarn einfällt. Putin, der einst davon geträumt haben mag, die »russische Welt« zu einen und eine Eurasische Union zu gründen, der als gefeierter Anführer Russland wieder in den Status einer anerkannten Großmacht erheben wollte, hat diesen Traum zu einer Schmach verkommen lassen. Die 2022 begonnene blutige Invasion der Ukraine scheint den Mythos von Russland als landgieriger, expansionsbesessener Weltmacht zu bestätigen.
Es ist eine überzeugende, reizvolle und scheinbar offenkundige Idee, in die Putin sich da verrannt hat. Doch was Putin für die beste Methode hält, Russland wieder zu seinem alten Status in der Welt zu verhelfen, ist kein einfacher Expansionismus, sondern Revanchismus, ein lähmender Kurs der Repression und des aggressiven Nationalismus. Dabei hat ausgerechnet er ein Teilgebiet Russlands einst einfach weggegeben, nur um das Ansehen seines Landes zu verbessern. Im Jahr 2008 wurde in einer schlichten Zeremonie auf Bolschoi Ussurijsk – einer Insel im Amur, auch bekannt als Heixiazi Dao – die chinesische Flagge gehisst und die Hälfte der Insel friedlich von Russland an China übergeben.[10] Seitdem florieren die Beziehungen zwischen Russland und China. Für Putin stellt sich jedoch eine knifflige Frage: War dieses territoriale Zugeständnis dem Ansehen Russlands in der Welt nicht sehr viel zuträglicher als sein revanchistischer Anspruch auf die Ukraine? Das Schicksal Russlands war nie allein von Expansionismus geprägt, angefangen beim Verkauf Alaskas im 19. Jahrhundert bis hin zur Abgabe jener Inseln an China. Die Invasion der Ukraine könnte daher durchaus das unausweichliche Ergebnis der verzerrten Wahrnehmung und Täuschungen des Putinismus sein. Aber sie findet im Rahmen einer imaginären Geografie statt, die eher auf Kränkung basiert als auf schlichtem expansionistischen Streben nach strategisch wertvollen Gebieten.
Russland war für den Westen lange ein Rivale, in jüngster Zeit ist mit China jedoch ein neuer Herausforderer auf den Plan getreten. Vor einigen Jahren hat das Land das größte Bauprojekt gestartet, das die Welt je gesehen hat – die Neue Seidenstraße. Künstliche, aus dem Südchinesischen Meer ragende Betoninseln und einsame Zugstrecken von den chinesischen Küsten quer durch Eurasien bis in den Londoner Osten, die China mit dem Rest des Globus verbinden sollen. Die Projekte der Neuen Seidenstraße reichen in alle Himmelsrichtungen weit über die Grenzen Chinas hinaus bis nach Bolivien oder zu den Bermudainseln, um sich zum ambitioniertesten Infrastrukturnetz der Welt zusammenzufügen. Steckt hinter dem Mythos einer Neuen Seidenstraße, deren Projekte eine neue Weltgeografie gestalten könnten, mehr als nur das Gerangel um die Weltherrschaft? Führen alle Wege unweigerlich nach China? Kann ein derart gigantisches Vorhaben erfolgreich sein? Oder wird es unter seinem eigenen Gewicht und der Last ungenutzter Infrastruktur zusammenbrechen oder gar im Meer versinken?
Um diese Fragen zu beantworten, muss der Blick über den reduktionistischen Mythos von Chinas Wunsch nach geopolitischer Macht hinausgehen. Die Gründe und Überlegungen hinter der Neuen Seidenstraße sind vielschichtig und nicht notwendigerweise aus einer Position wirtschaftlicher und politischer Stärke geboren. China verfolgt hier weniger eine kohärente Strategie als vielmehr ein Programm, das von der Jagd nach mysteriösen Drachen bestimmt wird – angefangen beim Erfüllen staatlich vorgegebener BIP-Ziele und der Ausübung souveräner Kontrolle bis hin zur Legitimation eines autoritären Regimes und der Stärkung der nationalen Identität des heimischen Publikums. Diese konkurrierenden und widersprüchlichen Ziele bergen das Risiko einer Kollision der imaginären Geografie einer Neuen Seidenstraße mit einer physischen Geografie und Humangeografie, die sich deren Willen nicht ohne Weiteres unterordnen.
Das letzte Kapitel schließlich befasst sich mit Afrika und dem Mythos, dass es vor sich selbst gerettet werden muss. Die Art und Weise, wie wir diese Region sehen und in ihr agieren, ist auch heute noch von der im Westen aktiv geförderten Vorstellung geprägt, dass Afrika »im Kampf gegen seine eigenen Probleme funktional hilflos« ist.[11] Diese Sichtweise verschleiert jedoch die Lebendigkeit, Diversität und Komplexität der Region. Die Darstellung Afrikas als eines Kontinents, der die unterstützende Einmischung und Wohltätigkeit von außen benötigt, ist der jüngste Versuch einer langjährigen Tradition, Afrikas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer wieder neu zu schreiben. In früheren, weniger wohlmeinenden Zeiten führte dieses Vorgehen zu Absurditäten wie den ausgeklügelten Hirngespinsten der weißen Herrscher Rhodesiens (1965–1979) über den Ursprung der prächtigen Fundstätte von Groß-Simbabwe. Diese vom 11. bis ins 16. Jahrhundert bewohnte, mittelalterliche Stadt ist mindestens genauso beeindruckend wie alles, was im zeitgenössischen Europa zu finden war. In unter rhodesischer Herrschaft verfassten Schulbüchern und vermeintlich akademischen Artikeln wurden die Ruinen jedoch zur Hinterlassenschaft arabischer Händler und Spuren eines alten, ausgestorbenen Volkes erklärt oder gar einer geheimnisvollen, verschwundenen »weißen Zivilisation« zugeschrieben.[12] Jedem, nur nicht der einheimischen Bevölkerung Simbabwes, die dort die Hauptstadt eines großen Königreichs errichtet hatte.
Mit derartigen Mythen hat man in den vergangenen Jahrzehnten zwar gründlich aufgeräumt, aber Geografie und Geschichte der Region werden auch heute noch lektoriert und zensiert. Anstatt eine ehrlichere Darstellung der Geschichte ihrer einstigen Weltreiche zu lehren, herrscht bei früheren Kolonialmächten wie Großbritannien ein Wissensvakuum, in dessen Lücke die nostalgischen Mythen einer unterstützenden, wohlwollenden oder zivilisierenden weißen Herrschaft hartnäckig überdauern und von den Qualen und der Schande des Empire ablenken. Die traumatischen Ereignisse zwischen Kairo und Kapstadt, die das Schicksal von Millionen Menschen bestimmten und bis heute die Welt gestalten, sind in den Ländern, die diese zu verantworten haben, kaum bekannt. Die Mythen der Vergangenheit hinter sich zu lassen, erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte, ansonsten werden ganze Regionen weiterhin übersehen und kleingehalten und die Phantomschmerzen und unfreiwilligen Zuckungen des Empire wegen »verlorener« Gebiete niemals aufhören.
Der letzte Teil dieses Buches stellt die Frage, was als Nächstes kommt. Der erste Schritt wird sein, sich über eine Reihe weithin akzeptierter Vorstellungen von der Welt und ihren Regionen, die wir in der Regel nicht hinterfragen, hinwegzusetzen. Denn auch wenn diese Mythen für viele von uns Realität geworden sind, dürfen wir nicht weiterhin unerschütterlich daran glauben, sonst laufen wir Gefahr, genauso blind in die Zukunft zu segeln wie einst die Seeleute, die sich aufmachten, um nach den fantastischen Ungeheuern am Rande der Welt zu suchen.
Die meisten der geografischen Mythen in diesem Buch waren für unsere Vorfahren jahrtausendelang kein Thema. Warum sollten sie uns also heute die Hände binden und unsere Zukunft bestimmen? Sich von nur einem dieser Mythen der Geografie zu distanzieren, hätte gewiss drastische Konsequenzen. Aber gibt uns der Glaube an sie tatsächlich die Harmonie und Sicherheit, nach der wir uns sehnen? Sind sie es wirklich wert, dafür zu leben und zu sterben? Um uns den globalen Problemen, mit denen wir uns derzeit konfrontiert sehen, stellen zu können, müssen wir uns von den geografischen Mythen, die wir uns selbst aufgebürdet haben, befreien. Wir müssen neue Möglichkeiten ersinnen, Veränderungen zu bewältigen, sowie umfassendere Methoden, Fortschritt zu messen und Vertrauen aufzubauen.
Viele Lösungsansätze gibt es bereits, wie das Fazit des Buchs zeigt. Mit Beharrlichkeit, Mut, Verständnis und der Bereitschaft zu lernen können wir die realen und die imaginären Mauern, die uns trennen, niederreißen. Den Mythen, die unsere Welt beherrschen, auf den Grund zu gehen und sie aufzudecken, ist ein beunruhigender und uns zuweilen widerstrebender Schritt ins Unbekannte. Umso mehr, als wir es mit einer immer komplexeren Medienlandschaft zu tun haben, in der Fakten und Fiktion verschmelzen und die sich von den alten Karten, die Ergebnisse wissenschaftlicher Vermessungen und Untersuchungen mit rätselhaften Kreaturen und goldenen Städten kombinieren, vielleicht gar nicht so stark unterscheidet. Trotzdem besteht Hoffnung. Denn sobald wir die Mythen der Geografie als das erkennen, was sie sind, können wir die Macht unserer Fantasie vielleicht auch dazu nutzen, mutige neue Welten zu gestalten.
1 Der Mythos von den Kontinenten
Wie viele Kontinente gibt es?
Der Thingvellir-Nationalpark in Island besticht durch seine einzigartige und mysteriöse Szenerie. Schartige Risse und spektakuläre Klippen zeugen von der Kraft der Erde, ganze Landschaften zu formen. Weite grasbedeckte Lavafelder und Schluchten aus hoch aufragendem Vulkangestein, das sich über den Besuchern zu schließen scheint, prägen die Landschaft. Im kristallklaren Wasser der Seen, die sich entlang des durch zwei auseinanderdriftende tektonische Platten entstandenen Grabenbruchs gebildet haben, spiegeln sich schneebedeckte Gipfel und hohe Felsgrate.[13] Für manche Besucher besteht der Reiz an einem Besuch dieses UNESCO-Welterbes aber vor allem in der Möglichkeit, zwischen den beiden Erdplatten zu schwimmen, auf denen sich Europa und Nordamerika befinden. Der Spalt zwischen den Platten ist dort nur einen halben Meter breit, und das prickelnde Gefühl, »Europa« und »Amerika« gleichzeitig zu berühren und mit dem eigenen Körper zwei Kontinente zu verbinden, macht ihn zu einem der beliebtesten Tauchspots der Welt.
[2]
In das eiskalte Wasser des Thingvallavatn, Islands größten natürlichen Sees, einzutauchen, ist allerdings nichts für schwache Nerven. Das kristallklare, durch mehrere Vulkansteinschichten gefilterte Wasser ist zwar so sauber, dass man es trinken kann, wird aber nie wärmer als ein Grad über dem Gefrierpunkt.[14] Während einem die Kälte den Atem raubt und die eisige Tiefe unglaubliche Einblicke in die Schönheit der Unterwasserwelt eröffnet, wenn man hineintaucht, fragt man sich dann doch irgendwann, wo im Grabenbruch – der sich durch den gesamten Nationalpark und weiter durch Island und den Atlantik zieht – man wohl wiederauftaucht. In Europa oder in Amerika? Hängt es davon ab, auf welcher Seite man wieder an Land krabbelt? Oder befindet sich dieser Ort – und ganz Island – gar nicht in Europa, sondern liegt irgendwo zwischen den Kontinenten? Im eiskalten Wasser des Thingvallavatn bekommt unsere klare Vorstellung von den Kontinenten, die uns umgeben, gewaltige Risse.
Für die meisten von uns sind die Kontinente auf den ersten Blick erkennbar – ihre Umrisse durch die sie umgebenden Gewässer klar festgelegt. Wo auch immer auf der Welt wir uns bewegen, wir sind stets in der Lage zu sagen, auf welchem Kontinent wir uns befinden. Aber schon die einfachsten Fragen stellen uns vor ernsthafte Probleme: Wie viele Kontinente gibt es? Sind Nord- und Südamerika ein Kontinent oder zwei? Stellt die Antarktis einen eigenen Kontinent dar? Welche Teile Asiens gehören zu Ozeanien? Und wo ziehen wir die Grenze zwischen Europa und Asien, wo kein Meer oder Ozean uns zu Hilfe kommt?
Dass wir nicht sofort und verbindlich beantworten können, wie viele Kontinente es gibt und wo ihre Grenzen verlaufen, obwohl wir absolut sicher sind, dass sie existieren, erscheint merkwürdig. Umso mehr, als ihre Form sich uns von Kindesbeinen an eingeprägt hat und wir sie seitdem immer wieder auf Karten, Atlanten und Bildern zu sehen bekommen. Der Mythos von den Kontinenten basiert auf der Einfachheit des Systems und dessen ständiger Wiederholung – auf der Annahme, dass sie offensichtlich sind und die einzige Möglichkeit, unsere Welt zu ordnen. Einer geografischen Region die ehrenvolle Bezeichnung »Kontinent« anzuheften, liegt jedoch nicht einfach so auf der Hand. Vielmehr stellt sich die unangenehme Frage: Wer hat die Umrisse der Kontinente eigentlich festgelegt und wann? Welche Konsequenzen hat es, die Welt in ein paar wenige gigantische Landmassen zu unterteilen?
Tatsächlich sagt uns das Schema der Kontinente relativ wenig über die physische Geografie der Welt, dafür aber umso mehr über uns selbst. Die Art, wie wir die Erde aufteilen, verschleiert viele der Feinheiten, in Bezug auf den Menschen, die Natur und die Geologie. Tatsächlich zeichnen sich die Kontinente weder durch geografische Einförmigkeit aus noch durch ureigene naturgegebene Charakteristika oder die wissenschaftliche Genauigkeit ihrer Kategorisierung. Vielmehr unterstreicht unsere derzeitige Wahrnehmung, die trotz zahlreicher Fakten, die das Gegenteil beweisen, auf einer bedeutungsvollen Existenz der Kontinente beharrt, die Macht unserer Vorstellungskraft.
Der Mythos der Kontinente ist so mächtig, dass er seine eigene Realität geschaffen hat. Bilder der Kontinente begegnen uns heute überall, in Klassenzimmern, auf Gepäckstücken, Logos und sogar auf Deodorants. Und doch sind sie Teil eines seit Langem existierenden Mythos, dessen Entstehungsgeschichte Martin Lewis und Kären Wigen in ihrem exzellenten Buch erzählen, dessen Titel diesem Kapitel den Namen gibt. Der Ursprung des Narrativs kann bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden,[15] als die Bewohner des antiken Griechenland – oder besser seine Philosophen, Geografen und Seefahrer – die Gebiete zu beiden Seiten der Ägäis, des Schwarzen Meeres und des Asowschen Meeres »Europa« und »Asien« nannten.[16] Für den Austausch, die Kultur und den Handel in der griechischen Welt waren diese Meere lebensnotwendig.
Doch die alten Griechen wussten wenig über diese Landmassen, abgesehen von einzelnen Bereichen ihrer Küstengebiete. Schon damals war die Unterteilung in Kontinente mehr als umstritten, und einige Denker »benutzten den Begriff Europa offensichtlich als Synonym für das nördlich gelegene (nicht-griechische) Thrakien«, welches heute dem Südosten der Balkanregion entspricht.[17] Andere verorteten zwar das griechische Festland innerhalb Europas, nicht aber die Inseln und die im Süden gelegene Halbinsel Peloponnes.[18] Während wieder andere – insbesondere der Philosoph und Gelehrte Aristoteles (384–322 v. Chr.) – behaupteten, die griechischen Gebiete und der Charakter ihres Volkes würden die »Mitte« zwischen Europa und Asien einnehmen.[19] Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, trennte man Libya – wie das heutige Afrika in der klassischen Antike genannt wurde – im Westen des großen Nildeltas von Asien ab und erhielt so ein Gebilde aus drei Kontinenten.[20]
Für den griechischen Geografen und Historiker Herodot (etwa 484–425 v. Chr.) war die Grenze zwischen Asien und Afrika entlang des Nils ein willkürlicher Schnitt, der die offensichtliche Einheit des Nildeltas im nördlichen Ägypten durchtrennte.[21] Herodot merkte an, dass Afrika und Asien nicht wirklich separat waren, sondern zusammenhingen, eine missliche geografische Tatsache, genau wie der Fakt, dass sie jedes für sich auch mit Europa verbunden waren. »Eine weitere Frage, die sich mir stellt«, so Herodot, »ist, warum drei unterschiedliche Frauennamen [Europa, Asien und Libya] an eine einzelne Landmasse vergeben werden sollten.«[22]
Trotz des frühen Widerspruchs formte das Schema aus drei Kontinenten ein Weltbild, das bis weit über das klassische Zeitalter hinaus Bestand hatte und über fast zwei Jahrtausende unverändert der Kategorisierung diente. Doch auch wenn das Schema weitgehend aufrechterhalten wurde, verschob sich die Bedeutung der Kontinente in dem Maß, wie neue Regionen hinzukamen. Mit dem Aufstieg des Christentums erhielten sie zudem einen religiösen Wert, indem man sie in die Geschichte der Nachfahren Noahs einbettete. Laut dem Heiligen Hieronymus (347–420 n. Chr.), dem Übersetzer der Biblia Vulgata, »gab Noah jedem seiner drei Söhne Sem, Ham und Jafet einen der drei Teile der Welt zum Erbe, und diese waren Asien, Afrika und Europa«.[23] So erhielt das Drei-Kontinente-Weltbild eine neue, spirituell untermauerte Legitimität und Macht.
Obwohl verschiedene Geografen des alten Griechenland und des Römischen Reichs – insbesondere Ptolemäus (etwa 100–170 n. Chr.) – sich darum bemühten, Form und Konturen der Kontinente wahrheitsgetreu wiederzugeben, opferte man diese frühen Bestrebungen nach geografischer Genauigkeit später auf dem Altar eines theologischen Weltbilds.[24] Elemente der geografischen Vorstellungen der alten Griechen verschmolzen im mittelalterlichen Europa mit einer religiösen und spirituellen Geografie, deren kosmologisch durchdrungene Kartografie besonders auffällig in sogenannten TO-Karten zum Ausdruck kommt. In diesen Karten repräsentiert das »O« die Grenzen der bekannten Welt, und das »T« – das Kreuzsymbol in der Mitte – steht für Mittelmeer, Nil und den Don (früher Tanais), der durch Zentralrussland ins Asowsche Meer fließt. Diese drei Gewässer sollten die Landmassen Europas, Asiens und Afrikas voneinander trennen. Europa war den mittelalterlichen Kartenmachern in der Regel zwar bekannt, dennoch zeichneten sie es nur als Teil der gesamten Schöpfung. Die Betonung lag auf einem unter Gott geeinten Universum, zu dessen Gunsten man auf eine akkurate Darstellung der Welt, wie Ptolemäus und ein paar Gleichgesinnte sie eingeführt hatten, verzichtete.[25]
Auch die Kompassnadeln auf den alles andere als präzisen TO-Karten sind für den modernen Betrachter eher verwirrend, da sich darauf häufig nicht Norden, sondern Osten oben befindet. Im Osten ging nicht nur die Sonne auf, sondern dorthin wandten die Christen des Mittelalters auch den Blick, wenn sie auf die zweite Wiederkunft Christi warteten.[26] Die theologische Orientierung dieser Karten erinnert uns daran, dass niemand jemals wirklich sicher sein kann, in welche Richtung sich der Erdball im Universum eigentlich dreht. Denn auch wenn der Kompass momentan vielleicht verlässlich nach Norden zeigt, polt sich alle paar Jahrtausende das Magnetfeld der Erde um, und der magnetische Nord- und Südpol tauschen plötzlich die Plätze. Drehen wir unsere Karten dann einfach auf den Kopf oder malen das andere Ende der Kompassnadel rot an? Und wenn Norden, Süden, Osten und Westen nicht ein für alle Mal festgelegt sind, welche anderen geografischen Gewissheiten wackeln dann noch?
[3]
Bei einem Besuch der Kathedrale im englischen Hereford offenbart ein Blick auf die Mappa Mundi (etwa 1300) eine Welt, die sich um eine völlig andere Achse dreht. Es handelt sich dabei um eine der hervorragend erhaltenen TO-Karten mit dem Osten dort, wo heute Norden liegt. Asien ist auf der Mappa Mundi oben zu finden, und Europa wurde auf die linke untere Hälfte verbannt. Von ungefähr der Mitte der Karte bis zum unteren Rand erstreckt sich ein langes, schmales Mittelmeer mit einem übertrieben breiten Don und Dnjepr, einem dünnen Ägäischen und Schwarzen Meer als linker Seite des »Ts« und dem Nil samt Delta als dessen rechter Seite.[27]
Karten wie diese wurden nicht in erster Linie zur Navigation erstellt, die Kontinente bildeten vielmehr den Hintergrund für eine heilige Landschaft. Auf der Mappa Mundi ist erhalten, wie Gelehrte des 13. Jahrhunderts die Welt sahen, sowohl spirituell als auch geografisch. Im Zentrum liegt Jerusalem, und genau dort hat eine Untersuchung des Originals mit dem 3-D-Scanner den winzigen Einstichpunkt enthüllt, an dem der Kartograf den Zirkel auf das Pergament gesetzt und mit dem »O« den Rand der Welt festgelegt hat.[28] Die Kontinente selbst sind mit Darstellungen der menschlichen Welt sowie zeitgenössischen Mythen, Legenden und Wundererzählungen überzogen. Neben realen Kathedralen und Städten – darunter Paris, Rom, Petra, Damaskus und Hereford – entdeckt man Wunder der antiken Welt, wie den Koloss von Rhodos oder den Leuchtturm von Alexandria, sowie Bezüge zu den Feldzügen Alexanders des Großen. Die Karte bildet aber auch biblische Ereignisse und Orte ab, unter anderem Noahs Arche, den Garten Eden, die untergegangenen Städte Sodom und Gomorrha, den Turmbau zu Babel und die Teilung des Roten Meers. Überall tummelt sich merkwürdiges Volk, angefangen bei einer Gestalt auf Skiern in Norwegen bis hin zu einem einäugigen König in Äthiopien, zudem allerlei Pflanzen, Tiere, Vögel und andere Kreaturen – sowohl reale als auch der Fantasie entsprungene. Und mit dem Labyrinth des Minotaurus auf Kreta, dem Goldenen Vlies oder den Säulen des Herakles an der Straße von Gibraltar ist sogar die klassische Mythologie vertreten.[29]
Je weiter man sich von Europa entfernt, umso dichter wird die Erde von Monstern und Ungeheuern besiedelt. Seltsame Völker und Geschöpfe streifen durch die Randgebiete der Welt: kopflose Blemmyer, Skiapoden mit einem einzelnen gigantischen Bein, in Höhlen hausende Troglodyten, hundeköpfige Kynokephale, in ihre riesigen Ohren gehüllte Panoti, ein über einem Smaragd wachender Griffon und kannibalische Issedonen. Auf dieser Karte existieren Mythos und Realität eng nebeneinander, »alles ist eingefangen und festgehalten, Vergangenheit und Gegenwart, Nahes und Fernes«. Die Mappa Mundi ist Zeugnis einer »von Gott geplanten Welt«,[30] in Teilen aber auch ein faszinierendes und zugleich beängstigendes Fenster in das Reich jenseits Europas, das den damaligen Betrachter in Angst und Schrecken versetzt haben muss. Imaginäre Geografien können sehr lange in den Köpfen haften bleiben, und in den darauffolgenden Jahrhunderten der Kolonialzeit, als es immer häufiger zu Kontakten zwischen Europa und Asien, Afrika und später auch Nord- und Südamerika kam, rechneten die Europäer stets damit, dort den Monstern der Karte zu begegnen.[31]
[4]
TO-Karten waren zu jener Zeit jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Welt wiederzugeben. Mitte des 12. Jahrhunderts schuf Muhammad al-Idrisi eines der großartigsten Werke der mittelalterlichen Geografie und Kartografie. Al-Idrisi, Spross einer adeligen Familie aus Ceuta in Marokko, studierte in Cordoba und begann schon mit sechzehn Jahren, ausgedehnte Reisen zu unternehmen. Er besuchte den Mittelmeerraum und Anatolien, fuhr die Nordwestküste der Iberischen Halbinsel entlang und kam sogar bis nach England. Um das Jahr 1138 wurde er von Roger II., dem normannischen König von Sizilien, nach Palermo eingeladen, der dort zwischen 1130 und 1154 regierte. Der König glaubte wahrscheinlich, al-Idrisis adelige Herkunft könnte ihm für seine politischen Ziele im westlichen Mittelmeerraum nützlich sein, am Ende waren es dann aber al-Idrisis Karten, die die Sicht auf die Welt grundlegend veränderten.[32]
Für die Erstellung seines Meisterwerks, Tabula Rogeriana, in dem er 70 regionale Landkarten und arabische Begleittexte zusammenträgt, brauchte al-Idrisi fünfzehn Jahre.[33] Es ist eine bemerkenswerte Ansammlung des kartografischen und regionalen Wissens jener Zeit, und die Karten bilden erkennbar, wenn auch etwas unproportional, sowohl Europa und Asien als auch den nördlichen Teil Afrikas ab. Al-Idrisi orientierte sich an der kartografischen Schule Ptolemäus’ – die ihren Ursprung in dessen Schrift Geographike Hyphegsis[34] hat –, wurde aber auch durch muslimische Kartografen der von Abū Zaid al-Balchī begründeten Schule der arabischen Geografie beeinflusst, deren Karten den Süden oben und Mekka in der Mitte verorteten.[35] Dass al-Idrisi griechisches und arabisches Wissen mit seinen eigenen Beobachtungen und den Berichten anderer Reisender kombinierte, war auch der Grund, weshalb seine Arbeit für die folgenden dreihundert Jahre die präziseste Weltkarte darstellen würde.[36] Obwohl al-Idrisis Welt verglichen mit den heutigen Vorstellungen scheinbar auf dem Kopf steht, ist die Tabula Rogeriana eine revolutionäre und erstaunlich akkurate Darstellung der Erde und zeitgleich an anderen Orten des christlichen Europas hergestellten Weltkarten weit voraus.[37]
Erst als das Mittelalter ins Zeitalter der Entdeckungen und die Renaissance überging, kehrte man in Europa zu einer geografisch genaueren Unterteilung der Kontinente zurück. Das im 15. und 16. Jahrhundert wiedererwachte Interesse an griechischer und römischer Gelehrsamkeit führte dazu, dass man sich erneut zum Erbe Ptolemäus’ bekannte, welches in fast ganz Europa über tausend Jahre verloren gegangen war.[38] Grundsätzlich stellten jedoch nur wenige Gelehrte der Renaissance das in der Antike entstandene System der Kontinente infrage, man reproduzierte einfach die dreigeteilten Darstellungen mittelalterlicher Kartografie. Allein durch die immer genauere Kategorisierung und Abgrenzung von Humangeografie und physischen Geografien gewannen diese Landmassen zunehmend an Autorität und Bedeutung.[39]
Während die Kartografen und Geografen der Renaissance immer präzisere Karten von Europa, Asien und Afrika zeichneten, sahen sie sich jedoch plötzlich mit einem »kosmologischen Schock« epischen Ausmaßes konfrontiert,[40] der neue geografische Probleme mit sich brachte – der unerwarteten Entdeckung Amerikas. Ein gewisser Seefahrer aus Genua namens Christopher Kolumbus hatte – anfangs noch mit dem Ziel Asien – gemeinsam mit portugiesischen, spanischen und florentinischen Entdeckern den Atlantik überquert und dort ungewollt die Bekanntschaft mit einer neuen Welt gemacht. Die »Entdeckung« Amerikas zerschmetterte die vorherrschende und gottgewollte Weltordnung geradezu, und auf den Weltkarten musste dringend Platz geschaffen werden für einen neuen Kontinent.[41]
[5]
Dieser Moment ist auf der außergewöhnlichen Universalis Cosmographia (1507) des deutschen Kartografen Martin Waldseemüller festgehalten, die 2003 zur teuersten Karte der Welt wurde, als die United States Library of Congress sie für 10 Millionen Dollar von Prinz Johannes Waldburg-Wolfegg erstand.[42] Ihr Preis spiegelt wider, dass viele in ihr gewissermaßen die »Geburtsurkunde Amerikas« sehen.[43] Waldseemüller hat auf der Universalis Cosmographia – zum ersten Mal überhaupt auf einer Weltkarte – eine separate westliche Hemisphäre mit dem Pazifik als trennendem Ozean gezeichnet. Sie wurde nach den Reisen des florentinischen Seefahrers Amerigo Vespucci (1454–1512) erstellt, der nach seiner Entdeckungsfahrt zwischen 1501 und 1502 von der Neuen Welt als eigenständiger Landmasse berichtet hatte. Waldseemüller taufte diese Vespucci zu Ehren »America« und gab so dem »neuen« Kontinent und der »neuen« Welt ihren Namen.[44]
Im späten 17. Jahrhundert stellte man in Europa dann Atlanten her, die die Welt ganz eindeutig in vier Hauptlandmassen gliederten – Europa, Asien, Afrika und Amerika.[45] Dabei hatten die Kartografen aber ein Problem, das auch schon die alten Griechen beschäftigte: Wo die Grenze zwischen Europa und Asien ziehen? Fortschritte in der Geografie und den Techniken der Kartografie warfen die unangenehme Frage auf, wo genau diese beiden Kontinente begannen und wo sie endeten. Erkenntnisse von Forschungsreisen in den Osten stellten die Kartografen vor ein kaum zu lösendes Problem: Europa und Asien waren fest miteinander verbunden, und es gab kein nennenswertes Gewässer, das die beiden Kontinente sauber voneinander trennte.[46]
Für die alten Griechen waren die Gebiete jenseits der Nordküste des Asowschen Meeres weitgehend Terra incognita, was sich für die Kartografen der Antike und ihre Nachfolger im frühen Mittelalter als großes Glück erwies, denn es ermöglichte ihnen die einfache Unterteilung der Welt in drei Kontinente.[47] Um zwischen Asien und Europa zu unterscheiden, dehnte man das kleine und flache Asowsche Meer – das durch die Straße von Kertsch mit dem Schwarzen Meer verbunden ist – in Richtung Norden aus, sodass Europa nur noch durch eine schmale Landbrücke mit Asien verbunden war und sich dahinter der Arktische Ozean erstreckte. Und um diese »natürliche« Grenze zwischen den Kontinenten perfekt zu machen, durchtrennte diesen dünnen Streifen Land auch noch der Don, der von seiner Quelle in der Arktis angeblich südwärts ins Asowsche Meer floss.[48] Mit ihrem erfundenen großen Fluss im Norden und einem übertrieben ausgedehnten Asowschen Meer reflektierten diese Karten eine Logik, wie die Welt aussehen müsste, nicht aber, wie sie wirklich war.
Es waren Darstellungen der Welt, die zunehmend dem widersprachen, was man an den östlichen Rändern Europas entdeckte. Im 16. Jahrhundert mussten Geografen und Kartografen sich allmählich daran gewöhnen, dass der Don noch nicht einmal in der Nähe des Arktischen Meeres entsprang und das Asowsche Meer sehr viel kleiner war, als man es sich ausgemalt hatte.[49] Die Trennlinie zwischen Europa und Asien – die sich fast zwei Jahrtausende zuvor etabliert hatte und zudem aufgrund der christlichen Interpretationen als heilig angesehen wurde – erwies sich jedoch als äußerst hartnäckig, und es fiel schwer, sich davon zu verabschieden.[50] Sie aufzugeben, war angesichts der vorherrschenden geografischen Vorstellungen ein drastischer Schritt. Es musste eine neue Grenze zwischen den Kontinenten festgelegt werden, die der Schöpfung zu hundert Prozent entsprach – zumindest der Vorstellung davon – und mit unüberwindbaren Gebirgszügen oder breiten Schluchten ihrer Bestimmung gerecht wurde – eine kaum zu bewältigende Aufgabe.
Bei den ersten Versuchen im 16. und 17. Jahrhundert, solch eine neue Trennlinie zu ziehen, wurde eine Auswahl an Flussläufen in Russland herangezogen, die man als Verlängerung des Don Richtung Norden vorschlug – darunter Wolga, Kama, Nördliche Dwina, Petschora und Ob. Man hoffte, diese Wasserwege würden sich als akzeptable und vertraute Grenze bis in die Arktis erweisen und die vorherrschende kontinentale Symmetrie aufrechterhalten.[51] Aber die Lösungsvorschläge brachten nur neue Probleme, da die Flüsse ohne Verbindung endeten oder stellenweise so schmal waren, dass sie als imposante Grenze zwischen zwei Kontinenten nicht taugten.
Es bedurfte des entschiedenen und entschlossenen Eingreifens eines schwedischen Offiziers, um die Trennlinie zwischen Asien und Europa aufrechtzuerhalten. Philipp Johann von Strahlenberg (1676–1747) gelangte zu der Überzeugung, dass das Uralgebirge sehr viel besser als Grenze zwischen den Kontinenten geeignet war als ein Fluss. Diesen Vorschlag unterbreitete er 1730 in einem Buch und mit einer Karte, auf der der Ural eindeutig den Hauptteil der Grenze zwischen Asien und Europa bildet. Am südlichen Ende des Urals führte von Strahlenberg die Grenze entlang der Samara und dann der Wolga in Richtung Westen bis in die Nähe von Zaryzin (Wolgograd), wo sie dem Don am nächsten kommt. Dem flachen Ackerland zwischen den Flüssen fügte er auf seiner Karte ein paar Hügel hinzu, die diese Lücke geschickt füllen, bevor die Grenze auf dem letzten kurzen Stück dem Don bis ans Asowsche Meer folgt und schließlich am Schwarzen Meer endet. Die Neuerung wurde von zeitgenössischen russischen Intellektuellen schnell aufgegriffen, insbesondere jenen, die die Modernisierungs- und Europäisierungspläne des ersten russischen Herrschers und Zaren Peters des Großen unterstützten.[52]
Während seiner langen Herrschaft (1682–1725) gründete Peter I. 1703 das an der Ostsee gelegene und nach ihm benannte St. Petersburg. Die Stadt, das Fenster nach Europa, wurde auf Land gebaut, das Russland dem nördlichen Rivalen Schweden im Großen Nordischen Krieg (1700–1721) abgerungen hatte. Dieser Krieg war auch der Grund für von Strahlenbergs dreizehnjährige Gefangenschaft in Westsibirien.[53] Während Russland im Norden schwedisches Gebiet eroberte, dehnte es sich auf der Jagd nach wertvollen Fellen auch immer weiter Richtung Osten aus,[54] sodass es sich Ende des 18. Jahrhunderts von der Ostsee bis nach Alaska über ganz Eurasien erstreckte. Gemeinsam mit dem von Tumulten begleiteten Umbau der russischen Gesellschaft durch Peter I. in etwas, das einem europäischen Staat sehr nahekam, verlieh diese Ausdehnung der Grenze zwischen Europa und Asien eine aktuelle politische Bedeutung.