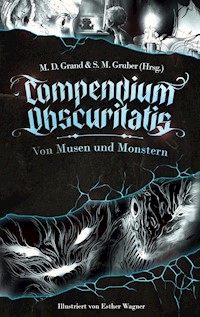
Compendium Obscuritatis E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was knistert da zwischen den Seiten dieses Buches? Du fühlst es doch auch, oder? Dieses Ziehen in andere Phantasien. Es kratzt, es holt, es lockt Dich. Obwohl Du alles schon gelesen hast, was die Phantastik zu bieten hat. Oder obwohl Du normalerweise keine Fantasy liest. Du entkommst nicht. Neue Phantasiegestalten warten auf Dich, ob gut oder böse oder irgendwas dazwischen. Muse, Monster, Kuriosität. Komm, trau Dich, ihrem Ruf zu folgen. Das Kollektiv Nikas Erben setzt sich aus Autor*innen verschiedenster Genres zusammen. Für diese Anthologie haben sie völlig neue phantastische Kreaturen erfunden, wie Du sie bisher noch nicht gelesen hast. Mit Illustrationen von Esther Wagner. Autor*innen: Vanessa Glau, M. D. Grand, S. M. Gruber, Andreas Hagemann, June Is, Jessica Iser, Kia Kahawa, Magret Kindermann, Wolfgang Lamar, Lily Magdalen, Liv Modes, Nicole Neubauer, Eva-Maria Obermann, Denny Sachs, Babsi Schwarz, Katharina Stein, Matthias Thurau, Julia von Rein-Hrubesch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bisherige Anthologien und ihre Herausgeberinnen
2017: Sehnsuchtsfluchten, Julia von Rein-Hrubesch/Nika Sachs
2018: Briefe aus dem Sturm, Magret Kindermann/Wiebke Tillenburg
2019: Herzgezeiten, Magret Kindermann/Wiebke Tillenburg
Für alle, die den Mut haben, hinzusehen
Dieses Buch enthält Inhaltswarnungen / Content Notes auf der letzten Seite gegenüber der Deckel-Innenseite.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Magret Kindermann:
Heiße Schokolade
Eva-Maria Obermann:
Inspirii
Matthias Thurau:
Extras
Vanessa Glau:
Das Gift in der Literatur
Wolfgang Lamar:
Ektoplasmatische Idylle
M. D. Grand:
Schattenbande
Matthias Thurau:
Generationen
June Is:
Leser zwischen den Welten
Vanessa Glau:
Rituelle Reinigung mit Apfelessig
M. D. Grand:
Inika oder der Staub des Lebens
Julia von Rein-Hrubesch:
Gezeiten
Liv Modes:
Eine Rose im Schnee
Kia Kahawa:
Ch’la, das Schlafmonster
Babsi Schwarz:
Das hungrige Wasser
Eva-Maria Obermann:
Gedankensammler
Andreas Hagemann:
Karl
Katharina Stein:
Nachtanbruch
Denny Sachs:
Der Buchesser
S.M. Gruber:
Grüner Tod
Jessica Iser:
Nixenfraß
Nicole Neubauer:
Definitiv nichts mit Tieren
Magret Kindermann:
Der Regengeist
Lily Magdalen:
Muse. Chaos.
Danksagung
Die Autor*innen
Inhaltswarnungen / Content Notes
Vorwort
COMPENDIUM OBSCURITATIS ist Latein - wie Du Dir vielleicht schon gedacht hast - und heißt frei übersetzt so viel wie »Lehrbuch der geheimnisvollen Merkwürdigkeiten«.
Aber wahrscheinlich weißt Du das schon und fragst Dich viel eher, warum unser Kollektiv eigentlich Nikas Erben heißt. Sei beruhigt, da bist Du nicht alleine. Wilde Theorien wurden bereits aufgestellt, von der düsteren Mafiavergangenheit bis zum Großerbentum einer reichen Baronin mit einer Vorliebe für die schönen Künste war schon alles dabei. Dabei ist es ganz einfach: Die großartige Autorin, Lektorin und Künstlerin Nika Sachs hat 2017 die erste Anthologie dieses damals noch namenlosen Kollektivs herausgegeben - zusammen mit Julia von Rein-Hrubesch, die uns bis heute erhalten bleibt. Nika hat so unglaublich viel Herzblut in die Schreibwerkstatt gesteckt, aus der dann die Anthologie Sehnsuchtsfluchten entstanden ist, dass wir das Kollektiv unbedingt weiterführen wollten. Auch nachdem Nika aus persönlichen Gründen leider nicht weitermachen konnte. Daher haben Magret Kindermann und Wiebke Tillenburg die Herausgeberinnenschaft übernommen und die Anthologien Briefe aus dem Sturm (2018) und Herzgezeiten (2019) herausgebracht. Für das Compendium Obscuritatis - Von Musen und Monstern durften nun wir das Ruder in die Hand nehmen und könnten nicht stolzer auf das Ergebnis sein.
Wie kommt aber eine Gruppe von Autor*innen aus unterschiedlichsten Genres darauf, eine phantastische Kurzgeschichtensammlung zu veröffentlichen? Und dann auch noch nicht mal Adaptionen oder Variationen klassischer Motive, sondern mit dem Anspruch, komplett neue Phantasiegestalten zu erschaffen? Nun, das liegt an der Natur des Kollektivs Nikas Erben. Wir lieben es einfach, uns scheinbar unmöglichen kreativen Herausforderungen zu stellen. So kam es, dass die demokratische Entscheidung auf das Thema »neue Phantasiegestalten« fiel. Keine Vampire, Hexen, Werwölfe sollten es sein, sondern noch nie dagewesene Ausgeburten unserer merkwürdigsten Hirngespinste.
Und was für Gespinste das sind! Da gibt es die inspirierenden, musenhaften Wesen, die uns Kreativität einflößen und Geistesblitze bescheren. Da gibt es aber auch düstere, bösartige Wesen, die Deine Kinder stehlen oder Dich durch die dunkelsten Ecken Deines Bewusstseins jagen. Und es gibt alles dazwischen, sagenhafte Kreaturen, die sich in Grauzonen am wohlsten fühlen, die irgendwo im Nebel lauern, zwischen Träumen und Visionen - oder mitten unter uns.
Viel Kribbeln beim Lesen wünschen Euch die Herausgeberinnen
Eure M. D. Grand & S. M. Gruber
Magret Kindermann
Heiße Schokolade
Als sie blinzelte, ballten sich die Wolken über ihr zusammen. Schlagartig wurde es dunkler.
War ich das etwa?, dachte Maria in den Donner hinein. Natürlich war sie es nicht. Sie konnte nicht das Wetter kontrollieren, auch wenn sie das geliebt hätte. Der erste Regentropfen traf ihr Kinn, der zweite landete auf der Mütze ihres Babys, das sie in einem Tragetuch hatte. Sie spreizte die Finger über sein Köpfchen, doch das würde es kaum vor dem Regen schützen. Bis nach Hause waren es bestimmt noch fünf Minuten. Vor ihr aber lag das bei jedem beliebte ÖkoCafé Isolde, direkt am Fenster war noch ein Platz frei, das sah sie durch die Scheibe, und es wirkte gemütlich. Maria steuerte schon darauf zu, als sie sich umentschied. Sie würde es bestimmt noch vor dem Regen nach Hause schaffen.
Beim Überqueren der nächsten Straße bereute sie den Entschluss, denn der Regen prasselte plötzlich so heftig auf die Erde, dass sie kaum einen Meter weit sehen konnte. Maria beugte sich über das Bündel vor ihrem Bauch und fluchte, sie eilte unter ein Vordach.
Da entdeckte sie ein Licht. Eine tanzende Flamme hinter einer dreckigen Glasscheibe. Dahinter sah sie weitere flackernde Lichtquellen, es waren Kerzen auf runden Tischen. Noch nie hatte sie wahrgenommen, dass hier noch ein Café war. Ohne lange zu überlegen, öffnete sie die Tür - es klingelte - und schlüpfte hinein.
Sie schaute hinunter, ihr Baby hatte die Aufregung verschlafen. Maria strich über den blonden Flaum auf dem Köpfchen und steuerte den hintersten Tisch am Fenster an. Beim Setzen wurde ihr Kind wach. Ihre Brustwarze kribbelte, ein sicheres Zeichen, dass es Hunger hatte.
Der Kellner kam und fragte nach ihrer Bestellung.
»Eine heiße Schokolade ohne Sahne, bitte.« Sie schaute nicht auf, weil sie damit beschäftigt war, ihr Baby aus dem Tragetuch zu heben.
Erst als es zufrieden und noch im Halbschlaf an der Brust lag, sah sie sich um. Das Café hatte eine seltsame Atmosphäre. Die Kerzen waren am Tag an, an der Wand hing ein Bild von Pasta neben einem von der Akropolis in Athen und daneben klebte ein Poster eines Reisebüros: Cuba Libre oder Cuba? In hohen Regalen wurden Waren von Olivenöl bis Gummibärchen angeboten. Ein neongelbes Schild daneben warb: Unsere Kondome sind die besten - 500 Euro! Die nackte Glühbirne flackerte, es gab keine Toiletten und es spielte keine Musik. Dafür stand in der Ecke ein Kinderkarussell mit quietschbunten Plastikpferden, dessen Spitze sich in die Decke bohrte. Der Putz war an dieser Stelle abgebröckelt. Das Café wirkte, als würde es nur so tun, als wäre es ein Café. Maria war der einzige Gast.
»Hier, bittä«, sagte der Kellner und Maria schreckte auf. Vor ihr stand ein Glas mit schaumiger, heißer Schokolade. Auf dem Unterteller lagen ein kleiner Löffel und ein Butterkeks. Wenigstens das Getränk schien in Ordnung zu sein.
»Danke«, sagte sie und blickte hoch. Der Kellner hatte einen schiefen, geschwungenen Schnurrbart und ein Augenbrauenpiercing. Es fiel Maria schwer, ihn anzuschauen, denn er schien zu flackern wie das Licht. Er lächelte und lief zurück zum Tresen, an dem eine verstaubte Happy-Birthday-Girlande hing. Dabei wackelte er seitwärts wie Charlie Chaplin und hob seine Beine wie ein Pelikan. Vielleicht hat er eine Behinderung?, dachte Maria.
Das Baby war inzwischen wieder eingeschlafen und träumte, was sie an den flatternden Lidern erkannte.
»Na, Marcel, träumst du von der Geburt?«, flüsterte Maria ihm ins Ohr.
Das Baby gluckste.
Der Regen erreichte durch das lange Vordach nicht die Fensterscheiben, doch er war so stark, dass die restliche Welt nicht mehr zu erkennen war. Mit dem Ende des Vordachs begann der nasse, prasselnde Vorhang.
Sobald der Regen nachlässt, verschwinde ich hier, dachte Maria. Das Café war ein seltsamer Ort und sie hatte ein unangenehmes Gefühl. Doch sie wollte auf keinen Fall so horizontlos wie ihre Mutter sein, die Marias Meinung nach viel zu schnell Menschen verurteilte und Neues ablehnte. Sie beschloss, den Ort schätzen zu lernen.
Sie klappte den Still-BH zu und Marcel wimmerte leise im Schlaf. Irgendwie kriegte er jedes Mal mit, wenn die Brust nicht mehr so leicht zugänglich war. Doch gleich darauf lächelte er, ohne aufzuwachen.
Maria bemerkte ihre verspannten Schultern und streckte den freien Arm. Sie hatte schon lange immer mal wieder Rückenschmerzen, doch seit Marcel auf die Welt gekommen war und sie ihn so viel trug, war es schlimmer geworden. Vor allem, weil sie schon seit einer Weile kein Yoga machte und nicht mehr meditierte.
Sie schloss die Augen. Nur ein bewusster Atemzug macht jede Situation entspannter, dachte sie. Maria spürte, wie sich ihre Lungenflügel mit Luft füllten. Für einen Moment hielt sie diese und ließ sie dann herausströmen. Jetzt war er vorbei, der bewusste Atemzug. Als sie die Augen öffnete, schien sich die Zeit verlangsamt zu haben. Das Flackern der Glühbirne störte nicht mehr und dafür fiel ihr das warme Licht der Kerzen auf.
Maria rührte ihr Getränk um und hob es an den Mund. Es roch nach aromatischem, dunklem Kakao. Sie war beeindruckt, so eine hochwertige heiße Schokolade gab es in der Isolde nicht. Der erste Schluck bestätigte ihren Eindruck. Der Schokoladengeschmack war so stark, dass sie lächeln musste. Und warte mal, spielte nicht doch Musik? Sie summte mit. Ja, es war ein Walzer. Vorsichtig trank sie wieder, sie wollte nichts auf Marcel verschütten. Zwar landete öfter mal etwas von ihrem Essen auf ihm, aber ein Heißgetränk hätte ihn verbrüht.
Als sie die Tasse zurückstellte, entdeckte sie neben dem Unterteller ein blaues Haar. Ihre Eltern hatten erwartet, dass sie sich die Haare wieder braun färben würde. Immerhin war sie ja nun Mutter. Doch Maria dachte nicht daran. Die beste Mutter war sie, wenn sie sie selbst war. Und sie hatte blaue Haare. Meerjungfrauenblau, wie der Frisör es nannte. Sie pustete das Haar vom Tisch.
Da fiel ihr die verunstaltete Tischplatte auf. Jemand hatte mit einem Messer oder Ähnlichem etwas ins Holz geritzt. Ein bisschen Berlin-chic, aber warum nicht? Immerhin war der Laden ja auch italienisch und griechisch. Es war eine Zeichnung von etwas, das wie ein Insekt wirkte. Zwei große, dünne Beine, die an den Knien abgeknickt waren, eine offene Wirbelsäule und ein Buckel aus etwas, das wie Krebsschale aussah. Auf dem unförmigen Kopf zählte sie zweimal vier Augen, jeweils an der Seite als eine gebogene Linie, und in der Mitte zog sich bis zum Kinn ein gigantisches Maul mit vielen spitzen, langen Zähnen, die fast wie dicke Borsten aussahen. Statt eines Bartes standen mehrere tentakelähnliche Greifarme vom Kinn ab. Arme schien die Kreatur keine zu besitzen.
Ist das aus einem Film?, fragte sich Maria und aß den Keks. Auch er war großartig, er war teilweise aus hellem, teilweise aus dunklem Teig gebacken.
Über dem Bild hatten verschiedene Leute gekritzelt, als wäre die Tischplatte die Wand einer Klokabine in einem Club.
Ich hatte eine Frau, stand dort mit Edding.
Irgendwas hab ich vergessen, mit Kugelschreiber.
Der Kuchen ist vergiftet. Kuchen war durchgestrichen, darüber stand in einer anderen Schrift: Kaffee.
Sie sammeln Menschen.
Ich will raus.
Insektenmänner.
Maria schob den Kerzenständer und die Menükarte zur Seite, um das gesamte Werk betrachten zu können, und führte das Glas zum Mund. Es war der letzte Schluck. Bald würde sie diesen verrückten Laden verlassen. Sie wollte heim und Stranger Things gucken. Der Kellner spähte schon neugierig über den Tresen. Wahrscheinlich wollte er schnell abkassieren. Um Kundschaft war man hier offensichtlich nicht bemüht. Vielleicht wollte man, dass sie schnell wieder ging.
Das Karussell drehte sich, es machte sie müde. Hatte es sich vorhin schon gedreht?
Maria richtete den Blick wieder auf das Holz. Über dem Kopf der eingeritzten Kreatur sagte eine Sprechblase in Großbuchstaben:
ISS NICHTS
TRINK NICHTS
ODER DU STIRBST
!!!
Sie spuckte über den Tisch, doch die heiße Schokolade hatte sie schon hinuntergeschluckt.
»Was habt ihr ...?«, rief sie, plötzlich doch panisch, denn das war alles nicht normal, sie war so, so müde ... Sie sah noch, wie der Kellner im flackernden Licht heraneilte - hatte er etwa viele kleine Greifärmchen unter seinem Kopf? - da kippte sie nach hinten, zog ihr Baby mit sich und schlief ein.
Als sie erwachte, schien die Sonne durch das Fenster auf sie. Der Regen warvorüber. Kein Walzer spielte, das Karussell stand still. Maria zog sich hoch und sah sich um. Der Kellner - ganz Mensch - wischte den Tresen ab. Wahrscheinlich hatte sie der Tag erschöpft. Sie legte drei Euro auf den Tisch und stand auf. Tatsächlich fühlte sie sich etwas wackelig auf den Beinen. Eine Erkältung. An der Tür drehte sie sich noch einmal um und betrachtete den seltsamen Ort. Die Glühbirne über ihr flackerte noch immer, doch es ging im strahlenden Sonnenlicht unter. Als sie das Café verließ, erinnerte sie sich an die Kritzeleien auf der Tischplatte. Hübsch waren sie nicht gewesen und sie konnten den Gästen wirklich einen Schrecken einjagen. Was ein schlechtes Marketing.
Was hatte sie noch gleich in der Stadt gewollt? Sie wusste es nicht mehr, doch am Brunnen stand die Erdbeer-Verkäuferin. Maria lief zu ihr und begrüßte sie fröhlich. Mehrmals im Monat kaufte sie bei ihr Erdbeeren.
Die Verkäuferin reichte ihr eine Pappschale. »Heute allein unterwegs? Hast du Marcel bei Jörn gelassen? Tut mal gut, was?«
Wie benommen griff Maria nach den Früchten. Übersah sie nicht etwas Offensichtliches? Sie hatte etwas vergessen. Sie hatte einen Sohn gehabt!
Lose hing das Tragetuch an ihr herunter. Ihr Sohn hatte einen Namen, Marcel, Marcel, Marcel. Sie rannte los, die Erdbeeren flogen durch die Luft. Schon aus der Ferne konnte sie sehen, dass hinter dem Vordach kein seltsames italienisch-griechischkubanisch-berlinerisches Café war. Als sie davorstand, lief sie trotzdem in den Feinkostladen. Die Glocke erklang, aber es war eine elektronische, dunklere. Sie taumelte, das konnte nicht wahr sein, das durfte nicht wahr sein. Sie konnte sich noch an sein Gewicht in ihren Armen erinnern, an das Geräusch, das er machte, wenn er an der Brust schluckte, und an sein vom Schreien warmes Gesicht, wenn sie ihn tröstete und wiegte.
»Darf ich Ihnen meine neuste Kreation vorstellen? Das ist Frischkäse mit Schafskäse und Basilikum, mega lecker!« Der Feinkostladenbesitzer hielt ihr ein Stück Brot mit seinem grünen Werk darauf hin.
Bleich und wortlos verließ Maria den Laden. Sie blickte sich um. Der Asphalt war trocken, als hätte es nie geregnet. Alles schien, als habe sie ihren Cafebesuch nur geträumt. Aber das Vordach war das gleiche und auch die Fenster schienen identisch. Sie blickte durch die Scheibe in die Ecke, in der sie gesessen hatte. Mit ihrem Sohn. Wie hieß er noch gleich? Dort stand nun eine Tiefkühltruhe.
Maria trat ein paar Schritte zurück und blickte die Außenwand hoch. Sie versuchte, sich zu erinnern. War es das dasselbe Haus wie zuvor? Sie stutzte. Oben in der Dachgeschosswohnung flackerte eine nackte Glühbirne. Nichts würde sie unversucht lassen! Sie würde ihn finden! Ihn. Wen?
Eva-Maria Obermann
Inspirii
Es gibt keinen köstlicheren Klang als das süße Kratzen eines Bleistifts auf Papier, das fein abgestimmte Klackern der Tastatur, das zauberhaft gewürzte Einrasten der Schreibmaschine. Wie das eifrige Brummen von Bienen in sonnenbeschienenem Lavendel oder rauschender Regen an einem Herbstabend, umfassend, erfüllend und gerade so verheißungsvoll, wie es noch erträglich ist. Ein Versprechen, dass etwas im Entstehen ist. Ja, natürlich kann das auch nur ein trostloser Einkaufszettel oder eine grammatikalisch wie orthografisch miserable E-Mail sein. Aber es könnte eben auch ein sagenhaftes Gedicht, ein weltbewegendes Drama oder ein literarisch wegweisender Roman werden. So wie das Klirren von Geschirr ein üppiges Festmahl oder das Einräumen von verdrecktem Geschirr in eine Spülmaschine signalisieren kann.
An einem sonnigen Tag im Spätherbst, umrauscht von dunkelroten, sachte herabfallenden Blättern, entstand es. So zögerlich und abgehackt, dass die meisten Inspirii daran achtlos vorbeigeflogen wären. Doch Lyria Cogita war ausgehungert. Gierig nahm sie Witterung auf. Zwar hatte sie ihren letzten Menschen erst vor wenigen Tagen verlassen, doch schon dort hatte sie hungern müssen.
Sie, die ihn, den Autor, gefördert und zu ungeahnten geistigen Höhenflügen gebracht hatte. Schnell war er dank ihrer Bissen vom Selfpublishing-Neuling zu einem Schriftsteller geworden, der Preise gewann und von den großen Verlagen Verträge vorgelegt bekam. Sie hätte wissen müssen, dass es Zeit war, weiterzuziehen, sie hatte es schon oft erlebt. Die Autorinnen und Autoren wurden von Verkaufszahlen getrieben, die Ideen, die Lyria ihnen mit ihrem Biss verschaffte, blieben liegen und sie formten ihre Romane stattdessen nach Schema F. Bewährt, verkauft und von den Verlagen abgesegnet. Wie es sie ermüdete! Es war der Glaube an ihren Autor gewesen, der sie zum Bleiben veranlasst hatte, und das Vertrauen in die Funken der Kreativität, die sie ihm gab. Er war der Erste, der dank ihr Bestseller geschaffen hatte, die in mehrere Sprachen übersetzt worden waren. Doch diesmal war es so schlimm gekommen wie noch nie. Er hatte sich hoffnungslos überschätzt, die Fristen ausgereizt, sich den Ruhm zu Kopf steigen lassen. Die leere Seite war zu einem mahnenden Denkmal geworden, dem er nichts entgegenzusetzen hatte. Lyria hatte es versucht, hatte ihn gebissen, ihn auf den Weg geschickt. Aber immer wieder war er davon abgekommen, hatte gelöscht, zerrissen, die Inspiration, die sie ihm geschenkt hatte, abflauen lassen. Auch sie hatte sich überschätzt.
Ihn zu verlassen war schließlich reiner Selbstschutz gewesen. Er hatte sie ausgesaugt und ihr nichts zurückgegeben, seit Jahren. Es hungerte sie nach Ideen, Einfällen. Nach süßen Gute-Nacht-Geschichten und kitschigen Liebesschnulzen, nach blutigen Thrillern und gut gereiften Klassikern.
Inspirii ihrer Gattung ernährten sich von Geschichten. Während andere sich zwischen Pinselstrichen oder Musiknoten, unter Töpferscheiben oder Stricknadeln, in Ballettschulen oder Theatern eine Nische erobert hatten, lebte Lyria von der Kraft, aus der Geschichten gemacht sind. Sie saugte nicht etwa Blut aus ihren Opfern, sondern den köstlichen Stoff, den Menschen ungeahnt freisetzen, sobald sie kreativ schreiben. Er haftet den Geschichten an, folgt ihnen in die Kinderzimmer und auf die Nachttische.
Lyria Cogita kannte den verlockenden Geruch, der beim Schreiben von Geschichten entsteht. Sie wusste um die betörende Süße, sobald die Worte auf das weiße Papier flossen, den aromatischen Geschmack, wo Plotlöcher gefüllt und Figuren ausgereift wurden. Doch nun schleppte sie sich erschöpft von Haus zu Haus und suchte nach Geschichten, die sie noch nicht kannte. Denn das ist die Krux bei der Sache: Der Dunst der Kreativität, der in seiner Reinheit beim Schaffensprozess freigesetzt wird, haftet zwar auch jeder Kopie in abgeschwächter Form an, doch aufnehmen können Inspirii ihn nur einmal. Danach hat das Werk jeden Nährwert verloren. Die Worte sind für die Inspirii schlichtweg nicht mehr kreativ genug.
Lyria verließ gerade frustriert durch das gekippte Fenster das Zimmer einer Jugendlichen, die über Mathematik-Hausaufgaben brütete. Schulbücher, also wirklich. Als gäbe es für eine Fünfzehnjährige keine spannendere Lektüre als das Chemie-Buch und Goethes Werther. Im Erdgeschoss hatte Lyria zumindest einen Happen aus einem fragwürdigen Kolumnenentwurf für eine Tageszeitung sammeln können. Nun lagen ihr die fahlen Wörter schwer im Magen und die Luft war trotz der Sonne eisig. Ihr Blick suchte einen Hinweis, in welchem der Nachbarhäuser sie fündig werden könnte. Dem Mehrfamilienhaus, bei dem bereits der Putz abblätterte? Dem schnieken Neubau daneben? Oder dem letzten Eingeschossigen der Straße, das mit Vorgarten und Gartenzaun auch aus einem Kinderbuch hätte stammen können?
Da erreichte sie mit einer lauen Woge Wind das feine Klappern. Sie folgte ihm, ehe sich in ihrem Bewusstsein manifestiert hatte, wohin der Weg sie führen könnte. Nicht etwa zu einer unstrukturierten Seminararbeit über die Lehren Thomas von Aquins, sondern zu einer kreativen Quelle selbst. In all ihren sechs Fingerspitzen begann es zu kribbeln. Die Aufregung stieg ihre gefiederten Arme hinauf, überzog ihren Rücken und tänzelte den Kopf entlang bis zu den feinen Ohren. Sie dankte dem Großen Wort für den Imbiss, den sie aus der Zeitungsredaktion hatte nehmen können. Ihre Flügelschläge wurden kräftiger angesichts der literarischen Kreativität, die sie dank ihrer eindrucksvollen Hörorgane wahrnahm.
Doch Lyria wusste, dass was immer da gerade getippt wurde, ohne ihren liebevollen Biss lediglich ein mühsames Gestammel bleiben würde.
Sie schwebte an der Rückseite des Mehrfamilienhauses empor. Natürlich war es das Dachzimmer und selbstverständlich waren die Fenster verschlossen. Ihr Magen krampfte vor Hunger, und Schwindel erfasste sie. Sie hatte nur noch diese Chance. Es kostete sie all ihre Kräfte, durch das Fenster zu diffundieren. Warum auch hatten die Menschen dreifach verglaste Scheiben erfinden müssen? Sie plumpste auf der anderen Seite auf den Boden und das Geräusch ließ eine junge Frau herumfahren. Die Haut der Inspirii reflektierte Licht auf eine kuriose Art und Weise, so dass die Schwarzhaarige kurz glauben musste, sie sähe unscharf, ohne eine Gestalt ausmachen zu können. Dann drehte sie sich wieder um und starrte auf den Bildschirm vor sich.
Sie zögerte, tippte, löschte wieder. Ein trauriger Anblick. Lyria rappelte sich müde auf. Die Konturen vor ihr verschwammen. Sie wankte, stolperte, wankte weiter. Nur noch ein paar Meter. Schon öffnete sie den Mund und ihre spitzen, tintenblauen Zähne kamen zum Vorschein. Es roch nach einem Anfang, einem ersten Wort, das noch im Raum schwebte, bereit, für immer aufs Papier gebannt zu werden. Lyrias Krallen fuhren in den Stuhl, hinterließen winzige Einkerbungen, als sie sich immer höher zog. Die junge Frau war kurz vorm Aufgeben. Sie wusste nicht, was fehlte, um ihre Geschichte gebären zu können. Doch Lyria wusste es. Sie mobilisierte ihre letzten Kräfte, klammerte sich an die Querverstrebung des Stuhles und schaffte es auf ihre Füße.
Die Inspirii griff nach dem Hosenbein der Frau, schob es gerade so weit beiseite, dass sie eine winzige Stelle Haut sehen konnte. Mehr brauchte sie nicht. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, dann biss sie zu, ließ einen Stoff in den menschlichen Kreislauf sickern, der die Synapsen anregte und das kreative Zentrum des Gehirns zu Höchstleistungen brachte. Die junge Frau schüttelte sich und Lyria verlor den Halt, rutschte ab, fiel und wurde vom Teppichboden milde begrüßt.
Alina rollte die Füße vor und wieder zurück. Vielleicht starrte sie schon zu lange auf den Computerbildschirm. Vorhin schon hatte sie kurz geglaubt, dass etwas durch das geschlossene Fenster hereingekommen war. Für die Dauer eines Herzschlags hatten ihr die Augen einen Streich gespielt. Sie schüttelte den Kopf und atmete laut aus.
Was für eine Schnapsidee. Sie hatte drei Hausarbeiten zu schreiben, aber dieser Flyer der Uni-Zeitung war ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Geschichte einreichen und mit etwas Glück veröffentlicht werden. Leicht gesagt - gar nicht so leicht geschrieben. Seit Stunden mühte sie sich ab und kam nicht über die erste Seite hinaus. Im Gegenteil. Immer wieder entschied sie sich um, löschte, was bereits geschrieben war, und doch klang jeder Satz für sie wie der davor.
Von ihrem Fußgelenk breitete sich ein Kribbeln aus. Als wäre ihr Körper selbst eingeschlafen, während sie weiterhin hellwach versuchte, eine Geschichte zu formen. Genervt schob sie den Stuhl zurück und rempelte gegen etwas, das auf dem Teppich lag. Sie starrte auf die Stelle und sah nichts. Vorsichtig beugte sie sich vor und machte vage Konturen aus. War das ein Spielzeug ihres kleinen Bruders mit einem komischen Tarneffekt? Alina stand auf und ging vor dem Ding in die Hocke. Sie konnte es immer noch nicht richtig sehen. Aber da, das waren doch riesige, spitze Ohren. Und die feinen Krallen an Händen und Füßen, die sie beim Blinzeln eben ausmachen konnte, waren jetzt schon wieder verschwunden. Sie griff nach ihrem Fußgelenk, das immer noch leicht pochte. Wie ein Biss war es gewesen. Alina schloss für einen Moment die Lider.
In ihrem Inneren formten sich Bilder, Figuren, Handlungen. Sie öffnete die Augen. Da war nichts vor ihr. Doch in ihr war eine Menge. Sie nickte kurz, dann richtete sie sich auf und setzte sich wieder hin. Was wäre denn, wenn ...
Das Zögen war verschwunden. Wort um Wort reihte sich aneinander. Aus jedem Satz ergab sich der nächste, das Gefüge verdichtete sich. Alina vergaß die Zeit und den Durst, die Hausarbeiten und den Wettbewerb. Sie schrieb, sie schuf, sie lebte.
Dabei merkte sie nicht, wie aus ihren Fingerspitzen ein zarter, orangefarbener Hauch austrat. Vertieft in ihre Geschichte übersah sie, wie dieser Hauch auf das formenlose Etwas hinter ihr traf. Während sie der Handlung Form verlieh, erkannte Alina nicht, wie dieses Etwas sich hinter ihr am Stuhlbein festkrallte und mühsam auf dem Teppich aufrichtete, sich endlich stehend an der unteren Querverstrebung des Stuhles festklammerte, einen Mund mit absonderlich spitzen und tiefblauen Zähnen öffnete und den orangen Nebel in sich aufsog.
Lyria aß. Es waren die feinsten Worte, die sie je gegessen hatte, die ersten Worte, die diese Menschenfrau je als Geschichte geformt hatte. Die Unerfahrenheit machte sie grob, doch ihr Geschmack ließ ein unendliches Können erahnen. Lyria aß und aß. Sie machte es sich auf dem Teppich gemütlich und schlug sich den Bauch voll. Hier würde sie bleiben. Im Kleiderschrank zwischen den kunstvoll verzierten bunten Tüchern, mit Blick auf ein verwaistes Bücherregal, das sich bald füllen würde, dessen war sie sich sicher. Die junge Frau war im Rausch und Lyria ebenso. Nie hätte es anders kommen dürfen, befand die Inspirii, während sie sich trunken neben dem Schreibtisch zusammenrollte. Hier gehörte sie hin.
Sie leckte sich genüsslich die Lippen und tätschelte zufrieden ihren prallen Bauch. Seit Jahren hatte sie nicht so gut gespeist. Wohlwollend sah sie hoch zu dem Mädchen, das die schwarzen Haare mittlerweile zu einem Zopf gebunden hatte, damit sie ihm beim Schreiben nicht immer wieder in die Augen fielen. Die Geschichte war beendet. Eine kurze für den Anfang, doch Lyria sah ihr den Drang an, mehr zu schaffen, mehr zu schreiben, mehr zu werden. Sie lächelte, während Alinas Lippen bereits bei der Überarbeitung waren und vorsichtig die ersten Worte ausprobierten, die sie geschaffen hatte: Es gibt keinen köstlicheren Klang als das süße Kratzen eines Bleistifts auf Papier.
Matthias Thurau
Extras
Man nennt mich Pippo. Ich bin ein ganz normaler Kerl, bin kinderlieb, nett zu Tieren, habe eine lustige Nase, freundliche Augen und sitze im Gefängnis.
Du weißt, wie es in dieser Welt zugeht. Alle meine Freunde, alle Menschen, die ich kenne, haben sich als Kind ihr Wunschwesen, den einen persönlichen, selbstgemachten Freund gewünscht, der erscheint, wenn er nur stark genug herbeigesehnt wird. Wir nennen diese Wesen Extras. Extras verändern das Leben der Menschen. Es gibt manche Extras, die wahre Monster sind. Sie werden zwanzig Meter groß gewünscht, mit Krallen und Zähnen. Ihre Wünscher hatten viel Angst, als sie klein waren, und brauchten Schutz und Mut, oder sie riefen ihr Extra, als sie einmal außer sich waren vor Wut. Mehr als ein Haus ging auf diese Weise zu Bruch. Später findet man diese Kinder manchmal beim Militär und die Extras ziehen für sie in den Krieg. Ich habe nie verstanden, wie die Menschen es übers Herz bringen, ihre Wunschwesen zu opfern. Jeder wird einmal erwachsen, schätze ich.
Es gibt auch die nützlichen Wesen, die Abfall fressen oder es lieben, Zimmer aufzuräumen. In diesen Fällen wollte sich wohl jemand vor der Arbeit drücken. Diese Extras und ihre Menschen landen bei den Stadtwerken oder bei Reinigungsservices.
Fast der gesamte Rest der Extra-Population ist flauschiger Natur, üblicherweise knallbunt, macht lustige Geräusche und vertreibt ein Leben lang die Einsamkeit ihrer Freunde. Sie sind nützlicher als all jene, die Arbeiten übernehmen und die Wirtschaft vorantreiben, wenn ihr mich fragt. Nichts hilft einem Menschen so sehr, ein gutes Leben zu führen, wie ein Wesen, das ihm bedingungslos den Rücken stärkt und niemals aufhört, ihn zu lieben. Denn das haben alle Extras gemein: Sie bleiben treu bis zum Schluss.
Kinderwünsche bergen aber auch die Gefahr, zu wenig durchdacht zu sein und nach hinten loszugehen. Sie wissen, was sie wollen, aber nicht, was es mit sich bringen kann, wirklich zu bekommen, was man will.
Erinnert ihr euch zum Beispiel an den Methanfrosch? Ein kleiner Junge wollte unbedingt auf einem großen, rülpsenden Frosch reiten und hätte damit beinahe die gesamte Nachbarschaft gesprengt. Das war ein Bekannter von mir. Die Behörden mussten einschreiten und haben den Frosch eingeschläfert.
Leider überstehen Kinderwünsche wie er nur selten ihr Heranwachsen. Es liegt in ihrer Natur. Sie werden erschaffen von Menschen, für die ein Jahrzehnt wie eine Ewigkeit erscheint.
Von allen Seiten versucht man daher, die Kinder und ihre Wünsche zu beeinflussen, damit ihre Extras der Gesellschaft nützen, Profite erwirtschaften und den erwachsen gewordenen Kindern die Karriere sichern. Häufig genug funktioniert es. Und wenn nicht, bezahlen meist die Extras den Preis.
In meinem Fall lief die Geschichte anders ab, deshalb wissen sie nicht recht, was sie mit mir tun sollen. Doch Anna ist jetzt glücklich - so glücklich es eben geht. Ich freue mich für sie. Ihr Wunsch war simpel, eben der eines Kindes: ein ganz normaler Papa, der kinderlieb ist, nett zu Tieren, mit einer lustigen Nase und freundlichen Augen, der sie vor ihrem biologischen Vater beschützt. Es funktionierte und ging doch daneben, denn das Leben ist komplizierter als die Wünsche der Kinder.
Sie nannte mich Pippo. Ich passte auf sie auf und sitze wegen Totschlags im Gefängnis.
Vanessa Glau
Das Gift in der Literatur
Müde tappte Chion durch das Haus und fand Saiph im Esszimmer, wo sie mit dem Gesicht auf einem aufgeschlagenen Buch lag und leise schnarchte. Vor ihr stand der bronzene Kerzenhalter, aber von den drei weißen Kerzen brannte nur noch eine. Die Flamme flackerte in einem Luftzug, den er nicht spürte, und er beugte sich über Saiph, um sie auszublasen.
Da loderte die Flamme auf und zog seinen Blick an, während das Zimmer und der Rest der Welt in kalter Dunkelheit versanken. Glückliche Leere breitete sich in ihm aus und in die Mitte brannte die Kerzenflamme ein Loch: ihr Weiß, das in der Kunst ständig für Gelb gehalten wurde. Feuer musste gelb und rot gemalt werden, damit seine Hitze beim Betrachten des Abbilds nicht in Vergessenheit geriet.
Diese Hitze so nah an trockenen Buchseiten war es, die ihn wieder zu sich kommen ließ, ihm plötzlich einen Schauder über den Rücken jagte. Hastig erstickte er die Flamme in seiner Faust und hieß den Schmerz willkommen.
Er rüttelte an ihrer Schulter. »Saiph.«
Sie rührte sich nicht. Er strich ihr einige rotblonde Haarsträhnen aus dem Gesicht, denen ihr Atem winzige Bewegungen entlockt hatte, und unterdrückte den Drang, daran zu ziehen wie ein boshafter Schuljunge. »He, Saiph. Wach auf, Schneewittchen.«
Mit schläfrigem Blick sah sie auf und ächzte etwas, das Was gibt’s oder Verzieh dich bedeuten konnte.
»Es ist spät. Gehen wir schlafen.«
Alle hielten Saiph für die Jüngere, mit ihrer aufrechten Haltung, ihrem flinken und von keiner Wolke getrübten Lächeln. Nur wenn sie müde war, sickerte ein Teil ihres Überdrusses in die feinen Linien ihres Gesichts. Auch jetzt stand eine Müdigkeit in ihren stahlgrauen Augen, die über körperliche Erschöpfung hinausging.
Seufzend ergriff sie seine dargebotene Hand. Einen Augenblick lang meinte er, ein Echo der schwarzen Buchstaben auf ihrer Haut zu sehen, aber das Buch war mindestens ein Jahrhundert alt und auf köstlich dickem Papier gedruckt worden. Zärtlich streichelte er über die Wange, die sich von ihrem Nickerchen auf den Seiten gerötet hatte. »Wie kannst du nur beim Essen einschlafen?«
»In letzter Zeit bin ich so müde.«
Er wusste es, spürte seit Wochen schon ihre gereizte Stille, das Lauern unter der Oberfläche. Für sich selbst wollte er nichts, all sein Schmerz über diese Worte galt ihr, seiner Liebsten, die er nicht retten konnte.
»Ich auch.«
Im Gang zum Schlafzimmer drückte sie seine Hand und er drehte sich um. »Wir haben noch uns«, erinnerte er sie.
Sie nickte und folgte ihm ins Bett, wo sie ein behagliches Nest für sie baute und ihn streichelte, bis sie wieder in den Schlaf hinüberglitt. Chion aber lag wach neben ihr und lauschte noch lange dem Echo ihrer müden Gleichgültigkeit.
Er schreckte aus dem Traum hoch und stieß gegen die Shamisen, die gefährlich in ihrer Halterung über dem Bett schaukelte, bevor sie schließlich fiel. Wie immer hatte er sich im Schlaf zusammengekrümmt und an die Wand gedrückt, was ihm ein Pochen an der Stirn und das kostbare Instrument im Schoß eintrug.
Aber dieser Traum von Saiph, die eine halbe Welt entfernt war ... Nachdenklich zupfte er eine Saite an. Bevor er aber zu einem Schluss kommen konnte, klingelte im Nebenzimmer das Telefon. Stöhnend wartete er ab und schlurfte erst hinüber, als das Geräusch nach zwei Minuten noch nicht verstummt war.
Als er abhob, brach ein solcher Wortschwall über ihn herein, dass er den Hörer eine Handbreit vom Ohr weghalten musste. Er verstand zwar nichts, erkannte aber die Stimme.
»Vic? Beruhige dich, Mann!«, rief er gereizt.
Victor stieß einen entsetzten Laut aus, bevor er sich zwar nicht ruhiger, aber langsamer wiederholte. »Chion, wo steckst du denn? Saiph ... es ist Saiph!«
Chions Ärger verpuffte, er richtete sich auf. »Was ist mit ihr?«
»Sie ist krank! Muss etwas Verdorbenes gegessen haben, jedenfalls sieht sie nicht gut aus. Abgemagert und grau im Gesicht, schon seit Tagen. Sie hat sich auch übergeben. Der Arzt hat etwas von Lebensmittelvergiftung gesagt.«
»Wird sie es überstehen?«
Aus der darauffolgenden Stille hörte er ein Schulterzucken heraus. Nicht zum ersten Mal hätte er Vic am liebsten gewürgt, bis dieser endlich antwortete: »Ich weiß es nicht. Du solltest kommen und ich weiß, du magst Panikmache nicht, aber Chion, es geht um Saiph! Sie tut so abgebrüht wie immer, aber du kennst sie ja, sie ist doch verletzlich und ... Ich bitte dich, komm sofort.«
Chion verschwendete keine Zeit mit einer Antwort, legte stattdessen auf und riss die Türen seines Kleiderschranks auf. Vic hatte sich geirrt, wenn er gedacht hatte, Chion müsste erst überzeugt werden. Selbst wenn Vic übertrieben hätte, gefiel es ihm doch nicht, sie mit diesem hysterischen Speichellecker alleine zu wissen!
Für Saiph überwand Chion alles, sogar seine Abneigung gegen Flugzeuge. Am nächsten Abend bestieg er einen der behäbigen Metallvögel, um darin den Ozean zu überqueren. Stundenlang füllte er seine Gedanken mit geschriebenen Worten und ignorierte die blaue Weite unter dem Fenster, die mit Gefahr und Tod lockte. Das Flugpersonal wunderte sich über den bleichen Herrn in Schwarz, der nichts aß und kaum die Nase aus seinen Büchern in drei verschiedenen Sprachen hob.
Als er schließlich den Boden der westlichen Welt betrat, hatte nicht nur sein Koffer an Gewicht verloren. In der Bahn nickte er beinahe ein, erkannte im letzten Moment seine Haltestelle und sprang zwischen den sich schließenden Türen hinaus. Wenige Minuten später stand er vor Saiphs Bett, neben ihm rieb Vic nervös die Hände aneinander.
Saiphs Haut glänzte feucht, aber selbst die tiefen Schatten unter ihren Augen verliehen ihr noch eine abgezehrte Schönheit. Als sie seine Anwesenheit bemerkte, streckte sie eine zittrige Hand aus. »Chion...«
Er kniete sich neben sie, drückte einen Kuss auf ihren Handrücken. »Du siehst aus, als wärst du an einem dieser Leiden erkrankt, die im viktorianischen England schrecklich in Mode waren. Schwindsucht vielleicht.«
»Dann bring mir Essig.«
»Wofür?«
»Um den Weißen Tod in der Flasche zu fangen.«
Chion lächelte. Saiph würde ihren Humor nicht einmal auf dem Sterbebett verlieren, trotzdem hatte der Scherz ihn beruhigt. »Wie geht es dir wirklich?«
Sie verdrehte die Augen. »Ich brauche nur die Ruhe, die dieser nervöse Kläffer mir nicht geben kann. Nimm ihn mit und bring mir etwas Sauberes zu essen, das diese Giftstoffe aus meinem Körper spült, dann springe ich bald wieder über die Felder wie Bambi.«
Chion fiel in ihr Lachen ein. Die Anspannung floss aus seinen Muskeln in die knarzenden Dielen, als er sich neben das Bett kniete und das Kinn auf die Kante stützte. »Ist Cocteau noch im Geschäft? Er hatte schon immer den besten Stoff weit und breit.«
»Ja, aber er verkauft nicht mehr an jeden. Du solltest...«
Vic unterbrach sie. »Er hat mich nicht hineingelassen. Ich wollte gerade aus diesem uralten Aufzug aussteigen, da hat er mir das Gitter vor der Nase zugeschlagen!«
»Ich locke ihn schon heraus«, versicherte ihm Chion trocken.
Saiph zog ihre Hand aus seiner und strich ihm durch die zerzausten Haare. »Schön, dich zu sehen, Liebster.«
Als Chion das Zimmer verließ, zerrte er den jammernden Victor mit sich und trug ihm auf, die Wäsche zu waschen und frisches Bettzeug vorzubereiten. Wenn Saiph genesen sollte, musste ihre Umgebung sie dazu anregen, anstatt ihr Dahinsiechen einzuladen. Als er auf die Straße trat, musste er die Augen gegen das aufdringliche Morgenlicht beschatten. Zwischen den Häuserdächern glühte noch die Röte, die bald verblassen und dem prallen Blau eines schönen Tages weichen würde. Chion hastete mit gesenktem Kopf über das Kopfsteinpflaster, um Saiphs alten Freund zu finden, bevor das Licht unerträglich wurde.
Zwei Stunden später breitete er die Köstlichkeiten, mit denen Cocteau ihn zuverlässig versorgt hatte, auf dem Orientteppich vor ihrem Bett aus: Der Steppenwolf, um den Ton zu setzen, Goethes Faust sowie Prometheus als Anker in diesen stürmischen Zeiten, Allen Ginsberg und Patti Smith boten zusätzliche Würze, bevor Baudelaires Les Fleurs du Mal die Mahlzeit abrundete.
Danach saßen sie zu dritt da, Saiph halb aufgerichtet auf dem frisch bezogenen Bett, Chion an den Diwan gelehnt auf dem Teppich und Victor, dem er widerwillig einen Bissen abgegeben hatte, unter dem Fenster. Sie hatten so lange gegessen, dass der Tag bereits wieder dem Abend wich, und so blieben sie sitzen und lauschten dem Vergehen des Lichts, das laut wie ein Schrei in der Luft nachklang.
Saiph erholte sich schnell, um mit Chion ihre nächtlichen Streifzüge wiederaufzunehmen. Die meisten ihrer Art zogen es vor, sich an den Alltag der Menschen anzupassen, die nach Sonnenlicht hungerten. Chion und Saiph dagegen hatten es schon immer genossen, die Welt bei Nacht zu erkunden.
Während Saiph ihn an der Hand durch ihr liebstes Viertel führte und ihm neue Cafés und Geschäfte zeigte, dachte Chion an ihre ersten gemeinsamen Spaziergänge zurück. »Diese Kälte in der Nacht ist mir lieber als falsche Freundlichkeit bei Tag«, hatte sie damals erklärt.
Auf einem Spaziergang, der sie kreuz und quer durch den weitläufigen Stadtpark führte, hakte Saiph sich bei ihm unter und schmiegte den Kopf an seine Schulter. »Was hast du getrieben in der geheimnisvollen Fremde? Ich brenne darauf, alle deine Geschichten zu hören!«
Chion dachte an den Traum und an die unschuldige Kerzenflamme, die ihm die Hand versengt hatte, behielt das Erlebnis aber für sich. Stattdessen erzählte er von den Menschen, die er getroffen hatte, unter denen er allein dank seiner ausgeprägten Gesichtszüge und der Lidfalte als fremd galt, die ihn nichtsdestotrotz mit Anmut und Respekt in ihrer Mitte akzeptierten. Wie er ihre Bücher gelesen und ihre Sitten studiert hatte, um das Loch des bitteren, aber von Zeit zu Zeit notwendigen Alleinseins zu stopfen.
Unwillkürlich rutschte er in einen Monolog über Ernährungsgewohnheiten. »Für uns sieht es dort schlecht aus. Ich muss immer genau aufpassen, was ich esse und woher die Zutaten stammen. Sie benutzen Unmengen künstlicher Inhaltsstoffe, der Trend zur gesunden und umweltbewussten Ernährung ist noch nicht bei ihnen angekommen.«
Sie seufzte. »Hier ist es nicht anders. Wann werden die Menschen jemals lernen, verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen umzugehen?«
»Wenn sie ihre grenzenlose Selbstsucht ablegen«, knurrte Chion. Er musste nicht hinzufügen, dass das noch eine lange Zeit dauern würde.
Saiph nahm seine Hand und drückte sie an ihre Wange, um ihn zu beruhigen. »Während deiner Abwesenheit sind viele der unseren gegangen. Entweder sie haben verseuchte Ware in die Hände bekommen oder sind spurlos verschwunden. Vielleicht sind wir bald die letzten.«
»Warum sollten wir abwarten, bis wir die letzten sind?«
Sie sah ihn starr an, als könnte sie ihm die Worte durch reine Willenskraft in den Mund zurückstopfen. In Momenten wie diesen, wenn ihre Strenge durchschimmerte, wollte er sich ihr zu Füßen werfen. »Was willst du damit sagen?«
Er zuckte mit den Schultern. Beide erkannten sie die ersten Anzeichen desselben Gesprächs, das sie über die Jahrzehnte unzählige Male geführt hatten. »Ich meine ja nur ... hast du etwa Lust, in deine Wohnung herumzusitzen und abzuwarten, bis das Gift deine Innereien zerfressen hat?«
»Du weißt doch, dass ich es nicht mag, wenn du so redest.«
Er senkte den Kopf. »Tut mir leid.«
Am Rand des Parks lag der Jahrmarkt, der seit zwei Jahrhunderten mit dem bekannten Riesenrad und anderen, fragwürdigeren Attraktionen für das Volk warb. Saiph schwieg einige Schritte, so lange, dass er zu hoffen begann, ihre Aufmerksamkeit wäre zu den blinkenden Schildern und dem Gelächter hinter dem Zaun gewandert.
»Es gibt doch so große Schönheit in der Welt, so vieles zu sehen und zu erleben. Ich werde nie verstehen, wie du das nicht sehen kannst. Schau genau hin!« Sie eilte einige Schritte vor, drehte sich schwungvoll und mit ausgebreiteten Armen wie eine Ballerina. Ihre Haare schlugen in der elektrischen Beleuchtung Funken wie frisch geschürte Flammen und flogen wild um ihre Schultern.





























