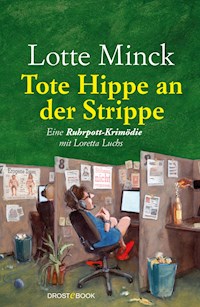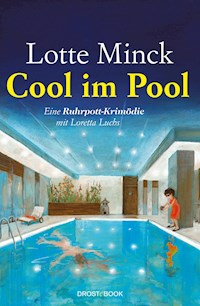
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droste Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreichste Krimödie im Pott – Loretta Luchs geht in die 6. Runde! Kann eine Hochzeit der schlimmste Tag im Leben sein? Ist es ein Problem, wenn der Brautvater schwul ist? Und was ist das Geheimnis der zweiten Badeschlappe? Anstatt sich über die Hochzeit der besten Freundin zu freuen, muss sich Loretta Luchs mit diesen Fragen herumschlagen – und mit einem Toten im Adamskostüm, auf dessen Anblick sie gern verzichtet hätte … … tiefschwarzer Humor trifft auf Ruhrpott-Chaos – eine Mischung, die ins Zwerchfell geht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lotte Minck (*1960) ist von Geburt halb Ruhrpottgöre, halb Nordseekrabbe. Nach 50 Jahren im Ruhrgebiet und etlichen Jobs in der Veranstaltungs- und Medienbranche entschied sie sich, an die Nordseeküste zu ziehen. Erst kürzlich überkam sie heftiges Heimweh nach dem Ruhrpott, als sie nach Jahren auf dem Land zum ersten Mal in einen echten Stau geriet, der aus mehr als sieben Autos vor einer Ampel bestand und sich diese Bezeichnung dank einer halben Stunde totalen Stillstands redlich verdient hatte. Ihre Heldin Loretta Luchs und alle Personen in Lorettas Universum sind eine liebevolle Huldigung an Lotte Mincks alte Heimat. Besuchen Sie Lotte Minck im Internet:www.facebook.com/lotte.minckwww.lovelybooks.de/autor/Lotte-Minck/www.roman-manufaktur.de Ruhrpott-Krimödien mit Loretta Luchs bei Droste:Radieschen von untenEiner gibt den Löffel abAn der MordseeküsteWenn der Postmann nicht mal klingeltDie Tote Hippe an der StrippeCool im Pool
Lotte Minck
Cool im Pool
Eine Ruhrpott-Krimödie mit Loretta Luchs
Droste Verlag
Figuren und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlhckeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2016 Droste Verlag GmbH, Düsseldorf Umschlaggestaltung: Droste Verlag unter Verwendung einer Illustration von Ommo Wille, Berlin eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7700-4120-6
www.drosteverlag.de
Prolog
Wenn es abends Sturm klingelt, hat das niemals etwas Gutes zu bedeuten
Dingdongdingdongdingdongdingdongdingdongdingdong …
Verdammt. Pascal hatte recht – das war kein Klingelmännchen. Und ich musste schon allein deshalb zur Tür gehen, damit der Lärm endlich aufhörte.
Natürlich nahm ich das Essenstablett mit, denn andernfalls würde Baghira mit allen vieren in meinem Döner stehen, wenn ich zurück ins Wohnzimmer kam. Ich drückte den Türöffner.
»Dann kommen Sie eben mit nach oben«, hörte ich im Treppenhaus eine weibliche Stimme, die ich als die meiner Freundin Diana erkannte. »Sehe ich so aus, als wollte ich Sie bescheißen?«
Mein Gehirn war noch dabei, die verblüffende Tatsache zu verarbeiten, dass Diana hier war, als ich einen Mann blaffen hörte: »Wissense, ich kann Ihnen auch nur vor den Kopp gucken, junge Dame. Und ich habe keine Lust, dass Sie mir ausbüxen, ohne zu zahlen.«
Wie erstarrt stand ich mit meinem Tablett in der Wohnungstür, als Diana und der mir unbekannte Mann in Sicht kamen.
Meine beste Freundin trug ihr Hochzeitskleid, beziehungsweise das, was davon übrig war. Der Rock hing in Fetzen und war – genauso wie das Oberteil – mit Flecken übersät, die ich geistesabwesend als Ketchup und Senf identifizierte.
Was zum Henker …?
»Die junge Frau sagt, Sie zahlen«, verkündete der Mann und schwenkte ein großes Portemonnaie, wie es Taxifahrer und Kellner benutzen.
Ehe ich reagieren konnte, fiel Diana mir um den Hals, und der Rest vom Döner wurde mit einem sanften Schmatzen zwischen ihren Brüsten und dem Tablett zerquetscht.
Das konnte doch alles nicht wahr sein.
»Ich bekomme 128 Euro und 50 Cent!«, blökte der Mann. »Vorher rühre ich mich nicht vom Fleck!«
Diana presste das Tablett an ihre Brust und starrte mich mit schwimmenden Augen an. Irgendwie musste ich Ordnung schaffen.
»Diana, du gehst ins Wohnzimmer«, sagte ich streng. »Und mach keine Sauerei mit dem Döner, ja? Jedenfalls wenigstens nicht auf dem Sofa, wenn es geht.« Ich deutete auf das Tablett.
Sie zockelte ab, und ich wandte mich dem Mann zu. »Also, wofür genau bekommen Sie …?«
»Hundertachtenzwanzichfuffzich«, fiel er mir ins Wort. »Na, für die Taxifahrt natürlich. Raststätte Münsterland West bis hier. Könnense gerne überprüfen, steht auf meim Taxameter, junge Frau. Hundertachtenzwanz…«
Ich unterbrach ihn mit einer Handbewegung. »Ist ja gut, ich glaube Ihnen ja. Warten Sie hier.«
Ich holte meine Geldbörse und war insgeheim froh, dass ich nach Feierabend 300 Euro für den Einkaufsbummel mit Isolde abgehoben hatte. Diana hatte vielleicht Chuzpe! Ich wollte mir lieber nicht ausmalen, welchen Tanz dieser Taxityp hier aufgeführt hätte, wenn kein Bargeld im Haus gewesen wäre.
Ich zählte 140 Euro ab und drückte sie dem Mann in die Hand. »Stimmt so, und vielen Dank auch. Eine Quittung brauche ich nicht. War … war sie sehr anstrengend?«
Er stopfte die Scheine in seine Patte und zuckte mit den Schultern. »Sie hat die halbe Fahrt geheult, und die andere Hälfte war sie stumm wie ein Fisch. Ging also. Ich bin weitaus Schlimmeres gewöhnt.« Er nickte und wandte sich zum Gehen. »Also dann.«
»Gute Heimfahrt.«
Ich schloss die Wohnungstür und zählte innerlich bis zehn.
Erst mal runterfahren.
Dann ging ich zu Diana, blieb aber angesichts des Bildes, das sich mir bot, in der Tür stehen und kämpfte gegen den irrationalen Drang, meine Kamera zu holen. Sie saß auf dem Sofa und streichelte geistesabwesend den Kater, der auf ihren Knien balancierte und hingebungsvoll Joghurtsauce von ihrem Dekolleté leckte. Die anderen Überreste meines zerquetschten Abendessens lagen auf dem Tablett, das auf dem Couchtisch stand. Vorbildlich.
Ich setzte mich zu ihr und zupfte ein Stückchen Salat ab, das an ihrem Oberteil klebte. »Süße, was ist los?«
Sie schien wie aus einem Traum zu erwachen und sah mich an. »Ich kann das nicht, Loretta. Ich kann nicht heiraten.« Dann setzte sie den strampelnden Kater auf den Fußboden, blickte an sich hinab und konstatierte: »Ich bin dreckig.«
Ach, du lieber Himmel.
Kapitel 1 – fünf Tage zuvor
Loretta reist mit dem Zug des Wahnsinns und stellt später fest, dass ein Kleid sie zum Weinen bringen kann
»Sie mögen wohl keine Kinder«, blaffte die junge Frau, die beinahe selbst noch ein Kind war.
Ich befand mich auf der Zugfahrt zum Treffen mit Diana. Eigentlich mochte ich es, mit der Bahn zu reisen. Man gab die Verantwortung für die zurückzulegende Strecke am Eingang des Bahnhofs ab und konnte die Hände in den Schoß legen, während man ans Ziel chauffiert wurde. Außerdem vermied man so die Gefahr, am Steuer seines Autos auf der Autobahn im Stau zu stehen und durchzudrehen, während der Motor heiß wurde und die Uhr unerbittlich tickte. Ganz schlecht, wenn man einen Termin hatte.
Jetzt aber erinnerte ich mich schlagartig an die zahlreichen Gründe, die gegen das Zugfahren sprachen: Man war mit lauter fremden Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht und konnte nicht raus. Es sei denn, man zog die Notbremse. Das allerdings war gar nicht gern gesehen, hatte ich mir sagen lassen. Also: Gelassenheit war angesagt. Und bestimmt waren die paar Stunden auszuhalten, auch für mich.
Warum die junge Frau mich angeblafft hatte? Ganz einfach: Ich hatte mich umgedreht, um die Lady hinter mir freundlich darauf hinzuweisen, dass ihr überaus reizender Sohn, der vielleicht vier oder fünf Jahre alt sein mochte, seit über einer Stunde rhythmisch gegen meine Rückenlehne zu treten beliebte. Natürlich langweilte sich das arme Kind halb zu Tode, da seine weibliche Begleitperson statt mit ihm mit dem Smartphone beschäftigt war. Nur sehr unwillig hatte sie den Blick vom Display des Gerätes losgerissen, um auf mich zu reagieren, und das auch nur in Form des unsterblichen Klassikers: »Sie mögen wohl keine Kinder.«
Man stelle sich vor, man würde diese Reaktion auf andere Situationen übertragen. Jemand sagt: »Aua! Sie haben mir Ihren Einkaufswagen in die Hacken gefahren.« Und man keift zurück: »Sie mögen wohl keine Einkaufswagen!«
Das Kind, das vermutlich einen Namen wie Finn-Nebukadnezar oder Winnetou-Ricardo trug, grinste frech und trat weiter. Die junge Frau starrte mich sekundenlang aggressiv an und wandte sich dann erneut ihrem Smartphone zu, um die Herkunft diverser Piepssignale zu checken, die es von sich gegeben hatte. Unnötig zu erwähnen, dass auch dieses Piepsen mir schwer auf den Geist ging, allerdings war es dann wiederum nicht so nervig wie die Tritte des Kindes, die meine Rückenlehne rhythmisch rucken ließen.
Da saß ich nun auf meinem reservierten Sitzplatz, in einem Zug, der so überfüllt war, dass ich keinerlei Hoffnung hatte, irgendwo ein ruhigeres Plätzchen zu finden. Ich fragte mich erneut, warum ich überhaupt dieses Transportmittel gewählt hatte, anstatt mit dem Auto zu fahren. Weil es viel bequemer ist, hatte ich Närrin gedacht.
Pustekuchen. Logisch, dass ich ein Großraumabteil erwischt hatte, in dem auch ein Männerclub, vielleicht Angler oder Skatbrüder, seinem Ziel entgegenreiste. Das ging nicht ohne das Absingen vielfältigen deutschen Liedgutes und auf keinen Fall ohne den reichlichen Genuss deutschen Gerstensaftes, sodass ein dezenter Bierduft mich umwaberte. Sie sangen, sie lachten, sie prosteten sich zu, pure Lebensfreude verströmend.
Und ich? Ich hätte sie am liebsten alle abgeknallt.
Ein paar Stationen lang hatte ein Mann neben mir gesessen, dessen Begleiterin ich mithilfe meiner Platzreservierung von seiner Seite verscheucht hatte. Das hatte mir zwar leidgetan, aber nicht umsonst war ich so schlau gewesen, mir einen Platz zu sichern. Wenn ich etwas noch mehr hasste als bewegungsauffällige Kinder in der Sitzreihe hinter mir, dann war es diese endlose, vergebliche Suche nach einem freien Platz in einem völlig überfüllten Zug.
Da die Menschen in meiner Sitzreihe der deutschen Sprache nicht mächtig waren, wie sich herausstellte, rafften sie zuerst nicht, was ich von ihnen wollte. Sie starrten mich verständnislos an und zuckten mit den Schultern. Ich zeigte also auf die Reservierung in meiner Hand, dann auf die entsprechende Anzeige über dem Sitz, dann auf den Sitz und schließlich auf mich.
Meiner, Herrschaften. Husch, husch, wenn ich freundlichst bitten darf.
Daraufhin stand die Frau auf und fortan viel zu nah neben mir im Gang, eine menschliche Mauer, die mich zwischen sich und dem Kerl am Fenster zu erdrücken drohte. Interessant fand ich, dass der Mann sie eisenhart stehen ließ, anstatt ihr seinen Platz anzubieten. Die beiden unterhielten sich lautstark auf Italienisch, und der Mann kramte ständig irgendwelche Lebensmittel aus dem Rucksack vor seinen Füßen, um sie dann vor meinem Gesicht an die Frau weiterzureichen. Mal tropfte es auf meine Knie, mal krümelte es, was die beiden völlig unberührt ließ.
Als ich kurz davor war, zu explodieren, stiegen sie aus. Der Herrenclub ebenfalls, also konnte sich meine ungeteilte Aufmerksamkeit dem piepsenden Smartphone und dem tretenden Kind hinter mir zuwenden. Ich hätte schreien und um mich schlagen können, so genervt war ich. Auch der MP3-Player, den ich zur Sicherheit dabeihatte, half nicht, denn keine noch so laute Musik schützte mich vor der rhythmisch wippenden Rückenlehne.
Nur noch eine halbe Stunde, dachte ich und schloss die Augen, um mich zu mehr Gelassenheit zu meditieren. Instinktiv wusste ich, dass es nicht ratsam war, mich mit der Tussi hinter mir auf eine weiterführende, womöglich handgreifliche Auseinandersetzung einzulassen. Immerhin hatte ich nicht vor, mich vor den Augen des Kindes mit ihr nach Fischweiber-Art kreischend zu streiten und quer durch den Zug zu schubsen, zumal mir schwante, dass sie derartige Skrupel nicht haben würde.
Ich spürte, dass meine Fäuste fest geballt waren, und zwang mich, sie zu entspannen.
Alles war gut. Ich würde gleich meine beste Freundin Diana treffen.
Warum also war ich nicht voller Vorfreude und von milder Gelassenheit gegenüber den kleinen Störfaktoren um mich herum? Warum konnte ich sie nicht einfach ignorieren? Ein Wochenende an der Nordsee wartete auf mich, mitten im Sommer!
Allerdings gab es zuvor noch eine kleine Hürde zu überwinden. Und diese Hürde war es, die mir zusätzlich die Laune verdarb.
Direkt vom Bahnhof aus würden Diana und ich nämlich zu einem großen Brautmodenladen gehen, um dort nicht nur ihr Hochzeitskleid, sondern auch ein Kleid für mich auszusuchen.
Und darauf hatte ich keine Lust.
Dafür gab es diverse Gründe.
Erstens: Ich wollte kein Kleid anziehen.
Zweitens: Ich wollte kein Kleid anziehen.
Drittens: Ich wollte kein Kleid anziehen.
Ich trug niemals Kleider, aber ich hatte Diana versprochen, diesmal eine Ausnahme zu machen.
Viertens bedeutete der Kauf eines Hochzeitskleides einen weiteren Schritt Dianas in ein anderes Leben, in das einer verheirateten Frau. Ich hatte keinen Zweifel, dass sie und Okko umgehend Kinder bekommen würden, was noch mehr verändern würde. Und dann, nur einen Wimpernschlag später, würde sie in einem Schaukelstuhl sitzen, von ihren Enkelkindern umringt. Und ich war die kinderlose Ersatz-Oma. Die mit den vielen Katzen. Keine Ahnung warum, aber wenn ich an meine Zukunft mit Pascal dachte, kamen Kinder darin nicht vor.
Das Glück mit Okko gönnte ich ihr von Herzen, aber es war mir auch ein bisschen unheimlich. In meiner Freundin erkannte ich kaum noch die Diana, die sie früher gewesen war. Niemals hätte ich gedacht, dass sie sich jemals so absolut und mit allen Konsequenzen auf einen Mann einlassen würde. Aber vielleicht hatte ich bloß noch nicht kapiert, dass man das durchaus tun konnte, ohne seine Freiheit aufzugeben. Ja, vielleicht steckte ich in der Vorstellung fest, dass so etwas wie eine Heiratsurkunde das Leben veränderte.
Vielleicht. Dennoch: Was wusste ich schon?
Mit Pascal lief alles wunderbar, aber das konnte auch daran liegen, dass wir durch seinen Job als Tontechniker immer wieder voneinander getrennt waren. Dafür, mir eine Hochzeit mit ihm vorzustellen, reichte meine Fantasie bei Weitem nicht aus (und das wollte was heißen!).
Langsam, aber sicher ging Ramses-Konfuso, oder wie das Gör hinter mir auch immer heißen mochte, die Luft aus. Seine Tritte wurden unregelmäßiger und immer schwächer, hörten dann ganz auf. Umgehend stürzte sich das Kind auf eine neue Aufgabe: seine Mutter mit Fragen zu nerven, die alles und jeden in Sichtweite betrafen. Innerlich feixend aktivierte ich meinen MP3-Player und bedauerte kurz, keine klingonischen Opern in meiner Playlist zu haben, die, wie jedermann weiß, an donnerndem Bombast selbst Wagner in den Schatten stellen.
Aber Mozart war auch okay.
Von den zauberhaften Melodien des großen Komponisten milde gestimmt, stieg ich eine knappe Stunde später aus dem Zug. Ich trat aus dem wuselnden Menschenstrom, um die Reisetasche abzustellen und mich nach Diana umzusehen, als meine beste Freundin mir auch schon kreischend um den Hals fiel. In einem Wirbel aus flatternden Rüschen mit Blümchen drauf und fliegenden blonden Locken versank ich, während sie mich schallend auf beide Wangen küsste. Dann standen wir da und grinsten uns debil an, als meine beiden Reisegefährten von der Sitzbank hinter mir an uns vorbeigingen und uns synchron den Mittelfinger entgegenreckten. Die erwachsene Begleitperson garnierte den Auftritt zusätzlich mit einem zwar gemurmelten, aber dennoch deutlich hörbaren: »Lesbe. Wusste ich.«
»Wer war das denn?«, fragte Diana verdutzt.
»Oh, das waren der liebreizende kleine Maik-Legolas und seine Mutter Schantall. Die Namen sind übrigens nur Platzhalter. Sie haben während der Zugfahrt hinter mir gesessen. Alles Weitere ist bereits aus meinem Gedächtnis gelöscht. Und das ist auch gut so. Ansonsten müsste ich Schantall nämlich vor den nächstbesten einfahrenden Zug stoßen.«
Dianas Augenbrauen hoben sich um eine Winzigkeit, aber sie stellte keine weiteren Fragen. Sie kannte mich gut genug, um sich vorstellen zu können, dass ich mit den beiden aneinandergeraten war.
Stattdessen zuckte sie mit den Schultern und hakte sich bei mir ein. »Also dann, meine Liebe, Mission Kleiderkauf. Wir haben einen Termin.«
Seufz.
Natürlich hatte Diana bereits eine Vorauswahl getroffen, sonst wären wir auch ein wenig spät dran gewesen, denn die Hochzeit war in gerade mal drei Wochen. Sie hatte mich während der letzten Wochen per Mail mit Fotos von Kleidern und Links zu Hochzeitsrobenanbietern bombardiert, wobei jedes einzelne Kleid in aller Ausführlichkeit diskutiert werden musste.
Herzausschnitt, große Ballrobe, Meerjungfrauen-Schnitt, A-Linie, Vintage-Style, mit Trägern oder schulterfrei, schlicht oder pompös, reinweiß oder elfenbeinfarben, mit Schleppe oder ohne, vielleicht sogar vorne kurz und hinten lang? Schleier oder lieber Fascinator – oder gar ein Diadem? Vielleicht doch ein Kranz aus echten Blüten?
Ich hatte mich zwar verbissen gewehrt, aber mittlerweile konnte ich mit all diesen Begriffen tatsächlich etwas anfangen. Das weiße, glitzernde Gift der Romantik hatte sich in meinem System unerbittlich ausgebreitet.
Immerhin äußerte Diana nicht den Wunsch, ›wie eine Prinzessin‹ aussehen zu wollen, wie es die allermeisten Bräute in den einschlägigen TV-Sendungen taten, die ich mir aus Recherchegründen zähneknirschend ansah. Deren Vorstellung von einer Prinzessin schien überdies ausschließlich aus Disney-Zeichentrickfilmen zu stammen, anders konnte ich mir die Vorliebe für bauschige Tüllröcke nicht erklären. Eine begutachtete sich mal im Brautmodenladen im Spiegel und quengelte dann: »Ich will wie Cinderella aussehen. Das hier ist mehr so wie Schneewittchen.« Das gequälte Gesicht der Verkäuferin sprach Bände.
Kopfüber war ich in dieses weiß glitzernde Paralleluniversum gestürzt, durch das ich irrte wie Alice durchs Wunderland. Aber das war bislang wenigstens nur ein virtuelles Wunderland gewesen. Wir hingegen betraten nun mit dem Brautmodengeschäft die materielle Ebene. Prompt erschien auf der Bildfläche der verrückte Hutmacher in Gestalt eines filigranen Jüngelchens und begrüßte Diana so überschwänglich, als wären sie schon zusammen im Kindergarten gewesen. Dann wandte sich der junge Mann mir zu, streckte mit graziös die Hand entgegen und zwitscherte: »Hallo, ich bin Steven. Und du musst Loretta sein.«
Dass er mich duzte, wunderte mich nur kurz, war ich doch damit beschäftigt, mich zu fragen, ob er einen Handkuss von mir erwartete oder nicht. Dann griff ich nach dem Händchen und schüttelte es vorsichtig.
»Steven und ich haben uns in letzter Zeit so oft gesehen«, sagte Diana, »dass ich das Gefühl habe, wir kennen uns schon ewig. Verrückt.«
Ja, verrückt.
Aber lange nicht so verrückt wie dieser Laden. Brautkleider, wohin das Auge auch blickte, deckenhohe Spiegel, altrosa Teppich und ebensolche Sessel, Kristalllüster. Vor den Spiegeln kleine runde Podeste, über deren Sinn ich dank meiner TV-Recherche nicht nachdenken musste: Damit wurden zu lange Kleider beziehungsweise das eventuelle Fehlen von Stöckelschuhen ausgeglichen.
»Sektchen?«, zwitscherte das Steven-Wesen.
Wie aus einem Munde kam Dianas und meine Antwort: »Mineralwasser, bitte.«
Steven verzog seine Lippen zu einem Schmollmund. »Nicht einmal heute? Wo doch heute die Entscheidung aller Entscheidungen fallen wird? Das ist doch ein Grund zu feiern! Immerhin geht es doch um den glücklichsten Tag im Leben einer Frau, meine Damen!«
»Oha, dann geht es danach also nur noch bergab?«, erkundigte ich mich freundlich. Steven plinkerte bestürzt mit den Lidern, und Diana stieß mich unauffällig in die Seite.
Ich zuckte in Stevens Richtung entschuldigend mit den Schultern und sagte: »Hehe, kleiner Scherz«, und er wieselte sichtlich erleichtert los, um unsere Getränke zu holen.
»Loretta, also wirklich«, kommentierte Diana grinsend. »Musst du das arme Vögelchen so erschrecken? Willst du mit deiner scharfen Zunge seine kleine, heile Welt zum Einsturz bringen?«
»Das war ich nicht«, gab ich zurück. »Ich habe neuerdings eine eingebaute Funktion für passende Antworten auf blöde Phrasen. Das geht automatisch, darauf habe ich keinerlei Einfluss.«
Diana kicherte. »So etwas Ähnliches dachte ich mir schon. Aber er sagt doch nur, was die Leute hören wollen. Plattitüden am laufenden Band. Glücklichster Tag im Leben, das Kleid ist wie für Sie gemacht, Sie sehen wie eine Prinzessin aus …«
»Sobald ich im Zusammenhang mit dir das Wort Prinzessin höre«, fiel ich ihr ins Wort, »verlasse ich unter Protest diesen Laden.«
»Das meinst du nicht ernst, du doofe Kuh.«
Sie versuchte, es amüsiert klingen zu lassen, aber ich spürte echte Nervosität dahinter. »Nein, das meine ich nicht ernst. Und du hast recht: Ich bin eine doofe Kuh, die keine Rücksicht auf deine Gefühle nimmt. Soll nicht wieder vorkommen. Ab jetzt reiße ich mich zusammen, großes Indianer-Ehrenwort.«
Steven brachte unsere Wässerchen und teilte Diana mit, ihre drei Vorauswahl-Kleider hingen für sie in der Umkleidekabine bereit. Meine beste Freundin machte einen kleinen aufgeregten Hopser und klatschte quietschend in die Hände, dann stürzte sie mit dem Elfenwesen davon.
Mit einem Seufzen ließ ich mich in einen der schwellenden Sessel fallen und trank das herrlich kühle Mineralwasser. Nach knapp drei Stunden in diesem Zug war ich ausgedörrt und erschöpft. Sich aufzuregen und genervt zu sein kostet doch mehr Kraft, als man meint. Natürlich nahm ich auf Zugreisen immer etwas zu trinken mit, was ich regelmäßig dann aber doch nicht anrührte, weil ich keine Lust hatte, auf die grundsätzlich total versifften Klos zu gehen. Das tat ich nur im äußersten Notfall.
Diana kam an Stevens Arm hereingeschwebt, und hätte ich nicht bereits gesessen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, mit wackligen Beinen hinter mir haltsuchend nach einem Stuhl zu tasten.
Ich muss sie wohl ziemlich fassungslos und vermutlich mit offenem Mund angeglotzt haben, denn sie fragte: »Gefällt es dir nicht? Findest du, ich sehe scheiße aus?«
Stevens Gesicht spiegelte ihre Besorgnis vortrefflich.
»Oh, mein Gott, nein! Du siehst wundervoll aus!«, sagte ich schnell – und absolut wahrheitsgemäß.
Nun, Diana sieht immer wundervoll aus, und ihr Anblick in einem Kleid war wahrlich nichts Neues für mich. Sie liebte duftige Kleider, sie liebte Rüschen und zarte Blumendrucke. Aber das hier … also das hier … Mir fehlten die Worte. Sie trug ein fließendes Gewand, ganz schlicht geschnitten, aus schimmerndem Stoff. Die langen Ärmel waren aus Spitze, der Ausschnitt ließ ihre Schultern frei.
Ich sah dieses Kleid nicht zum ersten Mal an ihr, denn sie hatte mir von jeder Anprobe Fotos geschickt. Aber: kein Vergleich zwischen einem Handyfoto und der Wirklichkeit, wie ich feststellen musste.
»Findest du?«, quiekte sie glücklich.
Sie drehte eine Pirouette, und der Stoff umfloss sie wie … wie … na ja, wie irgendein flüssiges, elfenbeinfarbenes Metall halt, sollte es so etwas überhaupt geben.
»Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön«, stammelte ich los. »Wirklich, sehr schön, ohne Witz.«
»Nicht wahr?«, zwitscherte Steven begeistert. »Sieht sie nicht wie eine wunderschöne Meerjungfrau aus?«
Dafür fehlten für meinen Geschmack zwar noch ein paar Algen in den Haaren, vielleicht ein Fischernetz als Schleier und ein paar hübsche Korallen als Diadem, ganz zu schweigen vom Fischschwanz. Aber sein Vergleich hatte was, das musste ich zugeben. Ganz insgeheim.
Diana lachte und drehte sich erneut. »Okay, dann ziehe ich das nächste an. Nicht weggehen!«
Das wäre ohnehin nicht möglich gewesen, dazu war ich viel zu baff. Ich war unendlich erstaunt darüber, wie sehr mich ihr Anblick in einem Hochzeitskleid anrührte. Oder war es nur dieses spezielle Kleid?
Die Antwort darauf bekam ich Minuten später, als sie in einem unförmigen Gewand zurückkehrte, das wie ein überdimensionaler Kaffeekannenwärmer aussah, den Dutzende verrückte Hausfrauen mit steifem Eischnee beworfen hatten. Überall um Diana herum wölbte und bauschte es sich voluminös, und ich fühlte mich fatal an die ausladende Robe erinnert, in der die selige Prinzessin Diana seinerzeit ihren Charles geheiratet hatte. Das war 1981 gewesen, und genau in dieses Jahr gehörte auch dieses Kleid, das meine Diana gerade vorführte. Oder in Scarlett O’Haras Kleiderschrank.
Was hatte uns bloß geritten, diesen Totalausfall welches ewiggestrigen Hochzeitskleiddesigners auch immer in die enge Auswahl zu nehmen? Waren wir beim entsprechenden Telefonat besoffen gewesen? Oder erlebte ich gerade den umgekehrten Effekt, was Foto und Realität anging?
Wie von selbst hob sich meine rechte Hand, dann senkte sich der Daumen nach unten. »Kein Vergleich zum ersten Kleid, tut mir leid«, sagte ich. »So viel Wahrheit muss sein. Ich schulde dir meine ehrliche Meinung. Eigentlich finde ich es sogar ziemlich schrecklich.«
Steven wollte protestieren. Was sollte er auch machen? Vielleicht sagen: »Ja, stimmt, wir haben hier ein paar fürchterliche Schrottfetzen im Laden, die seit 30 Jahren keiner will, und dies ist einer davon«?
Aber Diana winkte ab und musterte sich im Spiegel. »Kannst du dich erinnern, was wir daran so toll fanden?«, fragte sie mich ratlos.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich habe nicht den blassesten Schimmer, meine Liebe. Lief da vielleicht gerade Vom Winde verweht oder irgendein anderer Historienschinken im Fernsehen und hat unser objektives Urteilsvermögen manipuliert?«
»Weg mit dem gruseligen Fummel!«, sagte Diana resolut.
Steven sah aus, als würde er den unförmigen Stoffhügel am liebsten im nächsten Müllcontainer verschwinden lassen, aber aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber sollte er besser fest daran glauben, dass es irgendwo eine Frau gab, für die genau dieses Kleid die Erfüllung all ihrer Träume war.
Diana wandte sich mir zu und grinste. »Eine Entscheidung ist also schon gefallen. Läuft doch hervorragend, finde ich.«
Sie wallte raschelnd von dannen, und ich ließ meinen Blick schweifen. Dahinten, an einer langen Kleiderstange aufgereiht, hing das, was ich für Brautjungfernkleider hielt. Vorsichtig nahm ich sie aus der Entfernung in Augenschein. Es schillerte und schimmerte in allen Farben des Regenbogens und in noch ein paar Dutzend weiteren Schattierungen.
Auch zu diesem Thema hatte ich im Fernsehen schon allerlei Elend gesehen. In Amerika war es ja wohl üblich, dass es bei Hochzeiten immer eine ganze Armee von Brautjungfern gab, die alle das gleiche Kleid tragen mussten, was mich immer an diese eine Nummer in Travestieshows erinnert, die ich mal gesehen hatte: Sämtliche Ensemblemitglieder waren als Mireille Mathieu auf die Bühne gekommen.
Aber da ich die einzige Brautjungfer war, würde es zu einem derartig bizarren Anblick nicht kommen. Das fehlte auch noch! Loretta Luchs als Mitglied einer geklonten Armada mit einbetoniertem Grinsen, das wüsste ich aber.
Dianas Auftauchen riss mich aus meinen Gedanken, und ich war sofort elektrisiert. Das war es, dieses Kleid musste es einfach sein: oben schlicht wie ein ärmelloses weißes T-Shirt, darunter der mehrlagige Tüllrock einer Ballerina, der bis zu ihren Knöcheln reichte. Das war alles. Kein Glitzer, keine Rüschen, keine Schleifchen oder Stickereien, keine Spitze, keinerlei Firlefanz. Diana stand einfach barfuß da, ihre blonden Locken umrieselten ihre Schultern, und sie sah aus wie eine Braut.
Ich rang um Fassung, dann fing ich an zu heulen. »Diana, das ist ja … du siehst so …«, schluchzte ich hilflos, aber mehr kam nicht raus.
»Sieht sie nicht aus wie eine wunderschöne Prinzessin?«, juchzte Steven, und selbst das konnte ich ihm verzeihen.
»Bitte, nimm dieses Kleid«, sagte ich schniefend, und Diana nickte strahlend.
Kapitel 2
Loretta gibt sich alle Mühe, befürchtet aber, für eine Leuchtboje gehalten und in die Nordsee geworfen zu werden
Wie ein kleines Mädchen hüpfte Diana zurück in die Umkleidekabine, und ich atmete tief durch. Jetzt war ich also dran.
Ich hatte Hunger, ich war müde, ich wollte hier weg. Ich hatte keine Lust, in hundert verschiedene Kleider zu steigen, in denen ich samt und sonders schrecklich aussehen würde. Davon war ich fest überzeugt, und das machte es mir nicht leichter. Wenn Diana gerade ein glückliches, kleines Mädchen war, dann war ich wohl die trotzige, kleine Mistgöre, die alles scheiße finden wollte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!