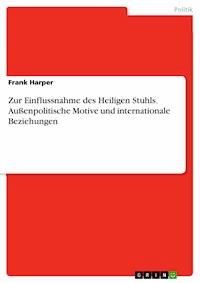6,99 €
Mehr erfahren.
Kümmern Sie sich um das Wunder von Muscatine!, befahl mir der Chefredakteur des New York Globe. Was für ein Wunder?
Die Hellseherin und Telepathin Bella Merlin behauptete, die millionenschwere und berückend schöne Cora Latour, Opfer eines geheimnisvollen Unfalls, soll ein Jahr nach ihrem Tod aus dem Grab auferstanden und wieder nach Hause zurückgekehrt sein... bestaunt von ihren Angehörigen und allen Einwohnern des Städtchens Muscatine.
Und als ich in Muscatine - im tiefsten Süden der USA - nachzuforschen begann, stieß ich auf eisige Ablehnung...
Der Roman Coras geheimnisvolle Rückkehr - ein klassischer Crime-Noir-Thriller - von Frank Harper erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1980.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
FRANK HARPER
Coras geheimnisvolle Rückkehr
Roman
Apex Crime, Band 208
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
CORAS GEHEIMNISVOLLE RÜCKKEHR
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Kümmern Sie sich um das Wunder von Muscatine!, befahl mir der Chefredakteur des New York Globe. Was für ein Wunder?
Die Hellseherin und Telepathin Bella Merlin behauptete, die millionenschwere und berückend schöne Cora Latour, Opfer eines geheimnisvollen Unfalls, soll ein Jahr nach ihrem Tod aus dem Grab auferstanden und wieder nach Hause zurückgekehrt sein... bestaunt von ihren Angehörigen und allen Einwohnern des Städtchens Muscatine.
Und als ich in Muscatine - im tiefsten Süden der USA - nachzuforschen begann, stieß ich auf eisige Ablehnung...
Der Roman Coras geheimnisvolle Rückkehr - ein klassischer Crime-Noir-Thriller - von Frank Harper erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1980.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
CORAS GEHEIMNISVOLLE RÜCKKEHR
Erstes Kapitel
Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen hatte, als ich in Cincinnati an Bord der Delta Queen ging. Sie war ein altes Schiff, der letzte Raddampfer auf dem Mississippi. Ihr Rumpf war schwarzer Stahl, ihre vier Decks waren weiß gestrichen, und ihr großes Doppelrad am Heck trieb sie langsam, doch beharrlich dahin. Wenn es hochkam, schaffte sie ihre zwölf Meilen die Stunde, und nach New Orleans brauchte sie nicht einen Tag länger als vor hundert Jahren, zehn Tage insgesamt.
Ich fuhr nach New Orleans zum Mardi Gras, dem großen Karneval des Südens, der in Amerika nicht weniger berühmt ist als in Europa der Karneval von Nizza oder von Venedig.
An Bord gab es nichts, womit man sich beschäftigen konnte. Radio oder Fernsehen schienen nie erfunden. Es gab auch keine Schiffszeitung, sodass es unmöglich war, sich auch nur über die wichtigsten Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Die Weltpolitik stand gleichsam still.
Sicher, ich hatte Zeit, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, nur war ich nicht daran gewöhnt, so viel Zeit zu haben. Ich versuchte es mit Büchern, die ich bald ungeduldig zuschlug, und oft trieb mich meine Hast im Laufschritt ums Promenadendeck, an Dutzenden von Liegestühlen vorüber, aus denen mir Menschen mit leiser Verzweiflung zulächelten.
Etwas abseits lag das Mädchen, das Roberta hieß, das lange, seidig-blonde Haar halb über das Gesicht geweht und die graublauen Augen sinnend auf ein Buch gerichtet.
Zuweilen machte sie eine kleine vergebliche Geste, sich das Haar aus der Stirn zu streichen. Das Buch, in dem sie las oder zu lesen schien, war ziemlich abgegriffen. Sie schien mich nicht zu beachten. Es fiel mir aber doch auf, dass sie jedes Mal den Blick hob, wenn ich mich von ihr entfernte, und dass sie mir dann eine Weile nachsah.
Sie war ungewöhnlich schön, und ich hatte das Gefühl, sie schon irgendeinmal irgendwo gesehen zu haben.
Ihr voller Name war Roberta Gregg, wie ich von einem Steward in Erfahrung gebracht hatte. Sie schien deutscher Herkunft zu sein.
Meine Ungeduld gab sich erst nach Tagen, als wir Memphis, Tennessee, hinter uns gelassen hatten. Plötzlich hörte ich auf, mich nach klingelnden Telefonen, Schreibmaschinen und Fernschreibern zu sehnen, und ich blickte den Flugzeugen, die gelegentlich in Sicht kamen, nicht mehr mit Neid nach.
Wir näherten uns dem tiefen Süden, und in einer Nacht war es so still, dass ich die Barrel-House-Blues, gesungen von Negern an einem Lagerfeuer am Arkansas-Ufer, hören konnte.
Tagsüber schwelte die Hitze über dem Mississippi, dem großen melancholischen Strom, der sich in endlosen Windungen dahinzieht, zuweilen in einem harten Silbergrau und zuweilen graugrün schimmernd, mit den Schatten von seltsamen Bäumen an den dschungelgleichen Ufern.
Mein Zeitgefühl funktionierte nicht mehr. Es gab nur noch den Fluss, die Ufer, die Zeitlosigkeit.
Es mochte 1850 und nicht 1957 sein.
Eines Morgens enttäuschte es mich, Miss Gregg noch nicht in ihrem Liegestuhl vorzufinden.
Dagegen fand ich das Buch, in dem sie so oft las, in ihrem Liegestuhl, und ich griff danach. Trotz des halb zerrissenen Umschlags konnte ich den Titel doch entziffern. Das Buch hieß Die vier Freiheiten, sein Verfasser hieß Frank Jones.
Frank Jones, das war ich, und das Buch, 1945 erschienen, enthielt meine Kriegserlebnisse in Deutschland, Frankreich und Japan.
Damals war ich amerikanischer Kriegskorrespondent gewesen. Später hatte man mich auch nach Korea geschickt.
In jenen Jahren war ich ein etwas wilder und abenteuerlicher junger Mann gewesen, und ich hatte an den Kriegen eine Art von bitterem Spaß gehabt.
Übrigens war es kein schlechtes Buch, das ich jetzt, seltsam berührt, in der Hand wog. Es war ein Stück meiner Jugend. Vor zwölf Jahren und noch lange hinterher war ich stolz auf das Buch gewesen, und es freute mich, dass es noch nicht ganz vergessen war. Ich versuchte, die vier Freiheiten, für die Amerika in den Krieg gegangen war, aufzuzählen. Komisch – eine fiel mir nicht mehr ein.
Ich war jetzt 42, und mein einstiger Idealismus war längst zum Teufel gegangen.
Aus meinen Gedanken schreckte ich auf, als Roberta Gregg plötzlich vor mir stand. Sie duftete wie ein ganzer Korb voll Blumen. Unwillkürlich musste ich lächeln.
»Verzeihen Sie... ich habe nur einen Blick in dieses Buch geworfen«, sagte ich.
Ohne auf mein Lächeln einzugehen, nahm sie mir das Buch aus der Hand. »Schmeichelt es Ihnen etwa, dass ich in Ihrem Buch lese, Herr Jones?«
Ich sah sie überrascht an. Schon einmal hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie mir nicht fremd war. Dieses aparte Gesicht musste ich doch schon einmal gesehen haben, vielleicht in New York...
»Es schmeichelt mir, dass Sie wissen, wer ich bin«, sagte ich in einem etwas idiotischen Ton, der mir selbst wehtat.
Ihr Gesicht drückte nichts als Gleichgültigkeit aus. »Was ist daran so schmeichelhaft? Ein Steward sagte mir, wer Sie sind.«
Ich konnte mein Gesicht nicht von ihr wenden. Ihr Körper war schmal und elegant, und aus der weißen Hemdbluse, die sie zu einfachen weißen Leinenslacks trug, hoben sich überraschend die fraulichen Formen ab. Ich blickte auf ihr feines, ovales Gesicht, auf ihre klare, doch ein wenig gerunzelte Stirn, auf ihr langes, seidig-blondes Haar. Mein Blick richtete sich auf ihre großen graublauen Augen, deren Glanz leicht verschleiert war, wie von einer geheimnisvollen Trauer, auf ihre kleine empfindliche Nase, auf ihren nicht lächelnden Mund.
Es war nur in Gedanken, dass ich sie an mich zog, nur in Gedanken, dass ich sie auf den Mund küsste, tief und besinnungslos. Meine Gedanken entsetzten mich, und unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück, aus Angst, mich wirklich zu vergessen.
Das war mir noch nie mit einer Frau passiert.
Schließlich fragte ich: »Darf ich wissen, wo Sie dieses alte Buch von mir aufgetrieben haben?«
»Jemand schenkte es mir. Ich weiß nicht mehr wer, wo und wann.«
»Gefällt es Ihnen?«
»Es gefiel mir, als ich es zuerst las. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Heute gefällt es mir nicht mehr.«
»Insbesondere was nicht?«
»Es ist wohl doch etwas zu oberflächlich, Herr Jones.«
Einen Augenblick später nickte sie mir kurz zu, wie zum Zeichen, dass sie es vorzog, für sich allein zu bleiben. Ich sah noch, dass sie sich in ihrem Liegestuhl niederließ und die obersten Knöpfe ihrer Hemdbluse aufzuknöpfen begann, und dann entfernte ich mich lächelnd, doch mit dem deutlichen Gefühl, abgelehnt worden zu sein.
Am Heck der Delta Queen trat ich an die Reling und starrte in den schäumend weißen Gischt, den das Doppelrad aufwühlte. Ich war beunruhigt, und die Monotonie des Flusses, der als Old Man River besungen wird, lastete auf mir. Ich starrte in das Dickicht beider Ufer, auf die gigantischen Zypressen, die von Spanischem Moos fast erdrosselt wurden, auf die wilden Magnolienbüsche. Und dabei dachte ich an Roberta Gregg. Doch der Name sagte mir nichts.
Wer war dieses Mädchen, und warum hatte ich das Gefühl, dass sie mir keine Fremde war?
Abends wurde der Paw Paw Patch getanzt. Es war ein Tanz, mit Verbeugungen der Herren und Knicksen der Damen, der zur Tradition der alten Mississippi-Raddampfer gehört, und einer der Passagiere am Klavier in der Halle mit den dunkel glänzenden Mahagoniwänden spielte die Musik dazu.
Ich hatte auf den Abend gewartet, und sobald die Musik begann, ging ich auf Miss Gregg zu.
»Darf ich mit Ihnen tanzen?«
Sie erhob sich und stand aufrecht und schmiegte sich, mit unpersönlichem Ausdruck, in meine Arme, und ich tanzte mit der Förmlichkeit, die sie mir aufzwang. Von allen Frauen war sie die Einzige, die kein Abendkleid trug. Ihr Kleid war aus schwarzem Organdy, etwas streng, und es war am Hals geschlossen. Sie trug es, als wollte sie damit kundtun, dass sie es nicht darauf anlegte, zu gefallen. Sie trug auch keinen Schmuck und kaum Aufmachung. Es war, als lehnte sich ihre fast phantastische Schönheit gegen irgendetwas auf. Und dabei dieser Blumenduft...
Ich tanzte mit gerunzelter Stirn, in einer gewaltigen Anstrengung, mich zu erinnern.
»Miss Gregg, besteht irgendeine Möglichkeit, dass ich Sie kenne?«
Sie lachte auf, es klang etwas heiser. Es war zum ersten Mal, dass sie amüsiert schien. »Ist das ein Annäherungsversuch, Herr Jones?«
»Nein, sicher nicht. Ich meine es ernst. Sind Sie aus New York?«
»Nein... Doch vor sieben Jahren war ich einmal in New York.«
Vor sieben Jahren war ich in Korea gewesen, und das schied aus. »Wo leben Sie jetzt?«
»Meistens im Westen. In Los Angeles, San Francisco, Las Vegas.«
»Sie reisen also viel?«
»Ich bin immer auf der Reise.«
»Immer?«
»Lange bleibe ich nirgends.«
Zu einer Frau, die immer auf Reisen war, hatte ich nie in Beziehungen gestanden, und doch schienen mir ihre Stimme, ihre Geste und ihre eigenwillige Persönlichkeit vertraut.
»Haben Sie etwas mit Sport zu tun?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ich bin Sportreporter für den New York Globe. Wäre es nicht möglich, dass ich Sie einmal in einer Sportarena gesehen habe?«
»Weder spiele ich Tennis, noch reite ich Turnierpferde.« Ihr Mund verzog sich spöttisch und bitter. »Ich bin auch keine Ringkämpferin.«
»Sind Sie vom Theater oder Film?«
»Nein, auch das nicht. Geben Sie es auf, Herr Jones. Dass ich ein Buch von Ihnen besitze, beweist noch lange nicht, dass wir uns kennen.«
Als ich sie später zu ihrer Kabine zurückbegleiten durfte, hatte meine Spannung durchaus nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Immer stärker zog es mich zu ihr hin.
Sie öffnete die Tür und drehte drinnen das Licht an, das auf einen Schrankkoffer fiel. Der gewaltige Koffer war abgegriffen, offenbar von vielen Reisen.
Und ein wenig schäbig waren auch die roten Samtpantoffeln unter ihrem Bett.
Sie wehrte mich nicht ab, als ich hinter ihr die Kabine betrat.
»Machen Sie die Tür zu«, sagte sie zu meinem Erstaunen, fast in dem kaltblütigen Ton einer Frau, die Männer für Geld empfing.
Plötzlich kam mir der Gedanken, dass sie eine Abenteurerin war, so damenhaft ich sie auch zuerst gefunden hatte, und dieser Verdacht verstärkte sich noch, als sie zwei Gläser Cognac einschenkte.
Sie hielt mir ein bis zum Rand gefülltes Glas hin. »Sie haben mich so viele Dinge gefragt, dass eigentlich auch ich das Recht habe, Sie etwas zu fragen.«
»Gern, Fräulein Gregg.« Ich konnte mir die Frage schon vorstellen, und ich war bereit, bis zu hundert Dollar für das Abenteuer auszugeben.
»Wollen Sie mich nicht Roberta oder Bobby nennen, damit ich Sie Frank nennen kann? Das vereinfacht alles, zumal wir uns wahrscheinlich nie wieder sehen werden.«
»All right, Bobby.«
Ich war auf die brutalen Geschäfte gefasst, die zwischen solchen Männern, wie ich es war, und solchen Frauen stattfanden, als sie mir gerade in die Augen sah. Und dann kam auch schon die Frage: »Warum sind Sie eigentlich Sportreporter geworden, Frank?«
Nein, darauf war ich nicht gefasst gewesen! Innerlich fühlte ich eine tiefe Befriedigung, dass das Bild, das ich mir anfangs von ihr gemacht hatte, rein geblieben war.
»Ich verstehe Ihre Frage nicht.«
»Frank, was hat den Autor von Die vier Freiheiten dazu gebracht, über so unwichtige Dinge wie Boxkämpfe und Pferderennen zu schreiben?«
Meine Hand bebte. Ich verschüttete den Cognac. »Was erwarten Sie von einem Kriegskorrespondenten, wenn die Kriege aufhören? Soll er verhungern?«
»Die Kriege hören leider nie auf.«
»Sport ist nicht unwichtig für mich«, verteidigte ich mich. »Ich habe mein Bestes dafür gegeben, und ich schäme mich nicht, über solche Sportgrößen wie Ted Williams, Eddie Arcaro, Sugar Ray Robinson zu schreiben.«
»Das war doch nicht immer Ihr Ehrgeiz?«
»Was wissen Sie, was mein Ehrgeiz war? Ist es gar nichts, dass meine tägliche Spalte in fast dreihundert Zeitungen erscheint, dass ich mein eigenes Fernsehprogramm habe und dass mich jedes Kind in diesem Lande kennt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es ist nicht allzu viel, Herr Jones.«
Das kleine steile Fältchen, das zwischen ihren Brauen stand, die nicht ganz symmetrisch waren, gab mir zu denken.
»Sonst noch Fragen, Roberta?«
»Nein. Ich hoffe, dass Sie mir jetzt nicht böse sind.«
»Ganz sicher nicht. Möglicherweise haben Sie recht, dass aus mir nicht viel geworden ist«, sagte ich lächelnd.
»Wollen Sie mir einen Wunsch erfüllen?«, fragte ich nach einer Weile.
Sie sah mich fragend an.
»Können wir uns in New Orleans treffen, etwa bei Antoine?«
»Das geht leider nicht.«
»Vielleicht geht es doch?«
»Nein, nein! Sie müssen jetzt gehen! Es ist schon spät.«
»Gute Nacht, Roberta Gregg«, sagte ich, wahrscheinlich mit einem leisen Seufzer.
Ihr herrliches Gesicht war fast ausdruckslos, als sie mich zur Tür begleitete. Zu meinem Erstaunen sah ich sie nach dem Lichtschalter greifen.
Im Nu sank der Raum in Dunkelheit. Ihre Hand fuhr durch mein Haar, sie schlang die Arme um mich und küsste mich heiß auf den Mund.
»Gute Nacht, Frank Jones. Leben Sie wohl«, sagte sie und schob mich rasch zur Tür hinaus.
Dort auf dem Gang stand ich minutenlang in tiefster Verwirrung, bevor ich mich zusammenreißen konnte.
Ich stieg die Treppe zum Deck hinauf. Der schwüle Nachtwind des Südens umwehte mich, ein ungeheurer Mond stand über dem Fluss, der langsam, lautlos und empfindungslos dahinfloss, dem weiten Delta zu.
Mardi Gras enttäuschte mich. Der Karneval von New Orleans ist der einzige Karneval, den wir in Amerika haben, doch der Trubel ging mir auf die Nerven, und die Menschenmassen machten es für mich unmöglich, New Orleans wirklich kennenzulernen.
Eine ganze Woche lang erscholl Musik von jeder Straßenecke. Wie Regen fiel Konfetti aus den Fenstern.
Jedes Gebäude war mit gigantischen Masken dekoriert, die grün, golden und purpurfarben bemalt waren. Maskierte Frauen, die sonst fast unbekleidet waren, winkten von blumengeschmückten Wagen, umjubelt von phantastisch kostümierten weißen und schwarzen Menschen.
All das schätzte ich nicht, und ich empfand es als zweifelhaften Genuss, die engen Straßen im Alten Viertel jenseits von Canal Street, der Hauptstraße der Stadt, entlanggeschoben zu werden.
Das war ein Jammer, weil dieses alte Viertel, 1718 von den Franzosen erbaut und später von den Spaniern vervollkommnet, eine Köstlichkeit ist. Inmitten des Gedränges erhielt ich nur einen flüchtigen Eindruck von den Palästen aus rosa- und purpurfarbenem Ziegelstein, den hohen Fenstern und grünen Jalousien und den großen Balkons mit grünlich oder bläulich bemaltem Gitterwerk.
Ich fand keine Gelegenheit, mich im Innenhof des berühmten Hauses Zu den beiden Schwestern umzusehen, und ich kam auch nicht dazu, im immer überfüllten Restaurant Antoine einen Tisch zu finden.
Die ganze Woche lang fühlte ich mich nicht wohl, und den einzigen hübschen Abend verbrachte ich im Coliseum anlässlich des Boxkampfes von Ed Jersey gegen Joe Orange.
Es war einer der aufregendsten Kämpfe, die ich je gesehen hatte, ein Kampf, der mir aus Gründen, die ich noch nicht ahnen konnte, auf lange Zeit unvergesslich blieb.
Das Coliseum ist ein Rundbau mit weißgekalkten Wänden, der dreitausend Zuschauern Platz bietet. Rauchen ist erlaubt, und die Sitzreihen um den Ring verschwammen in einem bläulichen Nebel. Nur der Ring selbst lag in grellem Scheinwerferlicht, sodass die dunklen Körper der beiden Boxer von weißem Glanz übergossen waren. Auf mich, der ich aus New York kam, machte es einen befremdenden Eindruck, dass die Sitze nur für Weiße waren und dass sich unsere dunkelhäutigen Landsleute mit Stehplätzen auf der Galerie begnügen mussten.
Gleich nach dem Gong zur dritten Runde landete Joe Orange eine Rechte, hinter der die ganze Kraft muskelstrotzender Jugend saß.
Zu meinem Schrecken sah ich Ed Jersey in die Knie brechen. Ich hatte vielen seiner Kämpfe beigewohnt, und oft hatte ich seine Ringerfahrenheit, seine Verschlagenheit und seine Furchtlosigkeit bewundert. Aber er war alt, an die 45, und es tat mir weh, ihn am Boden zu sehen.
»Ed! Ed!«, brüllte ich, als der Ringrichter zu zählen begann.
Der alte Boxer kam bei 5 zu sich und stand bei 7 wieder auf den Beinen. Auf sehr schwachen Beinen. Seine Augen waren verglast, doch Joe Orange war zu unerfahren, um sofort nachzusetzen.
Ed hatte sich bereits wieder erholt, als Joe endlich eine Serie von linken Jabs abschoss.
Das gesamte Publikum war für Joe Orange, den einheimischen Schwergewichtler, nur ich schien für Ed Jersey zu sein.
Längst war er nicht mehr der große Boxer wie in seiner Jugend, und doch gelang es ihm, sich neue Kraft aus jener Zeit auszuleihen. Mit kaltem Grimm versuchte er, sich für die Demütigung seines Knockdowns zu rächen.
Wenn Furchtlosigkeit Punkte eingetragen hätte, dann hätte er wohl nach Punkten geführt, ungeachtet der entsetzlichen Schläge, die er im Nahkampf einstecken musste. Ein linker Jab, scharf wie die Klinge eines Rapiers, verletzte sein Auge in der siebenten Runde. Es begann sich mehr und mehr zu schließen.
Erst als der alte Boxer in der neunten Runde noch einmal zu Boden ging, wenn auch dieses Mal nur kurz, sah ich mir Joe Orange näher an, und ich konnte ihm meine Achtung nicht länger versagen. Er war beinahe majestätisch in der Schönheit seines Körperwuchses und in seiner Urkraft, die sich in ungeheurer Angriffslust auszutoben schien. Er war geladen mit dieser Kraft, und dabei war er so geschmeidig wie ein Tänzer, der zu einer besonderen Musik tanzte, die nur er allein zu hören schien. Es musste eine barbarische, wilde Musik sein.
In der zwölften und letzten Runde war Ed Jersey nur noch ein müder Mann. Nichts erinnerte mehr an seine einstige Größe.
Natürlich fiel das Urteil zugunsten des einheimischen Schwergewichts aus.
Joe Orange war groß. Meiner Meinung nach Weltklasse.
Einige Minuten später suchte ich Ed Jersey in den Garderobenräumen auf und fand ihn auf dem Massagetisch, mit einem Eisbeutel auf dem Auge und verschwollenen Lippen, und doch grinste er.
»Phantasiere ich, oder sind Sieʼs wirklich, Jones?«, murmelte er.
Ich grinste zurück. »Es war ein guter Kampf, Jersey. Sie waren nie besser. Ja, ich hatte Sie nach Punkten vom.«
»Unsinn, Jones. Ich weiß, wann ich geschlagen bin.«
»Es ist keine Schande, Jersey. Sie hatten einen großen Gegner.«
»Der Junge ist ganz groß. Er kann sogar Patty schlagen.«
»Ich hatte ihn vorher nie gesehen. Wer ist er eigentlich?«
»Er gewann als Amateur die Golden Gloves, und hier in New Orleans hat er bisher jeden Kampf gewonnen, alle durch K.o.«
»Sie hat er aber nicht k.o. schlagen können!«
»Gratulieren Sie lieber dem Sieger!«
Ich blickte mich nach Joe Orange um. Er stand unter der Dusche, und die Wasserstrahlen umprasselten seinen gewaltigen Körper und sein lachendes Gesicht.
»Joe... das ist Frank Jones vom New York Globe. Er will dir gratulieren«, rief Ed Jersey.
Aus der Dusche hielt der junge Schwarze mir die Hand hin. Ich ergriff sie. »Meine Hochachtung! Sie haben mir imponiert«, sagte ich.
»Ich hatte es schwer! Es war ein verdammt harter Kampf gegen Jersey.«
Wegen dieser feinen Lüge gewann ich Joe Orange sofort lieb. Er war ein Gentleman, selbst in seiner Nacktheit unter der Dusche.
»Was sind Ihre Pläne, Joe?«, fragte ich, mir die Hand abtrocknend.
»Mein Manager verhandelt mit Patty wegen eines Kampfes im Herbst, und ich hoffe, dass Sie dabei sind, wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne.«
Ed Jersey ließ sich vom Massagetisch gleiten. Auf seine Helfer gestützt, wankte er zu einem Stuhl.
»Geht’s besser?«, fragte ich.
»Viel besser. Es sind nur meine alten Beine, die nicht mehr so recht wollen. Richtig getroffen hat Joe mich übrigens nie.«
»Nicht ein einziges Mal, Mister Jones. Es ist ganz unmöglich, Ed Jersey je voll zu treffen«, rief Joe Orange aus der Dusche herüber.
Der alte Boxer grinste stolz. »Junge, dich möchte ich trainieren! Ich kann dir deine Schwächen zeigen, kann dir zeigen, wie man sofort nachsetzt, mit einem tödlichen Uppercut.«
»Jersey«, sagte ich, »es scheint Ihnen wirklich viel besser zu gehen. Wollen wir nachher ein Glas Bier zusammen trinken?«
Sein Grinsen verschwand. Aus dem einen heilen Auge glotzte er mich verlegen an.
»Dies ist nicht New York oder Chicago, Mister Jones.«
Ich war schwer von Begriff. »Wetten, dass auch in New Orleans um diese Stunde noch Bier ausgeschenkt wird?«
»Aber nicht für einen weißen Mann, begleitet von einem Nigger.«
So war ich allein und verstimmt, als ich nach Mitternacht Canal Street überquerte, die Neustadt und Altstadt wie mit einem dicken Strich zu trennen schien, und mich im Alten Viertel verlor. Jetzt lag Royal Street leer in bleicher Beleuchtung, in der die rosa- und purpurfarbenen Häuser mit den seltsamen Balkons nur noch Schatten waren, wie von der Vergangenheit geworfen.
In Bienville Street einbiegend, gelangte ich zur Bourbon Street, der Straße, in der das Laster seit Jahrhunderten eine alte Tradition ist.
Die ganze lange Straße glühte in buntem Neonlicht. Jazz und Dixie-Jazz schlugen aus manchem Haus. Belesen wie ich war, wusste ich, dass fast jedes dieser Häuser einst ein Haus der Unmoral gewesen war, bewohnt von Kreolinnen, die den seltsamsten Süchten gefrönt hatten. Heute waren es Striptease-Lokale.
Ausrufer priesen die Tänzerinnen an, die drinnen zu sehen waren: Wildcat Frenchie, Stormy, Lilly Christine. Durch halboffene Türen konnte man die grellbeleuchteten Mädchen auf der Bühne sehen.
Das alles war recht gemein, so ungefähr das letzte an Sex, das einem für Geld geboten werden konnte, doch diese Straße scheffelte Geld, und die Tänzerinnen mochten über tausend Dollar wöchentlich verdienen. Und manche noch viel mehr.
Ich war bis zum Silver-Slipper gelangt, als ich plötzlich, vor Schreck nahezu gelähmt, stehenblieb.
Mein Entsetzen war so groß, dass ich nach einer Minute weiterlief, nein, davonlief. Einen kurzen Augenblick lang, auf der Delta Queen, hatte ich sie für eine Abenteurerin gehalten. Doch Striptease war noch schlimmer. Die Striptease-Tänzerin, kurz und geringschätzig Stripper genannt, ist eine Standardfigur in billiger amerikanischer Literatur, so billig, wie Cowboy, Gangster und Reporter es sind. Es war billig und niedrig, und es zerstörte mein Bild von Roberta Gregg, die so lieblich nach Blumen duftete...
Vielleicht war es darum, weil ich mich wehrte, mir dieses Bild zerstören zu lassen, dass ich an der nächsten Ecke umkehrte und langsam, doch energisch zum Silver-Slipper zurückging.
Eintrittsgeld wurde nicht erhoben.
Ich bezahlte mit der Angst meines laut pochenden Herzens, mit der Angst, dass ich zu Roberta oder Bobby – ich hasste übrigens den Namen Bobby – in einer Verbindung stand, der ich mich nicht entziehen konnte.
Die Umgebung, in die ich trat, war nicht ganz so schrecklich wie in den meisten Striptease-Lokalen. Immerhin war dies ein Theater. Da gab es eine Bühne, auf der im Augenblick Dixie-Jazz gespielt wurde – wie ich erfuhr, von den letzten Überbleibseln der einst berühmten Celestin-Kapelle, mit Papa Celestin, der immer noch in die Trompete sein berühmtes Lied blies:
»Wenn die Heiligen einmarschieren...«
Logen und Sitze waren aus rotem Samt, der seit 1770 allen Staub eingefangen zu haben schien, den Staub der Jahrhunderte, sozusagen historischen Staub. Die Kellnerinnen waren bekleidet. Man konnte Champagner oder schottischen oder amerikanischen Whiskey bestellen. Unter den Striptease-Lokalen war dies offenbar noch das vornehmste.
Papa Celestin verschwand mitsamt Trompete und Kapelle von der Bühne. Zwölf Tänzerinnen in glitzernden Höschen zogen sich die ersten heiseren Schreie von Männern zu, als sie die ohnehin durchsichtigen Schleier sinken ließen.
Der Vorhang, der nach jeder Nummer fiel, hob sich jetzt vor einer Frau in einem Hermelinmantel. Dieser Hermelinpelz musste ein Vermögen gekostet haben. Er verhüllte sie vom Kinn bis über die Knie. Einige Sekunden lang stand sie wie eine Statue, das Gesicht ein wenig streng mit der kleinen steilen Falte zwischen den Brauen und dem spöttischen Zug um den Mund...
Es war Roberta.
Das einzige Glas Whiskey hatte mich wohl betrunken gemacht. Ich... applaudierte.
Langsam begann sie sich zu einer Musik zu bewegen, die mich aufhorchen ließ. Sie kam wie von schmeichelnden Geigen, die eine törichte Melodie sangen. Ich kannte die Melodie. Sie stammte aus einer längst vergessenen Operette, die Die Frau im Hermelin hieß.
Zuletzt hatte ich diesen Walzer im September 1945 in einem amerikanischen Soldatenclub in Berlin gehört.
Ohne zu lächeln glitt Roberta über die Bühne, und der Lichtkegel des Scheinwerfers glitt mit ihr dahin. Nur wenige Striptease-Tänzerinnen konnten tanzen, doch sie tanzte mit einer Lieblichkeit und Grazie, die selbst den groben Männern nicht entging, die nur auf die Entkleidung warteten. Der Hermelinmantel sank an ihr hinab. Darunter trug sie ein großes, tief ausgeschnittenes Abendkleid aus weißem Samt mit purpurner Schärpe.
Ich starrte in ihr Gesicht. Es war bemalt, die Augenlider blau, mit angehefteten Wimpern, die den Glanz ihrer graublauen Augen noch verschleierter erscheinen ließen.
Ja, jetzt kannte ich auch dieses Gesicht, diesen Ausdruck von Hochmut, der nicht angemalt war. Es war derselbe Hochmut, den ein sechzehnjähriges Berliner Mädchen gehabt hatte. Ich hatte sie gekannt, damals in Berlin, wo ich Kriegskorrespondent gewesen war...
Gelegentlich hatte Nora in jenem Army Club in der Nähe des Zoos Klavier gespielt oder mit den Offizieren getanzt. Mir hatte sie, im Austausch gegen Englisch und Zigaretten, den Walzer aus Die Frau im Hermelin beigebracht. Ich wusste noch, dass sie die Tochter eines Professors von Gregor war, der nach dem 20. Juli 1944 von den Nazis erschossen worden war.
Mehr als zwölf Jahre und viele tausend Meilen lagen zwischen Nora v. Gregor und Roberta Gregg. Dunkel ahnte ich die Abgründe eines unfassbaren Schicksals, in dem ich selbst eine winzige Rolle gespielt hatte.
Die purpurne Schärpe war schon gesunken. Eine raffinierte Anordnung von Reißverschlüssen ermöglichte es, das große Abendkleid mit einem einzigen Ruck sinken zu lassen, und es sank mit der Lautlosigkeit von Samt – wie eine weiße Wolke, der ein schmaler und langbeiniger Körper in schwarzer Spitzenwäsche entstieg.
Die Musik, die ich kannte, rief in mir mehr und mehr Erinnerungen hervor...
Ich roch den brenzligen Geruch der zerstörten Straßen Berlins, sah die Ruinen, die abgebrochenen Türme, die Reste eines Hauses am Hohenzollerndamm, wo das Mädchen gewohnt hatte. Ich sah die Wohnung, in der eine Wand fehlte, die Haufen verkohlter Bücher in der ehemaligen Bibliothek, das Zimmer, in dem in einer Vase frische Blumen standen, die ich selbst gepflückt hatte, das Licht der Kerze, die in einer Flasche steckte...
Zugleich entsann ich mich der Worte, die gesprochen worden waren, als wir nebeneinander, wenn auch ganz sittsam, auf einer Matratze gelegen hatten.
»Erzählen Sie mir mehr«, sagte sie, fast wie ein Kind, dem man Märchen erzählen muss, bevor es einschlafen kann.
»Wovon?«
»Von dem Restaurant am Broadway in New York, wo man für einen Dollar soviel Roastbeef und Braten und Truthahn essen darf, bis man nicht mehr kann.«
»Davon habe ich schon zu oft erzählt.«
»Dann vom Farmerʼs Market in Los Angeles mit den Tausenden von Grapefruits und Orangen... oder von der großen Hummerkocherei in Cape Cod.«
»Muss es immer mit Essen zu tun haben?«, protestierte ich.
»Verzeihung, mein gestrenger Herr, ich vergesse immer, dass Sie genau wie mein seliger Vater am liebsten von den Segnungen der Demokratie erzählen! Das ist doch Ihr Lieblingsthema?«
Ich hatte viel mit Amerika geprahlt, mächtig stolz als Amerikaner im Land der Besiegten. Ich sagte großartig: »Demokratie ist etwas, das man erlebt haben muss. Es ist weder Theorie noch Glaubenslehre. Es ist etwas Handgreifliches, ein praktisches System, das es 160 Millionen Menschen von jeder Rasse und jedem Glaubensbekenntnis ermöglicht, gut und friedlich miteinander zu leben.«
»Das möchte ich gern selbst sehen, bevor ich daran glaube.«
»Man muss es wirklich erlebt haben«, sagte ich und kam mir dabei wie ein Ausrufer auf einem Jahrmarkt vor. »Demokratie ist genauso eine Tatsache wie das Roastbeef, der Braten und der Truthahn.«
»Mit einem Banana Split hinterher?«
»Ja, mein kleiner Schatz! Mit einem Banana Split hinterher.«
»Und das bekommt man sozusagen geschenkt, wenn man sich nur an Ihre vier Freiheiten hält? Sagen Sie sie mir bitte noch einmal.«
»Der Redefreiheit...«
»Der Religionsfreiheit und Pressefreiheit«, ergänzte sie rasch. »Was ist aber die vierte?«
»Freiheit von Angst.«
»Frank, mein großer Schatz, das ist die wichtigste der vier Freiheiten. In meinem Leben habe ich nur Angst gekannt. Angst, immer die schreckliche Angst.« Sie schmiegte ihren seidig blonden Kopf an meine Schulter. »Werden Sie Ihr Wort auch halten?«
»Mein Wort?«
»Oh, Frank! Sie sind ein Verbrecher! Erst gestern haben Sie mir versprochen, mir einmal Amerika zu zeigen, und heute haben Sie es schon vergessen.«
»Einmal werde ich Ihnen Amerika zeigen.« Brüderlich zog ich das Mädchen näher. »Das verspreche ich Ihnen ganz fest.«
»Hoch und heilig?«
»Ja, Hand aufs Herz. Sonst soll mich der Schlag treffen«, hatte ich geschworen.
Dann war die Kerze in der Flasche flackernd erloschen...
Im Scheinwerferlicht auf der sonst dunklen Bühne zog Roberta Gregg den kurzen, schwarzen Slip aus.
Ich konnte nicht mehr hinsehen! Ich vermochte es nicht mehr. Waren das die Segnungen der Demokratie, die ich ihr einstmals selbst zeigen wollte? Nochmals sah ich zur Bühne, und jetzt tauchte um die halb geöffneten und feucht schimmernden Lippen das Lächeln des Lockens auf, der Verführung, der Sinnlichkeit, die gespielt war und nur von einer kalten oder abgefeimten Frau so täuschend gespielt werden konnte, von einer Frau, die aber auch alle Schliche kannte...
Mich fröstelte.
Das also war das Mädchen, das immer auf Reisen war, mit einem Schrankkoffer voll raffinierter Wäsche und einem schäbigen Paar roter Samtpantoffeln, das Mädchen, das mir so bekannt vorgekommen war...
Am meisten ergrimmten mich die brutalen Schreie der Männer, die immer mehr und mehr zu sehen wünschten, und ich hasste in diesem Augenblick jeden, der da um mich herumsaß.
Noch einmal wanderten meine Gedanken zurück.
Die Kerze in der Flasche war ausgegangen, und es war Nora, die im Dunkeln die Decke über uns beide zog, unter der es warm, viel zu warm, wurde. Ich lag eine Zeitlang ruhig. Einmal schob ich ihre Hände von mir, die mir zu nahe gekommen waren.
»Warum küssen Sie mich nie?«, fragte sie.
»Ich habe Sie schon oft geküsst.«
»Nie richtig. Sind Sie nicht wirklich lächerlich? Sie liegen neben mir, und doch küssen Sie mich nie.«
»Es ist mir zu gefährlich.«
»Wenn Sie es sich nicht bald überlegen, küsse ich Sie, und ich meine, richtig.«
»Bleiben Sie auf Ihrer Seite«, sagte ich, sie von mir schiebend.
Aus ihrer Kehle kam ein tiefes Lachen. »Sie sind einzig, Frank! Hinter anderen Mädchen sind Sie wie der Teufel her, und mich weisen Sie ab. Wozu haben Sie mir denn die Pall Malis mitgebracht?«
Alles in allem hatte ich ihr im Laufe einer Woche sechs Stangen Pall Mall mitgebracht, in Deutschland damals genauso gut wie Gold.
»Aus Kinderliebe!«
»Das werden Sie bereuen«, schrie sie, sich wild in meine Arme drängend.
Dieses Mal wurde ich energisch. Ich mochte sie. Sie entstammte einer guten Familie. Ihr Vater, ein bedeutender Physiker mit einem Lehrstuhl an der Universität Berlin, war einer von denen gewesen, die sich den Kopf darüber zerbrochen hatten, was aus Deutschland nach Hitler werden sollte, und die dafür an einem Fleischerhaken aufgehängt worden waren. Ich trug die Verantwortung für sie in dieser wilden Zeit.
»Sie sind mir mehr als eine Geliebte«, log ich. »Sie sind irgendwie mein Kind. Und außerdem... Sie sind noch keine sechzehn.«
»Ich bin einundzwanzig«, log sie.
»Noch immer viel zu jung, um für ein paar Schachteln Pall Mall mit einem Fremden ins Bett zu gehen.«
Gerade so, als hätte ich sie entsetzlich beleidigt, schluchzte sie in das Kissen. »Frank, verstehen Sie doch... ich liebe Sie wirklich... Ich werde Sie mein ganzes Leben lang lieben...«
»Das geht vorüber.«
»Nie!«
»Darüber werden wir sprechen, wenn Sie mich einmal in Amerika besuchen.«
Lange schien Nora über diesen Punkt nachzudenken. Dann: »All right, mein großer Schatz. Einmal werde ich Sie in Amerika besuchen, und dann zahle ich all meine Zigarettenschulden ab.«
»All right. Vergessen Sie nicht, dass es genau sechs Stangen Pall Mall waren, mehr als genug für eine ganz große Liebesnacht!«
»Es wird toll werden.«
»All right.«
»Wollen Sie mir jetzt bitte weiter von den vier Freiheiten und Abraham Lincoln und der Golden Gate Brücke erzählen, von den Cowboys und Gangstern und von dem Restaurant am Broadway in New York, wo man für einen Dollar so viel Roastbeef...«
In der Dunkelheit brachen wir beide in Gelächter aus.
Im Silver-Slipper in der Bourbon Street von New Orleans, Louisiana, erklang noch immer der Walzer aus Die Frau im Hermelin, den Roberta Gregg alias Nora v. Gregor vor sieben Jahren – das hatte ich mir ausgerechnet – mit sich nach Amerika gebracht haben musste. Das war 1950 gewesen, und damals hatte mich meine Zeitung, der New York Globe, nach Korea geschickt.
Jetzt kam die Musik in ein wirbelndes Tempo.
Männer schrien: »Bobby, take it off! Take it off, Bobby!«
Da fiel ihr Blick auf mich. Sie hatte mich unter fast fünfhundert Männern herausgefunden, und ihr Blick blieb auf mich gerichtet, kühl und unberührt.
Ein Gürtel aus Rubinen funkelte um ihre Lenden. Ihr Körper war ein Symbol geworden, erblickbar, doch unantastbar. Gierige Blicke und heisere Zurufe konnten seine Schönheit nicht entadeln.
Ihr Gesicht war abweisend wie das einer Sphinx. In dem Augenblick, als sie den Gürtel von sich riss, erlosch der Scheinwerfer, und die Bühne war in Dunkelheit getaucht.
Kaum hatte sich der Applaus gelegt, kam Papa Celestins Jazzband auf die Bühne zurück, und schmetternde Trompeten zertrümmerten meine Versunkenheit. Sie spielten wiederum: »Wenn die Heiligen einmarschieren...« Die Heiligen verfolgten mich, als ich aus dem Zuschauerraum lief, einen Gang hinunter, auf eine schwere Eisentür zu, die ich nur mühselig öffnen konnte.
Ich musste mit Roberta sprechen, musste wissen, was ihr in sieben Jahren in Amerika widerfahren war, warum sie sich nicht ein einziges Mal mit mir in Verbindung gesetzt hatte...
Vielleicht trug ich noch immer eine Verantwortung für sie.
Jenseits der Tür stand ich zwischen Kulissen, von denen ich nur die Rückseite sah, um mich Männer in Hemdsärmeln, Tänzerinnen, die auf ihren Auftritt warteten.
Ich drückte einem Bühnenarbeiter ein paar Banknoten in die Hand.
»Können Sie mich zur Garderobe von Roberta Gregg führen?«
Der Mann machte einen gutmütigen Eindruck. »Wozu das?«, fragte er.
»Ich möchte sie gern sehen.«
»Hier können Sie sie nicht sehen.« Er gab mir das Geld zurück. »Gehen Sie in die Bar. Zwischen ihren Auftritten sitzt sie dort mit den Gästen.«
Er war ein gedrungener Mann von freundlichem Charakter, und ganz sicher konnte er nicht ahnen, dass es mir in der Faust zuckte, ihn niederzuschlagen.
Ohne auch nur einen Blick in die Bar zu werfen, verließ ich das Theater.
Spät in der Nacht zum Aschermittwoch wanderte ich durchs Alte Viertel zu meinem Hotel zurück.
Aus den Straßen von New Orleans waren Alptraumstraßen geworden. Leere Bierflaschen lagen überall im Rinnstein, überall lagen bunte Papierschlangen, Konfetti, Papptrompeten, Fetzen von Tüll, weggeworfene Masken.
Mardi Gras war vorüber, der Karneval von New Orleans. Aber die erregendste Geschichte meines Lebens hatte eben erst begonnen.
Sechs Wochen später hielt ich mich noch in Miami Beach auf, wohin ich von New Orleans gefahren war, froh, dieser Stadt am Mississippi entronnen zu sein. Im Hialeah Park spielte sich die Renn-Saison ab, und abgesehen von meinen täglichen Berichten an den New York Globe hatte ich keine Verpflichtungen.
Miami Beach ist eine kleine heitere Welt aus Gold vom Gold des Goldenen Kalbes, und am blauen Ozean entlang prunken die Hotels mit einem Luxus, der einen überwältigt, wenn nicht betäubt. In der Umgebung der phantastischen Hotelhallen, der eleganten Cabana Clubs, der Palmen und der dreitausend Flamingos im See inmitten der Rennbahn, vergisst man rasch, zumal wenn es sich um eine bittere Sache handelt, an die man sich nur ungern zurückerinnert.
Ein Telegramm meiner Zeitung unterbrach diese unbeschwerte Zeit. Es hieß darin:
»Nachrichten über Wunder von Muscatine machen Ihre nochmalige Anwesenheit in New Orleans erforderlich stop Nehmt Rücksprache mit Medium Bella Merlin wegen angeblicher Auferstehung Cora Latours, gestorben März 1956 stop Wir glauben, dass es sich um Schwindel handelt stop Beauftragt AP Miami mit Rennberichten...«
Ich zerknüllte das Telegramm und warf es zu Boden. Der bloße Gedanke an eine nochmalige Anwesenheit in New Orleans war mir widerlich. Es war ja durchaus möglich, dass Roberta noch im Silver-Slipper auftrat. Und dann... In Ermangelung von abscheulichen Kriegen hatte ich mich mit dem Job eines Sportreporters abgefunden. Politik, Morde, der Herzog von Windsor – das alles interessierte mich zurzeit nicht. Und schon gar nicht das Medium Bella Merlin oder die angebliche Auferstehung einer vor einem Jahr Verstorbenen...
Zudem war mir das Telegramm ziemlich unverständlich. Wenn ich auch fortwährend Zeitung las, war mir von einem Wunder von Muscatine nichts bekannt.
Nie zuvor war mir der Name Muscatine zu Ohren gekommen.
Von meinem Hotelzimmer aus telefonierte ich zum Portier hinunter und ließ mir einen Platz im Nachtflugzeug nach New Orleans reservieren.
Dann fuhr ich zum AP-Büro am Biscayne Boulevard in Miami City, wo ich Vorsorge traf, dass alle weiteren Rennberichte in meiner Abwesenheit regelmäßig an den New York Globe abgingen.
»Wissen Sie irgendetwas über ein Wunder von Muscatine?«, fragte ich Herrn Brady, den Chef der Nachrichtenzentrale.
»Ist das nicht die Louisiana-Geschichte?«
»Vielleicht.«
»Moment, Jones. Ich muss irgendwo einen Ausschnitt aus dem Muscatine Mascot haben.«
»Ist das das einheimische Blatt?«
»Blättchen.«
Er fand den Ausschnitt. Als er sich darin vertiefte, verzog sich sein Mund mehr und mehr, und schließlich brach er in helles Gelächter aus.
»Verrückt! Aus Louisiana kommen immer die verrücktesten Geschichten. Dort scheint es auch kein altes Haus zu geben, wo es nicht spukt oder wo die Toten nicht auferstehen.«
»Wer ist diese angeblich auferstandene Cora Latour?«
»Die Erbin des Parlange Plantagenhauses in der Nähe von Muscatine. Wennʼs wahr ist, dann ist sie im März vorigen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen.«
»Wer immer also auferstanden ist, hat es auf das Plantagenhaus abgesehen?«
»Darauf und auf ein Vermögen von einigen Millionen Dollar, die Coras Vater, Charles Latour, hinterließ. Immer vorausgesetzt, dass Ihre Annahme stimmt, dass hier ein Schwindel vorliegt.«
»Es muss doch Schwindel sein!«
»Nicht dem Muscatine Mascot nach, der behauptet, dass die Auferstandene wirklich und wahrhaftig Cora Latour ist!«
»Glauben Sie das etwa auch?«
Laut lachend warf Herr Brady den Zeitungsausschnitt in den Papierkorb.
Im Hotel nahm ich mir einen Reiseführer und Landkarten von Louisiana vor.
Ich entdeckte eine Ortschaft namens Muscatine etwa 100 Meilen von New Orleans entfernt. Sie lag am Westufer des Mississippi, ein Städtchen von 6.000 Einwohnern, von denen über zweitausend Farbige waren. Man baute dort Zuckerrohr an, und es gab eine moderne Zuckerfabrik. Die Gegend war berühmt für Erdbeeren, und zwischen März und Mai fanden in Muscatine große Erdbeer-Auktionen statt.
Mein Reiseführer erwähnte auch Petroleum-Möglichkeiten. Am Ostufer schräg gegenüber lag der alte Destrehan-Besitz, wo die Pan-American Oil Company Petroleum gefunden hatte.
Meine Sachen waren rasch gepackt.
Ich reise immer nur mit zwei leichten Sportanzügen aus Wolle und Seide, die nicht so leicht knitterten, einem Smoking, der gelegentlich nötig ist, und Nylonhemden, die ich im Notfall selbst waschen kann. Ich besaß damals auch eine silberne Flasche, die ich 1945 in Berlin mit Kirsch gefüllt hatte, von dem auch nicht ein Tropfen verlorengegangen war. Das Etui mit den beiden Dunhillpfeifen war mir am 6. Juni 1944, kurz vor der Invasion der Normandie, von einem Oberst Steward zur Aufbewahrung übergeben worden, doch der Oberst war eine halbe Stunde später tot gewesen. Ein wenig sogar durch meine Schuld...
Schließlich packte ich noch die alte Bibel ein, die mein Talisman ist.
Kurz nach Mitternacht landete ich in New Orleans.
Aus dem Flugzeug trat ich in eine unvorstellbar schwüle und drückende Luft, die sich um mich schloss und mir das Atmen erschwerte.
Ich stieg im selben Hotel ab, wo ich vor sechs Wochen gewohnt hatte, dem St. Charles. Es war historisch bemerkenswert – während des Bürgerkrieges hatte General Ben Butler hier alles Tafelsilber gestohlen –, doch das Hotel hatte immerhin eine moderne Klimaanlage, die mich glücklicherweise vom Druck der Schwüle befreite.
Trotzdem stellte ich nur meinen Koffer ab und ging sofort zu Fuß ins Alte Viertel weiter. Richtiger gesagt, es trieb mich mit aller Macht dorthin.
Ich ging langsam, als fürchtete ich, senkrecht in mein Unglück hineinzugehen. Und die schwüle Luft machte mir das Gehen nicht leichter. Sie war wie heiße Watte. Auf dem Weg kehrte ich ins Alte Absinth Haus ein und trank mehrere Glas Bier.
Hinter der offenen Tür eines der Striptease-Lokale sah ich ein völlig unbekleidetes Mädchen. Seltsam, wie einen das anwidert, wenn sich in einem gerade die wirkliche Liebe regt.
Der Ausrufer brüllte: »Das muss man gesehen haben!«
Ja, wirklich?
Schon von weitem sah ich die Blinklichter über dem Silver-Slipper.
Sie buchstabierten den Namen Zorita, und ich atmete tief auf.
In meiner Rückberufung nach New Orleans hatte ich so etwas wie Schicksal vermutet, vielleicht sogar unentrinnbares Schicksal. Ich hatte Angst vor einer neuen Begegnung mit Roberta Gregg gehabt, zugleich aber auch ein unheimliches Verlangen danach.
Ich atmete auf, dass sie nicht mehr da war.
Offenbar war sie mit ihrem großen Schrankkoffer weitergezogen, vielleicht nach Las Vegas, Los Angeles oder San Francisco.
Im Telefonbuch von New Orleans hieß es wie folgt:
Bella Merlin, Parapsychologisches Laboratorium, Telepathie und Hellsehen. Sprechstunden nach Vereinbarung. 520 Royal Street.
Parapsychologie, das konnte vieles bedeuten: reine Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen – oder zwielichtige, aber einträgliche Experimente mit der Geisterwelt.
Wenn ich ein wenig fröstelte, war es wegen der säuselnden Kälte der Klimaanlage in meinem Zimmer. Ich hob den Hörer vom Telefon und verlangte die Nummer. Eine weiche Stimme, anscheinend die einer Bedienten, meldete sich auf Französisch. Ich trug mein Anliegen vor, und ein Besuch wurde für sechs Uhr abends vereinbart.
Bis ein halb sechs Uhr blieb ich im Hotel, ein Gefangener der Hitze, der aus den Ritzen der Jalousien ins gleißende Sonnenlicht spähte, das die schattenlosen Straßen übergoss. Als ich schließlich ging, war mir nichts so gleichgültig wie das Wunder von Muscatine.
Royal Street ist die Straße mit den alten aristokratischen Bauten aus rosa oder purpurfarbenem Ziegelstein, die mit den zierlichen Balkons umgittert sind. Zweifellos war jedes Haus ein Kunstwerk, doch für mein ungeübtes Auge sah eines wie das andere aus, zwei oder drei Etagen hoch, die meisten arg verfallen.
Es gab da Restaurants oder kleine Cafés oder Läden in besser erhaltenen Häusern.
Es war mir nicht möglich, das Haus Nummer 520 zu finden, möglicherweise, weil die Haustüren so versteckt lagen. Mindestens eine Viertelstunde lang irrte ich umher, und ich kam schon auf den Gedanken, dass sich die Hellseherin aus Angst vor ihrem skeptischen Besucher weggezaubert haben mochte.
Ich trat in einen der Läden.
»Können Sie mir sagen, wo Nummer 520 ist?«, fragte ich die Ladeninhaberin, eine viel zu dicke junge Frau, die in der albernsten Weise zu lachen begann.
Im gleichen Moment fiel mir auf, dass ich mich in einem Spielzeugladen befand. Ich starrte auf Dutzende von Puppen. Es waren rote Drahtpuppen mit gemalten Gesichtern, die man in alle möglichen Stellungen biegen konnte, doch das gemalte Gesicht behielt immer den gleichen traurigen Ausdruck.
»Dies ist das Haus«, lachte die Ladeninhaberin.
»Wo finde ich Frau Merlin?«
»Der Eingang ist gleich nebenan.«
»Was kosten diese Puppen?«
»Fünf Dollar.«
Mit dem Finger deutete ich auf eine Puppe, die mir aufgefallen war. Sie hatte das traurigste Gesicht, und sie wurde in eine Tüte gesteckt. Aus der Tüte ragte nur das traurige Gesicht hervor.
Erst als ich auf die Straße zurücktrat, sah ich die Unsinnigkeit meines Einkaufs ein. Ich schob die Schuld daran dem Klima zu. Die Puppe hing aus meiner schlaffen Hand herab, als ich auf den Eingang zuging, ein unauffälliges Tor, das angelehnt stand. Die Nummer 520 war groß darübergeschrieben.
Hinter dem Tor lag ein großer Patio, mit Fliesen ausgelegt. Töpfe mit tropischen Pflanzen, das Gelb und Rot mir unbekannter Blumen belebten den ummauerten Hof. Auf der Rückseite, unter einem Bogen in der Wand, die eine offene Galerie trug, begann die Treppe. Ich stieg sie hoch, in ein Halbdunkel hinein, bis ich auf der Galerie herauskam. Ein starker Duft verwirrte mich, der Duft von Rosmarin, der in kleinen Töpfen die ganze Galerie entlang gepflanzt war. Rosmarin, entsann ich mich, war eine Pflanze von mystischer Bedeutung; welcher, war mir entfallen.
Ich fand an einer Wohnungstür eine Messingtafel mit der Aufschrift:
Parapsychologisches Laboratorium