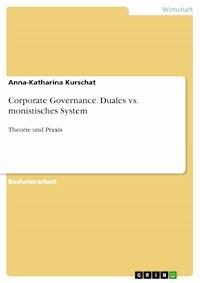
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,0, Hochschule RheinMain, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit den zwei grundlegenden Modellen der Unternehmensführung im Rahmen der Corporate Governance. Um die Modelle zu konkretisieren und Beispiele aufzeigen zu können, wird an einigen Stellen der Arbeit auf die Unternehmen Deutsche Lufthansa AG sowie British Airways Plc. Bezug genommen. Ziel der Arbeit Die Corporate Governance gehört aktuell zu den am meisten diskutierten Managementthemen weltweit. Laut v. Werder hat die Diskussion über zweckmäßige Formen der Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften in den letzten Jahren sowohl national als auch international einen noch nicht da gewesenen Stellenwert erlangt. In der Literatur werden zwei grundlegende Leitungsmodelle diskutiert, das duale und das monistische Modell. Das Ziel dieser Arbeit ist es diese beiden Modelle der Corporate Governance zu vergleichen und ihre Stärken sowie die jeweiligen Schwächen aufzuzeigen. Es soll auch gezeigt werden, dass sich beide Modelle aufgrund verschiedener Faktoren, auf die noch einzugehen sein wird, langsam annähern. Da die Thematik sich einer großen Resonanz in der Wirtschaftspraxis erfreut, soll auch auf einige Praxisbeispiele zur näheren Verdeutlichung eingegangen werden. Gang der Arbeit Der Einleitung folgt nach Abgrenzung und Definition im zweiten Kapitel eine Vorstellung des monistischen und des dualen Modells mit den jeweiligen Stärken und Schwächen. Des Weiteren wird in diesem Kapitel die Konvergenz der Modelle dargestellt. Das dritte Kapitel beschreibt sowohl den deutschen Corporate Governance Kodex als auch den britischen Combined Code, mithin die beiden Kodizes, die jeweils ein Modell näher ausgestalten. Das vierte Kapitel stellt zunächst die Deutsche Lufthansa AG sowie die British Airways Plc. und die jeweiligen Ausgestaltungen der Corporate Governance Richtlinien vor, um dann im nächsten Schritt beide Unternehmen im Hinblick auf ihre Corporate Governance direkt zu vergleichen. Ein abschließendes Fazit wird im fünften Kapitel gezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ziel der Arbeit
1.2 Gang der Arbeit
1.3 Abgrenzung
1.4 Definitionen
2 Grundlegende Leitungsmodelle der Corporate Governance
2.1 Das monistische Modell
2.1.1 Grundstruktur
2.1.2 Stärken und Schwächen
2.2 Das duale Modell
2.2.1 Grundstruktur
2.2.2 Stärken und Schwächen
2.3 Tendenz zur Annäherung der beiden Modelle
3 Combined Code (UK) des monistischen Modells und Deutscher Corporate Governance Kodex des dualen Modells
3.1 Combined Code des monistischen Modells
3.1.1 Entwicklung des Combined Code
3.1.2 Relevante Regelungen
3.2 Deutscher Corporate Governance Kodex des dualen Modells
3.2.1 Entwicklung des DCGK
3.2.2 Relevante Regelungen
4 Vergleich anhand von Praxisbeispielen aus der Luftfahrtbranche
4.1 British Airways plc.
4.1.1 Unternehmensstruktur
4.1.2 Corporate Governance bei British Airways Plc.
4.2 Deutsche Lufthansa AG
4.2.1 Unternehmensstruktur
4.2.2 Corporate Governance bei Lufthansa
4.3 Vergleich
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Internetquellen:
Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AktG Aktiengesetz
CEO Chief Executive Officer
CFO Chief Financial Officer
COB Chairman of the board
COO Chief Operating Officer
CPO Chief Planning Officer
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Grundstruktur des monistischen Modells.1
Abbildung 2: Grundstruktur des dualen Leitungsmodells.3
Anlage A: Stärken und Schwächen der Modelle.III
Anlage B: Board-Struktur der British Airways plc. V
Anlage C: Aufteilung der Eigentümerstruktur nach Nationalitäten bei Lufthansa.VI
Anlage D: Leitungsstruktur der Deutschen Lufthansa AG..VI
1 Einleitung
Diese Arbeit befasst sich mit den zwei grundlegenden Modellen der Unternehmensführung im Rahmen der Corporate Governance. Um die Modelle zu konkretisieren und Beispiele aufzeigen zu können, wird an einigen Stellen der Arbeit auf die Unternehmen Deutsche Lufthansa AG sowie British Airways Plc. Bezug genommen.
1.1 Zielder Arbeit
Die Corporate Governance gehört aktuell zu den am meisten diskutierten Managementthemen weltweit. Laut v. Werder hat die Diskussion über zweckmäßige Formen der Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften in den letzten Jahren sowohl national als auch international einen noch nicht da gewesenen Stellenwert erlangt.[1] In der Literatur werden zwei grundlegende Leitungsmodelle diskutiert, das duale und das monistische Modell. Das Ziel dieser Arbeit ist es diese beiden Modelle der Corporate Governance zu vergleichen und ihre Stärken sowie die jeweiligen Schwächen aufzuzeigen. Es soll auch gezeigt werden, dass sich beide Modelle aufgrund verschiedener Faktoren, auf die noch einzugehen sein wird, langsam annähern. Da die Thematik sich einer großen Resonanz in der Wirtschaftspraxis erfreut, soll auch auf einige Praxisbeispiele zur näheren Verdeutlichung eingegangen werden.
1.2 Gang der Arbeit
Der Einleitung folgt nach Abgrenzung und Definition im zweiten Kapitel eine Vorstellung des monistischen und des dualen Modells mit den jeweiligen Stärken und Schwächen. Des Weiteren wird in diesem Kapitel die Konvergenz der Modelle dargestellt. Das dritte Kapitel beschreibt sowohl den deutschen Corporate Governance Kodex als auch den britischen Combined Code, mithin die beiden Kodizes, die jeweils ein Modell näher ausgestalten. Das vierte Kapitel stellt zunächst die Deutsche Lufthansa AG sowie die British Airways Plc. und die jeweiligen Ausgestaltungen der Corporate Governance Richtlinien vor, um dann im nächsten Schritt beide Unternehmen im Hinblick auf ihre Corporate Governance direkt zu vergleichen. Ein abschließendes Fazit wird im fünften Kapitel gezogen.
1.3 Abgrenzung
Aufgrund der Einschränkung des Umfanges dieser Arbeit wird nur auf die beiden grundlegenden Leitungsmodelle der Corporate Governance, das in Deutschland geltende duale Modell sowie das in angelsächsischen Ländern vorherrschende monistische Modell, mit entsprechender Informationstiefe eingegangen. Auch die zugehörigen Kodizes werden nur im Rahmen der für diese These relevanten Regelungen untersucht.
1.4 Definitionen
Zunächst sind als Grundlagen der Arbeit die Begriffe der Corporate Governance und der Spitzenorganisation zu definieren.
Der Begriff Corporate Governance wird erst seit ca. 1990 verwendet und es gibt in der Literatur keine einheitliche Definition dieses Begriffes. Während teils Kurzübersetzungen als Unternehmensverfassung[2] oder Unternehmensführung[3] zu finden sind, beschreiben umfassendere Definitionen die Corporate Governance als den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens durch dessen Spitzenorganisation.[4] Nach v. Werder weist der Begriff Corporate Governance zwar weitgehende Überschneidungen mit dem oben genannten Begriff der Unternehmensverfassung auf, während aber die Unternehmensverfassung primär die Binnenordnung des Unternehmens regelt, geht die Corporate Governance noch weiter und bezieht auch Fragen der (rechtlichen und faktischen) Einbindung des Unternehmens in sein Umfeld mit ein.[5] Sie veranlasst außerdem, dass die entsprechenden Organe eingerichtet werden, um die Grundsatzentscheidungen des Unternehmens zu treffen.[6] Im internationalen Sprachgebrauch und so auch für diese Arbeit wird die Corporate Governance als „eine verantwortliche, auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensleitung und -kontrolle“[7] verstanden. Die Ausgestaltung dieser Unternehmensleitung und -kontrolle ist von Land zu Land unterschiedlich, wobei zwei Grundmodelle, das monistische und das duale, unterschieden werden, auf die noch einzugehen sein wird.
Da es in dieser Thesis in erster Linie um die Ausgestaltung der Spitzenorganisation von Unternehmen im Rahmen der Corporate Governance geht, soll dieser Begriff im Folgenden definiert werden. Die Spitzenorganisation als zentraler Gegen- stand der Unternehmensverfassung[8] regelt die Teilhabe bestimmter Personen und Personengruppen an der Formulierung und Realisierung der Zielsetzungen eines Unternehmens.[9] Die Gestaltung dieser Spitzenorganisation wird durch verschiedene Parameter bestimmt, so vor allem durch die Zahl und Art, die Kompetenzen sowie die Besetzung der Organe der Unternehmensführung. Sowohl durch das monistische Modell als auch durch das duale Modell sind hier zwei Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.
2 Grundlegende Leitungsmodelle der Corporate Governance
Im nun folgenden Kapitel werden die grundlegenden Leitungsmodelle der Corporate Governance vorgestellt. Mit Leitungsmodellen wird nicht nur festgelegt, welche Organe mit der Unternehmensführung betraut sind, sondern auch über welche grundlegenden Befugnisse diese Organe verfügen.[10]
2.1 Das monistische Modell
2.1.1 Grundstruktur
Das monistische Modell ist in erster Linie in Ländern vertreten, die seit jeher einen hohen Wert auf die freie Marktwirtschaft legen und in denen die Bedienung des Eigenkapitals im Vordergrund steht[11], also hauptsächlich im angelsächsischen Wirtschaftsraum. Dieses Modell wird in der Literatur auch Board-System, Ein-Kammer-System, Vereinigungsmodell[12], angelsächsisches Modell oder auch One-Tier-Model genannt und weltweit als Leitungsmodell verwendet, so z.B. auch in Australien, Belgien und Großbritannien.[13]
Die Leitungs- und Kontrollkompetenz ist hier zu einem Organ der Unternehmensführung zusammengefasst, dem sog. Board of Directors. Die Zusammensetzung des Board erfolgt aus unternehmensinternen Mitgliedern, den sog. Inside Directors, einerseits und unternehmensexternen Mitgliedern, den sog. Outside Directors, andererseits.[14] Die Outside Directors sind innerhalb des Board mit den spezifischen Überwachungsfunktionen betraut, da sie im Gegensatz zu den Inside Directors keine geschäftsführenden Aufgaben ausüben. Das Board bildet zur Wahrnehmung seiner Aufgaben mehrere Ausschüsse, sog. Committees, in denen sowohl Inside als auch Outside Directors sitzen können.[15] Klassische Ausschüsse sind das Audit Committee, welches die Abschlussprüfung des Unternehmens vorbereitet und das Nominating oder auch Compensation Committee, das Fragen im Hinblick auf die Ernennung von Führungspersonen sowie Fragen, die mit der Entlohnung dieser Personen im Zusammenhang stehen, bearbeitet und das Executive Committee, das Geschäftsführungsaufgaben wahrnimmt und meist aus den Inside Directors zusammengesetzt ist.[16] Ein Mitglied des Board kann zugleich in mehreren Committees Aufgaben wahrnehmen.
Sowohl die Inside Directors als auch die Outside Directors werden vom sog. Shareholder Meeting, im Wesentlichen eine Versammlung von Anteilseignern, gewählt. Die Funktion des Shareholder Meetings ähnelt jener der Hauptversammlung in deutschen Unternehmen und die wesentliche Aufgabe besteht, neben der Wahl bzw. Abwahl der Mitglieder des Boards, darin sog. „By-Laws“, die Satzung des Unternehmens, zu erlassen. Dem Shareholder Meeting wird bei wesentlichen Fragen der Unternehmensführung, wie z.B. bei Fusionen oder ähnlichen Geschäftsvorfällen eine Entscheidungskompetenz zu gebilligt, so dass die Anteilseigner des Unternehmens bei solch wesentlichen Entscheidungen nicht übervorteilt werden können.[17]





























