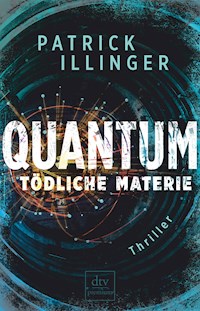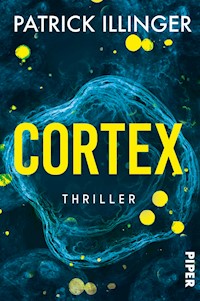
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller der besonderen Art: In einem Biolabor wird mit gezüchtetem menschlichem Gewebe experimentiert – doch das Unterfangen gerät außer Kontrolle … In den USA stürzt ein Flugzeug unter rätselhaften Umständen ab. In Honduras kommt es zu einer Reihe brutaler Morde. Als die Reporterin Livia Chang den Fall untersucht, stößt sie auf bizarre Ungereimtheiten: Eine verdächtige Hautprobe, ein geheimes Forschungslabor, aggressive Meerestiere, ein chinesischer Magnat. Nach und nach kommt sie einem Komplott ungeheuerlichen Ausmaßes auf die Spur. Menschenversuche sind außer Kontrolle geraten. Wird sie selbst Opfer dieser Machenschaften? Vor scheinbar unlösbare Aufgaben gestellt, muss sie nicht nur ihre eigene Familie retten, sondern auch einen Anschlag auf höchster politischer Ebene vereiteln. »Eine modernisierte Version von Mary Shellys Frankenstein – wissenschaftlich unmoralisch, aber denkbar.« BR24 Als Wissenschaftsjournalist konnte Patrick Illinger in einem Max-Planck-Institut selbst erleben, wie menschliches Gewebe gezüchtet wird. Wie realistisch ist das Szenario aus »Cortex«? »Noch ist diese Forschung am Anfang. Und das Szenario in Cortex ist fiktiv. Aber die Fortschritte sind gewaltig und ethische Grenzen werden unweigerlich berührt. Gezüchtetes menschliches Gehirngewebe wurde bereits in Tiere verpflanzt, mit erstaunlichen Ergebnissen. Was, wenn man noch weiter geht? Eines habe ich gelernt als Journalist: Grenzen werden irgendwann überschritten. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht in staatlich finanzierten Laboren, aber geforscht wird auch an anderen, oft obskuren Orten.« »Cortex« ist genial recherchiert und atemberaubend spannend Der Journalist und Autor Patrick Illinger war selbst Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. 1997 ging er zur Süddeutschen Zeitung, wo er viele Jahre lang das Ressort »Wissen« leitete und nun die Wochenendausgabe der SZ koordiniert. Dem Autor und erfahrenen Wissenschaftsjournalisten ist mit »Cortex« ein rasanter Thriller über die Macht der Wissenschaft und der modernen Gentechnik gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Cortex« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: bürosüd, München
Covermotiv: Getty Images (Pobytov; Choksawatdikorn/SCIENCE PHOTO LIBRARY)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Teil 2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Teil 3
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Verdammt sei der Tag, elender Teufel,
da du das erste Mal das Licht sahst.«
Mary Shelley
Teil 1
1
12 Chestnut Road, Newnan, Georgia, USA
Zwei Minuten, bevor ihre Welt unterging, kniete Maria Jiménez vor einem Bohnenstrauch. Sie stieß einen Fluch aus, zog eine knallgrüne Sprühflasche aus dem Putzeimer und nebelte die Pflanze von oben bis unten ein. Mit einem Lächeln blickte sie auf das Warndreieck auf der Dose. Das Zeug war ein Wunder. Die reinste Biowaffe. Keine Blattlaus würde das überleben.
Schuldbewusst blickte sie sich um. Familie Dawson wäre mit ihrem kleinen Geheimnis ganz und gar nicht einverstanden. Hunderte Male hatten die Arbeitgeber ihr eingeschärft, keine Chemie im Garten zu benutzen, weder im Hochbeet noch sonst wo. »Organic« stand auf jeder Lebensmittelpackung, die Ms. Dawson von ihren Einkäufen nach Hause brachte.
Aber Ms. Dawson musste auch nicht mit ansehen, wie die Blattläuse jeden Tag das Gemüse, die Kräuter, ja sogar die Süßkartoffelstauden zerfraßen, dachte Maria Jiménez. Also hatte sie von ihrem eigenen Geld dieses prächtige Wundermittel gekauft. Ein Zisch, und die Schädlinge fielen wie Brotkrümel von den Gewächsen. Die grüne Spraydose war ungleich wirkungsvoller als das Zwiebelwasser, das Ms. Dawson als Mittel gegen die Läuse zusammenbraute.
Die Dawsons brauchten nichts davon zu erfahren. Appetitliche Bohnen würden auch ihnen besser gefallen als zerfressene Sträucher. Allerdings war Maria Jiménez klar, dass sie ihren Job riskierte, sollten die Dawsons erfahren, dass sie im Biogarten eine chemische Keule einsetzte.
Mit einem Seufzen stand sie auf, stemmte sich auf den Rechen und drückte ihren steif gewordenen Rücken durch. Die Okras waren bald reif. Das Basilikum sah allerdings erbärmlich aus. Sie fragte sich, ob sie das Kräuterbeet woanders hätte platzieren sollen.
Aus dem Augenwinkel blickte sie durch die Kozuhecke auf die Straße. Selten genug kam ein Auto durch die Chestnut Street, aber jedes einzelne versetzte ihr einen kleinen Schrecken. Vor zwei Wochen war ihre siebenundsechzig Jahre alte Freundin Carmen in East Newnan verhaftet worden. Die pendejos von der Einwanderungsbehörde wurden immer hartnäckiger. Seit fast vierzig Jahren lebte Maria Jiménez nun im Land der Gringos. Vierzig Jahre als Illegale. Um eine Greencard wollte sie sich nicht bewerben. Dazu müsste sie aus dem Schatten treten und erklären, was sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hatte. Keine gute Idee. Also führte sie ihr Leben im Verborgenen weiter, so wie Hunderttausende andere Latinas.
Wer würde sich um die Blattläuse in den Vorgärten kümmern, wenn nicht Leute wie sie?
Ein Rauschen ließ die Luft vibrieren. Maria Jiménez drehte den Kopf hin und her, um die Richtung des Geräuschs zu bestimmen. Am Himmel erblickte sie einen leuchtenden Punkt. Sie hielt ihn zuerst für einen Stern. Doch dafür war das Ding zu hell. Und Sterne rauschten nicht. Das Geräusch kam von diesem Licht. Es schwoll zu einem Grollen an. Kein Zweifel, das war ein Flugzeug. Seltsam, dachte Maria Jiménez, Flugzeuge waren in dieser Gegend immer nur weit oben am Himmel zu sehen, klein wie Mücken. Dieses Flugzeug war alles andere als eine Mücke.
Plötzlich verdoppelte sich das Licht. Zwei kräftige Scheinwerfer strahlten nun in ihre Richtung. Und es veranstaltete einen Höllenlärm. Triebwerke heulten in unterschiedlichen Tonlagen auf. Die Flügel standen nicht seitlich, sondern senkrecht nach oben und unten ab. Die Maschine flog hochkant. Der Lärm wurde ohrenbetäubend. Maria Jiménez legte ihre Hände auf die Ohren und blinzelte im Licht der Scheinwerfer. Angst und Adrenalin lähmten ihre Körperfunktionen, als sie zusah, wie sich das Flugzeug dem Erdboden näherte und eine Flügelspitze den Vorgarten der Gulbraiths durchpflügte.
Die Tragfläche brach. Brennendes Kerosin spritzte wie aus einem Flammenwerfer. Der Bug der Maschine krachte mit infernalischem Lärm auf den Asphalt der Chestnut Street. Der übrige Rumpf mit der verbliebenen Tragfläche kreiselte seitwärts über mehrere Einfamilienhäuser hinweg. Maria Jiménez presste ihre Hände noch fester auf die Schläfen, als das abgerissene Seitenleitwerk in die Garage der Vandenbergs einschlug. Das Knirschen brechender Dachstühle mischte sich mit dem Knallen von Aluminiumstreben und dumpfen Einschlägen, die das Erdreich aufspritzen ließen.
Panik lähmte sie. Adrenalin trieb ihren Herzschlag in bedrohliche Höhen. Lehmige Erdbrocken trafen ihren Oberkörper. Sie wich nicht mal aus, als ein glühendes Metallstück so knapp über ihren Kopf schwirrte, dass sie den Luftzug spürte.
Unvermittelt ließ der Lärm nach. Nur noch das Knistern unzähliger Brände erfüllte die Luft, überall dort, wo das Flugzeug sein Kerosin verspritzt hatte. Schwarzer Rauch verdunkelte die Sonne.
Maria Jiménez wollte die Augen schließen und ins Haus rennen. Doch die apokalyptische Szenerie zog sie in ihren Bann. Sie starrte auf das gigantische Seitenleitwerk mit dem Logo der Fluggesellschaft. Reglos bemerkte sie, dass der Walmart knapp verschont geblieben war. Sie hörte die ersten Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Ihr Blick schweifte über den mit Erdbrocken und Metallteilen übersäten Garten ihrer Arbeitgeber. Links neben dem Okrabeet, zwischen Süßkartoffeln und Basilikum, erspähte sie einen seltsamen Gegenstand. Sie ging einige Schritte darauf zu. Als ihr klar wurde, was dort lag, quoll ein schrilles Kreischen aus ihrer Kehle.
Sie fiel auf die Knie und übergab sich.
2
Pete’s Tavern, New York City, USA
Yu Jihai, ein zwei Meter fünfzehn großer Angreifer des chinesischen Kaders, trat an die Freiwurfmarke. Dreimal ließ er den Basketball vom Boden abprallen, bevor er den Korb anvisierte. Er hob den Wurfarm und stabilisierte den Ball mit der linken Hand. Die Bewegung sah perfekt aus, aber der Ball prallte an die Platte, federte am Korb ab und fiel zurück ins Spielfeld, wo ihn ein italienischer Abwehrspieler schnappte und zum Gegenangriff überging.
In der Bar brach Jubel aus. Eine Gruppe italienischer Touristen prostete dem Fernsehschirm zu und ließ die Gläser aneinanderknallen.
»Ihr seid noch gut im Rennen«, rief Livia Chang zu ihnen hinüber, »sechs Punkte Rückstand, das ist zu schaffen!« Ihr Italienisch war makellos.
Die Italiener rissen die Köpfe herum. Sie blickten Livia erstaunt an, hoben ihre Daumen und prosteten ihr zu. Auch sie hob ihr Glas und schenkte ihnen ein Lächeln.
»Was hast du gesagt?«, fragte Rebecca Blumenstein, eine Nachrichtenredakteurin, die neben Livia saß.
»Nur eine kleine Aufmunterung. In Wahrheit fürchte ich, dass ihre Mannschaft keine Chance gegen die Chinesen hat.«
Es war ein langer Tag gewesen. Der Chefredakteur der New York Times hatte die gesamte Redaktion zusammengetrommelt, um diverse Umstrukturierungen zu verkünden. Für das Meeting war Livia zwei Tage zuvor eigens aus Rom angereist, wo sie das Außenbüro der Times leitete. Nachdem das Treffen zu Ende gegangen war, hatte sie sich einer Gruppe Kollegen angeschlossen, um den Tag mit einem Feierabendbier abzuschließen. Oder auch zwei.
Bill Kortz, der das berühmte Kreuzworträtsel der Times gestaltete, prostete Livia zu. »Dein Italienisch ist verflucht gut«, sagte er. »Ich habe vor Jahren einen Kurs belegt. Kann mich aber nur an mille grazie erinnern.«
Dan Fernandez, ein Reporter aus dem Hauptstadtbüro in Washington, mischte sich ein: »Mit meinem Spanisch kann ich immerhin Bruchstücke verstehen.«
Vom Italienertisch kam erneut Jubel.
»Wow, 66 : 70. Das können die Italiener noch schaffen. Oder bist du für die Chinesen, Livia?«, fragte Jeff Glockner, ein Investigativreporter, der bereits das dritte Bier leerte.
»Sie wartet ab, wer gewinnt«, witzelte Blumenstein.
»Halb Italienerin, halb Chinesin, ein Traum«, sagte Glockner.
Livia lächelte ihre Kollegen an. »Habt ihr vergessen, dass ich Amerikanerin bin?«
»Na klar, so gut, wie du Italienisch sprichst!«, rief Fernandez. Er lachte über seinen albernen Scherz.
»Achtung, Leute …« Jack Westinghouse, ein Technikredakteur, deutete mit gestrecktem Arm auf den Flachbildschirm über dem Bartresen.
Die Squadra Azzurra passte den Ball mit beeindruckender Geschwindigkeit um die Dreipunktelinie. Gilberto Tomba, Italiens Center, lancierte vom rechten Corner einen überraschend hohen Wurf und traf präzise. Der Ball berührte nicht mal das Metall der Netzhalterung, sondern donnerte mit Wucht hindurch. Drei Punkte. Nun stand es 69 : 70. Noch führten die Chinesen, aber am Italienertisch ging es zu, als wäre die Partie schon gewonnen.
»Na ja, irgendwie bist du keine typische Amerikanerin«, brummte Glockner, der überaus charmant sein konnte, wenn er nicht gerade das vierte Bier bestellte.
»Wie sind denn Amerikanerinnen?«, fragte Livia.
Fernandez kam ihr zu Hilfe. »Na ja, groß, blond, dicke Titten, aufgespritzte Lippen. Glockners Typ eben …«
»Fick dich«, zischte Glockner.
Livia lachte. »Das mit den Lippen überlege ich mir noch.«
»Bloß nicht!«, rief Blumenstein. »Nur schade, dass du dich an diesen weltfremden Physiker verschenkst.«
»Hey, das ist meine Sache. Nicola ist ein wundervoller Mann.«
»Nur, dass du ihn kaum je zu sehen bekommst, weil er ständig in seinem Teilchenlabor unter der Erde steckt.«
Livia blickte auf ihr Bierglas. »Er ist es wert.«
»Geschmack hat er auf jeden Fall«, sagte Kortz, der Kreuzworträtselmann.
»Danke, Will, aber sprachen wir vorhin nicht über Compliance-Regeln?«
»Man darf keine Komplimente mehr machen?« Glockners Zunge wurde minütlich schwerer.
»Jetzt ist gut, ihr Möchtegernmachos«, ging Blumenstein dazwischen.
Die Männer lachten und prosteten sich zu.
Livia musste schlucken. Sie dachte an Nicola. Vor drei Wochen hatte sie ihn zuletzt gesehen. Es war ein romantisches Wochenende gewesen, in Chioggia, der kleinen Schwester Venedigs. Sie hatte es genossen, aber mit düsterem Gewissen. Sie hätte es Nicola damals schon erzählen müssen. Die Sache mit Gigi. Mit Giancarlo Idda, einem Redakteur von La Stampa. Sie spürte ein ungutes Stechen im Bauch.
Seit dem Ausrutscher hatte sie pausenlos gearbeitet und weder an Nicola noch an Gigi gedacht. Sie war froh gewesen über dieses Meeting in New York. Eine willkommene Ablenkung. Auch wenn sie morgen wieder im Flugzeug nach Rom sitzen würde. Zurück in ihr Leben. Vor Entscheidungen gestellt.
Seit mehr als einem Jahr war sie inzwischen Korrespondentin der New York Times in Rom. Den Job hatte sie sich aussuchen können, nachdem sie den Pulitzerpreis gewonnen hatte. Die Auszeichnung hatte sie für eine Reportage im New York Times Magazine erhalten. Darin hatte sie den Verbleib des vor achtzig Jahren auf mysteriöse Weise verschwundenen Physikers Ettore Majorana aufgeklärt. Die Recherche und der achtzehn Seiten lange Bericht hatten ihr neben Ruhm und Ehre auch einen Buchvertrag mit vierhunderttausend Dollar Vorschuss eingebracht. Das Buch mit dem Titel Peacock House war vor einigen Monaten erschienen und sofort ein Bestseller geworden, auch in Italien. Der verschwundene Physiker, ein gebürtiger Sizilianer, war in seinem Heimatland seit Jahrzehnten eine Legende. Es war der berühmteste Vermisstenfall Italiens. Livia hatte jedoch keine Sekunde lang daran gedacht, sich auf diesem Erfolg auszuruhen, sondern sich in ihre Arbeit als Korrespondentin gestürzt.
Für den Ortswechsel hatte es einen weiteren Grund gegeben. Während der Recherche zu der Majorana-Geschichte hatte sie sich in Nicola Caneddu verliebt, einen Wissenschaftler, der in einem unterirdischen Labor in Mittelitalien Elementarteilchen erforschte. Sein Arbeitsplatz war nur zwei Autostunden von Rom entfernt. Doch die teils wochenlangen Experimente unter dem zweitausend Meter hohen Granitberg nahmen den Physiker voll in Beschlag. Für Livia fühlte es sich zunehmend an, als wäre sie mit einem Astronauten liiert.
Dabei hatte Nicola in den vergangenen Wochen mit seiner liebevollen Art das Thema Kinder ins Gespräch gebracht. Doch wie sollte das gehen, fragte sich Livia. Sie hatten beide mörderisch zeitaufwendige Jobs. Wann und wie wäre da Zeit für eine Familie?
Sie hatte sich mehr denn je in ihre Arbeit vertieft. Die Regierungskoalition Italiens war zum zweiten Mal in zwölf Monaten zerbrochen. Als erste ausländische Journalistin hatte Livia in Erfahrung gebracht, wer neuer Ministerpräsident werden würde, und ein langes Interview mit dem Sozialisten in ihrer Zeitung veröffentlicht. Wenn sie tief in ihrer Arbeit steckte, musste sie sich nicht den Kopf zerbrechen, ob sie mit Nicola eine Familie gründen wollte. Oder mit Gigi ein neues Abenteuer beginnen. Oder nichts davon.
Das Gebrüll der Italiener am Nebentisch holte sie zurück in die Realität. Die Chinesen hatten einen Zweipunktewurf geschafft und führten wieder mit drei Punkten Abstand.
»Basketball kommt für dich eher nicht infrage, oder, Livia? Mit deinen Einswieviel?«, fragte Fernandez.
»Einszweiundsechzig.«
»Eher Bodenturnen. Oder Pferderennen«, sagte Glockner. Seine Witze wurden nicht besser.
»Mugsy Bogues!«, rief Livia.
»Wie bitte?«
»Gutes Beispiel«, sagte Bill Pennington, ein Sportkolumnist. »Mugsy Bogues war von 1987 bis 2003 Stammspieler der amerikanischen NBA. Und nur eins sechzig groß.«
»Zwei Zentimeter kleiner als ich«, betonte Livia.
Ihre Kollegen blickten erstaunt.
»Im Ernst? An den kann ich mich gar nicht erinnern«, sagte Fernandez. »Sein Trick war vermutlich, durch die Beine der Gegner zu schlüpfen.«
»Die Charlotte Hornets und die Dallas Mavericks liebten ihn. Er hat im Laufe seiner Karriere mehr als zwanzig Millionen Dollar Gehalt kassiert. Plus Werbeeinnahmen«, erklärte Livia.
»Irre.«
»Aber du hast schon recht«, sagte sie, »mein Sport ist eher Karate. Wollt ihr eine Lektion?«
Alle lachten.
Was ihre Kollegen nicht wussten: Livias Selbstverteidigungskünste waren tatsächlich ausgezeichnet. Allerdings war nicht Karate ihre Disziplin, sondern der jahrhundertealte vietnamesische Kampfsport Viet Vo Dao. Aber das gehörte zu den Geheimnissen, die sie niemandem erzählte. So wie das noch größere Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter.
Die große Lüge.
Livia liebte ihren Job in Rom. Anders als viele dort arbeitende Ausländer mied sie Botschaftspartys und Irish Pubs, wo sich das internationale Publikum traf – die Diplomaten, Lehrer und Journalisten. Livia hielt sich an ihre einheimischen Kollegen. Sie mochte die Italiener, ihre Lebensfreude, ihren Humor. Dank einiger Freundschaften, die sie geschlossen hatte, war sie deutlich besser informiert als andere ausländische Korrespondenten. Die Italiener schätzten Livia ebenso, was nicht nur an ihrem umwerfenden Lächeln, ihren haselnussbraunen Augen und dem kräftigen, dunklen, schulterlangen Haar lag. Livia hatte viel Mühe darauf verwendet, im Rekordtempo Italienisch zu lernen. Und wenn sie zum Abendessen einlud, entzückte sie ihre Gäste mit einem butterzarten Ossobuco.
Noch immer stand es 69 : 72. Das italienische Basketballteam setzte zu einem Rebound an. Wenn ihnen ein Dreipunktewurf gelang, würden sie gleichziehen. Tomba, der italienische Center, schnappte sich den Ball mit einem rekordverdächtigen Sprung, wirbelte einmal um die eigene Achse und brachte sich mit leichter Rückenlage in Stellung für einen Weitwurf. Er hob den Ball, der in einer perfekten Parabel auf das Netz zuflog. Die Italiener sprangen von ihren Sitzen und brüllten aus vollem Leib.
Das Fernsehbild wechselte.
Statt des Basketballcourts sah man Rauchschwaden, Feuerwehrmänner, Wrackteile, zerstörte Einfamilienhäuser, aufgerissenes Erdreich und ein alles überragendes blaues Seitenleitwerk mit dem Logo der Delta Airlines.
Am unteren Bildschirmrand informierte eine Laufschrift über die Flugzeugkatastrophe bei Atlanta. Hundertneununddreißig Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder waren an Bord der Boeing 737 gewesen und vermutlich tot. Auch unter den Einwohnern eines Ortes namens Newnan, vierzig Kilometer südlich von Atlanta, war mit Opfern zu rechnen.
Es wurde schlagartig still in der Bar. Lediglich die italienischen Touristen stießen ein paar Flüche aus. Drei von Livias Kollegen zogen ihre Smartphones hervor und legten sie in die Mitte des Tischs.
»Sechzig Sekunden«, sagte Blumenstein und zeigte auf ihr Handy.
»Niemals.« Glockner deutete auf Fernandez. »Diesmal trifft es ihn.«
Livia kannte das Ritual. Wer als Erster vom diensthabenden Nachrichtenchef in die Redaktion gerufen wurde, musste die Zeche für alle bezahlen.
Nach dreißig Sekunden klingelte das erste Handy.
Aber es war keins von denen auf dem Tresen. Es steckte in Livias Hosentasche. Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte sie ihre Kollegen an, hob die Schultern und zog das Telefon hervor. Es war Thomas Bell, der Chefredakteur der New York Times. Sie ging ran.
»Tom, dein Anruf kostet mich jetzt um die zwanzig Biere, acht Cheeseburger und …«
»Ich habe gerade keine Lust auf Scherze, Livia. Es sind vermutlich mehr als hundertfünfzig Menschen tot.«
»Ich hab’s gesehen, Tom. Grauenhaft. Aber deshalb rufst du wohl kaum deine Italienkorrespondentin an.«
»Doch, Livia. Genau deshalb rufe ich dich an. Ich möchte, dass du dieses Unglück coverst.«
»Wie bitte? Hast du mitbekommen, dass die Maschine in Atlanta abgestürzt ist und nicht in den Abruzzen?«
»Ich will, dass du das übernimmst. Du fliegst morgen mit der ersten Maschine nach Atlanta. Kurz nach fünf von La Guardia. Das Ticket schickt dir Nancy auf dein Telefon.«
»Wozu betreibt die New York Times ein Außenbüro in Atlanta? Fausset ist ein guter Mann. Er könnte heute Abend noch … «
»Kann er nicht. Er ist im Urlaub auf Hawaii.«
»Was ist mit Gambetta aus Houston oder Rojas aus Miami?«
»Ich bin alles durchgegangen. Gambetta wäre verfügbar, aber er ist politischer Analyst, kein besonders guter Reporter. Rojas ist krank. Ich konnte einen Volontär in Atlanta auftreiben, der uns ein paar nachrichtliche Meldungen schreibt. Aber ich will noch jemanden in Georgia haben. Eine Vollblutreporterin wie dich. Ich halte es für möglich, dass es eine spannende Hintergrundstory gibt. Hast du gehört, woher die Maschine kam?«
»Nein, woher?«
»Aus Honduras. Vielleicht gibt es einen kriminellen Hintergrund. Ein Drogending. Was Politisches. Oder ein Einwandererdrama.«
»Mein Flug zurück nach Rom geht morgen.«
»In bella Italia verpasst du gerade nichts, ich brauche dich in Georgia. Morgen früh. Bitte, Livia.«
Sie seufzte und blickte ihre Kollegen mit heruntergezogenen Mundwinkeln an. Sie unternahm einen letzten Versuch, ihren Chef von der Idee abzubringen.
»Das Untersuchungsteam des NTSB ist garantiert schon unterwegs zur Unfallstelle. Lass jemanden in deren Zentrale recherchieren. Das bringt vermutlich mehr, als sich als Zaungast an der Absturzstelle herumzutreiben.«
»Das National Transportation Safety Board ist eine verdammte Bundesbehörde voller Techniknerds. Die tauchen frühestens morgen an der Unfallstelle auf und gehen erst rein, wenn die Leichen weg sind. Und es gibt viele Leichen. Nicht nur Passagiere, auch Bewohner am Boden. Danach werden sie monatelang mit Schrottteilen herumpuzzeln, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Also spielt die Musik jetzt in Atlanta. Oder wie das Kaff weiter südlich heißt, wo die Maschine abgestürzt ist. Wir haben dich auf den Direktflug gebucht, Businessclass, und vor Ort einen Fahrer besorgt. Das klingt doch gut, oder?«
»Es gibt auch First Class …«
»Dir ist wohl der Pulitzer zu Kopf gestiegen.«
»War nicht ernst gemeint.«
Mit dem Telefon am Ohr winkte Livia den Barmann herbei und drückte ihm ihre Kreditkarte in die Hand. Er solle die Zeche des gesamten Tisches abbuchen. Und sie bat ihn, ein Taxi zu rufen.
»Okay, Tom, ich schlafe drei, vier Stunden, nehme ein paar Sachen aus der Wohnung mit und fliege morgen früh nach Atlanta.«
»Du bist ein Schatz.«
»Eine Sache nur, Tom.«
»Was?«
»Ich mache das auf meine Weise.«
»Warum habe ich mir das fast schon gedacht?«
»Meine Regeln, Tom. Keine Kompromisse.«
»Okay, Livia. Solange ich nicht in der Post zuerst lese, warum dieser Flieger runtergekommen ist.« Er legte auf.
Livia erklärte ihren erstaunten Kollegen, was los war. Dass sie nach Atlanta aufbrechen musste, wegen des Unglücks. In Fernandez’ Gesicht war Enttäuschung zu lesen. Vermutlich hätte er den Job gerne übernommen. Livia blickte ihn an.
»Ich hätte dir das gerne überlassen. Aber du kennst den Chef – wenn er was will, müssen wir nicht diskutieren.«
3
Hafengelände, La Ceiba, Honduras
Das Dunkel der Nacht verbarg, wie furchterregend die Männer aussahen. Der größere, der aufrecht stand, hatte ein aufgerissenes Haifischmaul quer über die untere Gesichtshälfte tätowiert. Auf der Stirn prangten die Buchstaben »M« und »S« in Frakturschrift. Sie standen für »Mara Salvatrucha«, der Name der brutalsten Bande Zentralamerikas. Unter dem linken Auge waren acht dunkelblaue Tränen verewigt. So viele Menschen hatte Tiburón, wie sie ihn ehrfürchtig nannten, angeblich ermordet. Einem Schläger der verfeindeten Barrio-18-Gang hatte er angeblich die Kehle mit einer Machete aufgeschlitzt. Aber das war nur ein Gerücht.
»Hat sich einer der verhurten Achtzehner blicken lassen?«
»Alles ruhig, jefe.«
Der kleinere, dickere Mann hatte weniger Tätowierungen im Gesicht. Dafür war das Wort »MARA« auf seine Finger buchstabiert, und eine riesige »13« zierte seine Brust. Er fläzte auf einem Schemel an einer Hauswand auf der Zugangsstraße zum Hafen der honduranischen Küstenstadt La Ceiba. Im Osten war das Schimmern zweier Laternenmasten zu sehen. Sie beleuchteten die Brachfläche im Hafen. Nach Westen hin lag die Zufahrtsstraße im Dunkel.
»Halt bloß die Augen auf, Pippo. Wenn einer von den pendejos seinen Fuß in die Calle setzt, gibt es keine Gnade. Du ballerst sie weg. Wir sind sofort bei dir.«
»Keine Sorge, Tiburón, ich hab alles im Griff.«
»Munition?«
»Null-null-Schrot. Vier Schachteln.«
»Okay, das wird den Ärschen einheizen. Ich bin dann mal mit Gordo und Jesús bei Mama Juanita.«
»Klar, jefe. Trink einen plata für mich mit. Und steck ihn einmal für mich rein.«
Tiburón zeigte seine Zähne. Ein Dutzend von ihnen war mit Gold überzogen. »Hab Geduld, Pippo. Noch ein, zwei Jahre, und du bist auch ein jefe. Die Mara vergisst ihre Treuen nicht.«
»Alles klar, jefe, ich regle das hier. Wie letzte Nacht. Und die Nächte davor.«
»Okay. Aber nicht sinnlos herumballern. Das weckt nur die federales.«
»Está bien.«
Tiburón verschwand in eine Seitengasse. Pippo richtete seine Augen ins Dunkel. Eine geladene Remington 870 stand griffbereit an die Hauswand gelehnt. Mit Dunkelheit kam er gut klar, aber der vor ihm liegende Straßenabschnitt war nicht nur dunkel. Er war schwarz wie ein Kohlebergwerk. Pippo malte sich aus, auf welchem Weg die hijos de puta von der Barrio-18-Gang wohl kommen könnten.
Sie würden es vielleicht über die Dächer probieren. Vielleicht aber auch nicht, denn das Blech auf den Häusern machte verdammt viel Lärm. Außerdem würden sie ihn von oben schlecht sehen können. Vielleicht hatten sie aber auch Nachtsichtgeräte und Präzisionsgewehre. Schon oft hatte er Tiburón gebeten, solche Sachen anzuschaffen, das Zeug aus den Kriegsfilmen. Die Barrios würden jedenfalls nicht planlos angreifen, so viel war sicher. Sie wussten, dass die Mara 13 die Zugänge zum Hafen bewachte. Der Hafen, ihre wichtigste Geldquelle. Das Herz des Mara-Territoriums.
Pippo hatte Sehnsucht nach einer Zigarette. Aber die Glut würde ihn verraten. Ein Schluck Rum wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber das hatte Tiburón strikt verboten. Und Pippo wollte es nicht versauen. Ohne die Mara war sein Leben wertlos. Seit er vierzehn war, hatte er sich dem vida loca verschrieben. Dem hemmungslosen, brutalen Leben als Gangster.
La Mara para siempre.
Nach einer Stunde stand Pippo vorsichtig auf, um sein eingeschlafenes Bein zu schütteln.
Ein leises Knattern ließ ihn herumfahren. Eine Uzi, war sein erster Gedanke. Eine vollautomatische Maschinenpistole. Schoss da jemand im Hafen herum? Doch das Knattern hielt an. Eine Uzi konnte es daher nicht sein. Die hatte ihr 50-Schuss-Magazin nach zwei Sekunden verballert. Dieses Knattern hörte nicht auf. Es wurde langsam lauter. Es war ein gottverdammter Diesel. Ein Schiffsdiesel. Das Geräusch kam vom Wasser her.
Pippo blickte mit zusammengekniffenen Augen in Richtung Mole. Hatte Tiburón nicht gesagt, die Ladung aus Kolumbien komme erst morgen? Was, wenn es doch die Kolumbianer waren? Wenn sie schon heute kamen, und niemand empfing sie im Hafen? Er sollte Tiburón anrufen. Aber sein Smartphone konnte er unmöglich benutzen. Es leuchtete heller als jede Zigarette. Ein Scharfschütze von den Barrios, und er hätte sofort eine Kugel im Kopf.
Vielleicht sollte er den Posten verlassen und im Hafen nachsehen. Nur kurz. Als das Knattern deutlich zu hören war, nahm Pippo die Remington zur Hand und schlich an der Hauswand entlang in Richtung Mole. Was soll’s, dachte er, die Barrios hatten sich seit Wochen nicht blicken lassen. Es wäre schon okay, wenn er kurz im Hafen nach dem Rechten sah. Falls es die Kolumbianer waren, würde man ihn dafür loben, die cabrones aus Cartagena mit ihrem coca in Empfang genommen zu haben.
Pippo überquerte die Brachfläche vor der Hafenmole und sah das Boot. Tiburón hatte gesagt, die Kolumbianer würden mit einem dieser selbst gebauten U-Boote auftauchen. Aber das hier war kein U-Boot. Es war ein kleiner Fischtrawler mit buntem Holzrumpf.
Ohne Positionslichter tuckerte das Fischerboot quer durch das Hafenbecken und krachte ungebremst auf die Mole. Der Bug knirschte, während der Dieselmotor das Boot unnachgiebig gegen den Beton presste. Das war eine unerwartete Situation. Vielleicht eine Finte der Barrios? Pippo versteckte sich hinter einem rostigen Container und versuchte zu erkennen, wer dieses Boot steuerte.
Nach einigen Minuten nahm seine Neugier überhand. Er rannte an die Kante der Mole und sprang beherzt auf den Bug des Trawlers. Mit der Remington im Anschlag warf er sich hinter ein Bündel zusammengelegter Fischernetze. Dort blieb er einige Sekunden lang in Deckung. Als sich noch immer nichts tat, tastete er sich an der Kajüte vorbei in Richtung Heck, die Waffe im Anschlag.
»¡Colombianos! ¡Bienvenidos compadres!«, rief Pippo, auch, um sich selbst Mut zu machen.
Nichts regte sich. Pippo öffnete die Tür zum Steuerstand und setzte ein Bein in die Kajüte, als er vom Heck ein hölzernes Klappern vernahm. Es war der Deckel eines Stauraums. Doch Pippo kam nicht mehr dazu, sich umzudrehen. Etwas Weiches schlang sich um seinen Hals und drückte mit übermenschlicher Kraft zu. Aus der Remington löste sich ein Schuss. Die Schrotkugeln krachten in die Kajüte und zerfetzten den Steuerstand.
Eine Anakonda, war Pippos letzter Gedanke. Er hörte das Knacken seines Genicks. Und dann nichts mehr.
4
Hartsfield-Jackson International Airport, Atlanta, Georgia, USA
Er hätte sich wenigstens rasieren können, dachte Livia. Der Fahrer hielt ein handgeschriebenes Pappschild mit ihrem Namen in die Luft und stellte sich als Ramón Gonzales vor. Immerhin, der schwarze Anzug sah passabel aus. Und ihr Chefredakteur hatte Wort gehalten, indem er den Fahrdienst organisiert hatte.
Ramón nahm ihr den Rollkoffer ab und führte sie durch eine gläserne Schiebetür aus der Ankunftshalle des internationalen Terminals am Flughafen Atlanta zum Kurzzeitparkplatz. Dort schloss er einen dunkelblauen Lincoln Towncar auf. Das war gut, fand Livia. Mehr nach Regierung konnte ein Auto nicht aussehen.
»Wir müssen nach Newnan, Ramón, ich bin wegen des Flugzeugunglücks hier«, erklärte sie, als der Fahrer den Lincoln durch die Schranke des Parkplatzes steuerte. »Wir müssen uns der Absturzstelle von Süden nähern. Die Highways 29 und 85 werden von Norden aus verstopft sein, nehmen Sie also die 54 runter bis Luthersville, dann erst auf die 85 nach Norden.« Sie hatte im Flugzeug drei Stunden Zeit gehabt, die Gegend auf einer Karten-App zu studieren.
Ramón nickte widerwillig. Wie jeder Chauffeur konnte er es nicht ausstehen, wenn Fahrgäste ihm seinen Job erklärten. Aber er befolgte Livias Anweisung und steuerte den Highway 54 an. Nach einer knappen Stunde erreichten sie die Kreuzung südlich von Newnan und fuhren auf der Interstate 85 einige Meilen zurück nach Norden. Am Horizont stiegen Rauchfäden in den Himmel. Livia sah das Blinken von Rettungsfahrzeugen. Sie nahmen die Ausfahrt am örtlichen Krankenhaus und passierten eine Phalanx von TV-Übertragungswagen mit Satellitenschüsseln auf den Dächern.
»Fahren Sie weiter und machen Sie ein genervtes Gesicht.«
Livia reichte Ramón einen Plastikausweis mit farbigem Halsband nach vorne. Das offiziell aussehende Dokument war an sich wertlos. Es stammte von einem Besuch in Camp David, dem Sommersitz des amerikanischen Präsidenten, bei dem Livia im vergangenen Jahr zugegen gewesen war. Wer genau hinsah, konnte das längst abgelaufene Datum erkennen. Von Weitem jedoch sah man nur zwei Dinge: das Logo des Weißen Hauses und ein Passbild von Livia Chang.
Der Fahrer klemmte den Ausweis unter die Windschutzscheibe. Sie erreichten einen Kontrollpunkt, den nur Rettungsfahrzeuge passieren durften. Ramón spielte seine Rolle gut. Er tippte auf den Ausweis und machte eine ungeduldige Geste mit dem Zeigefinger. Der Feuerwehrmann an der Zufahrt winkte den Lincoln, ohne zu zögern, durch. Ein CNN-Team filmte sie sogar, vermutlich, weil es gerade nichts anderes zu filmen gab.
Ramón steuerte das Auto noch einige Hundert Meter weiter, bis ein zweiter Feuerwehrmann sie anwies, auf einem Stück Wiese zu parken. Livia stieg aus dem Fond, strich den Rock ihres Kostüms glatt und begrüßte den Lockenkopf mit Handschlag. Er hatte eine kräftige Statur und stellte sich als Bill Walsh vor.
Sie sagte nur: »Sehr erfreut. Chang«, und fischte den Ausweis des Weißen Hauses aus dem Lincoln. »Ist das Go-Team des NTSB schon da?«
»Noch nicht, Ma’am, die nördlichen Zufahrten sind ziemlich dicht, wegen der vielen Rettungsfahrzeuge. Die NTSB-Leute müssten aber jede Minute eintreffen.«
Livia hängte sich den Ausweis an dem dunkelblauen Plastikband um und verschränkte ihre Arme, um die Details zu verdecken. Sie lehnte sich an den Kotflügel des Lincoln.
»Grauenhafte Sache, was, Bill?«
»Absolut, Ma’am.«
»Wie viele Opfer werden es am Ende sein?«
»Noch nicht klar, einige werden auf der Intensivstation behandelt. Von den Passagieren und der Crew hat mit Sicherheit niemand überlebt. Aber einige der Menschen, die es am Boden erwischt hat, könnten es schaffen. Zum Glück waren die meisten Anwohner noch bei der Arbeit und die Kinder in der Schule. Sonst hätten wir hier ein echtes Gemetzel.«
»Das örtliche Krankenhaus wird kaum ausreichen, oder?«
»Wir haben insgesamt vier Kliniken beliefert, Ma’am. Und diese hier …« Walsh deutete auf drei kastenförmige Schwerlaster mit wummernden Kühleinheiten auf dem Dach.
Livia ahnte, worum es sich handelte. Es waren mobile Leichenwagen. Logisch, mindestens hundertfünfzig Tote, viele vermutlich zerstückelt – die konnten nicht alle beim County Coroner, dem örtlichen Leichenbeschauer, abgeliefert werden.
»Gute Arbeit, Bill.«
Sie stieß ein betrübtes Pfeifen aus und ließ ihren Blick über die Szenerie schweifen. Die zerstörten Wohnhäuser, die Flugzeugteile, das Seitenleitwerk, der Walmart. Das Gelände sah aus wie ein gigantischer Schrottplatz. Sie stellte keine weiteren Fragen, um nicht als Laie – oder noch schlimmer, als Pressevertreterin – aufzufallen.
Aus der gleichen Richtung, aus der sie gekommen war, näherten sich zwei schwarze Kleinbusse und ein Transporter. Die Fahrzeuge parkten neben dem Lincoln, in dem Ramón noch am Steuer saß. Gut zwei Dutzend Menschen, fast alle Männer, stiegen aus den Kleinbussen. Ein Kahlkopf Ende fünfzig mit buschigem Schnurrbart ging auf Bill Walsh zu. Er stellte sich als Leiter des Go-Teams des National Transportation Safety Board vor. Livia wartete, bis der Rest des Trupps seinem Boss folgte, und näherte sich von hinten. Sie erhob ihre Stimme laut und deutlich.
»Guten Morgen allerseits.«
Die NTSB-Leute wandten sich um, zunächst erstaunt, dann genervt, als sie Livias Ausweis wahrnahmen. Sie hielten sie für eine Aufpasserin aus dem Weißen Haus.
»Mein Name ist Chang. Bitte lassen Sie sich durch meine Anwesenheit keinesfalls stören. Wir machen alle nur unseren Job.«
Mit einer lässigen Bewegung schloss sie den Knopf ihres Jacketts über dem falschen Ausweis und hob den rechten Unterarm, um dem Untersuchungsteam den Vortritt zu lassen.
Der Kahlkopf mit dem Schnauzbart kniff die Augen zusammen, wandte sich wieder Bill Walsh zu und folgte mit seinen Leuten dem Feuerwehrmann. Der Pulk stieg über niedrig hängende Absperrbänder auf eine leichte Anhöhe. Von dort oben sah es aus, als wäre ein Tornado durch das Wohnviertel gezogen. Schlimmer noch, weil nicht nur Häuser plattgemacht worden waren, sondern auch das Erdreich wie von einem monströsen Pflug aufgewühlt war. Livia erspähte ein Flugzeugtriebwerk in einem Vorgarten. Einige Hundert Meter dahinter ragte das Seitenleitwerk in die Luft. Der Feuerwehrmann gab einen kurzen Überblick über die bislang bekannten Fakten. Livia schoss einige Fotos mit ihrem Smartphone und nahm ein paar Videos auf.
»Ist der Präsident an Katastrophenbildchen interessiert?« Der Spott in der Stimme des NTSB-Teamchefs war unüberhörbar.
»Nicht nur er«, sagte Livia mit einem vieldeutigen Lächeln.
Der NTSB-Mann hob die Hand und fing an, seinem Team Anweisungen zu geben. »Okay, Leute, Murph und Nguyen suchen den CVR, Chuck und Lizzie die Blackbox. Die Ortungssignale müssten deutlich messbar sein. Ron leitet das Hardware-Team. Wie immer erst die Triebwerke, dann Steuerflächen, Flügel, Tanks und Rumpf. Ramirez, du kümmerst dich um die Kräne und Schwertransporter. Am Ende kommt der ganze Scheiß in unsere Leichenhalle.«
Livia hätte gerne gefragt, was er mit Leichenhalle meinte. Vermutlich war es der Technikerjargon für den Ort, an dem man die Trümmer eines Flugzeugwracks zusammentrug, sortierte und wie ein gewaltiges Puzzle zusammensetzte, um die Absturzursache zu finden.
Die NTSB-Leute verteilten sich in Kleingruppen auf dem Feld. Einige packten elektronische Geräte aus, andere Fotoapparate, Werkzeuge und Nummerntafeln.
Livia schaute eine Weile zu, machte noch ein paar Bilder und wandte sich wieder dem Feuerwehrmann zu. »Bill, ich müsste mal den Papierkram sehen, die Listen der Opfer und Patienten. Alles, was bisher bekannt ist.«
»Klar, Ma’am.«
Der Feuerwehrmann führte Livia den Hügel hinab in ein provisorisches Zelt des Katastrophenschutzes. Dort drückte er ihr ein Klemmbrett mit mehreren B5-Papieren in die Hand. Das meiste waren Tabellen mit Namen von Opfern, Altersangaben, Fundorten. Viele Details fehlten noch, vor allem Namen, weil man die meisten Toten bislang nicht identifiziert hatte.
Eine weitere Liste führte die Verletzten auf, die in umliegende Kliniken gebracht worden waren. Das waren Ortsansässige, die von Wrackteilen getroffen worden waren oder Verbrennungen erlitten hatten. Livia las die Namen von drei großen Unfallkrankenhäusern in der weiteren Umgebung. Und eine Spezialklinik: das Henfield Center for Psychiatric Care. Dorthin war nur eine einzige Person gebracht worden. Eine Frau namens Maria Jiménez.
Livia tippte mit dem Finger auf den Namen und blickte Walsh an. »Ist das üblich? Dass man ein Opfer eines Flugzeugabsturzes in die Psychiatrie bringt?«
»Nein, Ma’am, aber in diesem Fall ging es nicht anders.«
Das Funkgerät des Feuerwehrmanns knackte. Der Leiter des Untersuchungsteams meldete sich. Aus einer Tragfläche tropfte noch immer Kerosin. Der NTSB-Mann bat Walsh, die Stelle zu sichern. Walsh entschuldigte sich bei Livia und eilte aus dem Zelt.
Livia blickte noch eine Weile auf die Listen der Opfer. Sie entdeckte, dass es eine Spalte gab, in der die Verletzungen eingetragen wurden, meist mit Kürzeln medizinischer Fachausdrücke. Frakturen, Rupturen, Quetschungen. Im Fall von Maria Jiménez war dieses Feld durchgestrichen. Die Frau war offenbar körperlich unversehrt. Bis auf ein akutes psychisches Problem. Ein massives Trauma, vermutete Livia.
Sie entdeckte einen Post-it-Notizzettel mit der Mobilnummer von Bill Walsh, speicherte die Ziffern in ihrem Telefon und verließ das Zelt. Sie machte es sich auf der Rückbank des Lincoln bequem, wo sie auf ihrem Laptop einen fünfzehnhundert Wörter langen Artikel schrieb, den sie mit mehreren Fotos und einem eilig zusammengeschnittenen 45-Sekunden-Video direkt an das Newsdesk ihrer Zeitung schickte. Namen von Opfern nannte sie keine. Das gehörte sich nicht.
Erschöpft lehnte sie sich zurück. Das war die Pflichtübung gewesen. Den aktuellen Bericht von der Unfallstelle hätte jeder bessere Volontär hinbekommen. Außer vielleicht den Trick mit dem falschen Ausweis. Doch die eigentliche Arbeit stand erst noch bevor. Was war die Ursache des Absturzes? Menschliches Versagen? Ein Anschlag? Ein technisches Problem? Livia suchte einen Anhaltspunkt, an dem sie ansetzen konnte. Ein Puzzleteil, von dem aus sie weiter recherchieren konnte.
Bei den NTSB-Leuten konnte sie sich nicht mehr blicken lassen. Ihr Bericht mit den Exklusivbildern würde in wenigen Minuten online gehen. In der Zentrale des National Transportation Safety Board dürfte das ein Erdbeben auslösen, gefolgt von einem deftigen Anschiss für das Go-Team, das sich von einer Journalistin auf das abgesperrte Gelände hatte begleiten lassen. Der Schnauzbartträger würde ihr bei nächster Gelegenheit vermutlich eins der Wrackteile an den Kopf schleudern.
Livias Reporterinstinkt begann, um eine offene Frage zu kreisen: Wieso war diese einzelne Patientin – wie hieß sie gleich? Jiménez? – in eine psychiatrische Klinik gebracht worden statt in ein Unfallkrankenhaus? War die Frau nur besonders empfindlich, oder hatte sie etwas Traumatisierendes erlebt?
Zweifellos konnte Maria Jiménez etwas über den Absturz erzählen, dachte Livia.
5
Henfield Psychiatric Hospital, Coweta County, Georgia, USA
Livia stieß die Eingangstür des psychiatrischen Krankenhauses auf und ging auf die Empfangstheke zu. Ihr Auftreten, ihr dunkelgraues Kostüm und ihre feste Stimme strahlten pure Autorität aus. Eine der vielen Erscheinungsformen von Livia Chang.
»Entschuldigen Sie bitte, Schwester, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Bei Ihnen ist eine Überlebende des Flugzeugabsturzes eingeliefert worden …«
Die Empfangsschwester blickte erst erstaunt. Dann mimte sie Geschäftigkeit. »Sie meinen vermutlich Ms. Jiménez.«
»Ganz genau. Ich muss sie unverzüglich sehen.« Statt einer Begründung zog Livia ihre Augenbrauen hoch, schürzte ihre Lippen und sah sich im Eingangsbereich um. Sie nannte das ihren Stiehl-mir-bloß-nicht-meine-Zeit-Bitch-Blick.
Es zeigte die erwünschte Wirkung. Die Empfangsschwester hob einen Telefonhörer ab und sprach einige Worte hinein. Eine übergewichtige Stationsschwester in hellblauem Kittel und weißen Sandalen kam zur Empfangstheke und bat Livia mitzukommen. Der Weg führte durch eine mit Codeschloss gesicherte Tür ein Stockwerk höher in einen Patiententrakt. Es roch nach Desinfektionsmitteln und frischer Wäsche.
»Bitte seien Sie vorsichtig«, bat die Krankenschwester, »es hat uns viel Mühe gekostet, Ms. Jiménez einigermaßen ruhigzustellen.«
Sie öffnete die Tür zu einem Einzelzimmer und ließ Livia den Vortritt. In einem Bett mit hochgeklappten Seitengittern lag eine ältere Lateinamerikanerin. Sie hatte dunkle, eingefallene Wangen und eine Sauerstoffmaske auf der Nase. Um den Bauch war sie mit einem kräftigen Ledergurt fixiert, mehrere Infusionsschläuche schlängelten sich von ihren Armen an ein Metallgestell voller Flüssigkeitstüten. Das Zischen des Atemgeräts und das Fiepen ihrer Herztöne waren die einzigen Geräusche im Zimmer.
»Ist sie voll mit Medikamenten?«
»Nur gängige Beruhigungsmittel, keine Hämmer. Im Moment schläft sie einfach nur. Zum Glück.«
Livia trat an das Bett. Ihr Blick schweifte über das schweißnasse Haar der Frau und die blutleeren Lippen. Ein Geflecht dunkelblauer Äderchen zog sich über ihre Nasenflügel. Die Augenlider zuckten unregelmäßig. Livia sah zartgliedrige Hände, die jedoch viel gearbeitet hatten. Die Brust der älteren Frau schien sich beim Atmen kaum zu heben. Am rechten Unterarm, in der Nähe des Handgelenks, entdeckte Livia ein Muster grünblau angelaufener Flecken. Vorsichtig streckte sie die Hand aus, um die Stelle zu betasten.
»Bitte nicht …«, flüsterte die Schwester.
Doch die Patientin öffnete bereits ihre Augen. Ihr Körper bäumte sich auf. Sie griff nach dem Sauerstoffschlauch und riss die Atemmaske herunter. Schreie drangen aus ihrem Mund, schrill wie ein siedender Teekessel. In der gleichen Tonlage begann sie, Worte zu formen.
»¡El braaaaaaaazo! El braaazo …«
Livia taumelte zurück. Das Kreischen klingelte in ihren Ohren. Aus dem Italienischen schloss sie darauf, was die Frau schrie. »Klagt sie über ihren Arm?«
»¡El brazo! ¡El braaaazo! ¡Me agarróóóóóó!«
Maria Jiménez warf ihren Kopf hin und her, ballte die Fäuste. Die Schwester drückte auf einen Notfallknopf an der Wand. Als müsste sie sich für den Zwischenfall entschuldigen, versuchte sie, das Schreien der Patientin zu übertönen.
»Bevor wir sie sediert haben, hat sie das ohne Unterlass getan. Wir wissen nicht, warum. Es ist bizarr, sie hat keine Verletzungen an den Armen, nichts. Nur diese Druckstellen am Handgelenk. Die sind aber nicht der Rede wert. Wir haben sie von oben bis unten geröntgt, ihre Arme sind genauso in Ordnung wie der Rest des Körpers.«
Zwei Pfleger kamen ins Zimmer gestürmt und begannen, mit beruhigenden Worten auf Maria Jiménez einzureden. Einer drückte ihren Oberkörper auf das Kissen. Der andere zog eine Spritze auf und pumpte die Flüssigkeit in einen Zugang an der Armvene der schreienden Frau. Ihre Muskeln entspannten sich innerhalb von Sekunden, der Körper wurde schlaff. Die Pfleger setzten ihr die Atemmaske wieder auf.
Livia blickte die Stationsschwester an. »Es tut mir leid, mir war nicht klar, dass Ms. Jiménez in einem derart … sensiblen Zustand ist. Haben Sie eine Erklärung für diese Symptomatik?«
»Wir vermuten im Moment eine psychische Störung namens Body Identity Integrity Disorder. Das ist ein Leiden, bei dem die Patienten einen Teil des eigenen Körpers nicht mehr akzeptieren. Oft betrifft das ein Bein oder einen Arm. Es kann extreme Formen annehmen. Manche BIID-Patienten entscheiden sich dafür, sich ein Körperteil amputieren zu lassen, obwohl das physiologisch unnötig ist. Aber tatsächlich geht es ihnen ohne den verhassten Körperteil besser. Die Entscheidung für einen solchen Eingriff können wir natürlich nicht eigenmächtig treffen. Das müsste Ms. Jiménez uns mitteilen, wenn sie bei vollem Bewusstsein ist.«
»Und die Male, wo kommen die her?«
»Die Male?«
»Diese Druckstellen am Unterarm. Woher stammen sie?«
»Das kann ich nicht sagen. Sanitäter lieferten Ms. Jiménez in großer Eile hier ab. Es gab weiß Gott noch genug anderes zu tun in Newnan.«
Livia nickte. Sie dankte der Schwester, trat auf den Flur vor dem Patientenzimmer und zog ihr Handy hervor. Sie entschied sich, Bill Walsh anzurufen, den Feuerwehrmann von der Absturzstelle. Seine Stimme wurde eisig, als er sie erkannte.
»Sie haben echt Nerven, Lady. Ich kann froh sein, wenn ich meinen Job behalte. Was glauben Sie, was hier los ist, seit raus ist, dass Sie eine verdammte Reporterin sind?«
»Ich habe nie gesagt, dass ich was anderes bin.«
»Bullshit. Sie hatten einen Ausweis vom Weißen Haus um den Hals.«
»Oh, das Ding. Sorry, das stammte noch von einem anderen Termin. Es stand deutlich drauf, dass ich Journalistin bin.«
»Müssen Sie sich nicht ausdrücklich als Pressevertreterin zu erkennen geben?«
»Mein Name ist Livia Chang, ich bin Reporterin der New York Times.«
»Sie gehen mir echt auf die Nerven.«
Livia machte eine kurze Pause. »Bill, sind Sie ein Anhänger der Pressefreiheit?«
»Ich habe jetzt keine Zeit für Grundsatzdebatten. Hier gibt es scheißviel Arbeit.«
»Einen Augenblick noch, Bill. Soll Ihr Name im nächsten Artikel erscheinen?«
»Was, zum Teufel? Nein.«
»Ich bräuchte nämlich noch zwei, drei Informationen von Ihnen.«
»Bei Ihnen hackt’s wohl! Erst übertölpeln Sie mich, und jetzt gehen Sie in die Offensive? Dafür habe ich wirklich keine Zeit.«
»Okay. Dann also Zitate mit Namen. Walsh, mit einem l, richtig?«
»Ist das eine Erpressung?«
»Nein, Bill. Ich biete Ihnen die beiden journalistischen Optionen an: das direkte Zitat, wir nennen es O-Ton, oder das Hintergrundgespräch. Im letzteren Fall benutzen wir Informationen, ohne die Quelle namentlich zu nennen.«
Tatsächlich war es ein Bluff. Niemals hätte Livia den Namen von Bill Walsh ihrer Zeitung genannt, selbst wenn er das Gespräch in diesem Augenblick abgebrochen hätte. Aber vor die Wahl gestellt, entschied sich der Feuerwehrmann für die Variante Hintergrundgespräch.
»Fünf Minuten.«
»Also los. Wie gehen Sie vor, wenn Sie so viele Verletzte auf einmal vorfinden?«
»Wir nennen es Triage. Wir ignorieren die Toten und die Hoffnungslosen, wir übergehen die Leichtverletzten und konzentrieren uns auf jene, die eine Chance haben, wenn wir ihnen schnell helfen.«
»In welche Kategorie fiel Ms. Jiménez?«
»Wer?«
»Die Frau, die als Einzige in die Psychiatrie kam statt in eine Unfallklinik.«
»Ach ja. Das war in der Tat bizarr. Normalerweise heben wir uns diejenigen, die schreien, für später auf. Wer schreien kann, ist noch bei Kräften. Also ignorieren wir sie erst mal. Die dringenderen Fälle sind die Halbtoten, die Ohnmächtigen, die Blutenden, bei denen jede Sekunde entscheidend sein kann. Ms. Jiménez gehörte eigentlich in die Kategorie der Schreihälse. Aber sie schrie anders als eine Verletzte. Nicht vor Schmerzen. Ihre Schreie klangen wie die eines gequälten Tiers. Es lief uns kalt den Rücken runter. So was hatte noch keiner von uns gehört.«
»Körperlich war sie okay?«
»So ziemlich. Kein Blut und nichts. Bis auf einen echt gruseligen Umstand.«
»Was war das?«
»Wir mussten etwas von ihrem Arm entfernen.«
»War sie eingeklemmt? Ein Stück Schrott?«
»Nein, nein, anders.«
»Was war mit ihrem Arm los?«
»Ein Arm …«
»Ja, der Arm …« Wann kommt er zur Sache, dachte Livia.
»Wenn Sie mich ausreden lassen, sag ich es Ihnen.«
»Sorry.«
»Sie hatte einen Arm am Arm.«
»Was?«
»An ihrem Unterarm war ein Arm festgeklammert. Ein einzelner abgerissener Arm. Männlich. Er hing an ihr, als hätte der Besitzer sie gewaltsam am Handgelenk gepackt. Nur, dass der Mann hinter dem Arm fehlte …«
Livia rang um Worte. Sie überlegte kurz, ob Ms. Jiménez eine Passagierin des Flugzeugs gewesen sein könnte und der Arm von ihrem Sitznachbarn gestammt hatte. Aber das war ausgeschlossen. Diesen Absturz hatte kein Passagier überlebt.
»Wir haben den Arm zunächst gar nicht abbekommen von der armen Frau. Sie schlug um sich wie eine Irre. Und das Teil war festgeklammert wie ein Schraubstock. Wir mussten sie fixieren und die Finger des Arms mit einer Rettungszange einzeln abkneifen.«
»Gibt es einen Hinweis darauf, von wem der Arm stammte?«
»Wir konnten ihn noch keinem der Opfer zuordnen, das wird dauern. Wir brauchen DNA-Tests und all das. Außerdem sind im Moment immer noch die Hunde unterwegs, die weitere menschliche Überreste suchen.«
»Wo befinden sich die sterblichen Überreste der Opfer?«
»Na, was denken Sie wohl?«
»Beim Leichenbeschauer.«
»Hundert Punkte, Miss Superschlau.«
»In den mobilen Einheiten auf dem Gelände? Ist der Arm dort zu finden?«
»Nein, in die Trucks kommen vollständige Leichen. Einzelteile werden zum County Coroner gebracht. Die brauchen mehr forensische Aufklärungsarbeit.«
»Danke, Bill. Und keine Sorge. Nichts wird auf Sie zurückfallen.«
»Das will ich hoffen, Lady.«
Livia beendete das Gespräch, bedankte sich ein weiteres Mal bei der Stationsschwester und eilte durch die Eingangshalle aus dem Krankenhaus. Vor der Tür sah sie ihren Fahrer, der mit grimmigem Blick und verschränkten Armen am Kotflügel des Lincoln lehnte.
»Alles okay, Ramón? Ich muss zum Office des Coroners von Coweta County. Es ist nicht weit, weniger als zwanzig Meilen.«
»Sorry, Lady, aber Ihre Zeitung hat mich nur für einen halben Tag gebucht.«
»Wir halten bei Starbucks, und Sie bekommen eine Venti Latte mit Karamell und allem Schnickschnack: Donut, Kuchen, was auch immer Sie möchten.«
»Davon kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen.«
Livia streckte ihm einen Fünfzig-Dollar-Schein hin. »Zum Leichenbeschauer von Coweta County. Bitte, Ramón. Danach kehren wir zum Flughafen zurück. Und Sie haben frei. Versprochen.«
»Na schön, Ma’am.«
6
Comedor Carmen, Barrio La Barra, La Ceiba, Honduras
»Dieser kleine Pummelige von den Mara-Wichsern, wie hieß er noch …?«
»Pippo.«
»Genau. Man hat den Scheißkerl im Hafen gefunden. In zwei Teilen. Sein fetter Wanst lag auf einem Fischerboot, sein Kopf auf der Mole. Und wisst ihr, was? Gordo erzählt rum, die Birne sei ihm abgerissen worden. Ab-ge-riss-en! Keine Machete und kein Messer. Auch nicht mit ’ner Knarre weggepustet. Abgerissen. Puta madre. Wer schafft so was? Jemandem den Kopf abzureißen?«
Unter dem kalten Licht einer Leuchtstoffröhre kreisten Nachtfalter in allen Größen. Auf den Plastiktischdecken klebten Ketchupreste. Eine halb leere Bierkiste stand auf dem Bretterboden, Cumbia-Rap wummerte durch den Gastraum des Schnellrestaurants.
»Macht die scheiß Mucke aus!«, brüllte Concho.
Die Männer an seinem Tisch zuckten zusammen. Eine verängstigte Frau schoss aus der Küche hervor und schaltete die Musik ab. Als es still war, knurrte der Anführer der Barrio-18 wie ein Kampfhund und blickte zornig in die Runde.
Er und drei seiner Leute waren die einzigen Gäste an diesem Abend. Als sie das Lokal betreten hatten, waren mehrere Familien überstürzt aufgebrochen. Unbescholtene Bewohner der Stadt wollten mit den Banden nichts zu tun haben. Vor der Tür hatte Concho zwei seiner Killer postiert, beide mit einer M16 bewaffnet. Eins der Gewehre war zusätzlich mit einem M203-Granatwerfer ausgerüstet.
Concho schlug mit der flachen Hand auf die Plastiktischdecke. »Also, ihr verdammten Hurensöhne, noch mal für eure Spatzenhirne: Die Wichser von der Mara-13 denken, wir hätten einem ihrer Typen die Birne abgerissen. Wir waren es aber nicht …«
»Vielleicht wurde er gehenkt. Mit einem Galgen oder so. Da kann schon mal der Kopf abreißen …«
»Halt die Fresse, du dumme Sau! Hast du schon mal ein Fischerboot mit Galgen gesehen? Und wenn die Mara-13 ihn aufgeknüpft hätte, dann würden die das wohl kaum uns in die Schuhe schieben! Die denken wirklich, dass wir das waren.« Concho, der vom Haaransatz bis zur Oberlippe mit einem bunten Muster tätowiert war, blickte seine Leutnants wütend an. »Die Maras glauben, wir hätten uns mit einem alten Fischerboot genähert. Vom Hafen her. Ein Überraschungscoup. Aber, puta madre, wir waren das nicht.«
Der Jüngste von Conchos Entourage war ein Hagerer mit Pickeln und dem Spitznamen El flaco. Er traute sich, das Wort zu ergreifen. »Tiburón ist außer sich vor Wut. Er lässt überall in der Stadt erzählen, dass er deinen Kopf will. Zehntausend will er zahlen. Dollares. Cash.«
Von der Veranda vor dem Restaurant erklang ein Schrei. Er kam von einem der beiden Aufpasser. Concho und seine Leute rissen gleichzeitig die Köpfe herum. Vor dem Fenster warf sich der sicario hinter einen Tisch und feuerte eine 203-Granate ab. Doch der Schuss war schlecht gezielt. Die Granate prallte an einem Holzpfeiler der Veranda ab, flog quer über die Straße und explodierte in einem gleißenden Blitz. Die Männer im Speiseraum warfen sich auf den Boden. Die Frontscheibe barst, und Glassplitter regneten auf die Tische.
Einige Sekunden lang blieb es ruhig. Concho und seine Männer hoben die Köpfe. Ein runder Gegenstand flog durch das zerbrochene Fenster in den Gastraum, schlug dumpf auf den Holzboden und rollte vor den Augen der Männer unter den Tischen vorbei. Es war der Kopf eines der beiden Wachposten. Fleischfetzen hingen an den Halswirbeln, und die Speiseröhre stand zwei Handbreit heraus. Keine Schnittwunden. Der Kopf war abgerissen worden. Ohne Zweifel.
Concho wurde weiß wie die Wand. Seine Beine zitterten. Der Pickelige erbrach einen Schwall halb verdauter Maisfladen auf die Holzdielen.
Puta madre. Concho sprang auf, stürmte durch die Küche, stieß Töpfe, Geschirr und die verängstigte Köchin beiseite und rammte den Hintereingang mit der Schulter auf. Einige Meter weiter sprang er über einen niedrigen Zaun. Hühner flatterten nach allen Seiten davon. Mein barrio, dachte er, hier kenne ich mich aus. Das gab ihm ein vages Gefühl der Sicherheit. Concho bog nach links ab, rannte durch den Garten von Tío Jorge, trampelte durch ein Salatbeet und sprang wie ein Hürdenläufer über einen Stapel Holzlatten.
Ein Schatten tauchte auf, zwanzig Meter rechts von ihm.
Jesús, der war schneller als Usain Bolt.
Concho griff im vollen Lauf in sein Schulterholster, zog einen Colt hervor, bremste scharf und feuerte das komplette Magazin auf den Schatten ab. Doch auf ein solches Ziel hatte er noch nie geschossen. Der Schatten schien ein Dutzend Arme und Beine zu haben, so geschickt bewegte er sich. Und er sprang schneller von links nach rechts, als Concho seinen Arm schwenken konnte. Keine der Kugeln traf ihr Ziel.
Concho schleuderte den Colt weg, vollführte eine 180-Grad-Wende und trat wie ein Taekwondo-Kämpfer mit der Fußsohle gegen die Hintertür des nächsten Hauses. Sie flog krachend auf. An einer schreienden Familie vorbei stürmte er durch das Haus und die Vordertür auf die Straße. Doch der Schatten tauchte bereits an der nächsten Hausecke auf. Er ist schneller, dachte Concho fluchend. Oder sind es mehrere? Sein Atem klang wie das Schnaufen eines brünftigen Walrosses. Von seinem Verfolger hörte man nicht mal ein Hauchen.
Mit brennenden Lungen rannte Concho an der Vorderfront des Comedor vorbei, aus dem er wenige Minuten zuvor geflohen war. Sein linker Fuß prallte auf ein Hindernis. Er stolperte, verlor das Gleichgewicht und klatschte der Länge nach auf den staubigen Asphalt. Das Hindernis kullerte an ihm vorbei. Es war der Kopf von El flaco, dem Pickligen.
Von Panik getrieben, aus Handballen und Ellenbogen blutend, versuchte Concho, sich so weit aufzurichten, dass er wenigstens krabbelnd vorankam. Seine Finger krallten sich in den brüchigen Straßenbelag, seine Füße schabten über den Boden. Die Knie blutig. Da griff etwas nach seinem Unterschenkel.
Es fühlte sich an wie eine zuschnappende Wildtierfalle. Concho schaffte es nicht mehr, sich umzudrehen. Ein Schatten schlang sich um seinen Hals und drückte zu wie ein Schraubstock.
7
Coroner’s Office, Coweta County, Georgia, USA
Die roten Backsteine des Flachbaus unterschieden sich weithin sichtbar von den unzähligen grauen Lagerhallen an der nördlichen Ausfallstraße von Newnan. Auf einem meterhohen Pfeiler vor dem Gebäude prangte ein Schild: »Coweta County, Coroner’s Office, Steven Sharrett, M. D.«
Livia entschied sich, diesmal ohne Tricks zu arbeiten. Während ihr Fahrer auf einen der Besucherparkplätze vor dem Backsteinhaus einbog, sah sie einen Mann, der einen dunkelgrünen Chevrolet Impala aufsperrte. Er war Ende fünfzig, trug ein Leinensakko, ein offenes Hemd, Jeans und einen beigefarbenen Panamahut. Er war unrasiert und hatte dunkle Ringe unter den Augen. Livia sprang aus dem Lincoln und beeilte sich, den Mann anzusprechen, bevor er sich in das Auto setzte.
»Sir … Sir! Entschuldigen Sie bitte, eine kurze Frage nur. Ich suche Dr. Sharrett!«
Der Mann blickte sie mit müden Augen an. »Ma’am, können Sie auch nur im Entferntesten ahnen, wie viel ich in den letzten achtzehn Stunden zu tun hatte?«
Sein Atem roch nach Kaffee und Fast Food.
»Sie sind Dr. Sharrett? Sir, ich will Sie gewiss nicht lange aufhalten. Versprochen. Mein Name ist Livia Chang, ich bin Reporterin der New York Times.«
Der Gerichtsmediziner zog seine Augenbrauen zusammen und starrte Livia einige Sekunden lang an. Sie konnte seinen Gesichtsausdruck nicht recht deuten. Sie hielt alles für möglich, auch einen Wutausbruch. Vielleicht verständlich, dachte sie, wenn man gerade achtzehn Stunden lang sterbliche Überreste einer Flugzeugkatastrophe zu begutachten hatte.
»Mein Sohn studiert Physik in Stanford …«, sagte Dr. Sharrett.
Livia war verwirrt. Warum erzählte er das?
»Er hat mir im vergangenen Jahr diese Geschichte aus dem New York Times Magazine über den verschollenen italienischen Physiker geschickt. Wie hieß er noch?«
Livia wurde klar, worauf der Mann hinauswollte. Er hatte ihre preisgekrönte Reportage gelesen. »Ettore Majorana.«
»Genau. Absolut faszinierend. Nachdem ich die Story in dem Magazin gelesen hatte, habe ich mir Ihr Buch gekauft. Peacock irgendwas. Das ist von Ihnen, oder? Tolle Story.«
»Ja. Peacock House. Danke, das freut mich sehr.«
»Also, Ms. Chang, worum geht es?«
»Es gibt einen Körperteil von der Absturzstelle. Einen einzelnen Arm. Wenn es irgendwie geht, müsste ich ihn sehen. Nur kurz.«
»Ms. Chang, Sie werden verstehen, dass wir mit sterblichen Überresten respektvoll umgehen. Wir stellen keine Leichenteile zur Schau. Auch nicht vor Journalisten. Abgesehen davon, platzen wir im Moment vor Einzelstücken. Ich habe alles da, Füße, Hände, Arme, auch einzelne Zehen, Haarbüschel …«
Livia schluckte. »Der Arm, den ich suche, weist eine Besonderheit auf.«
»Welche?«
»Die Feuerwehr hat die Finger mit einer Zange abgekniffen.«
Das Gesicht des Coroners hellte sich auf. »Ah, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ich hatte mich nämlich gefragt, warum das gemacht wurde …«
»Wie wäre es mit einem Deal? Ich sage Ihnen, warum die Finger abgeklemmt wurden, dafür darf ich den Arm kurz sehen …«
Der Coroner überlegte. »Na gut, aber nur diesen einen Arm. Und wir halten es kurz, Ms. Chang.«
»Einverstanden, Doktor. Danach werde ich nie hier gewesen sein.«
»Folgen Sie mir.«
Der Arzt steckte seinen Autoschlüssel in die Sakkotasche und führte sie in den Eingangsbereich des Backsteingebäudes, wo zwei Schwestern hinter einer Empfangstheke auf Computern herumtippten. Dr. Sharrett griff in einen Blechschrank und warf Livia einen Kittel, einen Mundschutz und Latexhandschuhe zu. Sie zog die Sachen an und folgte ihm durch einen Flur und eine mit Codeschloss gesicherte Schiebetür in einen gekühlten Raum mit hellgrünem Kachelboden. In dessen Mitte waren drei Metalltische festgeschraubt. Fenster gab es keine. Abflüsse am Boden ließen darauf schließen, dass hier jede Menge Flüssigkeiten entsorgt wurden.
An der Stirnwand waren mehrere große Waschbecken angebracht. Die längere Seite des Raums bestand aus edelstahlverkleideten Türen mit dicken Handgriffen. Der Leichenbeschauer öffnete eine davon und zog eine Metallwanne heraus. Darauf lag ein männlicher Arm, blutleer und bleich. Die mit einer Zange abgekniffenen Finger lagen daneben.
Livia unterdrückte einen Anfall von Übelkeit und näherte sich. »Haben Sie irgendeine Ahnung, wer diesen Arm vermisst, Dr. Sharrett?«
»Nein, wir haben dieses Fundstück noch nicht mit anderen Leichenteilen in Verbindung gebracht. Aber wir gehen nicht davon aus, dass der Besitzer noch lebt.«
Livia stellte sich direkt vor die Wanne und musterte das Körperteil. Die Behaarung des Unterarms war deutlich zu sehen. Der Knorpel des Oberarmknochens stand hervor, ebenso wie das blanke Muskelfleisch des Trizeps und das blutige Ende einer abgerissenen Schlagader. Unvermittelt richtete sie sich auf und deutete in eine entfernte Ecke des Raums.
»Und was ist dort?«
Der Leichenbeschauer blickte reflexartig in die angedeutete Richtung. In diesem Moment rammte Livia ihren Daumennagel in das abgerissene Ende des toten Arms und zupfte einen Hautfetzen ab. Als der Coroner sich wieder zu ihr umdrehte, ratlos, weil er nicht wusste, worauf Livia gezeigt hatte, wandte sie sich bereits von der Wanne ab und ging einige Schritte in Richtung Ausgang.
»Ich glaube, mir ist übel.«
»Verstehe. Ich begleite Sie nach draußen.«
Das mit der Übelkeit war nicht mal gelogen. Sie kämpfte gegen den Geschmack von Magensäure in ihrem Rachen. Das abgerissene Stück Haut hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger fest, krempelte den Handschuh um und zog ihn von ihrer Hand. Das Latexbündel mit dem Hautfetzen schob sie unauffällig in die Tasche ihres Blazers. Die Maske und den anderen Handschuh warf sie in einen Mülleimer.
»Tausend Dank, Dr. Sharrett, ich brauche nur etwas frische Luft und werde nicht weiter Ihre wertvolle Zeit stehlen. Ich wünsche viel Erfolg bei den Untersuchungen. Meinen Verlag werde ich bitten, Ihnen eine signierte Ausgabe meines Buches zuzusenden.«
»Das wäre sehr nett. Vielen Dank, Ms. Chang. Aber Sie wollten noch das Rätsel der abgekniffenen Finger lüften.«
Livia berichtete dem Arzt von Maria Jiménez und dem festgeklammerten Arm. Dr. Sharrett zog ein zutiefst erstauntes Gesicht und schüttelte mehrmals den Kopf. Sie hängte den geliehenen Kittel wieder in einen Blechschrank, verabschiedete sich freundlich und verließ das Backsteingebäude. Vor der Tür winkte sie ihrem Fahrer zu.
»Feierabend, Ramón! Wir fahren zurück nach Atlanta.«
8
Calle 5, Barrio La Barra, La Ceiba, Honduras
Der Schatten hauchte seine Worte in Conchos Ohr. Er sprach Englisch mit starkem Akzent. »Wo hebt ihr euer Geld auf?«
Concho musste seine Worte aus dem Rachen würgen. »Was für Geld?«
»Noch so eine Antwort, und dir passiert das Gleiche wie den anderen.«
»Bitte …«
»Das Geld. Wo ist euer Geld?«
»Wir haben etwas in der Casita Marmita.«
»Bring mich hin.« Der Schatten riss Concho vom Asphalt hoch auf die Beine. »Wo ist deine Karre?«
Concho deutete auf einen Plymouth GTX mit Breitreifen und orangegelber Flammenmuster-Lackierung. Eine Ikone der Siebziger.
»Du fährst, ich sitze hinter dir.«
Concho nickte. Gemeinsam gingen sie zum Wagen. Als der Schatten Concho losließ, damit sie einsteigen konnten, traute der Gangster sich nicht, seinen Blick zu wenden.