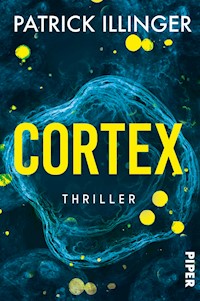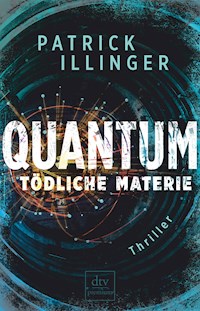
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Sprache: Deutsch
Ein Actionfeuerwerk der Extraklasse Eben noch sitzt der Physiker Nicola Caneddu beim Feierabendbier – im nächsten Moment findet er sich in den Händen brutaler Kidnapper wieder, die Informationen zu einem geheimen Tunnel am CERN aus ihm herauspressen wollen. Nicola entkommt und recherchiert zunächst auf eigene Faust – dann im Auftrag des amerikanischen Präsidenten. Und tatsächlich deckt er eine Verschwörung um eine Superwaffe auf, die ungeheure Dimensionen annimmt. Als Agent wider Willen landet Nicola in einem Szenario, das er bis dato nur aus Actionfilmen kannte. Doch sein immenses Wissen in der Elementarteilchenforschung macht ihn zum wertvollen Verbündeten in einem Kampf, der die ganze Welt verändern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Eben noch sitzt der italienische Physiker Nicola Caneddu mit Kollegen beim Feierabendbier in einem idyllischen Münchner Biergarten – im nächsten Moment findet er sich in den Händen brutaler Kidnapper wieder. Nach einem Kampf ums Überleben gelingt es Caneddu in letzter Sekunde, seinem Schicksal zu entkommen, und er beginnt zu recherchieren. Zunächst auf eigene Faust – dann im Auftrag des amerikanischen Präsidenten, denn sein immenses Wissen in der Elementarteilchenforschung macht ihn zum wertvollen Verbündeten der Großmacht. Und tatsächlich deckt er mithilfe des Ex-Elitesoldaten Kenton Williams und der furcht losen amerikanischen Journalistin Livia Chang eine Verschwörung um eine Waffe auf, die alle bisherigen Gesetze der westlichen Demokratie außer Kraft zu setzen droht. Dass Livia, die nicht nur ein Geheimnis zu haben scheint, ihn zusehends fas ziniert, macht es nicht gerade leichter für Caneddu, seinen Auftrag zu erfüllen ...
PROLOG
RESTAURANT ›MOTI MAHAL‹
MADURAI, SÜDINDIEN
April 1968
Rachman, immer wieder dieser Rachman. Gleich würde sie seine schlurfenden Schritte auf der steinernen Kellertreppe hören. Sicherlich hatte er wieder seine Rute dabei. Er würde sie bedrohlich über ihrem Kopf schwingen oder, je nach Laune, auf ihren Rücken schlagen. Er tat das nie so heftig, dass Verletzungen blieben, zumindest keine sichtbaren. Aber nach zwei Jahren in diesem Keller, nach zwei Jahren unter Rachmans Herrschaft hatte Lakshmi ihre Lebenslust nahezu verloren.
Seit drei Stunden meißelte sie nun kleine Stücke Kohle aus großen, unförmigen Briketts heraus. 128 Splitter waren es bis jetzt, eine besondere Marke, fand sie. Was für eine elegante Zahl. Man konnte daraus zwei gleich große Haufen machen. Und diese Haufen wieder in zwei gleich große Haufen teilen. Und wieder. Und wieder. Acht Mal. Sie liebte sie, diese runden »weichen« Zahlen, wie sie sie nannte. Lakshmi wusste, dass die Erwachsenen Zahlen bevorzugten, die sich durch zehn teilen ließen, so wie die Fünfzig. Oder die Hundert, vor der sie geradezu Ehrfurcht zu haben schienen. Das konnte sie nicht verstehen. Was konnte man schon mit der Hundert anfangen? In zwei Teile teilen, dann noch mal, und dann musste man schon fünf Haufen machen, um gleich große Mengen zu bilden. War die 128 nicht viel, viel edler? Und erst die Vierundsechzig. Oder die Neunundvierzig. Wieso gab es in der Welt der Erwachsenen Geldscheine im Wert von fünfzig Rupien und nicht von neunundvierzig? Neunundvierzig Kohlestücke konnte man in einem perfekten Quadrat anordnen, mit je sieben Stücken an einer Kante. Was nur liebten die Erwachsenen an der Fünfzig, aus der man keine symmetrischen Figuren legen konnte und die sich nur ungelenk in Haufen teilen ließ?
Ähnlich faszinierend, wenngleich auf bizarre Weise kantig, fand Lakshmi die »harten« Zahlen. Jene, die man gar nicht in gleich großen Haufen anordnen konnte. Drei, fünf oder sieben Kohlestücke konnte man schlecht aufteilen. Je mehr Kohlestücke zusammenkamen, desto seltener wurden allerdings diese unteilbaren harten Zahlen.
Als sie gerade mit ihren zarten, bis zu den Ellenbogen staubschwarzen Händen in der Kohle wühlte, trat Rachman in den Kellerraum.
Immer wieder dieser Rachman.
Er schlug ihr mit seiner Ledergerte auf den Rücken.
»Träumst du schon wieder, du kleiner Nichtsnutz? Arbeiten sollst du, miese Heuschrecke! Weshalb haben wir dem Waisenhaus tausend Rupien bezahlt? Dafür, dass du träumst? Was geht bloß in dir vor? Bis um sechs Uhr, wenn die ersten Gäste eintreffen, will ich beide Säcke voller Kohlestücke sehen. Beide. Und kein Stück darf größer als mein Daumennagel sein. Hast du das verstanden?!«
Lakshmi nickte unterwürfig und versuchte, Rachman nicht mit ihrem Blick zu provozieren.
»Außerdem brauchen wir dich heute Abend oben im Gastraum. Es ist Feiertag. Wir erwarten mehr Rummel als sonst. Du musst fegen und Tische abräumen.«
Lakshmi nickte erneut.
Seit man sie vor drei Jahren aus dem Waisenhaus in dieses Restaurant gebracht hatte, musste sie im Keller die Kohle schlagen, mit der die Grillöfen für die Dosa-Fladen und der Herd für die Currytöpfe angeheizt wurden. Ein gut gehendes Restaurant wie das ›Moti Mahal‹ im Herzen von Madurai konnte Dutzende Menschen wie sie mit Arbeit versorgen, was natürlich auch daran lag, dass Arbeit in ihrem Land so gut wie nichts kostete. Man fand für jede noch so niedrige Tätigkeit jemanden, der sie ausführte. Einer von Lakshmis Zimmergenossen, ein vielleicht zehnjähriger Junge, hatte die Aufgabe, Papierservietten einzusammeln, welche die Gäste nach dem Besuch des Lokals in die Straßengräben der Umgebung warfen. Na, da hacke ich lieber Kohle, dachte Lakshmi.
Ein Onkel zweiten Grades hatte sich ihrer vor drei Jahren erbarmt und sie aus dem Waisenhaus geholt. Er ließ sie in seinem Restaurant, dem ›Moti Mahal‹, arbeiten. Sie bekam dort jeden Tag zu essen und ein anständiges Bett in einem kleinen Zimmer, das sie sich mit vier weiteren Kindern teilte. Aber sie musste hart dafür arbeiten. In die Schule zu gehen, kam nicht infrage, sie war ein Mädchen. Ihr Onkel war an sich kein schlechter Mensch, doch für die Überwachung der Tätigkeiten im Keller – das Kohleschlagen, die Vorratshaltung und das Flicken von Kesseln – war Rachman zuständig. Und Rachman war alles andere als ein guter Mensch.
Seit drei Jahren schlug Lakshmi bereits Kohle für Rachman. Und seit drei Jahren schlug Rachman auf sie ein. Sie spürte, wie der Druck und die andauernde Bedrohung sie abstumpfen ließen. Sie konnte Rachman nichts recht machen, und so flüchtete Lakshmi sich immer tiefer in ihre Welt aus Zahlen und Formen. Sie reihte manchmal Kohlestücke in Vierecken auf. Dabei entdeckte sie, dass nicht alle weichen Zahlen sich als Quadrate anordnen ließen. Die Vierundsechzig ja, die 128 aber nicht. Und sie entdeckte, dass jede größere quadratische Zahl, die sie Tischzahlen nannte, weil sie wie die Tische im Gastraum eben quadratisch waren, sich aus zwei kleineren Tischzahlen addieren ließ.
Früh am Morgen, wenn Rachman noch schlief und die Dosa-Öfen abgekühlt waren, schlich Lakshmi manchmal durch das Restaurant, penibel darauf bedacht, die Arbeiter nicht zu stören, die das Geschirr wuschen und den Boden fegten. Dann hob sie einige der länglichen Zettel auf, die mit dem übrigen Dreck in einer Ecke zusammengekehrt waren. Sie entdeckte darauf Symbole, die stetig wiederkehrten. Zehn verschiedene Symbole, so viele wie sie Finger hatte. Sie brauchte nicht lange, um in den Symbolen verschieden große Haufen von Kohle zu erkennen. Und mehrere der Symbole in einer Reihe geschrieben konnten gewaltigen Haufen entsprechen. Sie begann zu verstehen, dass das Symbol »0«, welches eigentlich nichts bedeutete, also einen leeren Kohlesack, plötzlich einen Haufen Kohle bedeutete, wenn eine »1« davor geschrieben stand. Sie nannte es das Zehnfingerzählen. Und sie begann, die Zettel aus dem Restaurant nachzurechnen. Dabei fiel ihr auf, dass viele dieser Zettel Fehler enthielten. Es wurden unterhalb eines breiten Strichs oft größere Zahlen ausgewiesen, als es der Summe der darüber aufgeschriebenen Zahlen entsprach.
An diesem Tag war Vishu, ein hoher südindischer Feiertag, und das Restaurant war brechend voll. Familien in traditionellen Festtagsgewändern bevölkerten die Tische, die Männer in langen, um die Beine geschlagenen Tüchern, die Frauen in leuchtend bunten Saris. Die Gespräche, das Klappern der Metallbecher, die Rufe aus der Küche hallten durch den Gastraum.
Wie Rachman angewiesen hatte, half Lakshmi an diesem Tag oben mit. Der Boden musste unablässig gefegt werden, und die als Gedeck dienenden Bananenblätter mussten ausgetauscht werden, sobald Gäste ihr Mahl beendet hatten und Platz für die nächsten Hungrigen machten.
An einem der Ecktische bemerkte Lakshmi einen älteren Herrn. Er trug altmodische ausländische Kleidung, eine dunkle Hose, ein weißes Hemd mit hohem Kragen und eine abgewetzte schwarze Jacke, aus deren Tasche eine Kette hing. Ein grauer Vollbart umrahmte seinen fülligen Mund. Sein Haar war ebenfalls grau und ungekämmt. Eine silberne Nickelbrille klemmte auf seiner Nase, durch die zwei aufgeweckte freundliche Augen den Gastraum musterten. Als der Mann sich zum Gehen erhob, näherte sich Lakshmi und begann, seinen Tisch abzuräumen. Dabei bekam sie seinen achtlos liegen gelassenen Zahlenzettel in die Finger. Sie warf verstohlen einen Blick darauf und brauchte nur Sekunden, um zu merken, dass wieder einmal etwas nicht stimmte. Die ausgewiesene Summe war eine harte Zahl, aber das konnte nicht sein. Es musste eine weiche Zahl sein. Was hier stand, war falsch, und sie schüttelte den Kopf.
»Na, was hast du denn entdeckt?«
Die tiefe Stimme ließ Lakshmi zusammenzucken. Der ältere Herr war zurück an den Tisch gekommen, weil er seinen Hut vergessen hatte. Dabei hatte er Lakshmis Verwunderung bemerkt. Sie sah ihn verunsichert an. Da ergriff der Mann die zerknitterte Rechnung und überflog sie mit seinen wachen Augen. Er nickte und sah Lakshmi mit neugierigem Blick an.
»Erstaunlich«, murmelte er. »Sehr erstaunlich.«
Lakshmi zuckte ängstlich mit den Schultern. Der Mann zog einen Stift aus seiner Jackentasche, kritzelte etwas auf die Rückseite des zerknitterten Zettels und zeigte es Lakshmi. Es war die Zahl 169.
»Das ist eine Tischzahl«, sagte Lakshmi, ohne zu zögern.
»Was meinst du damit?«, fragte der Mann, woraufhin Lakshmi mit ihrem Zeigefinger die Kanten des quadratischen Tisches abfuhr, an dem der Ausländer gegessen hatte. Der Fremde nickte wissend.
»Und kannst du mir die Zahl sagen, die für diese Kante steht?«, fragte er sie.
Sie nahm den Stift und kritzelte eine »13« auf den Zettel. Die Augen des Mannes weiteten sich. Er betrachtete Lakshmi mit wachsendem Staunen.
»Wie alt bist du?«, fragte er.
»Eine Kistenzahl«, sagte Lakshmi. Sie lächelte vorsichtig.
Der alte Mann malte mit dem Zeigefinger die Form eines Würfels in die Luft.
»Meinst du das mit einer Kistenzahl?«, fragte er. »Einen Würfel?«
Das Mädchen nickte.
»Und eine Kante sind zwei Jahre?«, fragte der Alte.
Lakshmi nickte wieder.
»Dann bist du also zwei im Kubik, also zwei mal zwei mal zwei, macht acht?«, fragte der Mann mit erwartungsvollem Blick.
»Stimmt genau. Liebst du auch Zahlen? Darf ich dir noch ein Rätsel aufgeben?« Langsam verlor Lakshmi ihre Scheu.
»Vielleicht später. Wie heißt du? Und wer ist dein Vormund?«
Lakshmi nannte ihren Namen und deutete mit dem Finger in Richtung ihres Onkels, der in einer Ecke des Gastraums mit dem Chefkoch redete.
»Bitte gedulde dich einen Moment, ich will mit deinem Vormund sprechen.«
Doch bevor der Mann sich abwandte, schrieb er noch eine Zahl auf den Zettel und zeigte sie Lakshmi. Es war die 1233.
»Ui, das sind zwei Tischzahlen, zusammen in einen Sack gesteckt«, sagte sie.
»Die Summe aus zwei Quadratzahlen«, nickte der alte Mann. »Stimmt. Und wie lang sind die Kanten der beiden Quadr…«
»Zwölf und dreiunddreißig«, sagte Lakshmi bevor er den Satz beendet hatte.
Der alte Mann schüttelte staunend den Kopf. Lakshmi sah ihm hinterher, als er zu ihrem Onkel ging und diesen beiseitenahm. Gelegentlich deutete er in ihre Richtung, und ihr Onkel schaute verunsichert. Nach einer Weile rief man Rachman hinzu. Dieser sprach so laut, dass Lakshmi, scheinbar konzentriert den Boden fegend, jedes Wort verstand.
»Sie ist sowieso nutzlos«, tönte Rachman, »gebt mir einen Jungen für das Kohleknacken, diese Heuschrecke träumt den ganzen Tag vor sich hin. Sie macht ständig Haufen aus Kohlestücken und schiebt die Splitter am Boden herum, kreuz und quer, statt sie in den Sack zu stecken. Was soll ich mit ihr? Ich wäre froh, wenn wir sie los sind.«
Lakshmi fegte weiter zwischen den Tischen und beobachtete, wie der alte Mann, mittlerweile wieder an einem der Tische sitzend, mit ihrem Onkel verhandelte. Ihr Onkel nickte viel, und der andere machte ausladende Gesten. Am Ende rief man Lakshmi an den Tisch.
»Lakshmi«, sagte ihr Onkel in einem fast feierlichen Ton, »dieser gütige Sahib meint, du seist auf besondere Weise begabt. Ich kenne den Mann seit vielen Jahren als ehrenwerten Gast unseres Hauses. Er schlägt nachdrücklich vor, dass du Schulbildung erfährst. Wie du weißt, sehe ich keinen Sinn darin, Mädchen zur Schule zu schicken. Aber dieser Mann, der vor vielen Jahren aus dem fernen Italien zu uns gekommen ist, besteht darauf. Er will dich in der ersten Zeit persönlich unterrichten. Mir soll es recht sein. Du wirst daher fortan in seinem Haus wohnen. Er hat eine Villa nicht weit vom Blumenmarkt mit mehreren Angestellten. Ich glaube, du wirst dich wohlfühlen. Es ist ein Privileg.«
Lakshmi nickte unterwürfig. Innerlich jubelte sie bei dem Gedanken, von Rachman loszukommen.
»Wie soll ich Sie ansprechen?«, fragte sie den alten Mann, während sie scheu auf den Boden blickte.
»Etto. Du darfst mich Onkel Etto nennen.«
TEIL I
BIERGARTEN AM WIENER PLATZ
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
23. Juli, Gegenwart
Nicola Caneddu hatte nicht ahnen können, welchen Verlauf der Abend nehmen würde. Hätte er es geahnt, wäre er niemals zu den Toiletten gegangen.
Nicht zu diesen.
Dann hätte er einfach die stinkende Baracke am Rande des Biergartens aufgesucht, in der Horden angetrunkener Besucher an eine Metallwand pinkelten und literweise Urin über eine mit Duftsteinen gefüllte Rinne ablief.
Aber die übel riechende Baracke widerte ihn an, und Caneddu beschloss, sich auf die Suche nach gepflegteren Waschräumen zu machen. Ein grässlicher Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellte.
Dabei hatte alles so friedlich, ja geradezu ausgelassen begonnen. Ein schwülwarmer Juliabend lockte Massen fröhlicher und durstiger Menschen in den Biergarten in der Münchner Innenstadt. Im vorderen Teil des Gartens standen mit blau-weiß karierten Tischdecken eingedeckte Tische, an denen die Gäste bedient wurden. Weiter hinten erstreckten sich Dutzende Reihen schlichter zweckmäßiger Bierbankgarnituren unter Kastanienbäumen. Gemäß einer alten Münchner Tradition durften Gäste in diesem Teil des Gartens ihr eigenes Essen mitbringen, sofern sie Getränke am Ausschank kauften.
In dem Gedränge suchten Nicola Caneddu und seine Kollegen einen freien Tisch. Nach einem anstrengenden Konferenztag freuten sie sich darauf, den Feierabend mit kühlem Münchner Bier zu begießen. Drei Tage lang hatten die Wissenschaftler mit achthundert weiteren international anerkannten Experten für Elementarteilchenphysik in den Auditorien und Seminarräumen des Deutschen Museums ihre neuesten Erkenntnisse ausgetauscht. Die Konferenz mit dem Titel PANUC – eine Abkürzung aus »particles« und »nuclei« – war unter Elementarteilchenphysikern einer der Höhepunkte des Jahres.
Caneddu war erleichtert, seinen Vortrag hinter sich gebracht zu haben. Auch wenn er sein Thema beherrschte und bereits Dutzende Vorträge darüber gehalten hatte, war er immer noch angespannt, sobald seine Zuhörerschaft eine kritische Masse überschritt. Ihm war völlig klar, dass es unberechtigte Ängste waren, die da an ihm nagten.
Dazu gehörte die absurde Sorge, jemand könnte aufspringen und ihn als Sohn eines Schafhirten entlarven. Ja, das war er. Der Sohn eines Schafhirten, eines pastore aus Sardinien. Aber heute war er Physikprofessor und wissenschaftlicher Leiter des weltweit bekannten Teilchenforschungslabors unter dem Gran-Sasso-Gebirge in Mittelitalien.
Sicher, der Verlauf seiner Karriere glich einem kleinen Wunder. Nachdem Nicolas Rechenbegabung in der Grundschule aufgefallen war, hatte ihn der Bürgermeister seines in den Hügeln Sardiniens gelegenen Heimatdorfs Ittiri gefördert. Der Ortsvorsteher hatte einen Vetter in der Verwaltung der Universität der Provinzhauptstadt Sassari, was genügte, um den jungen Caneddu in einen concorso einzuschleusen. In diesen Wettbewerben konnten junge Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihren finanziellen Möglichkeiten ihre Fähigkeiten zeigen. Die Tests lieferten tatsächlich recht objektive Ergebnisse, was aber nicht immer dazu führte, dass die Begabtesten die besten Studienplätze bekamen. Dafür spielten in Italien persönliche Beziehungen eine zu übermächtige Rolle. In Caneddus Fall war die herausragende Punktezahl allerdings nicht mehr zu ignorieren, und so bekam der junge Sarde mit nur siebzehn Jahren einen Studienplatz an der Universität von Sassari. Von dort wurde er zwei Jahre später an die ›Scuola Normale Superiore‹ in Pisa vermittelt, eine Eliteuniversität. Nach einigen Jahren als Jungwissenschaftler am Elementarteilchenforschungszentrum CERN bei Genf berief ihn die Universität von Triest auf einen Lehrstuhl, und Caneddu wurde Chefwissenschaftler des unterirdischen Forschungslabors im mittelitalienischen Gran-Sasso-Gebirge. Unter zweitausend Metern Granitfels, abgeschirmt von der störenden Teilchenstrahlung des Weltraums, leitete er dort hochempfindliche Experimente mit Elementarteilchen.
Doch als er an diesem Vormittag das Mikrofon umgeschnallt hatte, um seinen Vortrag zu beginnen, war es plötzlich wieder da gewesen, dieses schale Gefühl. Das Gefühl, im Grunde nicht hierherzugehören. Im Grunde nur ein Schafhirte zu sein. So wie sein Vater. Und seine Großväter. Er war inzwischen routiniert genug, sich seine Verunsicherung nicht anmerken zu lassen. Aber heute hatte ihn noch etwas anderes aus der Spur gebracht.
Pasqualina saß im Auditorium.
Noch bevor er seine Zuhörer begrüßte, starrte er einige quälend lange Sekunden in die vorletzte Reihe des Hörsaals. Zu Pasqualina. Es entstand Unruhe. Mehrere seiner Kollegen wandten ihre Köpfe nach hinten, um zu sehen, was Professor Caneddus Aufmerksamkeit auf sich zog. Irgendwann schloss Caneddu kurz die Augen, schüttelte den Kopf und begann mit seinem Vortrag. Die Frau mit dem haselnussbraunen Haar in der hinteren Reihe war natürlich nicht Pasqualina. Aber, Himmelherrgott, sie sah ihr verblüffend ähnlich.
Die echte Pasqualina lebte in Moskau. Sie war Kulturattaché der italienischen Botschaft und seit einigen Monaten in einer Beziehung mit Oleg, einem Cellisten. Deren gemeinsame Ausflüge und Restaurantbesuche postete sie ausgiebig auf Instagram. Manchmal schickte sie sogar Bilder per WhatsApp direkt an Nicola, als sei er nun eine Art guter Freund für sie. Er fühlte sich aber nicht wie ihr guter Freund. Jedes dieser Bilder stach ihn ins Herz. Genauso wie die Frau in der vorletzten Reihe. Und jede andere Frau, die Pasqualina auch nur entfernt ähnlich sah.
Ihre Ehe war vor zwei Jahren in die Brüche gegangen. Ach was, zerbrochen, das war das falsche Wort. Die Beziehung war sublimiert. Sie hatte sich verflüchtigt wie ein Festkörper, dessen Atome zu einem Gas verdampften, ohne je einen erkennbaren Schmelzpunkt zu durchlaufen. Caneddu begriff immer noch nicht, wie das hatte passieren können. Sicher, er hatte damals verdammt viel Zeit mit seinem Forschungsexperiment verbracht, und Pasqualina war auf ihren ersten Auslandsposten entsandt worden. Ausgerechnet Singapur. Unendlich weit weg. Aber musste eine gute Ehe so etwas nicht aushalten?
In seinem Labor, zweitausend Meter unter dem Granit der Apenninen, hatte er keinen Mobilfunkempfang. Und er verbrachte oft mehrere Tage hintereinander im Untergrund. Als Pasqualina ihn einmal über der Erde am Handy erwischte, wurde ihm klar, dass sie sich seit mehr als zwei Wochen nicht gesprochen hatten. Ob Nicolas Assistentin ihre Bitten um einen Rückruf nicht ausgerichtet habe, wollte sie wissen.
Nein, hatte sie nicht. Er verneinte es guten Gewissens. Aber Pasqualina glaubte ihm nicht. Als er Brunella Scasa, seine Assistentin, zur Rede stellte, behauptete sie erst, die Anrufe habe es nicht gegeben. Dann fiel ihr ein, ach ja, einen Anruf vergessen zu haben. Aber welche Assistentin vergisst, dass die Frau des Chefs angerufen hat? Caneddu brauchte eine Weile, bis er sich die Antwort eingestand. Eine Assistentin natürlich, die selbst ein Auge auf ihren Chef geworfen hatte.
Fortan war es mühsam. Er wollte Brunella nicht für ihre Gefühle bestrafen. Sie zu entlassen, weil sie in ihm mehr als nur ihren Chef sah, kam für ihn nicht infrage. Also versuchte er, den Kontakt mit ihr auf ein Minimum zu reduzieren. Er erledigte fortan viele Schreibarbeiten selbst. Wenn er Brunella etwas Dienstliches aufzutragen hatte, schickte er oft eine Mail, statt sie anzurufen. Eigentlich kein Zustand.
Je mehr er über ihre Beziehung nachdachte, umso mehr vermisste er Pasqualina. Aber zu allem Unglück konnte er damals, als die Beziehung ins Wanken geriet, sein Experiment unmöglich verlassen. Die Doktoranden und Jungwissenschaftler waren zwar fleißig und engagiert. Aber die Teilchenstrahlen, die ihnen das Forschungszentrum CERN quer durch die Erdkruste bis nach Italien schickte, waren extrem kostbar. Undenkbar, dass die Leute am CERN zu hören bekamen, dass Professor Caneddu im Untergrundlabor von Gran Sasso nicht persönlich anwesend war, während sie für Zehntausende Euro pro Stunde Neutrinos quer durch die Erde schossen. Caneddu bemühte sich, möglichst viel mit Pasqualina zu telefonieren, aber er spürte, wie die Beziehung zunehmend erkaltete. Er flog nicht nach Singapur, und Pasqualina meldete sich kaum mehr. Irgendwann war sie unangekündigt aufgetaucht, in einem Mietwagen aus Rom. Sie hatten die ganze Nacht geredet. Am Morgen waren sie kein Paar mehr gewesen.
Und heute saß Pasqualina im Auditorium.
Eine wildfremde Frau mit schmalem Gesicht und haselnussbraunem Haar reichte aus, um Caneddu gehörig aus der Bahn zu werfen. Da half auch sein ganzer Selbstschutz nichts, die Barrieren, die er zwischen sich und den Widrigkeiten der Welt zu erschaffen versuchte. Die teuren Anzüge, die er seit dem Ende seiner Beziehung trug. Die Sorgfalt, mit der er seine Nägel maniküren ließ. Das gewellte Haar, das er nun etwas länger trug und jeden Morgen in Form brachte. Der knallrote Alfa, den er angeschafft hatte.
Die makellose Welt, in der Caneddu seit dem Ende seiner Ehe Halt suchte, war natürlich nur eine Schimäre. In Wahrheit lief in seinem Leben vieles aus dem Ruder. Einmal meldete sich sogar der Hausmeister seiner Wohnung in Triest, weil Nachbarn die Feuerwehr hatten rufen müssen. Caneddu hatte einige Wochen zuvor einen Lammbraten im Ofen stehen lassen, roh. Das Ding war schlicht und einfach verwest und hatte mit seinem Gestank das ganze Treppenhaus verpestet. Und, mein Gott, schließlich hatte er doch zweimal mit Brunella geschlafen, bevor er sie bat, eine andere Anstellung zu suchen.
Caneddu durchschaute das Selbstbedienungssystem des Biergartens und besorgte mehrere Brezeln sowie frisch gezapftes Bier, abgefüllt in die ortsüblichen Literkrüge.
Hier, im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt, war leicht zu erkennen, dass die Physikergruppe nicht aus Einheimischen bestand. Zwei von ihnen waren asiatischer Abstammung, eine Professorin aus Princeton war Afroamerikanerin mit ausladender Lockenpracht. Wer nicht mit Englisch aufgewachsen war, sprach ein flüssiges, in der jeweiligen Muttersprache gefärbtes Englisch. Während manche seiner Kollegen die farbige Plastiktasche mit dem Logo der Konferenz dabeihatten und einige sogar ihr Namensschild an einem Band um den Hals hängen ließen, trug Nicola Caneddu an diesem lauen Sommerabend einen taubenblauen Anzug von Etro, dazu rotbraune Slipper aus feinstem Kalbsleder und ein dezent gemustertes Seidenhemd. In dieser Hinsicht unterschied er sich deutlich von seinen Kollegen.
Doch im lebhaften Treiben des Biergartens interessierte sich dafür niemand. Zwischen Hipstern, Studenten, Geschäftsleuten und Einheimischen in traditioneller Tracht hätten Caneddu und seine Kollegen auch mit Augenklappen und Holzbeinen keine Aufmerksamkeit erregt. Und wer doch einen Blick auf das Grüppchen warf, ahnte sofort, um welche Art Menschen es sich handelte: vergeistigte, redselige Akademiker.
Eng zusammengerückt an einem der Holztische, entspann sich unter den Physikern eine lebhafte Unterhaltung. Sie begann mit beruflichen Themen: neue, noch unveröffentlichte Daten eines Elementarteilchendetektors im Eis der Antarktis, die Schwierigkeiten bei der Finanzierung eines Elektronenbeschleunigers in Russland. Mit der zweiten Runde Bier verlor der Gesprächsstoff an fachlichem Gehalt. Man ging über zu Anekdoten von früheren Konferenzen. Da war die allseits beliebte Geschichte über einen bornierten französischen Kollegen, der sich bei einem Symposium in Shanghai verlaufen hatte und ohne Chinesischkenntnisse die Nacht in einer schäbigen Polizeistation verbringen musste. Ein Dauerbrenner war auch die Anekdote von einem britischen Professor, dessen Ausführungen über Quantenchromodynamik wenig Beachtung fanden, weil das Auditorium von seinem offenen Hosenschlitz abgelenkt war. Als er sein zweites Bier zur Hälfte ausgetrunken hatte, merkte Caneddu, dass ihm ein klassischer Anfängerfehler unterlaufen war. Mit leerem Magen hatte er eineinhalb Maßkrüge in weniger als vierzig Minuten geleert. Der Umgang mit Alkohol war dem drahtigen Sarden zwar keineswegs fremd, doch der lange Konferenztag, das warme Wetter und das eilig gegen den Durst getrunkene Bier forderten ihren Tribut: Caneddu war nicht nur angetrunken, er musste auch dringend aufs Klo.
Er entschuldigte sich und machte sich auf den Weg zu den Toiletten. Im Inneren der Gaststätte, zu der der Biergarten gehörte, gelangte er über ein geräumiges steinernes Treppenhaus ins Kellergeschoss, wo er großzügige und blitzblank geputzte Toilettenräume vorfand.
Während er sich an einem Urinal daranmachte, die zuvor genossene Biermenge wieder loszuwerden, stellte sich ein groß gewachsener dunkelhaariger Mann neben ihn, augenscheinlich mit demselben Bedürfnis. Doch als Caneddu seinen Reißverschluss gerade wieder zuziehen wollte, spürte er einen heftigen Stich am Gesäß. Er schrie kurz auf, dann versagte seine Stimme. Ein Kribbeln breitete sich in seinem Körper aus, als fließe heißes Frittierfett durch seine Adern. Die rechtwinkligen Kacheln an den Wänden verzogen sich zu organischen Gebilden, seine Knie wurden weich. Wie aus dem Nichts tauchte ein weiterer Mann auf, ein kleinerer mit gestutztem Vollbart. Gemeinsam griffen die beiden Caneddu unter die Arme und führten ihn zurück in das Treppenhaus der Gaststätte.
In Caneddus Gehirn formten sich noch halbwegs vernünftige Worte, doch seine Zunge verarbeitete alles zu Brei. Er hatte keine Kraft, um sich dem Klammergriff der beiden Unbekannten zu entwinden. Die Männer – waren sie Nordafrikaner? Palästinenser? Iraner? – machten in gebrochenem Deutsch Scherze über das viele Bier und mahnten, dass es nun aber Zeit sei, für heute Schluss zu machen. Caneddu ließ zu, dass sie ihn durch den Vorderausgang der Gaststätte auf eine breite, mit Trambahngleisen belegte Straße geleiteten. Als sie einer Gruppe aufgekratzter junger Frauen begegneten, witzelten die beiden Fremden erneut über den Zustand ihres Freundes, den man nun schleunigst nach Hause bringen müsse.
Caneddu erlebte seine Entführung wie durch einen psychedelischen Nebel. Als er in einen dunklen Mercedes-Transporter gesetzt wurde und eine Kapuze übergestülpt bekam, schien es ihm, als beobachte er das Geschehen von der Warte eines Zuschauers aus. Sein einziger klarer Gedanke war: Er hätte doch die schmuddelige Pinkelbaracke im Biergarten aufsuchen sollen und nicht diese verfluchte Toilette in der Gaststätte.
Dann fiel er in tiefe schwarze Ohnmacht.
EHEMALIGES FABRIKGELÄNDE
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
24. Juli
Nicola Caneddu erwachte mit dröhnenden Kopfschmerzen. Seine Zunge fühlte sich an wie frisch gegerbtes Wildleder, und er verspürte unbändigen Durst. Er hatte noch Hemd, Krawatte und Sakko an, aber vom Bauchnabel an abwärts war er nackt. Die Knie und das Gesäß waren aufgeschürft, der Rücken steif. Als er sich mühsam aufrappelte, stellte er fest, dass er in einem Bottich aus Gusseisen gefangen war. Dessen Rand reichte ihm bis zur Brust. Auf dem rauen gewölbten Kesselboden versuchte er, Halt zu finden. Langsam realisierte er, in welcher Lage er sich befand. Sein Herz begann zu jagen. Er fühlte sich ausgeliefert. Und jeglicher Würde beraubt.
Was ging hier vor sich?
Und wo zur Hölle war er hier eigentlich?
Als er über den Kesselrand blickte, sah er im Halbdunkel verrostete Ketten, die von Stahlträgern herabhingen. Die Wände um ihn herum waren gut zehn Meter hoch und aus rotem Backstein. Neben dem Kessel erkannte er weitere Bottiche, dazwischen Rohre und große Ventile mit Drehverschlüssen, alles dick mit Staub bedeckt. Eine ehemalige Fabrik, vermutete Caneddu. Er tippte auf Nahrungsmittel. Teigwaren vielleicht.
Die schmalen hohen Fenster der Fabrikhalle waren mit alten Matratzen und Schaumstoffstücken abgedunkelt. Aus den Ritzen drangen vereinzelte Lichtstrahlen in die Halle, in denen Staubteilchen tanzten. Wie rotes Laserlicht, dachte Caneddu. Sonnenuntergang vermutlich. Als er an die Kante des Bottichs griff, schnitt er sich in die Hand. Der Rand war messerscharf.
Plötzlich hörte er Schritte. Sie kamen von links. Aus dem Halbdunkel schälten sich die Silhouetten zweier Männer. Ein großer schlaksiger und ein kleinerer mit gestutztem Vollbart. Die stronzi von der Biergartentoilette, schoss es Caneddu durch den Kopf. Die Schweine, die ihm eine Spritze verpasst und ihn mit einem Sack über dem Kopf entführt hatten. Sie waren jung, etwa Anfang zwanzig. Nordafrikaner vermutlich. Was wollten die von ihm?
»Na, professore«, sagte der Kleinere in passablem Italienisch, »ausgeschlafen?«
Caneddu spürte Wut in sich hochkochen. Er versuchte, die Männer anzubrüllen, aber es kam nur ein Kieksen aus seiner ausgetrockneten Kehle, das in der Halle ein bizarres Echo erzeugte. Der Schlaksige reichte ihm eine Plastikflasche mit Wasser. Caneddu nahm sie und trank gierig. Der Kleinere begann, mit ruhiger Stimme zu sprechen.
»Wir wollen nur ein wenig über Ihre Arbeit erfahren, professore«, sagte er. »Icarus, so heißt doch ein Experiment, das Sie jahrelang geleitet haben, richtig? Wir wollen ein paar Dinge besser begreifen.«
Caneddu verstand nicht. Die Männer hatten ihn entführt und halbnackt in einen gusseisernen Bottich gesteckt, um mit ihm über seine Arbeit zu sprechen? Über Elementarteilchenphysik?
Als er seine Entführer fassungslos anstarrte, sagte der Größere der beiden: »In aller Ruhe: Was war das Ziel von Icarus?«
»Mà che porca miseria!«, brach es aus Caneddu heraus. Seine Stimme hallte wie ein Donnern durch die Backsteinhalle. »Ein Forschungsexperiment ist das! Ein ziviles! Unter einem Granitgebirge in Italien! Grundlagenforschung. Ich arbeite mit Elementarteilchen. Was zur Hölle soll das alles hier?«
Der Schlaksige wirkte unbeeindruckt. Er fragte erneut.
»Was war das Ziel von Icarus?«
»Neutrinophysik«, blaffte Caneddu, »sagt dir Eseltreiber das was?«
»Erklären Sie’s uns.«
»Wisst ihr was, ihr lasst mich jetzt sofort hier raus. Gebt mir meine Hose wieder, und wir vergessen den ganzen Irrsinn. Von mir erfahrt ihr jedenfalls nichts, gar nichts. Ihr könnt euch ja ein Buch kaufen über Physik, da gibt es ein paar ganz gute …«
Caneddu sah, wie der Schlaksige einen Handschuh überstreifte, sich gemächlich umdrehte, zu einem Pappkarton ging und nach etwas griff. Ein Fiepen und ein Kratzen waren zu hören. Geräusche, die Caneddu gut kannte – und die er hasste. Panik stieg in ihm auf. Es gab kaum etwas, das er mehr fürchtete. Mehr als Ratten. Und das hier war ein besonders fettes Exemplar.
Der Schlaksige hob ein zappelndes dunkelgraues Tier an dessen fleischfarbenem, mit einzelnen Borsten behaartem Schwanz hoch, trug es zu Caneddu und ließ es in den Eisenbottich fallen.
Caneddu begann, hemmungslos zu schreien. Er hüpfte von einem Bein auf das andere, während das Nagetier, von ähnlicher Panik ergriffen, zwischen seinen Füßen herumjagte. Die Ratte kroch vergeblich an den gewölbten Kesselwänden hoch, fiel zurück, versuchte es an anderen Stellen erneut und sprang zwischendurch immer wieder an den nackten Beinen des Physikers empor. Ekel und Adrenalin raubten Caneddu fast das Bewusstsein. Seine Stimme begann zu versagen, und Tränen schossen ihm aus den Augen.
Bloß nicht hinfallen. Bloß nicht mit nacktem Hintern und entblößtem Geschlecht in die Nähe des rasenden Tiers gelangen. Er klammerte sich an den Kesselrand, der ihm erneut schmerzhaft in die Hände schnitt, während seine Beine einen unkontrollierten, von Angst getriebenen Tanz vollführten. Das Hämmern seiner Füße auf dem Boden des Eisenbottichs dröhnte durch die Halle und erzeugte ein bizarres Geräusch, es hörte sich an wie das dilettantische Klopfen auf einer überdimensionalen Trommel.
Zweiunddreißig Jahre seines Lebens spulten sich im Rekordtempo zurück. Er war plötzlich wieder der Zwölfjährige. Der Klugscheißer, den man in der Pause im Klassenzimmer eingesperrt hatte. Mit einer Ratte. Caneddu war wieder in seinem alten Schulzimmer, vor dessen Tür die anderen Jungs kichernd warteten und horchten, und versuchte, über die Schulbänke springend, die Ratte auf Abstand zu halten. Die Ratte, die ihm die Usai-Brüder, diese elenden Scheißkerle, in den Schulranzen gesetzt hatten. Irgendwann hatte er es damals geschafft, seine Panik zu überwinden. Er hatte einen Papierkorb ausgeleert und einen weggeworfenen Pfirsichkern zwischen zwei Schulbänke geschleudert. Das hatte die Ratte angelockt, und dem zwölfjährigen Caneddu war es schließlich gelungen, den Papierkorb über das Tier zu stülpen.
Trotz seiner blinden Panik versuchte er jetzt, in dem Eisenbottich, einen Rhythmus an der Raserei der Ratte zu erkennen. Irgendwann hob er ein Bein, ahnte den nächsten Haken des Tiers und trat mit der Ferse zu. Er erwischte den Schwanz, immerhin, die Ratte war blockiert. Sie zappelte unter seinem Fuß um ihr Leben wie eine Fliege, die am Honig klebte. Während Caneddu sich vor Ekel fast übergeben musste, rammte er die andere Ferse in das Genick des Tiers und spürte, wie ihm das Rückgrat brach. Er riss seine Seidenkrawatte vom Hals, packte damit den zertretenen Kadaver und schleuderte ihn den beiden Männern entgegen.
Die duckten sich nur lachend weg.
»Wir haben noch mehr davon!«, sagte der Schlaksige mit einem kindischen Grinsen.
»Nein, stopp, ist gut. Wir reden«, keuchte Caneddu und streifte die blutigen Hände an seinem Achthundert-Euro-Sakko ab. »Was wollt ihr wissen?«
»Das Ziel von Icarus, dem Experiment …«
Das panische Entsetzen, das seinen Körper durchflutet hatte, wich langsam einem schalen Gefühl der Hilflosigkeit. Er wischte sich über die schweißnasse Stirn.
»Okay, es geht um Neutrinos. Das sind Elementarteilchen …« Er brach ab. Ihm wurde schwarz vor Augen. Innerlich fluchend versuchte er, den Faden wiederzufinden. Er atmete tief durch, räusperte sich und setzte erneut an.
»Elementarteilchen also, so wie das Elektron zum Beispiel. Aber viel schwerer zu entdecken und zu messen. Ein Neutrino ist nicht elektrisch geladen, hat fast keine Masse und tritt praktisch nie in Erscheinung. Dennoch spielen Neutrinos im Universum eine bedeutende Rolle. Ohne sie gäbe es zum Beispiel keine Kernfusion in der Sonne, sie würde nicht leuchten …«
Er musste vor Erschöpfung eine Pause machen. Der kleinere der beiden Entführer reichte ihm erneut eine Wasserflasche. Aber Caneddu schlug sie aus.
»Am Europäischen Teilchenforschungszentrum CERN wurde einige Jahre lang ein künstlicher Neutrinostrahl erzeugt. Diese Neutrinos wurden unterirdisch quer durch die Erdkruste Richtung Italien gelenkt. Neutrinos lassen sich von Fels und Gestein praktisch nicht aufhalten. In dem Labor unter dem Berg Gran Sasso, wo ich arbeite, fing ein Detektor einige dieser Neutrinos auf. Wir haben gemessen, ob sich die Partikel auf ihrem Weg durch die Erde verändern. Neutrinos können sich von selbst in andere Neutrinoarten verwandeln. Das nennt sich Neutrinooszillation.«
Caneddu sah, wie der kleine Bärtige einen kurzen Blick mit seinem Partner tauschte.
»Vom CERN wurden die Neutrinos nach Italien geschossen? Von Genf zum Gran Sasso? Das ist alles?«, fragte der Größere, als er sich wieder Caneddu zuwandte. »Gibt es weitere solcher Neutrinoexperimente am CERN?«
Diese Frage verblüffte Caneddu.
»Nein«, sagte er. »Das Experiment war ziemlich aufwendig. Es musste eigens ein Beschleunigertunnel gebaut werden, eine Abzweigung am großen Ringbeschleuniger des CERN. In diesem Tunnel wurden die Neutrinos erzeugt und durch die Erde zum Gran Sasso geschickt. Das Experiment ist aber beendet. Die USA haben den Detektor aus dem Gran Sasso gekauft und werden in den kommenden Jahren damit eigene Neutrinoforschung betreiben. Aus, basta!«
»Kein weiterer Neutrinostrahl am CERN? Kein weiterer Tunnel?«, fragte der Bärtige.
»Ein zweiter Neutrinostrahl? Ausgeschlossen«, sagte Caneddu bestimmt.
Was wollten diese Kerle bloß? Seine Antwort befriedigte seine Peiniger offenbar nicht. Der Schlaksige holte eine weitere Ratte. Diesmal gelang es Caneddu, ihm das Tier aus der Hand zu schlagen, sodass es fiepend durch die Fabrikhalle davonrannte. Er warf den beiden Männern italienische, teils sardische Flüche an den Kopf. Als könnte seine Wut auch nur das Geringste an seiner Situation ändern. Immerhin hielt er mit seinem Geschrei die erneut aufkommende Panik etwas in Schach. Es war ein Mittel gegen die totale Verzweiflung.
Die beiden Männer zogen sich in eine Ecke der Backsteinhalle zurück. Trotz seiner höllischen Kopfschmerzen und der mittlerweile überhandnehmenden Übelkeit versuchte Caneddu, zu erahnen, worum es den beiden cretini tatsächlich gehen könnte.
Nach einer Weile trat der Schlaksige wieder an den Bottich heran. Diesmal hatte er einige großformatige Papiere in der Hand. Bauzeichnungen. Caneddu hatte keine Probleme, die Pläne zu lesen: Es handelte sich um den Grundriss der Tunnelanlage des CERN, die er als leitender Wissenschaftler nur allzu gut kannte. Eine Skizze zeigte die beiden ineinander verschlungenen Ringbeschleuniger, den älteren SPS und den riesigen LHC. Er erkannte auch den Tunnel, der im Südwesten von einem Segment des LHC abzweigte und schnurgerade auf den Flughafen von Genf zulief. In diesem waren für einige Zeit Neutrinos erzeugt und durch die Erdkruste zum 730 Kilometer entfernten Gran Sasso geschossen worden.
Der Bärtige tippte mit dem Finger auf einen gestrichelten Bereich der Skizze. Es sah aus wie ein Seitenast, ein weiterer Tunnel, der mit dem bekannten Neutrinotunnel einen spitzen Winkel bildete. Die beiden Röhren formten ein liegendes Y.
»Was ist das?«, wollte der kleine Bärtige wissen. »Was passiert hier neben dem Tunnel, den Sie für Ihr Experiment genutzt haben?«
Caneddus erster Impuls war, diesem Typen ein weiteres verächtliches »scemo« oder »imbecille« entgegenzubrüllen. Aber der Gedanke an die Kiste mit den Ratten hielt ihn davon ab. Stattdessen versuchte er, zu ergründen, was es mit der seltsamen Verzweigung auf der Zeichnung auf sich haben könnte. Gab es dort einen weiteren Tunnel? Einen Seitenarm, den er bislang nicht kannte? Konnte er sich an Durchgänge erinnern? Eine Putzkammer, einen Notausgang, Kühlleitungen? Zweifellos gab es im Umfeld des riesigen Beschleunigers am CERN jede Menge technische Anlagen. Rohre für das flüssige Helium, mit dem die lastwagengroßen Magnetspulen des Protonenbeschleunigers auf minus 270 Grad Celsius gekühlt wurden. Andererseits mussten solche Kühlleitungen in unmittelbarer Nähe des Ringtunnels angeordnet sein. Und Kühlanlagen waren wohl kaum der Grund, warum diese zwei Spinner einen Wissenschaftler entführten und mit Ratten quälten. Einfach um irgendetwas von sich zu geben, sagte er schließlich: »Ich vermute einen Lagerraum, vielleicht ein Zugang zu Kühlleitungen oder Vorräte für die Betriebsfeuerwehr …«
Das war ein Fehler. Der Schlaksige schüttelte den Kopf und wandte sich erneut ab. Caneddu sah, wie er im hinteren Bereich der Halle einen Eimer ergriff und langsamen Schrittes zum Bottich zurückkehrte. In dem Eimer schwappte eine Flüssigkeit. Wie eine Registriermaschine ging Caneddus Gehirn die Möglichkeiten durch, was das bedeuten konnte. Doch die Realität sollte seine Fantasie bei weitem übertreffen. Einen Schritt vom Eisenbottich entfernt, packte der Schlaksige den Eimer, eine Hand am Griff, die andere am Boden, und schüttete den Inhalt direkt über den Physiker. Eine nach ranzigem Fleisch, Schimmel und Fisch stinkende Brühe lief an seinem halb bekleideten Körper hinab und sammelte sich langsam am Boden des Kessels.
Wo auch immer diese disgraziati den Inhalt dieses Eimers herhatten, das Zeug war ekelhafter als alles, was Caneddu je gesehen und gerochen hatte. Restlos verdorbene Knochenreste mit weißgrünem Schimmel überzogen und ranzige Fischstücke waren noch nicht einmal das Schlimmste. Als Caneddu sah, dass sich fingerlange graue Maden in der Pestbrühe suhlten, musste er sich übergeben. Sein Erbrochenes konnte dem Gestank kaum etwas hinzufügen.
Ein Zittern fuhr durch seinen Körper, das weder durch Kälte noch durch Angst motiviert war. Purer Ekel ergriff Besitz von seinem Nervensystem. Aus seinem Mund drangen unbeherrschte Schreie. Wie durch einen öligen Nebel nahm er wahr, dass der Bärtige die Kiste mit den Ratten holte und sich näherte. Er nahm nicht nur eine einzelne Ratte heraus, sondern kippte ein Dutzend der grau-schwarzen Tiere mit ihren nackten Schwänzen in den Bottich.
Auf die Nager hatte die stinkende Mixtur eine völlig andere Wirkung als auf Caneddu. Die Ratten gerieten in Ekstase. Sie begannen, sich wie Schakale um die vergammelten Fleischstücke zu reißen, verbissen sich in Sehnen, in Fischgräten und wälzten sich fiepend in der Brühe zu seinen Füßen. Obwohl mehr als genug zu fressen für alle herumschwamm, steigerten sich die Ratten bald in einen Rausch, einen Zustand höchster Aggression. Die Tiere begannen, sich gegenseitig anzugreifen. Sie schlugen die Zähne in ihre Artgenossen, ja sogar in den eigenen Schwanz und schließlich in Caneddus Beine.
Als sich die erste Ratte in seinem Hodensack verbiss, wurde Caneddu schwarz vor Augen. Sein Körper kippte an die Wand des Bottichs und rutschte nach unten. Am rauen Gusseisen schürfte er sich das Gesäß blutig. Doch davon merkte er nichts mehr, denn er hatte bereits das Bewusstsein verloren.
HAUPTQUARTIER DER GSG 9
SANKT AUGUSTIN, DEUTSCHLAND
25. Juli
Polizeiobermeister Gerhard Helmrich sagte einen Grand Hand an, obwohl er nur einen Trumpfbuben im Blatt hatte. Seine drei Asse und die beiden Zehner stimmten ihn zuversichtlich, seinen Mitspielern in dieser Runde 120 Punkte abzuknöpfen. Man musste manchmal etwas wagen, fand er. Ohne Risiko hatte er gegen seine jüngeren Kollegen sowieso nicht viele Chancen. Sie waren die besseren Skatspieler. Vor allem der Neue, dieser Rothaarige aus dem Allgäu, hatte es verdammt gut drauf. Der Saukerl hatte sie gestern in einer Ramschrunde mit einem Durchmarsch kalt erwischt. Bis dahin hatte Helmrich gedacht, die Jungs aus Bayern könnten nur Schafkopfen.
Helmrich bekam seine 120 Punkte nicht. Beim dritten Stich quakte die Sirene. Das kam selten vor. Und noch seltener um kurz nach drei Uhr morgens. Aber nun war es so weit. Er warf seine Karten genauso schnell hin wie seine beiden Mitspieler. Im Nebenraum sprangen fünf Kollegen vom Sofa auf und schalteten die dritte Staffel der Serie ›Narcos‹ ab.
»Ist das jetzt ernst?«, rief einer der Jüngeren, als Helmrich auf dem Weg zum Lagezentrum an ihnen vorbeilief.
»Fertigmachen zum Einsatz«, brüllte er seinen Untergebenen zu.
In der Einsatzzentrale traf Helmrich auf die gute Seele ihrer Truppe, Ruth Binder. Die fröhliche Rheinländerin hatte hier schon Dienstpläne koordiniert und über die Notrufleitung gewacht, als Helmrich noch mit Bauklötzen spielte.
»Diesmal geht es richtig los«, sagte Binder ohne Aufregung in der Stimme und drückte Helmrich einen frischen Computerausdruck in die Hand. »Ihr fliegt nach München. Der Puma ist in zwanzig Minuten startbereit. Zwei Einheiten zu je vier Mann. Du hast das Kommando.«
Helmrich nickte, während er den Ausdruck überflog. Es sah tatsächlich ernst aus. Zwei Nordafrikaner – meine Güte, die Kollegen in München schrieben immer noch »Nafris« – waren vor drei Tagen mit einer Maschine aus Casablanca am Münchner Flughafen gelandet. Ihre Touristenvisa waren sauber, aber ihre Herkunft hatte eine Markierung im Überwachungscomputer der Bundespolizei ausgelöst. Ihre Daten und Gesichter waren automatisch mit Dateien islamistischer Gefährder abgeglichen worden. Ohne Ergebnis. Die Gesichter waren in der Datenbank geblieben, und zwei Tage später hatte es dann doch einen Treffer gegeben.
Vor einigen Jahren hatte die bayerische Polizei an »empfindlichen Stellen« Überwachungskameras angebracht, so auch in Großmärkten, die Chemikalien und Pflanzenschutzmittel verkauften, Rohstoffe, aus denen man mit etwas Geschick und einem gewissen Basiswissen Bomben bauen konnte. Und siehe da: Die beiden »Touristen« aus Casablanca tauchten tatsächlich in einem Baumarkt auf, der jede Menge Düngemittel führte. Allerdings kauften sie keine Chemikalien, sondern ein halbes Dutzend Eimer, Kisten, Kabelbinder, Tierfutter – und gut fünfzig Quadratmeter Schaumstoff.
Was wollten zwei Touristen mit Tierfutter und bergeweise Schaumstoff? Bei der Polizei und dem Verfassungsschutz läuteten die Alarmglocken. Eine Datenbankrecherche ergab zudem, dass die Männer bei Europcar einen Mercedes-Transporter gemietet hatten. Einen Transporter? Touristen? Glücklicherweise hatten sie das teure Modell gewählt, mit Navi, Ledersitzen und Klimaanlage. In diese Ausführung baute Europcar standardmäßig GPS-Sender ein, man wollte die schönen Fahrzeuge schließlich nicht in Tadschikistan einsammeln. Tagsüber tauchte das GPS-Signal an mehreren Stellen in der Münchner Innenstadt auf. Am Nachmittag entschied sich die bayerische Polizei für eine Observierung. Man stellte einen Beamten ab, der den Transporter am Wiener Platz in der Nähe eines Biergartens aufspürte. Gegen Abend tauchten die beiden Nordafrikaner schließlich mit einem betrunkenen Mann auf und fuhren mit dem Transporter davon. Nicht Grund genug, die Verfolgung aufzunehmen. Der Beamte funkte lediglich in die Zentrale, die Gäste aus Nordafrika hätten sich im Biergarten vergnügt und Freundschaft mit einem gut gekleideten Europäer geschlossen.
Am nächsten Tag ging eine Vermisstenmeldung bei der Polizei ein. Ein italienischer Atomphysiker war abgängig, meldeten Teilnehmer einer Wissenschaftskonferenz. Die Personenbeschreibung passte zu dem gut gekleideten, betrunkenen Europäer. In Sekundenschnelle breitete sich Hektik im Landeskriminalamt aus. Die vermeintliche Völkerverständigung im Biergarten war in Wahrheit eine Entführung oder Geiselnahme gewesen. Man ortete den gemieteten Transporter in der Nähe einer Fabrikruine, kein Hotel weit und breit. Die bayerischen Behörden forderten das große Aufgebot der Bundespolizei an.
Helmrich, der von seiner Truppe »Helmi« genannt wurde, wenn er nicht zugegen war, musste seinen Jungs nicht viel Dampf machen. Sie waren wie Zirkustiere darauf gedrillt, in weniger als zwanzig Minuten einsatzbereit zu sein. Mit Tarnanzügen, Helmen und Schutzwesten standen sie um 3:27 Uhr an der Rampe vor dem Hauptquartier. Der Kleinbus der Kollegen von der Unterstützungseinheit näherte sich bereits.
Sie konnten sich blind darauf verlassen, dass sämtliche Ausrüstungsgegenstände, Helme, Schutzwesten, Handfeuerwaffen, Blendgranaten, Brillen, Stabtaschenlampen wie auch Nachtsichtgeräte und Herzschlagsensoren bereits in den Helikopter verladen wurden. Auch Helmrichs liebstes Werk-zeug, die MP7 von Heckler & Koch, gehörte zur Standardausrüstung. Es war eine teuflische Waffe. Sie hatte die Leichtigkeit einer Pistole, die Schussfrequenz eines Maschinengewehrs und die Durchschlagskraft eines Karabiners. Trotz ihres kleinen Kalibers von nur 4,6 Millimetern durchschlugen die Projektile noch aus zweihundert Metern Entfernung den Standard-Kevlarhelm der NATO. Ihre volle Wirkung entfaltete die kurzläufige MP7 im Häuserkampf und in Innenräumen.
Um 3:38 Uhr hoben Polizeiobermeister Helmrich sowie sieben ihm unterstellte Beamte des deutschen Antiterrorkommandos GSG 9 vom Flughafen der Bundespolizeifliegerstaffel nahe der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn in den Nachthimmel ab. Ihr Ziel, die Grünfläche der Trabrennbahn von Daglfing im Osten Münchens, war 437 Kilometer entfernt. Die 3600 PS des dunkelblau lackierten Puma-Hubschraubers würden die Strecke in weniger als zwei Stunden bewältigen.
EHEMALIGES FABRIKGELÄNDE
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
25. Juli
Aus Nicola Caneddus Mund drang nur ein Wimmern. Eine erbärmliche Mischung aus Flehen und Verzweiflung. Der Wissenschaftler war an Armen und Beinen mit Kabelbindern gefesselt. Das Blut pochte in seinem Schädel wie die Basstrommel einer Heavy-Metal-Band. Er steckte zwar nicht mehr in dem Bottich, aber man hatte ihn nun kopfüber an einem Seil aufgehängt. Sein Körper brannte, als würden Feuerzeuge an mehreren Stellen gleichzeitig die Haut versengen. Der beißende Geruch, der ihn umhüllte, ließ ihn vermuten, dass die Entführer seine Schürfwunden und Rattenbisse mit einem Antiseptikum behandelt hatten.
Mittlerweile war er völlig nackt. Sein Haar stank noch immer nach der ekelhaften Brühe, die seine Entführer in den Kessel geschüttet hatten. Der kleinere der beiden prüfte die Fesseln, während der Schlaksige aus einigen Schritten Entfernung zusah. Sie ließen ihn eine Weile einfach kopfüber hängen. Dann bauten sich die Männer vor ihm auf und blickten ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Der Größere stellte in seinem gefärbten Italienisch eine Frage.
»›Parasciu‹, was sagt Ihnen das?«
Die Frage machte Caneddu nur noch mehr Angst. Die Situation war gleichermaßen bedrohlich wie absurd. Nicht nur dass er nackt an einem Strick hing, während zwei Verbrecher ihn fordernd anstarrten. Sie fragten auch noch nach einem Begriff, der ihm nichts, aber auch gar nichts sagte. Er wusste keine Antwort, die sie beschwichtigen würde.
»Wie bitte?«, fragte er zurück, um etwas Zeit zu gewinnen.
Die beiden Entführer sahen einander kurz an und versuchten es ein weiteres Mal.
»›Pa-ra-sciu‹, was sagt Ihnen das?«
Caneddu blickte sie mit seinen geschwollenen Augen an. »Mà che cazzo dici …?«, murmelte er. Vorsichtig schüttelte er den Kopf.
Der kleine Bärtige drehte sich um und ergriff einen Eimer, der beträchtliches Gewicht zu haben schien. Der Schlaksige stellte eine Leiter neben Caneddu auf und stieg einige Sprossen nach oben. Von dort nahm er den Eimer entgegen. Der andere wickelte ein altes Frotteehandtuch um Caneddus Kopf. Der Physiker sah nun nichts mehr, spürte aber, wie der Schlaksige langsam eine Flüssigkeit auf ihn schüttete, Wasser vermutlich. Es rann über die Beine an seinem Geschlecht vorbei den Bauch hinunter zu seinem Kopf. Das Handtuch begann, sich vollzusaugen, und schließlich bekam Caneddu kaum noch Luft. Als das Handtuch vollständig mit Wasser getränkt war, fühlte es sich an, als würde er ertrinken. Er versuchte, Luft zu holen, atmete aber nur Flüssigkeit ein. Und der Scheißkerl auf der Leiter ließ weiter Wasser an seinem Körper hinunterlaufen. Caneddu fing an, sich zu winden wie ein Fisch, den man an der Schwanzflosse festhielt. Das Gefühl zu ertrinken war überwältigend.
»Zum letzten Mal: Was ist ›parasciu‹?«, fragte der Schlaksige.
Caneddu versuchte, etwas zu sagen, aber es spritzten nur Wassertropfen aus dem nassen Handtuch hervor. Er wünschte sich, er könnte den Entführern sagen, was sie hören wollten. Aber weil er das nicht konnte, war er sicher, dass sie ihn nun ertrinken lassen würden. Sein Herz schlug wie wild. Er hatte Todesangst.
Da riss der Schlaksige das nasse Handtuch von seinem Kopf.
»Ist das wirklich noch nicht genug, du verdammter Makkaroni?«
Doch das letzte Wort erstarb in einem gewaltigen Knall. Ein gleißender Lichtblitz flutete die Halle. Geblendet und benommen erlebte Caneddu das weitere Geschehen nur bruchstückhaft. Es schien ihm, als hätte jemand seine Sinne auf Zeitlupe gestellt. Martialische Krieger tauchten aus Rauchwolken zwischen den Kesseln und Rohren auf. Sie schrien Befehle, schwenkten Maschinenpistolen, auf denen starke Lichtstrahler angebracht waren. Die Fabrik, in der er so heftige Qualen durchlitten hatte und noch immer kopfüber an einem Seil hing, füllte sich mit Gestalten, die aus einem Ego-Shooter-Spiel zu stammen schienen.
Der Schlaksige machte eine abrupte Bewegung, als die Soldaten auf ihn zustürmten. Einer der Kämpfer feuerte aus zehn Schritten Entfernung eine Salve in seinen Leib. Der Mann, der Caneddu gefoltert hatte, klappte zusammen wie ein Stapel Bauklötze. Caneddu wandte den Blick entsetzt ab, als der vermummte Soldat auch noch einen Kopfschuss nachsetzte. Der kleine Bärtige riss gerade noch die Hände hoch, während die Spezialkräfte bereits auf ihn zustürmten. Den auf Deutsch gebellten Befehl »Auf den Boden und Hände hinter den Kopf!« verstand er zwar nicht, aber er tat intuitiv das Richtige. Er sank mit erhobenen Armen auf die Knie. Ein Soldat trat ihm in den Rücken. Er kippte vorwärts auf den Bauch.
»Gesichert!«, brüllten die Männer des achtköpfigen Trupps, nachdem sie sämtliche Winkel der ehemaligen Fabrikhalle durchkämmt und mit Infrarotkameras und Herzschlagsensoren gescannt hatten.
Caneddu nahm die rabiate Befreiungsaktion ohne nennenswerte Gefühlswallungen wahr. Seine Ohren dröhnten von dem infernalischen Knall der Blendgranate. Da der eine seiner beiden Entführer nun tot war und der andere gefesselt auf dem Boden lag, wandten sich die Befreier ihm zu. Reichlich ruppig, fand Caneddu angesichts seiner erbärmlichen Lage.
Die Beamten des deutschen Sonderkommandos schnitten ihn nicht sofort von dem Seil ab. Einer der Polizisten redete zunächst auf Arabisch und dann auf Englisch auf ihn ein.
»Wie ist Ihr Name, und welche Sprache sprechen Sie?«
Auf die englische Version hin nannte Caneddu seinen Namen und fügte hinzu: »Italian, I am Italian.«
»Gibt es hier weitere Personen?«
Der Polizist musste die Frage zweimal wiederholen.
»No, no«, stöhnte Caneddu und warf seinen Kopf hin und her, »nur die beiden stronzi.«
»Okay. Mein Name ist Gerhard Helmrich, ich leite diese Operation. Wir bringen Sie jetzt in Sicherheit. Hören Sie?«
Auf dessen Zeichen hin durchschnitt einer der Männer endlich Caneddus Plastikfesseln mit einem Kampfmesser. Zwei weitere Soldaten griffen ihm unter die Arme, ein dritter kappte das Seil.
Am Boden hüllten sie Caneddu in eine knisternde, gold glänzende Rettungsdecke. Als sie im Innenhof des Gebäudekomplexes ins Freie traten, staunte der Italiener über den logistischen Aufwand. Vier schwarze BMW-Limousinen standen mit Blaulichtern vor dem Backsteingebäude, daneben zwei schwarze Transporter, offenbar für Waffen, Schutzkleidung und wer weiß was für Geräte. An den Ausfahrten des Fabrikhofs sperrten silber-blaue Streifenwagen der Münchner Polizei das Gelände ab. Von Süden bahnten sich zwei Krankenwagen den Weg in den Fabrikhof. Ein Wunder eigentlich, dachte er, dass er und seine Entführer von diesem ganzen Rummel nichts mitbekommen hatten.
LANDESKRIMINALAMT
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
25. Juli
Nicola Caneddu war reichlich benommen von den Qualen seiner Entführung. Er ließ sich von den deutschen Antiterrorspezialisten bereitwillig in die Obhut zweier Sanitäter übergeben, die ihn auf einer Trage in einen Krankenwagen schoben. Im Konvoi mit zwei 450-PS-starken, allradgetriebenen BMW 750Li und drei silber-blauen Streifenwagen mit blinkenden Blaulichtern verließ der Krankenwagen das Fabrikgelände im Münchner Osten. Die Wagenkolonne raste quer durch die erwachende Stadt zu dem im Westen gelegenen Gebäude des Bayerischen Landeskriminalamts. Im Untergeschoss des mehrstöckigen schmucklosen Zweckbaus wurde Caneddu in eine bestens ausgestattete Krankenstation aufgenommen, wo er eingehend untersucht wurde. Sogar eine Kernspintomografie ließ er trotz seiner Erschöpfung über sich ergehen.
Nachdem seine Wunden gesäubert, desinfiziert und verbunden waren, gab ein streng gescheitelter Arzt mit weißem Kittel das Einverständnis, Caneddu in einem Zimmer der oberen Stockwerke unterzubringen. Die Unterkunft war ausgestattet wie das Einzelzimmer eines Mittelklassehotels, ein Bett, ein Schreibtisch, ein kleines, aber sauberes weiß gekacheltes Bad mit Dusche. Dass es in diesem Quartier keinen Fernseher gab, fiel Caneddu zunächst nicht auf. Wohl aber bemerkte er die stabilen Gitter vor dem Fenster, das sich nicht öffnen ließ. Ihm wurde klar, dass er für die deutschen Behörden so etwas wie ein Halbverdächtiger sein musste, einerseits das Opfer eines schweren Verbrechens, andererseits womöglich selbst in die Sache verstrickt.
Man hatte ihm einen Packen Kleidung auf das Bett gelegt. Eine legere Cordhose, Unterwäsche, ein T-Shirt und einen Pullover sowie Socken und billige Turnschuhe in seiner Größe. Keine erstklassige Ware, aber funktional. Deutsch und praktisch, dachte Caneddu. Er vermisste seinen Lederkoffer, der vermutlich noch in seinem Hotelzimmer war, gefüllt mit ausgewählten Kleidungsstücken, darunter ein paar seiner Lieblingsteile, die er auf Reisen immer mitnahm. Ohne seine persönlichen Dinge, ohne den Duft seines Eau de Toilette und vor allem ohne seine elegante Garderobe fühlte er sich unwohl und verletzlich. Gut sitzende Kleidung war für ihn wie eine zweite Haut. Sie gab ihm Sicherheit.
Nach einer ausgiebigen Dusche legte er sich, in einen billigen weißen Frotteebademantel gehüllt, auf das Bett und schlief sofort ein.
Geweckt wurde er nur wenige Stunden später mit bayerischer Direktheit. »Grüß Gott, Herr Kanettu«, quakte eine füllige rotbackige Hausdame. Mit weißer Schürze und einem Tablett spazierte sie in das Zimmer und stellte ein Frühstück – weiße Semmeln, Butter, Marmelade, Schinken, Käse, ein gekochtes Ei sowie ein Kännchen Brühkaffee – auf das Nachtkästchen. Das Verlangen nach einem kräftigen Doppio unterdrückend, trank Caneddu eine Tasse des lauwarmen deutschen Filterkaffees.
»Wie viel Uhr ist es?«, fragte er die Frau.
»Es ist kurz vor zwölf Uhr mittags. Sie haben einige Stunden geschlafen.«
Immerhin, dachte er. Einige Stunden. Nachdem sie das Fenster geöffnet und die Bettwäsche aufgeschüttelt hatte, verließ die Frau das Zimmer wieder. Caneddu strich Butter und Marmelade auf eine Semmel. Als er gerade den letzten Bissen hinunterschluckte, klopfte es erneut. Ein junger uniformierter Beamter erkundigte sich in unbeholfenem Englisch, ob »Mr. Caneddu« bereit sei für eine Unterredung mit den leitenden Ermittlern des Hauses. Er werde in zehn Minuten zur Verfügung stehen, versicherte Caneddu, obgleich er ziemliche Lust verspürte, sich nach dem Frühstück für weitere zwei Stunden ins Bett zu legen.
Man führte Caneddu durch mehrere Gänge des Gebäudes und über einen Fahrstuhl in einen Besprechungsraum, der einige Stockwerke über dem Zimmer lag, in dem er die vergangenen Stunden verbracht hatte. Zwei Männer und eine Frau erwarteten ihn. Sie umgab eine Aura professioneller, distanzierter Höflichkeit. Man erkundigte sich nach Caneddus Befinden, fragte, ob sein Quartier akzeptabel sei und ob er etwas zu trinken wünsche. Die Beamtin mit weißblondem, akribisch nach hinten gekämmtem Zopf wurde als Abteilungsleiterin beim Verfassungsschutz vorgestellt. Einer der beiden Männer war Polizeirat des Landeskriminalamts, der andere ein Kriminaloberrat des Bundeskriminalamts.
»Herr Caneddu«, begann der ranghöchste der anwesenden Beamten, der Mann vom BKA, in korrektem, aber akzentgefärbtem Englisch, »wir bedauern außerordentlich, was Ihnen zugestoßen ist, und das ausgerechnet auf deutschem Staatsgebiet.« Deutschland sei generell ein äußerst sicheres Reiseland, erklärte der sportlich wirkende Mann mit gescheiteltem grau-schwarzem Haar und einem schmalen Schnurrbart, der ihm etwas Aristokratisches verlieh. Man halte es für wahrscheinlich, dass Caneddu nicht zufällig einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Es sei daher für die Aufklärung dieser Angelegenheit, aber auch für die generelle Sicherheit ausländischer Besucher in Deutschland von größter Bedeutung zu erfahren, was der Hintergrund dieser abscheulichen Gewalttat sein könne.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete Caneddu.
Seine Augenlider waren schwer. Die wenigen Stunden Schlaf in der Obhut der Polizei hatten nicht ausgereicht, um seine Erschöpfung zu beseitigen. Er hatte Mühe, den Kopf hochzuhalten, während die smarten Verhörspezialisten der deutschen Polizei ihn mit hellwachen Augen musterten.
Der BKA-Beamte neigte den Kopf zur Seite und sah sein Gegenüber mit enttäuschtem Blick an. Caneddu war klar, dass dieser Mann nicht sein erstes Verhör führte. Aber er hatte nicht vor, sich auf Machtspielchen einzulassen. Er war hier schließlich das Opfer und nicht der Täter.
»Hören Sie, ich war beruflich in München, auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Am Abend haben wir einen Biergarten aufgesucht, und in den Toilettenräumen haben mich zwei Männer betäubt und entführt. Sagen Sie mir, welchen Zusammenhang ich hier sehen soll.«
»Sie kommen aus …«
Der Beamte blätterte in seinen Unterlagen.
»Sardinien«, sagte Caneddu. »Ich komme aus Sardinien.«
»Richtig. Sardinien. Haben Sie dort vielleicht Feinde?«
»Feinde? Wie meinen Sie das? Blutrache? Mafia? Solche Sachen?« Caneddu verschränkte die Arme.
»Ja, zum Beispiel.«
»Blödsinn«, sagte Caneddu und stieß einen verächtlichen Laut aus. »Verwechseln Sie unsere Insel nicht mit anderen Teilen Italiens. Die Mafia aus Sizilien oder Kalabrien hat mit Sardinien seit Jahrhunderten nichts zu tun. Der Unterschied ist mindestens so groß wie … wie zwischen Bayern und Schleswig-Dingsda …«
»Sicher, verzeihen Sie. Herr Caneddu, was wir suchen, ist das Motiv für das Verbrechen, das an Ihnen verübt wurde. Dabei blicken wir zunächst in alle Richtungen. Aber lassen wir das im Augenblick. Für das Wahrscheinlichste halten wir einen Zusammenhang mit Ihrem Beruf. Sie sind Physiker. Soweit wir das feststellen konnten, Atomphysiker. Sie haben also womöglich Fähigkeiten, die in gewissen Kreisen … sagen wir, begehrt sind.«
»Welche Kreise?«
»Haben Sie den Namen Abdul Kadir Khan schon einmal gehört?«
»War das einer der beiden stronzi, die mich gefoltert haben?«
»Nein, nein. Kahn ist Pakistaner. Er hat jahrelang Atomwaffen und kerntechnisches Know-how verschoben, auch in Länder, die den westlichen Demokratien nicht sonderlich verbunden sind.«
»Ach ja, ich habe darüber gelesen. Das ist aber einige Jahre her. Und der Kerl sitzt im Gefängnis, oder?«
»Ja. Das Proliferations-Netzwerk, das Kahn aufgebaut hatte, ist zerschlagen. Aber das Interesse an moderner Nukleartechnik ist damit keineswegs verschwunden. Wir können davon ausgehen, dass so einige Regierungen und terroristische Organisationen in höchstem Maße daran interessiert sind, was Sie so in Ihrem Kopf haben.«
»Das ist Blödsinn. Ich bin kein Kernphysiker. Ich bin Elementarteilchenphysiker, verstehen Sie? Das ist ein Riesenunterschied. Das, woran ich arbeite, hat nichts mit Atombomben oder Kernspaltungen zu tun. Aus der Elementarteilchenforschung lässt sich niemals irgendeine wahnsinnige Bombe ableiten. Es geht um Grundlagenphysik, um die fundamentalen Gesetze der Materie und der mikrokosmischen Kräfte, wie sie Millisekunden nach dem Urknall herrschten …«
Der Begriff »Urknall« ließ die Beamten aufhorchen. Wahrscheinlich klang es in ihren Ohren wie eine Bestätigung dafür, dass in der Fabrikruine Caneddus Wissen über futuristische Monsterwaffen hatte herausgepresst werden sollen. So viel Naivität machte den Physiker wütend. Er merkte, wie sein Temperament in Wallung geriet.