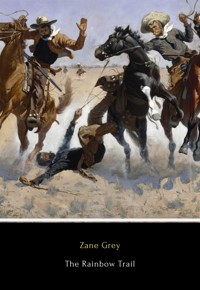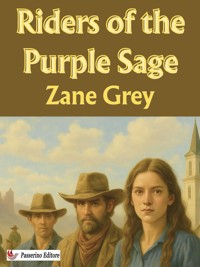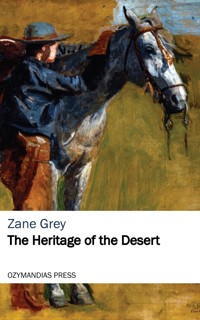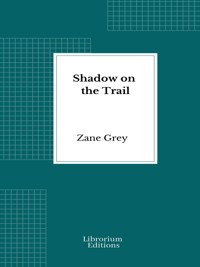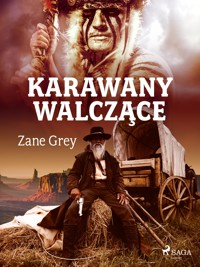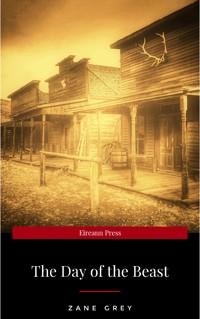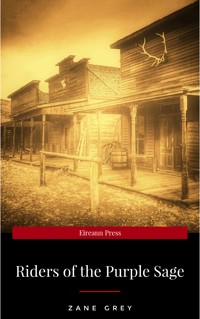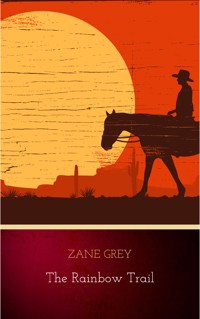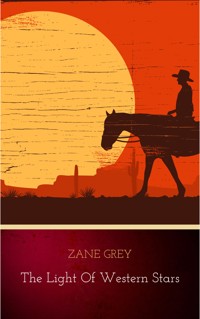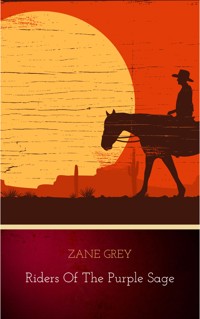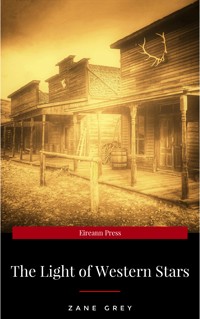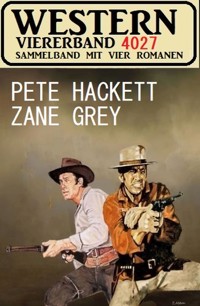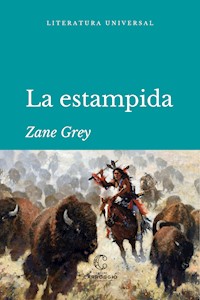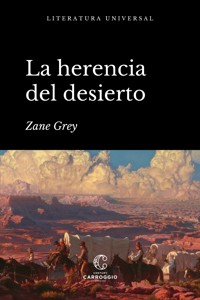Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Western: Pete Hackett: Terror, Hass und Tod Pete Hackett: Das Teufelsweib aus Texas Zane Grey: Westlich des Pecos Die acht Apachen jagten auf ihren Mustangs heran. Ihr wildes Kampfgeschrei ließ die Herzen der drei Weißen erbeben, die im letzten Moment eine Gruppe von Felsen erreicht hatten und die jetzt von den Pferden sprangen. In fliegender Hast schlangen sie die Leinen der Pferde um die Stämme dorniger Comas, die hier wucherten. Es waren zwei Männer und eine Frau. Ihr Name war Kelly McPherson. Mit einem der Männer war sie verheiratet. Er hieß Cole. Der andere Bursche war ein Freund Coles, sein Name war John Durango. Sie rissen die Gewehre aus den Scabbards, knieten hinter den Felsblöcken ab, repetierten. Der Pulk der herandonnernden Angreifer riss auseinander. Schüsse peitschten. Das Donnern erhob sich und rollte über die Ebene, und in das verebbende Grollen hinein brüllten wieder die Gewehre. Die drei Weißen schossen die Rohre heiß. Die um sie herum brausenden Krieger aber boten nur ein schlechtes Ziel. Außerdem waren sie in der Wolke aus Staub, die die Hufe ihrer Pferde in die Luft rissen, nur wie durch wallenden Nebel auszumachen. Plötzlich jagten die Apachen in alle Richtungen davon. Sie sprangen in einiger Entfernung von den Pferden und rannten zwischen die Felsen, von denen es hier, mitten in der Wildnis der Sierra Blanca, mehr als genug gab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cowboy Western Großband 4/2023
Inhaltsverzeichnis
Cowboy Western Großband 4/2023
Copyright
Terror, Hass und Tod
Das Teufelsweib aus Texas
Westlich des Pecos
Cowboy Western Großband 4/2023
Dieses Buch enthält folgende Western:
Pete Hackett: Terror, Hass und Tod
Pete Hackett: Das Teufelsweib aus Texas
Zane Grey: Westlich des Pecos
Die acht Apachen jagten auf ihren Mustangs heran. Ihr wildes Kampfgeschrei ließ die Herzen der drei Weißen erbeben, die im letzten Moment eine Gruppe von Felsen erreicht hatten und die jetzt von den Pferden sprangen. In fliegender Hast schlangen sie die Leinen der Pferde um die Stämme dorniger Comas, die hier wucherten.
Es waren zwei Männer und eine Frau. Ihr Name war Kelly McPherson.
Mit einem der Männer war sie verheiratet. Er hieß Cole.
Der andere Bursche war ein Freund Coles, sein Name war John Durango.
Sie rissen die Gewehre aus den Scabbards, knieten hinter den Felsblöcken ab, repetierten.
Der Pulk der herandonnernden Angreifer riss auseinander. Schüsse peitschten. Das Donnern erhob sich und rollte über die Ebene, und in das verebbende Grollen hinein brüllten wieder die Gewehre.
Die drei Weißen schossen die Rohre heiß. Die um sie herum brausenden Krieger aber boten nur ein schlechtes Ziel. Außerdem waren sie in der Wolke aus Staub, die die Hufe ihrer Pferde in die Luft rissen, nur wie durch wallenden Nebel auszumachen.
Plötzlich jagten die Apachen in alle Richtungen davon.
Sie sprangen in einiger Entfernung von den Pferden und rannten zwischen die Felsen, von denen es hier, mitten in der Wildnis der Sierra Blanca, mehr als genug gab.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Terror, Hass und Tod
Pete Hackett
Terror, Hass und Tod
Western von Pete Hackett
John Stirling stieg zwischen zwei windschiefen Schuppen vom Pferd und ließ die Zügel zu Boden fallen. Sein wachsamer Blick sprang in die Runde. Er nahm das Gewehr. Kein Muskel zuckte in Johns Gesicht. Er vermittelte einen entschlossenen Eindruck.
Elwell Collins trat aus dem verwahrlosten Farmhaus. In seiner Armbeuge lag die Winchester. Ein gehässig-hämisches Grinsen umspielte seine wulstigen Lippen. Collins rief rau: „Es ist schnell bis zu dir durchgedrungen, dass ich wieder auf mein Land zurückgekehrt bin, Stirling.“
John ging zwei Schritte und versetzte kühl: „Ja, Collins, es drang ausgesprochen schnell bis zu mir durch. Du willst dich also wieder einnisten hier?“
„Habe ich nicht das Recht dazu? Diese Farm“ - Collins vollführte mit dem linken Arm eine ausholende Bewegung in die Runde - „habe ich aufgebaut. Allerdings war ich dir ein Dorn im Auge, Stirling. Du hast mich davongejagt wie einen räudigen Straßenköter.“
John nickte unbeeindruckt. „Weil das das Land der Antelope Hill Ranch ist, Collins. Du hast dich einfach hier breit gemacht und es für dich in Anspruch genommen. Oder verfügst du über eine Besitzurkunde? Vor allem aber habe ich dich zum Teufel getrieben, weil wir in deinem Haus die Haut eines Rindes mit dem Antelope Hill Brand fanden. Ich hätte dich aufhängen lassen können.“
Collins legte den Kopf etwas in den Nacken. Ein heimtückisches Schillern trat in seine wässrigen Augen. „Du hast mich vertrieben, Stirling, aber du hast mich nicht zerbrochen. Monatelang brütete ich über meiner Rache. Du erinnerst dich doch an das Versprechen, das ich gab?“
„Sicher, Collins.“
John sprach die beiden Worte sanft. Langsam ging er weiter. Collins duckte sich etwas, vermittelte einen sprungbereiten Eindruck. Er belauerte John wie ein Raubtier, das sich jeden Moment auf sein Opfer stürzt.
„Du versprachst, zurückzukehren und mich fertig zu machen“, sagte John und es klang auf besondere Art gelassen. „Ich aber warnte dich. Du scheinst zur Sorte der Unbelehrbaren zu gehören, Elwell Collins.“
Collins‘ Züge verzerrten sich. In seinen unterlaufenen Augen wütete grenzenloser, vernichtender Hass. Hass verzerrte auch seine Stimme, als er schnappte: „Diesmal werde ich nicht alleine sein, Stirling. In wenigen Tagen treffen einige Freunde von mir hier ein. - He, wo sind überhaupt deine Sattelwölfe, Rancher? Dein rauer Vormann Warren Kilpatrick und der schnellschießende Joe Walker?“
„Ich brauche keinen, um dich davon abzuhalten, hier wieder Fuß zu fassen, Collins.“ John machte eine kurze Pause, zwingend und durchdringend musterte er den anderen. „Bist du von alleine zurückgekommen, oder hat dich Clark Allison hergeholt?“ So fragte er plötzlich, und seine Frage kam überraschend, wie aus der Pistole geschossen.
Einen Schritt vor dem heruntergekommenen Farmer blieb John stehen. Er verströmte Unnachgiebigkeit und Härte. Dass die Winchester des Farmers auf seinen Leib deutete, ignorierte er.
Collins verriet sich mit keinem Lidschlag. Er spuckte John vor die Füße. „Du wirst von selbst dahinter kommen, Stirling.“ Die vom langjährigen, übermäßigen Alkoholgenuss verwüsteten Züge des Farmers wurden von einem bösen Grinsen zerlegt. „Spätestens an dem Tag, an dem der Antelope Hill Ranch der Todesstoß versetzt wird.“
„Verschwinde wieder, Collins, sonst garantiere ich für nichts“, drohte John und eine Vielzahl düsterer Gedanken stürmten mit Vehemenz auf ihn ein.
Collins stieß hervor: „Du fühlst dich verdammt stark und überlegen, Stirling. Allein die Tatsache, dass du ohne deine zweibeinigen Wölfe aufgekreuzt bist, zeugt von deiner Arroganz. ‚Iron‘ John nennen sie dich.“ Collins lachte schallend auf. „Und weil man dir diesen dämlichen Beinamen gegeben hat, hältst du dich für unschlagbar. Du denkst, dein Auftauchen allein lässt mich vor Angst und Ehrfurcht im Boden versinken.“
„Ich habe dich gewarnt, Collins“, versetzte John ungerührt. „Es war meine letzte Warnung.“ John wandte sich um. Er hatte alles gesagt.
Collins lachte gekünstelt auf - und wirbelte im nächsten Moment die Winchester herum ...
Instinktiv duckte John sich ab. Der gemeine Schlag wischte dicht über seinen Kopf hinweg. Hätte er getroffen, würde er ihm den Schädel zertrümmert haben. Mit einer Reflexbewegung rammte John dem Farmer den Gewehrlauf in den Bauch. Elwell Collins brüllte auf und knickte in der Mitte ein. Blitzschnell entwand John ihm die Waffe und schleuderte sie hinter sich. Er glitt einen Schritt zurück.
Collins stand gekrümmt da, presste beide Hände vor den Leib, keuchte abgehackt und stierte John völlig perplex an. Seit seinem unvermuteten Angriff auf John waren keine drei Sekunden vergangen.
Brechend sagte John: „Ich gebe dir drei Tage, Collins. Dann sehe ich nach, ob du noch hier bist. Falls ja, wird es rau für dich.“
„Du verdammter Hund!“, brach es wild und unbeherrscht aus Collins‘ Kehle, und der Farmer stieß sich ab. Wie von einem Katapult geschleudert flog er auf John zu. Mit diesem blitzartigen Angriff hatte John nicht gerechnet, und er reagierte einen Sekundenbruchteil zu spät. Der Aufprall des schweren Körpers warf John fast um. Collins‘ Faust traf ihn am Ohr, und John hatte das Gefühl, der Kopf würde ihm von den Schultern geschlagen. Vor seinem Blick schien die Welt zu explodieren.
Seine Not schien unüberwindlich zu sein, und seinem Gegner waren die Gesetze der Fairness unbekannt. Panik befiel John. Blindlings schlug er mit dem Gewehr zu. Er traf Collins am Hals und der Farmer taumelte zur Seite. Der Schwinger, den er im selben Moment auf die Reise schickte, zischte ins Leere. Collins wurde von der Wucht seines Schlages nach vorne getrieben.
Die Nebel vor Johns Augen lichteten sich. Er fand Zeit, sich auf den Gegner einzustellen. Collins wirbelte zu ihm herum und holte aus. John ließ das Gewehr fallen und blockte den Schlag ab, gleichzeitig stieß seine rechte Faust kerzengerade nach vorn. Mit der Wucht einer Dampframme knallte sie mitten in Collins‘ Gesicht.
Der Farmer stolperte zwei Schritte zurück. Ein gefährliches Grollen stieg aus seiner Brust, Blut rann aus seiner Nase. Er hob die Fäuste und giftete: „Ich schlage dich durch Sonn‘ und Mond, Stirling. Und wenn du mit der Nase im Staub liegst, zertrete ich dich wie ein lästiges Insekt.“
Und dann kam er. Seine Fäuste wirbelten wie Dreschflegel ...
*
John hatte Mühe, die Schläge Elwell Collins‘ zu parieren und abzublocken. Er schaffte es nicht, seinerseits einen Hieb anzubringen. Der Kampf wurde verbissen und unerbittlich geführt. Keiner der beiden Gegner gab sich eine Blöße. Ihre Fäuste prallten aufeinander, suchten eine Lücke in der Deckung des anderen oder wehrten einen wild geschwungenen Haken ab.
Wie ein Panther sprang John auf den Farmer zu, platzierte einen Haken auf dessen Brustbein und ließ sofort die Linke fliegen, mit der er Collins am Kinnwinkel erwischte. Einen Lidschlag lang hatte John das Gefühl, seine Handknochen zersplitterten unter der Wucht des Treffers.
Der Anprall warf Collins gegen die Wand des Farmhauses, dass es krachte. Aber Collins zeigte kaum Reaktion. Es war unglaublich, was er wegstecken konnte und mit welcher Ausdauer er kämpfte.
Collins schüttelte sich nur, ihm entrang sich ein abgerissenes Grunzen. Er rammte beide Fäuste in Johns Körper und stieß mit dem Kopf in das Gesicht des Ranchers. Im nächsten Moment zog er aus der Hüfte einen Schwinger, der wahrscheinlich einen Bullen von den Beinen geholt hätte.
John sprang im letzten Moment zurück und der Schlag pfiff ins Leere. Aus Collins‘ Hals kam das Knurren eines Wolfes. John hatte die Arme angewinkelt und die Fäuste gehoben. Ungestüm mit den Armen schwingend trieb ihn Collins vor sich her. In den Schlägen lag nichts als blinde Wut. Collins wollte den verhassten Rancher zerschlagen, ihn regelrecht zertrümmern - ihn wahrscheinlich sogar mit seinen Fäusten töten. Er zwang John, immer weiter zurückzuweichen.
In Collins‘ Gesicht glitzerte Schweiß. Die Anstrengung hatte es gerötet. Es war eine Grimasse des Hasses und Vernichtungswillens, sein Atem ging stoßweise und rasselnd.
Johns Rechte schoss nach vorn und durchbrach Collins‘ Deckung. Sie bohrte sich in die Magengrube des Farmers, der diesen Schlag mit einem gequälten Aufschrei quittierte. Die Luft wurde ihm aus den Lungen gedrückt, sein Oberkörper pendelte nach vorn, genau in Johns Uppercut hinein.
Die knallharte Linke ließ den Schädel Collins‘ wieder hochfliegen. Collins taumelte. Er wich einige Schritte zur Seite aus. Collins spürte nun die Wirkung von Johns Schlägen, aber er war hart genug, sie zu ertragen. Er begann John zu umrunden, belauerte ihn und suchte nach einer Blöße bei John. Seine blinde Wut schien kühler Überlegung gewichen zu sein. Er wirkte jetzt schnell, geschmeidig und sicher in seinen Bewegungen.
John drehte sich auf der Stelle. Unvermittelt unternahm er einen Ausfallschritt. Seine Linke zuckte nach Collins‘ Kopf, und der Bursche riss unwillkürlich beide Fäuste zur Deckung hoch. Johns Rechte knallte auf seine Leber. In diesem Schlag lagen alle Empfindungen, die John beherrschten.
Ein wilder Schrei löste sich aus Collins‘ Mund. Ein stahlharter Schwinger erstickte ihn. Der Farmer taumelte rückwärts, krachte erneut mit dem Rücken gegen die Hauswand, sein Hinterkopf schlug dumpf dagegen.
Collins ächzte. Blut rann aus seiner Nase und aus einigen Platzwunden in seinem Gesicht. Sein Blick war glasig. Die Benommenheit nach den unerbittlichen Treffern ließ seinen Kopf von einer Seite auf die andere pendeln. Er war jetzt angeschlagen, aber er war noch immer nicht kampfunfähig. Ein dämonischer Durchhaltewille riss ihn aus seiner Betäubung. Er wollte Rache. Eine Woge der tödlichen Leidenschaft überspülte seinen Verstand.
Collins drückte sich ab und stürzte John entgegen. Er legte all seine Kraft in diesen Angriff. Seine Fäuste flogen. Er kämpfte mit Kraft und Verbissenheit. Seine Zähne waren fest aufeinander gepresst, seine Lippen in der Anspannung verzogen. Er hatte die Umwelt vergessen.
Sein Angriff kam wie eine Explosion. Doch John blieb in den Knien elastisch. Er federte zurück, zur Seite, duckte sich ab, tauchte unter Collins‘ Heumachern hinweg, und bald spürte Collins, wie seine Arme erlahmten. Der Rhythmus seiner Schwinger kam längst nicht mehr so rasend.
Er hielt inne und schnappte nach Luft. Und jetzt begann John, ihn zu umtänzeln. Er bewegte sich leichtfüßig, mit der Geschmeidigkeit eines Pumas. Unvermittelt schnellte er auf Collins zu. Er warf sich mit der linken Schulter gegen den Leib des Farmers und feuerte ihm gleichzeitig die geballte Faust ins Gesicht. Collins stolperte rückwärts, ein Gurgeln quoll aus seinem Mund, von keinem bewussten Willen mehr gesteuert ließ er seine Rechte noch einmal fliegen, im nächsten Moment die Linke.
John, der dem ersten Schwinger ausweichen wollte, beugte sich genau in den Haken hinein. Er flog regelrecht zur Seite, Blitze zuckten vor seinen Augen, und die Welt schien sich um ihn herum zu drehen. Er wankte und spürte, wie seine Beine unter ihm nachgeben wollten. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen.
Collins füllte seine Lungen mit frischem Sauerstoff. Ihm entging Johns momentane Schwäche nicht. Der Gedanke, das Ruder doch noch zu seinen Gunsten herumzureißen, beflügelte ihn und schien ihm neue Kraft und Energie zu verleihen.
Wie durch wallenden Nebel sah John ihn vor sich auftauchen. Mit einer einzigen, kraftvollen Bewegung, an der sein ganzer Körper beteiligt zu sein schien, rammte Collins ihm das Knie in den Leib. Es gab einen grässlichen Laut, der an das Platzen einer Melone erinnerte.
John stöhnte mit weit aufgerissenem Mund. Der Atem entwich seinen Lungen wie der Überdruck aus einem Dampfkessel. Er sah nur noch feurige Garben, und dann traf ihn Collins mit aller Härte am Kinnwinkel. Sein Kopf wurde auf die linke Schulter gerissen, er sank auf die Knie, wie haltsuchend griffen seine Hände ins Leere. John war in diesen albtraumhaften Sekunden völlig orientierungslos, wusste nicht mehr, wo hinten oder vorne war.
„Ich zertrete dich wie einen Wurm!“, hechelte Collins. Seine Stimme klang kratzend, seine Worte fielen abgehackt. Er war erschöpft und die Treffer, die er einstecken musste, zeigten Wirkung. Im Moment aber triumphierte er. Und diesen Triumph kostete er aus.
Damit verschaffte er John die Zeit, die er brauchte, um seine Benommenheit zu überwinden und neue Reserven zu mobilisieren. Die Nebelschleier vor Johns Augen rissen. Verschwommen sah er Collins einen Schritt vor sich. In seinem Schädel dröhnte und hämmerte es. In seinen Ohren rauschte das Blut, sein Puls raste.
Und plötzlich sah John wieder klar. Sein Verstand funktionierte wieder. Seine Muskeln und Sehnen reagierten wieder auf die Signale seines Gehirns. Aus seiner knienden Haltung warf er sich nach vorn. Seine Arme umklammerten Collins‘ Beine. Mit einem kraftvollen Ruck riss John die Füße des Gegners vom Boden weg. Collins war total überrumpelt. Sekundenlang schien er quer in der Luft zu hängen. Seine Arme ruderten verzweifelt, aber da war nichts, woran er sich klammern konnte. Der Länge nach krachte er auf den Rücken.
John kämpfte sich hoch und keuchte.
Collins rollte auf den Bauch und stemmte sich in die Höhe. Aber ehe er die Knie durchdrücken und sich zu seiner vollen Größe aufrichten konnte, landete John eine knochentrockene Doublette an seinem Kinn. Collins‘ Kopf flog in den Nacken. Er sank auf die Knie zurück, ein dumpfer Ton brach über seine Lippen, und als ihn Johns weit aus der Hüfte geholter Schwinger genau auf die Kinnspitze traf, kippte er hinüber und blieb verkrümmt liegen.
Collins war fertig. Er hob den Kopf, versuchte, sich noch einmal hochzurappeln, fiel aber kraftlos zurück. In seinem zerschlagenen, schweiß-, schmutz- und blutverschmierten Gesicht zuckten die Nerven.
Johns Arme schmerzten bis in die Schultergelenke. Er spürte schmerzhafte Verspannungen in seinen Händen, und nur langsam legte sich in ihm der Aufruhr, der sein Innerstes aufgepeitscht hatte. Seine Atmung beruhigte sich, das Herz fand wieder zu seinem regulären Rhythmus zurück.
Ziemlich außer Atem stieß John hervor: „Drei Tage, Collins, dann komme ich wieder.“
Er holte zuerst sein Gewehr und seinen Hut, den er während des Kampfes verloren hatte, stülpte ihn sich auf den Kopf, und hob dann die Winchester des Farmers auf. Er ging damit zum Brunnen, schlug den Kolben mit einem einzigen Hieb auf dem gemauerten Rand ab und warf die Trümmer hinein. Dann bestieg er sein Pferd.
Elwell Collins röchelte: „Wenn du kommst, bin ich sicher nicht allein, Stirling. Meine Freunde sind bereits auf dem Weg zu mir. Und es ist ein Siedlertreck zum Sweetwater River unterwegs. Es ist Regierungsland. Du wirst ...“
John schnitt ihm brechend das Wort ab: „Wann begreifst du endlich, dass es das Land der Antelope Hill Ranch ist, Collins? Und zwar seit fast fünfzig Jahren ...“
Er nahm sein Pferd um die linke Hand und gab dem Tier den Kopf frei. Mit einem Schenkeldruck trieb er es an.
*
Vor John lagen die Gebäude der Diamant-A Ranch. Sie erhoben sich vor der dunkelgrünen Kulisse dicht zusammenstehender Pappeln, die das Ufergebüsch des Beaver Creek überragten.
In Johns Gesicht waren die Spuren seines Kampfes mit Elwell Collins deutlich zu erkennen. Am Brunnen saß er ab. Einige Helps traten aus den Ställen und Schuppen und beobachteten ihn. Aus dem Bunkhouse schoben sich eine Handvoll Cowboys ins Freie.
John hievte einen Eimer voll Wasser in die Höhe und wusch sich das Gesicht. Die kleinen Platz- und Schürfwunden brannten wie Feuer. Auf seinem Jochbein zeigte sich ein dunkler Bluterguss.
„Hallo, Nachbar!“
Als die beiden Worte gerufen wurden, wandte John sich dem Haupthaus zu. Auf der Veranda stand Clark Allison. Ein Lächeln, das John so falsch erschien wie eine Fünfzehn-Dollar-Note, umspielte seine schmalen Lippen.
John tippte mit dem Zeigefinger gegen die Krempe seines Stetsons, dann ließ er seine Stimme erklingen: „Ich komme geradewegs vom Sweetwater River, Allison. Elwell Collins ist zurückgekehrt. Er ist drauf und dran, sich wieder auf dem Gebiet der Antelope Hill Ranch breitzumachen.“
„Und ich dachte schon, Sie sind in eine Stampede geraten, Stirling. Haben Sie Collins zum zweiten Male auf die raue und unmissverständliche Art klar gemacht, dass er hier nichts verloren hat?“
„Ich glaube nicht, dass mir das gelungen ist. Ich denke auch, dass Collins nicht von sich aus zum Sweetwater zurückgekehrt ist. Er sprach von Freunden, die noch aufkreuzen sollen, und er äußerte, dass ein Siedlertreck zum Sweetwater unterwegs sei.“
Unablässig erforschte John, während er sprach, Clark Allisons Reaktionen. Aber dessen hintergründiges Lächeln veränderte sich nicht, abgesehen davon, dass es um eine Idee spöttischer wurde.
Allison rief: „Weshalb erzählen Sie mir das, Stirling? Es ist nicht mein Problem.“
„Sie sind sehr ehrgeizig, Allison, und Sie sind nicht damit zufrieden, nur die zweitgrößte Ranch im County zu besitzen. Daraus haben Sie nie ein Hehl gemacht. Sie wollen raus aus dem Schatten der Antelope Hill Ranch. Wo immer Sie eine Gelegenheit gefunden haben, mir zu schaden, nutzten Sie diese. Darum nehme ich an, dass Sie Elwell Collins zurückholten, und dass Sie auch die Heimstätter ins Land lockten, von denen Collins sprach.“
„Mit Ihnen geht die Fantasie durch, Stirling“, entrüstete Allison sich. Klirrend fügte er hinzu: „Wenn Sie hergekommen sind, um mich zu kränken, dann rate ich Ihnen, sofort wieder zu verduften. Ihre Herrlichkeit endet am Sweetwater.“
„Warum spielen Sie nicht endlich mit offenen Karten, Allison?“, rief John. „Ehe Sie vor einigen Jahren in diesen Landstrich kamen, gab es hier ein halbes Dutzend kleine Ranches. Auf eine Art und Weise, die zum Himmel schrie, machten Sie die zum Teil hochverschuldeten Viehzüchter fertig und rissen sich ihren Besitz unter den Nagel. Nun, scheint mir, bin ich dran.“
Clark Allison reckte seine breiten Schultern. „Mir reicht es jetzt, Stirling!“, zischte er. „Schwingen Sie sich auf Ihren Gaul und verschwinden Sie, ehe ich Sie von meinen Männern über den Sweetwater prügeln lasse. Wer gibt Ihnen überhaupt das Recht, auf meine Ranch zu kommen und mich derart zu beleidigen? Entspringt es Ihrer Angst, dass ich eines Tages tatsächlich größer sein könnte als Sie, dass ich Ihren Platz als ungekrönter King im County einnehme?“
„Immer wieder müssen meine Weidereiter ganze Herden von Rindern mit dem Diamant-A Brand über den Fluss zurücktreiben!“, sagte John. „Ihre Männer pöbeln meine Boys an - wo immer sie sie auch treffen - und beleidigen sie. Bringen Sie das Fass nur nicht zum Überlaufen, Allison. Irgendwann ist meine Geduld zu Ende.“
Clark Allisons Hände verkrampften sich um das Verandageländer, dass die Knöchel weiß unter der Haut hervortraten. Seine Zähne knirschten übereinander, hart traten seine Backenknochen hervor. John fand das Gesicht Allisons plötzlich widerwärtig und abstoßend. Allison schürzte die Lippen und stieß hervor: „Ihr Stern ist am Sinken, Stirling. Das Land, das Sie für sich beanspruchen, ist freie Weide. Kommen Sie mir nicht mit dem Unsinn, dass die Regierung irgendwann vor einem halben Jahrhundert das Land südlich des Sweetwater Ihrem Großvater geschenkt hat. Jeder kann das Land nutzen. Ober er nun Weizen und Mais anbaut, oder ob er Rinder züchtet. Sie hatten kein Recht, Elwell Collins zu vertreiben. Und Sie müssen akzeptieren, dass neue Siedler an den Sweetwater kommen und sich Parzellen abstecken. Hätten Sie das Land rechtzeitig auf Ihren Namen ins Landbesitzregister eintragen lassen, dann wäre das etwas anderes. Das haben Sie versäumt, Stirling, und jetzt ist es zu spät, nachdem die Regierung auf die Durchsetzung des Heimstättengesetzes pocht. Ich habe die Entwicklung nicht verschlafen. Ich habe mir meine Landansprüche rechtzeitig gesichert. Denn ich war nicht vermessen genug zu glauben, aus einem Gewohnheitsrecht heraus für alle Zeiten Besitzansprüche ableiten zu können.“
„Wagen Sie es nur nicht, ihre schmutzigen Finger nach der Antelope Hill Ranch auszustrecken, Allison“, warnte John. „Sie beißen sich die Zähne aus. Wenn Sie dennoch den Krieg wollen, können Sie ihn haben.“
John ging zu seinem Pferd und kletterte in den Sattel. Er spürte die Nachwirkungen seines Kampfes mit Elwell Collins in sämtlichen Gliedern. Ein Ächzen entrang sich ihm. Er rief: „Bisher habe ich Ihren Ehrgeiz und Ihr Bestreben, der Große und Mächtige im County zu werden, nicht so ernst genommen. Das jedoch tue ich von nun an. Ich werde mich zu wehren wissen.“
John wendete sein Pferd und ritt davon.
Ein Grinsen, triefend vor Hohn, zog Clark Allisons Lippen in die Breite.
Aus dem Pulk der Cowboys vor der Mannschaftsunterkunft löste sich ein großer Mann und kam zur Veranda. Er sagte: „Stirling weiß, woher der Wind weht, Clark. Er wird um sich beißen wie ein in die Enge gedrängter Wolf.“
„Komm herein, Lester“, versetzte Allison nach einem schnellen Blick in die Runde seiner Männer, die herumstanden. Was er zu sagen hatte, war nicht für die Ohren aller bestimmt. Er machte kehrt und ging ins Haus. Lester Duncan folgte ihm. Im Ranch Office setzten sie sich. Erwartungsvoll fixierte Duncan den Rancher.
Clark Allison nickte. „Ich habe John Stirling langsam da, wo ich ihn haben will. Es muss jetzt Schlag auf Schlag gehen, bis er sich nicht mehr scheut, seinen Besitz mit Pulver und Blei zu verteidigen, und sich jenseits von Recht und Ordnung stellt. Er muss Amok laufen. Und dann ist das Gesetz an der Reihe.“
„Ein geradezu perfekter Schachzug, Clark. Ich frage mich nur, wie du am Ende die Siedler wieder loswerden willst. Außerdem wird dir Emerson Howe mit seiner Rustlermannschaft am Bein kleben wie ein Bleiklotz.“
„Keine Sorge, Duncan. Die Geister, die ich gerufen habe, weiß ich am Ende auch wieder zu bannen. Die Siedler kommen ziemlich mittellos ins Land. Ich unterstütze sie mit Krediten. Wie aber sollen sie diese zurückzahlen, wenn beispielsweise Feuer ihre Ernten vernichtet oder wenn der Sweetwater über die Ufer tritt und ihre Äcker und Felder überschwemmt?“
Duncan nickte verstehend. Er war mit Allison vor einigen Jahren ins Land gekommen und nahm auf der Diamant-A die Rolle des Vormanns ein. Beide konnten auf eine ziemlich bewegte, dunkle Vergangenheit zurückblicken. „Man könnte einen Felsen sprengen und so den Sweetwater anstauen“, murmelte Duncan versonnen.
„Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten“, meinte Allison. „Was Emerson Howe anbelangt, so mache ich mir seinetwegen keine allzu großen Gedanken. Er hat seinen Preis genannt, und ich habe ihn akzeptiert. Wenn alles vorbei ist, verschwindet er mit seiner Bande auf Nimmerwiedersehen.“
„Wenn er nur nicht gierig wird und auf die Idee kommt, sich ein größeres Stück von dem Kuchen abzuschneiden, den es seiner Meinung nach zu verteilen gilt.“
Allison lachte verächtlich auf. „Dann verschwindet Howe auch auf Nimmerwiedersehen. Allerdings nicht aus Wyoming, sondern unter der Erde.“
*
Zwei Tage später ...
Es war eine stockfinstere Nacht. Die tiefziehenden Wolken verdunkelten den Himmel. Dort, wo der Mond stand, hellte ein gelber, verschwommener Lichtfleck die bedrohlich anmutenden Wolkenberge auf. Weit im Westen flammte hin und wieder ein greller Blitz über den Horizont. Danach war fernes, lang anhaltendes Donnergrollen zu vernehmen. Von einem zum anderen Mal wurden die Donnerschläge lauter, was den Cowboys Amos Dalton und Ben Frawler verriet, dass sich das Unwetter sehr schnell näherte. Eines jener gefürchteten Frühjahrsgewitter war im Anmarsch.
Die Rinder schliefen unruhig. Die Cowboys ritten in entgegengesetzter Richtung um die lagernde Herde. Nach jeweils einer halben Runde trafen sie aufeinander. Sie beneideten ihre Gefährten, die im weit entfernt liegenden Weidecamp in ihren Zelten wie Murmeltiere schliefen.
Amos war nervös. Er war müde. Die harte Round up-Arbeit steckte ihm in den Knochen. Ihn fröstelte. Wenn irgendwo ein Stier brüllte, zuckte er zusammen. Die Nacht verkündete Unheil.
Wieder zuckte im Westen ein Blitz aus den sich drohend türmenden Wolken. Der Horizont wurde in bläuliches Licht getaucht, und für Sekunden wurden die Konturen der Berge aus der Finsternis gerissen. Ein berstender Schlag folgte. Die Unruhe in der Herde verstärkte sich. Viele Tiere ruckten hoch, witterten, prusteten, brüllten und muhten.
Mürrisch ritt Amos seine Runde. Einmal heulte in den Bergen ein Coyote. Lang gezogen, durchdringend und schauerlich. Andere stimmten ein. Wie ein vielstimmiger Choral wehte das Heulen in die Täler. Das Pferd unter Amos warf nervös den Kopf in den Nacken und wieherte. Amos knirschte eine Verwünschung.
Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich Ben Frawler auf. Pferd und Reiter waren durch die Finsternis nur ein großer, unförmiger Schemen. Anhaltendes Donnergrollen rollte durch die Nacht. Es begann zu tröpfeln. Heiser rief Ben: „Das wird eine verdammte Nacht, Amos, das sage ich dir. Die tausend Kuhschwänze sind noch ziemlich nervös vom Zusammentrieb, und wenn ein Blitz zwischen sie fährt, haben wir das Chaos perfekt. Dann wäre die Arbeit eines ganzen Tages futsch.“
„Vielleicht ist McGibbon klug genug und schickt uns einige Männer zur Verstärkung“, antwortete Amos lahm. „Hast du irgendetwas Verdächtiges wahrgenommen, Ben?“
„No.“ Ben lachte freudlos auf. „In einer solchen Nacht bleiben sogar die Skunks in ihren Löchern.“
Die Pferde traten unruhig auf der Stelle. Die Nervosität ihrer Reiter schien wie ein Funke auf sie übergesprungen zu sein. Ringsum war Muhen und Brüllen. Es handelte sich um die ersten tausend Herefords, die für den Trail nach Kansas City vorgesehen waren. In spätestens zwei Wochen sollte eine Herde von fünftausend Stück Vieh marschbereit in der Senke stehen.
„Okay, Ben, mach‘s gut“, murmelte Amos, hob die Hand zum Gruß und trieb das Pferd mit einem Schenkeldruck an. Sie ritten auseinander.
Mit dem Wind trieben schwerere Regentropfen heran, und bald prasselte der Regen Amos ins Gesicht. Er schlug den Kragen seines Regenumhanges hoch und rückte sich den Hut tiefer in die Stirn.
Ein krachender Donnerschlag drohte den Weltuntergang anzukündigen. Unmittelbar vorher war ein gewaltiger Blitz zur Erde gerast. In vielfältigen Echos verrollte der Donner, und in das sich entfernende Grollen hinein glaubte Amos durch das Rauschen des Regens dumpfes Getöse zu vernehmen. Er zerrte das Pferd in den Stand, drehte das Ohr in den Wind, der von Westen kam, und lauschte angespannt.
Amos hatte sich nicht geirrt. Das pochende Geräusch verursachten mehrere Pferde, die schnell getrieben wurden.
Alarmglocken schlugen in Amos‘ Bewusstsein an. Wie eine Warnung vor Unheil und Untergang zuckte es durch seinen Verstand. Fast automatisch griff Amos nach dem Gewehr und zog es aus dem Sattelschuh, repetierte.
Einen Augenblick versuchte er sich damit zu beruhigen, dass vielleicht Tom McGibbon Verstärkung aus dem Weidecamp schickte. Er verwarf diesen Gedanken sogleich wieder, denn das Camp lag im Osten, der Hufschlag aber näherte sich von Westen.
Das Herz schlug dem Cowboy plötzlich bis zum Hals hinauf. Wie Fieber rann es durch seine Blutbahnen. Der Gedanke, dass vielleicht Clark Allison ein Rudel Reiter schickte, um Terror auf die Weide der Antelope Hill Ranch zu bringen, kam bei Amos und brannte sich in seinem Bewusstsein fest. Ratlos schaute er hinter sich, aber da war nur die Masse der erregten Rinder, deren Leiber in der Finsternis ineinanderzufließen schienen. Von Ben war nichts mehr zu sehen.
Für einige Sekunden wurde der Hufschlag von einem berstenden Donner verschluckt. Dann wurde er wieder laut, und er schien Amos jetzt viel deutlicher vernehmbar. Unschlüssig rutschte der Cowboy im Sattel herum. Sollte er versuchen, das Camp zu erreichen, um Hilfe zu holen? Es war etwa zwei Meilen entfernt, denn McGibbon und die anderen Boys hatten am Abend das Lager verlegt, um am kommenden Morgen gleich mit der Arbeit beginnen zu können.
Amos verwarf diesen Gedanken wieder. Er spürte den Regen nicht mehr. Auch die Kälte nahm er nicht mehr wahr. Hart klatschten die hagelkörnerschweren Tropfen in Amos‘ Gesicht. Rastlosigkeit und Beklemmung, die den Cowboy im Klammergriff hielten, bereiteten ihm nahezu körperliches Unbehagen. Härter krampften sich seine Fäuste um das Gewehr. Schwer trug der Weidereiter an seiner Unschlüssigkeit.
Das Hufgetrappel war jetzt ganz nahe. Amos‘ Augen schmerzten, so sehr strengte er sie an, um mit seinem Blick die Nacht zu durchdringen. Aber die Dunkelheit war nach wenigen Schritten schon wie ein schwarzer Vorhang, die Welt schien in treibenden Regenwänden und in einem bedrohlichen, endlosen Nichts zu enden.
Und plötzlich spuckte die Nacht einen Pulk Reiter aus. Nach Amos griff eine jähe Panik. Und es kostete ihn allen Willen, seine plötzliche Angst, die ihm den Hals austrocknen und sein Herz ein wildes Stakkato gegen die Rippen hämmern ließ, zu unterdrücken.
*
Die Horde Reiter kam zum Stehen. Der Wind trieb Wortfetzen an Amos Daltons Gehör. Der Cowboy hielt den Atem an. Verstehen konnte er nichts.
Plötzlich flammten Sturmfeuerzeuge auf. Funken sprühten. Amos wurde von der Wucht des Begreifens getroffen wie von einem Faustschlag. Dynamit! Seine Nackenhaare sträubten sich. Er riss das Gewehr an die Schulter ...
Die Banditen schleuderten die Dynamitstangen weit von sich. Sie beschrieben einen weiten Bogen durch die Luft, Funken sprühend, eine dünne Rauchspur hinter sich herziehend. An verschiedenen Stellen fielen die Sprengladungen zwischen die Rinder. Für die Spanne einiger Lidschläge, in der sich jeder der Schufte einen zweiten der hochexplosiven Stäbe aus der Tasche angelte, geschah gar nichts.
Plötzlich aber stießen grelle Feuerblitze zwischen den Rindern in die Höhe. Gleichzeitig erfolgten die Explosionen, verschmolzen ineinander, die Blitze weiteten sich zu blendendem Leuchten aus, und im brüllenden Getöse wurden die schweren Tierleiber um die Detonationsherde zur Seite geschleudert.
Amos schüttelte den Bann ab, der ihn fesselte, und feuerte.
Noch standen die Rinder unter dem Schock der Explosionen, der ihre Instinkte lähmte. Die Banditen hielten die Zügel derart gestrafft, dass die Gebisse aus Stahl den Tieren tief und schmerzhaft in die Mäuler schnitten. Sie scharrten mit den Hufen und stampften, aber die eisenharten, zähmenden Hände der Rustler ließen sie nicht ausbrechen.
Mit dem Aufpeitschen der Winchester wurde einer der Outlaws vom Pferd geschleudert. Der Reiterpulk riss auseinander. Raue Rufe erschallten. Und gleich darauf versank das Rauschen und Prasseln des Regens in den Geräuschen, die die Herde verursachte und die begleitet wurden von Blitz und Donner. Da war wieder das erregte Muhen und Brüllen, das Stampfen vieler hundert Hufe, der trockene Klang, wenn Horn gegen Horn stieß.
Amos würgte und schluckte hart. Die Banditen trieben ihre Pferde an. Amos überwand sich. Auch er setzte seinen Braunen in Bewegung. Durch die Finsternis und die Regenschleier nahm er das Gewoge wahr, das durch die Herde ging. Hier und dort brach ein Rind aus dem Durcheinander. Das Getöse nahm zu und bald war die ganze Senke voll von dem erdbebenhaften Rumoren.
Amos hämmerte seinem Pferd die Sporen in die Seiten. Das Tier streckte sich. Einer der Reiter sprengte auf ihn zu. Der Bandit schwang seinen Colt. Amos riss das Pferd zurück. Die Hufe schlitterten über den aufgeweichten Boden. Der Cowboy zog den Gewehrkolben an die Schulter und drückte ab. Ein ellenlanger Mündungsblitz stieß aus der Mündung, er spürte den leichten Rückschlag, repetierte sofort wieder.
Amos vernahm einen spitzen Aufschrei, und im ersten Moment glaubte er, seine Kugel hätte den Halunken vom Pferd geworfen. Sofort aber wurde er eines besseren belehrt. Der Oberkörper des Burschen ruckte wieder in die Höhe, und dann lohte es bei ihm auf.
An der Flanke der Herde entlang donnerte Ben Frawler dem erdbebenhaften Dröhnen auf der Westseite der Senke entgegen. In seiner Faust lag der Colt. Die Hufe seines Pferdes schienen kaum den Boden zu berühren.
Die Herde setzte sich in Bewegung. Sie stand kurz vor der Stampede. So manches Tier ging unter im Hin und Her der schweren Leiber und kam nicht mehr hoch. Stiere brüllten voller Panik.
Amos‘ Schuss hatte den Reiter lediglich am Oberarm gestreift. Tief auf den Pferdehals geduckt jagte der Bandit jetzt heran. Das Tier unter Amos scheute, und der Cowboy konnte nicht ruhig zielen. Ein zweiter Bandit tauchte auf. Er fegte heran, und der Cowboy feuerte blindlings. Amos‘ Verstand begann zu blockieren.
Mündungsfeuer stießen fahlglühend auf Amos zu. Eine Kugel bekam sein Pferd in den Kopf, die andere bohrte sich mit einem fürchterlichen Schlag in die Brust des Cowboys. Das stürzende Pferd begrub ihn unter sich. Jäh riss Amos‘ Denken ab.
Ben Frawler nahm einen dunkel und drohend anmutenden Reiterschemen nur wenige Schritte vor sich wahr. Im vollen Galopp feuerte er mit dem Colt. Der Sattel des Banditen war plötzlich leer. Das reiterlose Pferd lief weiter. Ben Frawler überholte es. Und wieder sah Ben einen der Banditen vor sich. Von der Seite näherte sich ein zweiter Reiter. Ben feuerte, und er konnte erkennen, dass sein Geschoss den Burschen, der vor ihm ritt, auf den Pferdehals warf. Doch da blitzte es bei dem Banditen auf, der von rechts kam. Er jagte eine ganze Serie von Kugeln aus dem Lauf. Bens Oberkörper wurde von den Treffern geschüttelt und herumgerissen. Der Weidereiter stürzte vom Pferd. Sein Gesicht lag im nassen, niedergetrampelten Gras, Ben Frawler fiel in eine gähnende, bodenlose Leere ...
Ein greller Blitz lichtete die Finsternis. Wie glitzernde Glaskugeln starrten die gebrochenen Augen der ermordeten Cowboys in die zuckende Helligkeit hinein. Noch im Tode waren ihre Gesichter vom Grauen entstellt.
Ein rauer Befehl wurde gebrüllt. Die Stimme des Mannes vermochte kaum den Lärm zu überbieten. Wieder lohten Sturmfeuerzeuge auf ...
Schon zogen die nächsten Dynamitpatronen ihre verhängnisvolle Bahn. Wie das Krachen von Feldhaubitzen erhoben sich die Explosionen über die Herde, begleitet vom Auseinanderplatzen der grellen Blitze. Wieder wurden Rinder wie von einer Riesenfaust weggeschleudert. Und dann war das Inferno perfekt.
Die Schufte rissen die Pferde herum und jagten sie zum Rand der Senke. Die Herefords drängten auseinander. Brüllen und Muhen prallte gegen die Hügelflanken und Wälder und wurde zurückgeworfen. Rinder stürzten und kamen nicht mehr hoch. Andere stiegen auf, drückten die Tiere unter sich zu Boden. Sie waren wie rasend vor Panik. Und schließlich brach die Herde auseinander. Wie ein entfesseltes Element, wie von Furien gehetzt, rannten die Rinder in alle Richtungen davon. Der Boden erzitterte wie bei einem Erdbeben. Was den von Panik und Entsetzen getrieben Tieren in den Weg kam, wurde gnadenlos niedergetrampelt. Tote und sterbende Rinder blieben liegen.
*
John war fassungslos und erschüttert, als ihm am folgenden Vormittag die Hiobsbotschaft von dem blutigen Überfall von einem Boten McGibbons übermittelt wurde. Als aber wenige Stunden später die beiden getöteten Weidereiter und auch die toten Outlaws auf die Ranch gebracht wurden, als er in die erstarrten, wächsernen Gesichter Amos Daltons und Ben Frawlers blickte, kam der Hass in heißen, giftigen Wogen.
„Kennt jemand die toten Banditen?“, fragte er. Seine Stimme war belegt und rau wie Sandpapier.
Die Männer, die um den flachen Wagen mit den Leblosen herumstanden, schüttelten die Köpfe. Ihre Mienen waren Spiegelbild ihrer Empfindungen. Über die Gesichter liefen die verschiedensten Gemütsregungen, die von stummer Ergriffenheit über Verwirrung und Betroffenheit bis hin zur tödlichen Leidenschaft reichten. Und es gab wohl keinen unter den Cowboys und Helps, der nicht an blutige Vergeltung dachte. Da war aber auch die hilflose Ohnmacht angesichts dieses Irrsinns der brutalsten Gewalt und des Strudels von vernichtendem Terror, der die Antelope Hill Ranch heimgesucht hatte.
Johns Mund bildete eine zusammengekniffene, entschlossene Linie. Er riss sich von seinen trübsinnigen Gedanken und Überlegungen los und stieß hervor: „Ich glaube, Leute, dass das Maß voll ist. Joe, sattle für uns Pferde. Wir reiten nach South Pass City und erstatten Anzeige beim Sheriff. Anschließend versuchen wir, die Spur der Banditen aufzunehmen. Ich schwöre bei den beiden ermordeten Jungs, dass ich nicht eher ruhen will, bis ich die Höllenhunde, die sie auf dem Gewissen haben, zur Rechenschaft gezogen habe.“
Er quoll voll Härte und kompromissloser Entschiedenheit aus seinem Mund, und jeder, der den Schwur vernommen hatte, ahnte, dass er für John Gesetz sein würde.
John hob noch einmal an: „Du bist, solange ich fort bin, der Boss auf der Ranch, Warren. Alles läuft wie gewohnt weiter. Schicke alle verfügbaren Männer auf die Weide, damit sie die Herde für den Trail nach Missouri zusammenstellen.“
„Beim Henker, John, ich käme viel lieber mit!“, maulte der Vormann.
Doch John winkte ab. „Einer muss hier das Kommando übernehmen. - Wir reiten in einer Viertelstunde, Joe. Vergiss nicht, genügend Munition und Proviant einzupacken. Es kann einige Tage dauern, bis wir zurück sind.“
*
Als sie in die Main Street von South Pass City einbogen, sahen sie die sieben Conestoga Schoner am Rand der Fahrbahn stehen. Männer, Frauen und Kinder bevölkerten die Straße und Gehsteige. Unwillkürlich fielen die beiden Männer ihren Pferden in die Zügel. John schluckte trocken. Joe Walker stieß rau hervor: „Ich fresse meinen Hut, wenn das nicht die von Elwell Collins angekündigten Heimstätter sind. Du lieber Himmel, John, was ist plötzlich gegen dich im Gange?“
„Ich soll vernichtet werden“, antwortete John, und seine Stimme klang belegt. „Es ist unglaublich, mit welcher Energie Clark Allison meinen Untergang betreibt.“
Für ihn stand fest, dass auch die Banditen, die in der Nacht seine Weide heimsuchten, von Clark Allison angeheuert worden waren. Beweise hatte er allerdings nicht. Aber John hatte sich geschworen, dem Drahtzieher des Verbrechens die Maske des Biedermannes vom Gesicht zu reißen.
Sie ritten zu den Schonern hin. Ein Mann in grober Kleidung lehnte mit übereinander geschlagenen Beinen und verschränkten Armen an einem der Fuhrwerke. Ausdruckslos musterte er John, als dieser vor ihm das Pferd parierte. John fragte: „Ihr seid zum Sweetwater unterwegs, nicht wahr?“
Der Siedler nickte und erwiderte: „So ist es, Mister. Hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass das Land südlich des Flusses besiedelt werden soll?“
„Das Land südlich des Sweetwater gehört der Antelope Hill Ranch“, antwortete John schroff.
Die Lippen des Mannes zuckten, dann knurrte er: „Wir wissen Bescheid. Es wird Probleme geben, denn John Stirling, der Boss der Antelope Hill Ranch, soll ein ziemlich harter, despotischer und unduldsamer Bursche sein. Der Verdruss mit ihm ist wahrscheinlich unausbleiblich.“
„Ich bin John Stirling!“ Wie Bleitropfen fielen diese Worte von Johns Lippen.
Der Bursche beim Wagen duckte sich etwas und zog den Kopf zwischen die Schultern. Seine Arme fielen aus der Verschränkung, ein betroffener Laut wand sich ihm aus der Kehle.
Dann aber fing er sich und gab kühl zu verstehen: „Sie werden sich damit abfinden müssen, Stirling. Wir haben das Gesetz auf unserer Seite.“
„Da bin ich mir nicht so sicher, mein Freund“, entgegnete John brechend. „Darum rate ich euch, eure Fuhrwerke nicht auf dem Gebiet der Antelope Hill Ranch anzuhalten.“
Wütend ritt er weiter. Walker schloss sich ihm an. Der Mann rief ihnen hinterher: „Wir sind eine starke Gemeinschaft, Stirling. Ihnen gehört das Land am Sweetwater nicht. Wir haben es ordnungsgemäß erworben.“
John und Joe ritten zum Sheriff Office. Sie leinten ihre Pferde an und gingen hinein. Sheriff Andrew Steele hatte am Fenster gestanden und das Treiben auf der Main Street beobachtet. Jetzt ging er hinter seinen Schreibtisch und setzte sich. Griesgrämig blickte er den beiden Männern entgegen.
„Gebieten Sie dem, was sich anbahnt, Einhalt, Steele“, begann John ohne Umschweife. „Ich dulde die Siedler nicht auf meinem Weideland. Meine Rinder brauchen freien Zugang zum Sweetwater. Sie wissen genau, dass das Land, das die Antelope Hill Ranch beansprucht, meinem Großvater vor vielen Jahren vom Gouverneur übereignet wurde.“
Der Sheriff seufzte. „Wie soll ich etwas aufhalten, das nicht aufzuhalten ist, Stirling?“, sagte er lahm. „Die Schenkung wurde nirgends vermerkt. Eine Schenkungsurkunde existiert nicht mehr. Diese Menschen, die mit ihren Fuhrwerken gestern nach South Pass City gekommen sind, haben Kaufverträge. Ich kann sie nicht daran hindern, das Land, das sie erworben haben, in Besitz zu nehmen.“
„Hinter diesem schmutzigen Geschäft steckt Clark Allison!“, fauchte John. „Vergangene Nacht suchten Banditen meine Weide heim. Zwei meiner Cowboys wurden ermordet und tausend Rinder mit Dynamit in alle Winde versprengt. Elwell Collins ist zurückgekehrt. Dahinter steckt System, Sheriff. Die Antelope Hill Ranch soll vernichtet werden. Falls Allisons schmutziger Plan aufgeht ...“
Steele winkte ab und unterbrach damit John. „Es ist nicht Allison, es ist die Regierung, die das Land besiedelt. Die Zukunft des Landes liegt nämlich nicht in der Rinderzucht, sondern in der Landwirtschaft. Der gesamte Mittelwesten befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Die Besiedlung soll Handel und Wandel bringen und den Städten Blüte und Wachstum bescheren.“
Andrew Steele legte beide Hände auf die Schreibtischplatte, lehnte sich zurück, und es schien, als formulierte er seine weiteren Worte erst im Kopf, ehe er weitersprach. Schließlich tönte er: „South Pass City kann ein Umschlagplatz von Waren und Gütern, ein wirtschaftlicher Knotenpunkt werden. Von hier aus wird das Land nach Westen erschlossen. Auswanderertrecks werden über den South Pass nach Kalifornien und Oregon ziehen, und eines Tages führt auch eine Eisenbahnlinie hierher. Die Stadt wird Bedeutung erlangen, das kann sie aber nur, wenn die Impulse für den Aufschwung von ihr und ihrem Umland ausgehen.“
„Dagegen ist gewiss nichts einzuwenden“, dehnte John. „Es passt mir nur nicht, dass diese Wunschträume auf Kosten der Antelope Hill Ranch verwirklicht werden sollen, Sheriff. Und darauf läuft wohl alles hinaus, nicht wahr? Ich rate Ihnen, diese Entwicklung aufzuhalten. Lassen Sie die Siedler nicht an den Sweetwater, soweit er mein Weideland nach Norden begrenzt. Und klopfen Sie Clark Allison auf die Finger. Ihm geht es nicht um die Zukunft dieses Landstrichs. Er will sich die Antelope Hill Ranch unter den Nagel reißen. Um an sein Ziel zu gelangen, ist ihm jedes Mittel recht. Er spannt die Heimstätter nur vor seinen schmutzigen Karren. Eines Tages aber - wenn sie ihm im Weg sind - macht er die Farmer fertig, so wie er die Smallrancher fertiggemacht hat, denen einst die Weidegründe nördlich des Sweetwater gehörten.“
Sheriff Andrew Steele konnte dem düsteren, durchdringenden Blick Johns nicht standhalten. Nervös kaute er an seinem Daumennagel herum.
Johns Organ grollte: „Sie wissen jetzt Bescheid, Steele. Sie sind gefordert. Wenn Sie nicht in der Lage sind, dem Gesetz auf meiner Weide Geltung zu verschaffen, dann nehme ich es selbst in die Hand. Ich lasse mir von niemand auf der Nase herumtanzen.“
Andrew Steele schien auf seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch regelrecht zu schrumpfen. Groß, wuchtig, ehrfurchtgebietend und voll Zorn stand John vor ihm. Er hatte die Arme in die Seiten gestemmt. Sein Gesicht war wie aus Granit gemeißelt. In den pulvergrauen Augen war ein hartes, unduldsames Flirren.
Kleinlaut erwiderte der Sheriff: „Was soll ich denn tun, Stirling? Soll ich zu Clark Allison reiten und ihn auf Ihre Beschuldigung hin verhaften? Haben Sie irgendeinen Beweis für Ihre Behauptungen? Ich kann auch nicht tagelang die Wind River Range durchstreifen auf der Suche nach den Banditen, die auf Ihrer Weide waren. Und was die Siedler anbetrifft, so besitzen sie ordnungsgemäße Kaufverträge und ...“
Rau stieg es aus der Kehle des Ranchers: „Um die Schufte von vergangener Nacht kümmere ich mich selbst, Steele.“ John beugte sich vor und stemmte seine Arme auf den Schreibtisch. „Noch einmal, Steele: Das Land südlich des Flusses gehört mir. Auch wenn es nicht im Grundbuch auf meinen Namen eingetragen ist. Der damalige Gouverneur des Wyoming-Territoriums schenkte es Old Mathew, meinem Großvater. Jahrzehntelang gab es daran nichts zu rütteln. Dass das so bleibt, dafür garantiere ich. Notfalls kämpfe ich um mein Recht.“
Fast weinerlich verzog der Sheriff das Gesicht. „Sie haben eine starke Mannschaft, Stirling. Von mir aus - nehmen Sie das Gesetz auf der Antelope Hill Weide selbst in die Hand. Ja, kehren Sie mit eisernem Besen auf Ihrem Land, aber verlangen Sie nicht von mir, dass ich mich zwischen zwei Mühlsteine stelle und zermalmen lasse. Dazu bin ich erstens zu alt, zweitens zu schwach und drittens ...“
„Zu feige!“, vollendete John Stirling verächtlich. „Sie degradieren das Symbol des Gesetzes, das Sie an Ihrer Weste tragen, zu einem Stück wertlosem Blech, Steele. Warum danken Sie nicht ab? Es gibt genügend gute Männer in South Pass City, die als Sheriff in Frage kämen. Sie sind eine Schande für die gesamte sterntragende Gilde.“
Im hageren, faltigen Gesicht Andrew Steeles arbeitete es. Seine Lippen zuckten. Er knetete seine schweißnassen Hände. Er spürte Johns Verachtung. Die anklagenden, bitteren Worte des Ranchers hatten ihn wie Peitschenhiebe getroffen. Sie brannten sich in ihm fest, und trotz des Unbehagens, das ihn erfüllte, spürte er den Hass, der sich wie ätzende Säure in sein Gemüt schlich.
Grollend fuhr John fort: „Vielleicht wende ich mich, wenn ich die Weide der Antelope Hill Ranch gesäubert habe, an den County Sheriff, Steele. Soweit ich weiß, macht er mit Versagern wie Ihnen kurzen Prozess. Er reißt ihnen den Stern herunter und feuert sie. - Joe, gehen wir. Bei dieser traurigen Figur - scheint mir - ist jedes Wort gegen die Wand gesprochen.“
Nach einem letzten Blick auf Andrew Steele, in dem sich nicht die Spur von Verständnis oder Entgegenkommen zeigte, schwang John auf dem Absatz herum und stapfte aus dem Office.
Joe Walker folgte ihm.
*
Draußen empfing sie ein diesiger, kühler Frühlingstag. Tief zogen am Himmel die Wolken. Auf den Gipfeln der himmelstürmenden Berge lag noch Schnee. Die Fahrbahn war vom letzten Regen aufgeweicht. Auf der Straße war kaum Betrieb. Die beiden Pferde am Haltebalken peitschten mit den Schweifen.
John sagte: „Wir genehmigen uns noch einen Drink im Silver Star. Ich will mit Carol sprechen, ehe wir der Spur der Banditen folgen.“
Steifbeinig schritt Joe neben John her zum Silver Star Saloon. Unter ihren Stiefeln schmatzte und gurgelte der knöcheltiefe Schlamm. Sie umrundeten einige Wasserpfützen, und schließlich stiegen sie die vier Stufen zum Vorbau empor. Sie hinterließen auf den Bohlen dicke Schmutzspuren. Auf einem Lattenrost, das vor der Schwingtür lag, traten sie den größten Schmutz von ihren Stiefeln ab, dann gingen sie in den Inn.
Es waren fünf Männer aus der Stadt anwesend. Hinter dem Tresen hockte Lionel Gates, der Keeper, auf einem Stuhl. Er hatte die Hände über dem Bauch verschränkt und döste vor sich hin. Jetzt zuckten seine Lider in die Höhe, er sah John Stirling und Joe Walker und erhob sich.
Nach knappem Gruß bestellte John zwei doppelte Bourbons. Dann fragte er: „Ist Carol oben?“
Lionel griente schief und anzüglich. „Yeah. Carol sah Sie schon in die Stadt reiten, Stirling. Ich glaube, Sie werden bereits ungeduldig erwartet.“
Er schenkte den Schnaps ein, John nippte daran, dann wandte er sich an Joe. „Wir reiten in einer halben Stunde. Warte hier auf mich.“
Er ging zur Treppe, die ins Obergeschoss führte, und stieg sie hinauf. Die Stufen knarrten unter seinem Gewicht. Joe trank, dann suchten er sich einen Tisch beim Fenster und setzte sich.
Indessen ließ Carol den Rancher in ihre Wohnung. Als sie die Tür geschlossen hatte, nahm John sie in die Arme und küsste sie. „Es ist gut dich zu sehen und im Arm zu halten, Darling“, murmelte er.
Sie funkelte ihn an. „Nachdem du es selten genug für notwendig findest, dich um mich zu kümmern, sollte ich dir nicht mal mehr die Tür öffnen, John Stirling. Wann warst du das letzte Mal in der Stadt? Warte mal ...“ Sie schien nachzudenken. „Es ist fast eine Woche her. Eine Woche, in der mir mindestens zehn Männer den Hof gemacht haben. Irgendwann ...“
„Irgendwann frage ich dich, ob du meine Frau werden willst, Carol Godfrey. Dieser Tag ist gar nicht mehr so fern. Und du wirst ja sagen. Sollten tausend andere Kerle dir den Hof machen, dir zu Füßen liegen, dir den Himmel auf Erden versprechen - heiraten wirst du mich.“
Im ersten Moment starrte sie ihn betroffen an, dann aber lachte sie, und ihre Lippen gaben eine Reihe ebenmäßiger, perlweißer Zähne frei. „Überredet, John. Wenn das eben ein Heiratsversprechen war, dann können mir tausend andere Männer gestohlen bleiben.“
„Dann sind wir uns ja einig“, lächelte er und führte sie zu einem der Plüschsessel, drückte sie sanft hinein, und wurde wieder ernst. Er nahm ihr gegenüber Platz, legte die Unterarme auf die Knie und ließ die Hände baumeln. „Vergangene Nacht haben Banditen auf meiner Weide für Furore gesorgt“, begann er. „Sie jagten eine Herde von etwa tausend Rindern mit Dynamit auseinander und ermordeten zwei Cowboys. Ben Frawler und Amos Dalton.“
Zutiefst erschreckt und fassungslos schaute Carol ihn an. „Ich weiß nicht, John“, sagte sie plötzlich, „aber irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass jemand ein Kesseltreiben auf dich veranstaltet. Collins ist zurückgekehrt, in seinem Schlepptau kommen Siedler, um dir das Land am Sweetwater streitig zu machen, und nun die Sache auf deiner Weide. Mir scheint, dahinter steht Methode.“
„Yeah.“ John nickte und wirkte versonnen. „Für mich ist Clark Allison der Drahtzieher all der Niederträchtigkeiten. Leider existiert die Schenkungsurkunde nicht mehr, die das Weideland südlich des Flusses als das Eigentum der Stirlings ausweist. Als vor zwanzig Jahren die Ranch niederbrannte, fiel auch sie den Flammen zum Opfer.“
„Du hast dich an den Sheriff gewandt?“
„Andrew Steele ist ein Versager, ein jämmerlicher Haufen Ohnmacht, Hilflosigkeit und Feigheit. Der Stern an seiner Brust ist ein Hohn.“
Unten auf der Straße wieherte ein Pferd. John achtete nicht darauf.
„Du willst also auf eigene Faust das Problem in den Griff kriegen?“, fragte Carol.
„Was bleibt mir denn anderes übrig? Soll ich tatenlos zusehen, wie man mich fertig macht, wie man mir langsam aber sicher die Luft abdreht?“
„Das bedeutet Kampf, John.“ Carol sprach es herb aus, ihre Mundwinkel zuckten, ihre blauen Augen wurden von Sorge verdunkelt.
Von der Straße wehte dumpfer Hufschlag herauf.
„Ich muss hart durchgreifen“, murmelte John bitter. „Andernfalls wird die Antelope Hill Ranch ruiniert. Dafür aber haben mein Vater und Großvater nicht gekämpft.“
Vor dem Saloon parierten fünf Reiter ihre Pferde. Es waren bärtige, verwegen anmutende Kerle, in deren Zügen ein rastloses, sündhaftes Leben tiefe Spuren eingegraben hatte. Sie glitten aus den Sätteln. Um ihre Hüften wanden sich patronengespickte Gurte, tief an ihren Oberschenkeln hingen die Holster mit den Sechsschüssern. Sie schlangen die Zügel um den Querholm und staksten in den Inn.
Die Bürger der Stadt, der Keeper und Joe Walker starrten sie an, taxierten sie, versuchten sie einzustufen.
Sie gingen zum Schanktisch. Eine Stimme rasselte: „Gib uns Brandy, mein Freund. Aber keinen Fusel. Sonst lassen wir dich die ganze Flasche selbst aussaufen.“
Joe Walker spürte, dass mit den fünf Typen der Verdruss in den Saloon gekommen war.
*
Sie tranken. Einer der Fremden hüstelte, als ihm der scharfe Schnaps in der Kehle brannte. Ein anderer wandte sich an den Keeper: „Wir wollen zum Sweetwater River, zu Elwell Collins. Wie weit müssen wir noch reiten?“
Lionel zog den Kopf zwischen die Schultern.
Joe Walker war hellhörig geworden. Ihm entging nicht der hilfesuchende Blick, den Lionel ihm zuschoss. Er nahm die fünf Fremden noch schärfer unter die Lupe, kniff die Lider eng, in seinen Augen erschien ein Grübeln, ein Forschen, seine Miene verschloss sich.
„Sie - Sie müssen nach Südosten reiten, Gentlemen“, erklärte Lionel stockend. „Immer am Fluss entlang. Nach etwa zwölf Meilen stoßen Sie auf Collins‘ Siedlerstelle.“
„Der gute Elwell Collins scheint ja mächtige Probleme mit einem großspurigen und selbstherrlichen Viehzüchter zu haben“, ließ der Sprecher von eben wieder seine Stimme erklingen.“ Er lachte scheppernd. „John Stirling ist der Name des Weidepiraten, man hat ihm den Beinamen ‚Iron‘ gegeben. Gehört er wirklich zur eisernen Sorte?“
Langsam, fast schwerfällig stemmte sich Joe Walker am Tisch in die Höhe. Lionel schoss ihm einen warnenden Blick zu. Das Netz von Falten in seinen Augenwinkeln, die zusammengepressten Lippen und die mahlenden Kiefer verrieten, dass Joe unter einer immensen innerlichen Anspannung stand.
Mit wiegenden Schritten und pendelnden Armen näherte er sich dem Schanktisch. Leise klirrten seine Sporen. Zwei Schritte hinter dem falkenäugigen und gewiss sehr hartbeinigen Quintett blieb er stehen. Sie hatten ihn kommen hören, wandten sich aber nicht um, warteten und lauerten. Joe wippte auf den Fußballen, seine Stimme grollte: „Ja, John ‚Iron‘ Stirling gehört zur eisernen Sorte, Strangers. Und nicht Elwell Collins hat Probleme mit der Antelope Hill Ranch, es ist vielmehr so, dass er es ist, der den Ärger macht. Er nimmt Land für sich in Anspruch, das ihm nicht gehört. Er ist ein Landräuber und obendrein ein Viehdieb der übelsten Sorte, der es nur John Stirlings Gutmütigkeit und Fairness zu verdanken hat, dass ihm damals der Hals nicht lang gezogen wurde.“
Seine Worte waren wie Hammerschläge gefallen. Und der letzte Satz schien noch in der Luft zu hängen, als die Kerle sich umdrehten und Front zu Joe einnahmen. Sie musterten ihn von Kopf bis Fuß, der eine oder andere ausdruckslos, der Anführer der Horde, ein großgewachsener, hagerer Bursche mit schwarzen Haaren und einem brutalen Ausdruck um den Mund, mit unverhohlener Ironie.
Joe Walker verdammte unvermittelt seine Unbeherrschtheit. Er fühlte sich plötzlich nicht wohl in seiner Haut. Eine unbeugsame, mitleidlose Strömung ging von den Sattelstrolchen aus wie etwas Tierisches. Joe spürte es ganz deutlich, und die Gefahr, in der er schwebte, berührte ihn wie ein eisiger Hauch.
„Bist du ein Freund Stirlings?“, schnappte der Sprecher des Rudels.
Ein Ruck durchfuhr Joe. „Ich arbeite auf der Antelope Hill Ranch“, versetzte er laut.
„Ein stinkender Kuhtreiber!“, höhnte einer der Kerle, ein anderer lachte spöttisch, und ein dritter knurrte böse: „Er riskiert eine verdammt große Lippe, Scott, findest du nicht? Vielleicht sollten wir dieses Großmaul etwas auf seine richtige Größe zurechtstutzen. Was meinst du?“
Joe maß den Sprecher von oben bis unten. Er hatte zu seiner alten Sicherheit zurückgefunden. „Du kannst es ja versuchen, Mister!“, schnaubte er herausfordernd. „Wahrscheinlich rauche ich dich hinterher in der Pfeife.“
„Yeah, er hat ein großes Mundwerk“, sagte der Bursche namens Scott. „Aber das hat er nur, weil er sich im Fahrwasser der Antelope Hill Ranch überlegen, stark, mächtig und unantastbar fühlt.“ Seine Brauen schoben sich zusammen. „Dabei weiß er noch gar nicht, dass die Tage der großen und mächtigen Ranch gezählt sind“, fuhr er dann eisig und vielversprechend fort. „Und nicht mehr John ‚Iron‘ Stirling wird in diesem Landstrich den Ton angeben, sondern ...“
Er brach ab, grinste wie ein Teufel. Die Verworfenheit, die seine Züge prägte, war erschreckend. Was er gesagt hatte, klang in Joe Walker, dem Keeper und den fünf Städtern nach wie eine höllische Prophezeiung.
„Sondern?“, fauchte Joe. „Warum sprichst du den Namen nicht aus, Mister? Wer ist der Hundesohn, der der Antelope Hill Ranch das Wasser abzugraben versucht? Ist sein Name vielleicht Clark Allison? Wer seid überhaupt ihr? Gehört ihr gar zu den Halsabschneidern, die in der vergangenen Nacht zwei gute Cowboys ermordeten?“
„Mein Name ist Galbraith - Scott Galbraith. Jetzt weißt du auch, wer dich in die Hölle schicken wird, Cowpuncher. Da wir sowieso beabsichtigen, mit der Antelope Hill Ranch aufzuräumen, mache ich bei dir den Anfang. - Tretet zur Seite, Leute.“
Seine Kumpane folgten mit hohngetränktem Grinsen seiner Aufforderung. Die fünf Städter erhoben sich schnell und verschwanden ohne zu bezahlen. Joe Walkers Rechte legte sich auf den Griff des Sechsschüssers.
Abgesehen vom rhythmischen Knarren der Pendeltür, die nach und nach ausschwang, war es jetzt still im Silver Star Saloon - gefährlich still. Und als das rhythmische Knarren abbrach, breitete sich eine bleierne, lähmende Atmosphäre im Schankraum aus.
Zwei Schritte trennten Joe von Galbraith. Eine absolut tödliche Distanz. Für beide. Außer dieser Galbraith war sich seiner absoluten Überlegenheit mit dem Sechsschüsser sehr sicher. Joe schluckte trocken und mühsam. Er schaute Galbraith in die glitzernden Reptilienaugen und sah darin den Tod lauern.
Scott Galbraith‘ Rechte hob sich über den abstehenden, abgegriffenen Coltknauf. Die Finger waren gekrümmt wie die Klaue eines Greifvogels. Ohne jede Gemütsregung stieß Galbraith hervor: „Du wirst doch nicht kneifen, Cowpuncher?“
Die überhebliche Entschlossenheit Galbraith‘ irritierte Joe und verstärkte die Nervosität in ihm. Er spürte ein flaues Gefühl im Magen, um nicht zu sagen Übelkeit. Jeder Muskel seines Gesichts wirkte straff, stramm und angespannt wie bei einem Mann, dessen Gefühle in heftiger Zwietracht entflammt waren und den alle möglichen Zweifel quälten.
Joe Walker hatte in seinem fast vierzigjährigen Leben manchen Kampf bestanden und war ein erfahrener, furchtloser Mann geworden. Jetzt aber kroch ihm zum ersten Mal vor einem Revolverduell etwas kalt den Rücken herauf. Er wusste das Gefühl nicht gleich zu deuten, aber aus dem hohngetränkten Grinsen, das plötzlich die Lippen Galbraith‘ umspielte, schloss er, dass der Gunslinger sich seiner Sache völlig sicher zu sein schien. Es war echte Überlegenheit, die Galbraith verströmte, keine zur Schau getragene Überheblichkeit.
Da rief auf der Treppe John Stirling rau und brechend: „Da habe ich schätzungsweise auch noch ein Wort mitzureden, Gents!“
Er kam langsam die Treppe herunter. Wie hineingeschmiedet lag der Colt in seiner Faust. Der Daumen lag quer über der Hammerplatte. Unmissverständlich deutete die Mündung auf Scott Galbraith. Johns Gesicht war hart und kantig, seine Stirn düster umwölkt.
„Es gibt keinen Kampf!“, peitschte seine Stimme. Und ohne Joe anzusehen fragte er: „Was sind das für Kerle? Weshalb suchen sie Streit?“
Zischend stieß Joe die Luft durch die Nase aus. Er zog den Colt und ließ den Lauf von einem der Kerle zum anderen pendeln. Grimmige Genugtuung erfüllte ihn plötzlich, und er presste hervor: „Fünf Revolverhaie, die zu Elwell Collins möchten. Sie scheinen ziemlich gut Bescheid zu wissen über die Verhältnisse hier. Er“ - Joe deutete mit dem Colt auf Galbraith - „posaunte, dass die Tage der Antelope Hill Ranch gezählt wären, und dass nicht mehr du, sondern irgendein anderer Mister künftig den Ton in diesem Landstrich angeben wird.“
Lauernd standen die fünf Strolche da. Die Hand eines jeden befand sich in unmittelbarer Nähe des Schießeisens. In der angespannten Atmosphäre schien die Luft regelrecht zu knistern, als wäre sie elektrisch aufgeladen.
Da knackte es hinter den Kerlen metallisch. Lionel Gates, der Keeper, knirschte: „Was ich in den Händen halte, ist ein solider Bleistreuer, Gentlemen, und in jedem Lauf befindet sich eine Ladung grob gehacktes Blei. Wenn ich durchziehe, seid ihr Hackfleisch. Also nehmt die Flossen von den Colts und hebt sie.“
Die fünf Kerle standen wie zu Salzsäulen erstarrt. Scott Galbraith‘ Zähne mahlten.
*
John zeigte ein grimmiges Grinsen ohne jede Freundlichkeit. Seine Lippen sprangen auseinander: „Lionel meint es genauso, wie er es sagt, Strangers. Also hoch die Flügel, oder müssen wir euch erst die Ohren abschießen?“
Langsam - aufreizend langsam - hoben sie die Hände bis in Schulterhöhe. Galbraith knirschte hassgetränkt: „Du bist also der große und mächtige John ‚Iron‘ Stirling? Nun weiß ich wenigstens, wie du aussiehst. Irgendwann in allernächster Zeit stehen wir uns sicherlich wieder gegenüber. Doch dann werden die Rollen vertauscht sein.“
„Er heißt Scott Galbraith“, erklärte Joe Walker. „Vielleicht sollten wir mal bei Steele die alten Steckbriefe durchblättern. Ich verwette alles, was ich habe, gegen ein altes, verlaustes Hemd, dass uns diese Galgenvogelvisage von einem der Fahndungsblätter entgegengrinst.“
„Tretet vom Tresen weg und stellt euch in einer Reihe auf!“, befahl John. „Haltet sie in Schach.“ Damit meinte er Joe und den Keeper. Dann holsterte er den 45er, trat hinter Galbraith und zog ihm die Waffe aus dem Futteral. Es war ein langläufiger Remington. John öffnete den Verschluss der Trommel, hielt die Waffe mit dem Lauf nach oben und ließ die Trommel rotieren. Nacheinander rutschten die Patronen heraus und fielen auf die Dielen. Dann schloss er die Trommel und stieß Galbraith den Colt wieder ins Holster.
Dieselbe Prozedur wiederholte er bei Galbraith‘ Kumpanen. Sie knirschten mit den Zähnen, standen da wie sprungbereite Raubtiere, angesichts der drohend auf sie gerichteten Waffen jedoch hätte jeder Widerstand Selbstmord bedeutet. Vor allem die Parkergun in Lionel Gates‘ Fäusten flößte ihnen den allergrößten Respekt ein.
„Wo sind deine Kaltschnäuzigkeit und überhebliche Selbstsicherheit geblieben, Galbraith?“, stieg es grollend aus Joes Kehle.
Galbraith ignorierte ihn. „Und jetzt?“, zischte er wie eine Schlange, den Blick auf John gerichtet.
„Jetzt wirst du mir zuhören, Galbraith“, dehnte John. Er trat dicht vor den Strolch hin. „Das Land, auf dem Collins siedelt, gehört mir. Ich bin nicht bereit, auch nur einen Quadratzoll davon abzugeben. Da das Gesetz in diesem Landstrich versagt, bin ich gezwungen, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich werde Collins und alle anderen, die sich widerrechtlich auf meinem Land festzusetzen gedenken, auf die schonungslose Art fortjagen, und ihr fünf Figuren werdet es nicht ändern können. Ihr handelt euch allenfalls heißes Blei ein. Also reitet dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid.“
„Steck dir deine Ratschläge an den Hut, Stirling!“, bellte Galbraith‘ Organ. „Kommt, Leute, wir gehen!“
„Ein zweites Mal warne ich euch nicht!“, drohte John. „Und sollte ich einen von euch Halunken auf dem Weidegebiet der Antelope Hill Ranch antreffen, dann geht es ihm dreckig.“
Galbraith setzte sich in Bewegung. John trat zur Seite. Die fünf Kerle stiefelten zur Tür. John nahm Lionel die Shotgun aus den Händen und folgte ihnen. Hinter ihm trat Joe auf den Vorbau. Galbraith und seine Männer leinten ihre Pferde los und kletterten in die Sättel. Sie zerrten die Tiere herum und ritten mit einem bösen Versprechen in den Augen im Trab davon.
„Da hat sich Collins ein paar höllische Nummern hergeholt“, murmelte Joe. „Diese Kerle sind gewiss nicht billig.“
„Es sind die Freunde, von denen Collins sprach“, erklärte John kehlig. „Tatsächlich aber wird es wohl so sein, dass Clark Allison diese Sattelwölfe finanziert.“
Joe ließ den Colt einmal um den Finger wirbeln und versenkte ihn im Holster. Galbraith und sein Gefolge waren um einen Knick der Main Street verschwunden.
„Reiten wir“, kam es düster von John.
*
Sie ritten hinaus zu der Senke, in der die Herde vor dem nächtlichen Anschlag gestanden hatte. Viele tote Rinder und Amos Daltons erschossenes Pferd lagen herum. Es regnete leicht. Doch manchmal riss die Wolkendecke auf und die Sonne brach durch. Das Land dampfte. Aus den Wäldern stieg der Nebel wie weißer Rauch.
Zwischen den Hügeln nahmen sie die Spur der Banditen auf. Ihre Pferde hatten eine richtige Schneise in das knöchelhohe, junge Gras getreten. Sie folgten der Fährte nach Westen. Bald durchquerten sie die Hügel. Nach drei Stunden schälten sich die ersten bewaldeten Buckel der Wind River Range aus dem Dunst. Weiter nördlich zog sich eine Hügelkette mit steilen Hängen von Osten nach Westen. Turmhohe Felsgebilde überragten die Baumwipfel, dichter, dunkler Wald bedeckte auch die Abhänge und stieß weit in die Senken und Täler hinein.
John hielt an, zog sein Pferd um die linke Hand und erkundete mit seinem Blick das Terrain nach Süden zu. Auch da wuchteten bewaldete Kuppen empor. Sie waren versetzt, und es gab genügend Durchlässe.
Die Fährte führte nach wie vor schnurgerade nach Westen. Aber sie war längst nicht mehr so deutlich wie am Morgen. Das Gras richtete sich bereits wieder auf.
John sagte: „Wenn Allison die Schufte ins Land geholt hat, dann hält er sie akribisch von seiner Ranch fern, damit auf keinen Fall jemand eine Verbindung zwischen ihm und den Banditen herstellen kann.“
„Vielleicht legten sie auch nur eine falsche Spur“, antwortete Joe. „Möglicherweise warten sie auch irgendwo auf uns, um uns mit heißem Blei zu empfangen. Es war vielleicht ein Fehler, ihnen ohne die Mannschaft zu folgen.“
„Wir müssen eben die Augen offen halten.“
Sie zogen zwischen den Hügeln dahin. Manchmal mussten sie weit in die Täler reichenden Waldzungen oder steilen Hügel ausweichen. Und schließlich wurde der Graswuchs immer karger, der Untergrund nahm an Festigkeit zu, und dann war es blanker Fels, über den sie ritten. Aber es gab immer wieder Hinweise, die ihnen verrieten, dass sie sich noch auf der Fährte der Outlaws befanden. Die Hufe krachten und klirrten.
Die Pferde trugen sie tiefer in die Wind River Range hinein.
Weit vor ihnen erhob sich eine Felswand. Einige Schluchten zerteilten sie. Sie ritten an der Wand entlang ein Stück nach Norden und drangen dann in eine der Klüfte ein. Der Hufschlag wurde von den Echos verzerrt. Die Schlucht endete, und das für die Wind River Range typische, bewaldete Hügelland schloss sich an. Sie folgten der Talsohle und ahnten nicht, dass sie drei eiskalte Augenpaare seit einiger Zeit vom Waldrand im Norden aus beobachteten. Einer der Kerle knurrte: „Das sind keine harmlosen Pilger, sage ich euch. Ich fresse meinen Hut, wenn das nicht zwei Schnüffler sind, die uns John Stirling hinterhergeschickt hat.“
„Was denken wir lange darüber nach?“, dehnte ein anderer. „Legen wir sie einfach um. Ob sie nun von der Antelope Hill Ranch kommen oder nicht: Wenn sie noch einige Meilen in dieser Richtung reiten, stoßen sie auf das Camp.“
Der Sprecher repetierte und zog den Gewehrkolben an seine Schulter, drückte das linke Auge zu und zielte sorgfältig. Auch die beiden anderen Kerle legten die Waffen an. Fast gleichzeitig brüllten die Gewehre auf.
John und Joe vernahmen den Knall. John warf sich instinktiv auf den Pferdehals, heiß fuhr es ihm über den Rücken. Er hämmerte geistesgegenwärtig dem Tier die Sporen in die Seiten. Es schnellte erschreckt nach vorn.
Joe stürzte vom Pferd. Das erschreckte Tier sprang an und lief ein Stück weiter.
John warf sich aus dem Sattel. Er hatte die Winchester in den Fäusten. Er rollte sich weg, gelangte in eine Mulde, federte hoch und gelangte in den Schutz eines Felsbrockens. Die Kugeln, die sie ihm schickten, ließen Sand und Gesteinssplitter fliegen. Ein Querschläger jaulte grässlich.
Als die Schüsse verklungen waren, knirschte einer der Heckenschützen: „Der Bursche hat mehr Glück als Verstand. Allerdings nützt es ihm nicht viel. Geben wir ihm den Rest.“
Sie warteten mit den Gewehren im Anschlag. Als John seinen Kopf über den Felsen schob, drückten sie ab, und er zog ihn schnell wieder zurück. Im nächsten Moment aber schnellte er hinter dem Felsen hervor. John setzte alles auf eine Karte. Ehe die Banditen durchgeladen hatten, landete er im Sattel. Das Tier streckte sich.
Mit dem Peitschen der Schüsse riss John sein Pferd zur Seite. Er spürte den glühenden Strahl der Kugel an seiner Wange. John jagte den Braunen den Abhang hinauf und als der nächste Schuss krachte, war er zwischen den uralten Stämmen in Deckung.