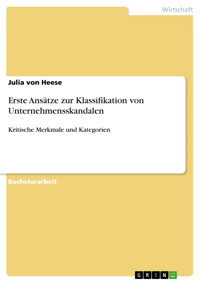CPOE-Systeme im Einsatz zur Reduzierung von Medikationsfehlern im Krankenhaus E-Book
Julia von Heese
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Unternehmensethik, Wirtschaftsethik, Note: 2,0, Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Wirtschaftswissenschaft), Veranstaltung: Seminar im Bereich Wirtschaftsinformatik, Sprache: Deutsch, Abstract: 2,4% bis 3,8% der Krankenhausaufenthalte gehen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen zurück. Solche vermeidbaren Krankenhausaufenthalte können nicht nur tödlich für Patienten enden, sondern verursachen im Gesundheitssystem nach groben Schätzungen Kosten i.H.v. 3,5 Milliarden Dollar jährlich. Andere Schätzungen, die den Untersuchungsradius auch auf andere durch UAW bedingte Behandlungsfehler ausdehnen und weitere Folgen berücksichtigen kommen zu weitaus höheren Schätzungsergebnissen in Bezug auf Sterblichkeit der Patienten und Kosten. Beleuchtet man die Ursachen dieses Phänomens genauer, so kommt zum Vorschein, dass die zunehmende Multimorbidität älterer Patienten zu Multimedikationen führt, die es für den in seiner ärztlichen Routine festgelegten, behandelnden Arzt erschwert, die Wechselwirkungen verschiedener Arzneimittel abzuwägen. Standardverfahren zur Medikation sind bisher nur halbtechnische Verfahren. Das MAI-System (Medikation erfassen, Angemessenheit bewerten, Intervention durchführen) stellt ein halbtechnisches Verfahren dar, mit dessen Hilfe in der heutigen Praxis begonnen wird, die Risiken der Multimedikation zu reduzieren. Von der Wirklichkeit des Kommunikationsprozesses zwischen Arzt und Patient abweichend wird dabei jedoch von einem idealtypischen Kommunikationsprozess ausgegangen, der nach wie vor fehleranfällig ist, insbesondere im Hinblick auf die individuelle Schulung des jeweils behandelnden Arztes. Das seit 2003 in Heidelberg erprobte CPOE-System verfolgt das Ziel, Bestandsaufnahme, Medikationsbewertung sowie Abstimmung der Therapieziele und Verordnungsvorschlag nahezu fehlerfrei nach den Bedürfnissen des Patienten und unter Berücksichtigung der individuellen Patientenvorgeschichte aufeinander abzustimmen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Darstellung der Funktionsweise von CPOE-Systemen und deren Wirkung bzgl. der Reduktion von UAW sowie einer Betrachtung der betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen und Kosten bei der Einführung eines CPOE-Systems.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltverzeichnis
1 Einleitung
2 Problemfeld der Medikationsfehler und Lösungsansatz
2.1 Wissenschaftliche Definition des Medikationsfehlers
2.2 Ursachen für Fehler bei der Medikation
2.3 Möglichkeiten zur Eindämmung von Medikationsfehlern
3 Rechnergestützte Verordnungssysteme zur Verhinderung von Medikationsfehlern
3.1 Computerized Physician Order Entry (CPOE-System)
3.1.1 Aufbau des CPOE-Systems
3.1.2 CPOE-System mit Clinical-Decision-Support-System (CDSS-Komponente)
3.1.3 Bedingungen und Variablen für die erfolgreiche Implementierung eines CPOE-Systems
3.2 Positive und negative Effekte rechnergestützter Informations-systeme in der Medizin
3.3 Kosten eines CPOE-Systems
4 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
2,4% bis 3,8%[1] der Krankenhausaufenthalte gehen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen[2] zurück. Solche vermeidbaren Krankenhausaufenthalte können nicht nur tödlich für Patienten enden, sondern verursachen im Gesundheitssystem nach groben Schätzungen Kosten i.H.v. 3,5 Milliarden Dollar jährlich[3]. Andere Schätzungen, die den Untersuchungsradius auch auf andere durch UAW bedingte Behandlungsfehler ausdehnen und weitere Folgen berücksichtigen kommen zu weitaus höheren Schätzungsergebnissen in Bezug auf Sterblichkeit der Patienten und Kosten. Beleuchtet man die Ursachen dieses Phänomens genauer, so kommt zum Vorschein, dass die zunehmende Multimorbidität[4] älterer Patienten zu Multimedikationen führt, die es für den in seiner ärztlichen Routine festgelegten, behandelnden Arzt erschwert, die Wechselwirkungen verschiedener Arzneimittel abzuwägen. Standardverfahren zur Medikation sind bisher nur halbtechnische Verfahren[5].
Das MAI-System (Medikation erfassen, Angemessenheit bewerten, Intervention durchführen) stellt ein halbtechnisches Verfahren dar, mit dessen Hilfe in der heutigen Praxis begonnen wird, die Risiken der Multimedikation zu reduzieren. Von der Wirklichkeit des Kommunikationsprozesses zwischen Arzt und Patient abweichend wird dabei jedoch von einem idealtypischen Kommunikationsprozess ausgegangen, der nach wie vor fehleranfällig ist, insbesondere im Hinblick auf die individuelle Schulung des jeweils behandelnden Arztes. Das seit 2003 in Heidelberg erprobte CPOE-System verfolgt das Ziel, Bestandsaufnahme, Medikationsbewertung sowie Abstimmung der Therapieziele und Verordnungsvorschlag nahezu fehlerfrei nach den Bedürfnissen des Patienten und unter Berücksichtigung der individuellen Patientenvorgeschichte aufeinander abzustimmen[6].
Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Darstellung der Funktionsweise von CPOE-Systemen und deren Wirkung bzgl. der Reduktion von UAW sowie einer Betrachtung der betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen und Kosten bei der Einführung eines CPOE-Systems.
2 Problemfeld der Medikationsfehler und Lösungsansatz
Zunächst ist eine Definition darüber nötig, was ein Medikationsfehler ist und was dessen Ursachen sind. Im Anschluss daran erfolgt eine erste Übersicht möglicher Lösungsversuche zur Problembewältigung.
2.1 Wissenschaftliche Definition des Medikationsfehlers
Unter Medikationsfehlern ist Folgendes zu verstehen: solche Fehler entstehen im Prozess der Verordnung, Transkription (Übertragung der Verordnung in den Medikationsplan), Abgabe, Verabreichung oder Kontrolle von Medikamenten[7]. Diese Fehler können bspw. mit dem Produkt oder der Produktbezeichnung, der Verpackung, der Kommunikation und Ausbildung des Behandlungsteams oder der Kontrolle der Behandlung zusammenhängen[8]. Medikationsfehler sind potenzielle, unerwünschte Arzneimittelereignisse, d.h. schwerwiegende Medikationsfehler, die möglicherweise einen Patienten schädigen oder dessen Tod verursachen können. Ebenfalls werden Dosierungsfehler unter diesen Begriff gefasst.
2.2 Ursachen für Fehler bei der Medikation
Im Allgemeinen kann das Verfahren der Medikation immer zu einem Risiko für die Gesundheit des Patienten führen. In der Gruppe der vermeidbaren Medikationsfehler muss jedoch im Interesse der Patientensicherheit die Frage nach den Ursachen gestellt werden. 40% bis 50% aller Medikationsfehler sollen auf falsche Verordnungen durch den behandelnden Arzt zurückzuführen sein. Weitere 10% bis 12% der Medikationsfehler treten bei der Übertragung von Medikationsplänen auf, 11% bis 14% bei der individuellen Zusammenstellung der Medikamente und schließlich 26% bis 53 % bei der Verabreichung an den Patienten. Schließt man persönliches Verschulden als Ursache für den Medikationsfehler aus, so bleibt die Frage, ob Krankenhäuser an einem Organisationsdefizit im Medikationsprozess leiden. Bei Betrachtung der Fehler-quellen, die in die Gruppe „menschliche Faktoren“ fallen, ergibt sich folgendes Bild: unleserliche Handschrift, Gedächtnislücken, Müdigkeit und Ablenkung durch Verwaltungsaufgaben sind insbesondere bei Ärzten Ursachen dafür, dass angesichts eines Berges an Medikamenten Medikationsfehler beim Schritt der Medikationsbewertung auftreten[9]. Dosierungsfehler in Bezug auf die körperliche Kondition des Patienten wie Alter, Gewicht oder Allergien können ebenso wichtige und ausschlaggebende Faktoren sein, die bei der Medikationsbewertung nicht in den Abwägungsprozess einfließen[10].
2.3 Möglichkeiten zur Eindämmung von Medikationsfehlern
Angesichts der oft einfachen Möglichkeiten, diese oft schwerwiegenden Fehler einzudämmen wie bspw. durch die Eingliederung von Pharmazeuten in das Behandlungsteam, eine verbindliche Überprüfung der Dosis sowie durch ein gesetzliches Verbot, Medikamente mit ähnlichen Namen zu verkaufen, erscheint für den Medikationsprozess in Bezug auf die Fehlerreduktion insbesondere die Einführung von CPOE-Systemen vorteilhaft. Neben CPOE-Systemen kommt außerdem die Einführung von elektronischen Patientenakten, automatisierte Medikamentenausgabemaschinen und eine elektronische Medikationsverwaltung via Tablet-PC in Betracht[11].
3 Rechnergestützte Verordnungssysteme zur Verhinderung von Medikationsfehlern
Die Abwägung von Neben- und Wechselwirkungen eines Medikaments ist im Interesse der Patientensicherheit ein unabdingbarer Faktor, der umfangreiches Wissen über medizinische Erfahrungen mit reziproken Wirkungen von Arzneimitteln voraussetzt[12]. Dieser Abwägungsprozess zur Auswahl des richtigen Medikaments wird teilweise durch elektronische Informationssysteme, sog. CPOE-Systeme, unterstützt[13].
3.1 Computerized Physician Order Entry (CPOE-System)
Was bedeutet die Abkürzung CPOE? Der Begriff CPOE stammt aus dem Englischen und bedeutet im dortigen Sprachgebrauch: Computerized Physician Order Entry“, „Computerized Provider Order Entry“ oder „Computerized Prescriber Order Entry“. Je nach dem Schwerpunkt eines Systems, ob dieser also auf den Wechselwirkungen zum menschlichen Stoffwechsel liegt (physican) oder ob die Symptome einer Krankheit oder Inhaltsstoffe von Medikamenten ausschlaggebender Ansatzpunkt des Systems sind (provider oder prescriber), verändert sich die Bedeutung des Buchstaben „P“. Erste Schritte machten diese rechnergestützten Systeme bereits in den 1970’er Jahren[14]. Ein CPOE-System ist ein Computerprogramm, das den Medikationsauswahlprozess durch die Speicherung von Arzneimittelwirkungen erleichtern soll, indem es eine benutzerfreundliche Suchfunktion zur Recherche von Arzneimitteln (Handelsname, Wirkstoff, ggf. Indikation, Preisvergleich) und eine Auswahl des jeweiligen Medikaments (inklusive der empfohlenen Dosierung) aus einem Portfolio anbietet. Besondere Beachtung findet in einem CPOE-System die Berücksichtigung patientenindividueller Daten wie Alter, Gewicht, Krankheit, Komedikation (gemeint ist damit die Multimedikation) und Nierenfunktion. Die Berücksichtigung dieser Daten im Medikationsprozess verhindert Fehler in der Medikationsauswahl und dient damit dem Zweck, UAW zur Sicherheit des Patienten auszuschließen[15]. Dazu gehören auch automatisierte Dosenberechnung sowie mögliche Arzneimittelinteraktionen und Allergien. Der Ressourceneinsatz lässt sich damit optimieren, medizinische Fehler minimieren, die Dokumentation wird genauer und Übertragungsfehler sind an dieser Stelle ausgeschlossen. Davon profitiert nicht nur der Patient, sondern auch der gesamte klinische Workflow[16].
3.1.1 Aufbau des CPOE-Systems
Nach welchen Kriterien wird das CPOE-System bedient? Zunächst wird durch Auswahl des jeweiligen Patienten ein passendes Verordnungsformular aufgerufen. Nach Eingabe der Patientendaten wie Alter, Gewicht, Allergien und laufende, anderweitige Medikation werden Medikament, Dosis und Darreichungsform durch den Arzt ausgewählt. Die für die Eingabe von Verordnungen benötigte Zeit wird durch die Verwendung dieser standardisierten Formulare verkürzt, wodurch die Akzeptanz des Systems bei den Anwendern steigt[17]. Die vorgeschlagenen Medikamente begnügen sich nicht mit der Empfehlung eines einzelnen Medikaments, sondern berücksichtigen auch andere Medikamente gemäß den Behandlungsrichtlinien für die jeweilige Diagnose, was ein abgestimmtes Verordnungsset passend zur Diagnose des Pateinten (sog. best practices) gewährleistet[18]. Üblicherweise müssen alle Pflichtfelder in den vorgegebenen Formularen ausgefüllt werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass komplexe Informationen möglichst komplett, präzise und klar dargestellt werden. Die Vollständigkeit ärztlicher Verordnungen und ihre fehlerfreie Übertragung in den Medikationsplan werden durch dieses Verfahren garantiert. Bereits mit einfacher elektronischer Erfassung der Verordnungen werden Fehler vermieden, die auf unvollständigen, inkorrekten oder unleserlichen Angaben beruhen[19].
3.1.2 CPOE-System mit Clinical-Decision-Support-System (CDSS-Komponente)
CPOE-Systeme können, aber müssen nicht an „Systeme für klinische Entscheidungsfindungen“, sog. CDSS (engl. „Clinical-Decision-Support-System“), gebunden sein[20], wohingegen allerdings auch Arzneimitteltherapie-Systeme (CDSS) existieren, die ohne ein CPOE-System eingesetzt werden. Die in den CPOE-Systemen integrierten CDS-Systeme erfüllen eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Aufgaben. Diese können in Warnungen bestehen wie bspw. bei Allergien, Kontraindikationen, Interaktionen, Doppelverordnungen oder Überdosierungen sowie über potenzielle UAW im Allgemeinen oder Kalkulationshilfen zur Dosierung unter Abwägung von Alter, Körpergewicht oder Nierenfunktion. Andererseits können CDSS auch eine Verlinkung mit internen und externen Leitlinien herstellen, pharmazeutische und medizinische Datenbanken überprüfen, interne oder allgemeine Arzneimittellisten berücksichtigen sowie durch indikationsgerechte Dosierungen, Laborkontrollen, Begleitmaßnahmen und Anwendungshinweise verordnungsspezifische Empfehlungen geben und damit Informationshilfen zur Medikationsauswahl darstellen, die in so kurzem Zeitrahmen kein Arzt bewältigen kann und einen hohen Sicherheitsgewinn für den Patienten mit sich bringen. Zur Gewährleistung einheitlicher Standards existieren verschiedene Bestrebungen, die Anforderungen an die Arbeitsweise von CPOE-Systemen und deren CDSS-Komponenten festzulegen und auf diese Weise zu standardisieren[21].
3.1.3 Bedingungen und Variablen für die erfolgreiche Implementierung eines CPOE-Systems
Erste Voraussetzung für die Einführung eines CPOE-Systems ist die kontinuierliche Dokumentation des Behandlungsverlaufs jedes Patienten abhängig von früher behandelnden Ärzten oder früher getroffenen Medikationsentscheidungen[22]. Das CPOE-System speichert alle patientenbezogenen Daten und gibt diese auch an den behandelten Arzt weiter. Trotz aller Vorteile und Einfachheit für den geübten Anwender ist die Implementierung eines CPOE-Systems ein komplexer Prozess und dieses sollte deswegen nicht das erste, rechnergestützte System in einer medizinischen Einrichtung sein. Online-Zugang zu elektronischen Fachbüchern, medizinischer Literatur und Richtlinien sollten bereits vorher vorhanden sein[23]. Der Erfolg des CPOE-Systems hängt von der Veränderungsbereitschaft der Belegschaft und des Managements ab sowie von organisatorischen bzw. technischen Voraussetzungen der jeweiligen Einrichtung[24]. Darüber hinaus sind die nachfolgenden Bedingungen für eine erfolgreiche Implementierung zu beachten[25]: Auswahl und Anpassung an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung der CPOE-Systeme, finanzielle Ressourcen, kommunikative Mitarbeiterführung, Entwicklung ausreichender Verordnungssets und Training der Mitarbeiter sind zu beachtende Variablen. Die Ärzteschaft muss ggf. auch vom Nutzen dieses Systems überzeugt werden und es in ihren Workflow integrieren. Eine schrittweise Implementierung hat sich bewährt[26]. Dennoch möchten viele Mitarbeiter ihre Arbeitsweise nicht ändern, weil ein CPOE-System zu komplex sei oder mehr Zeit als die gewohnten Prozeduren in Anspruch nehme. Sollte eine medizinische Einrichtung die Einführung eines CPOE-Systems in Erwägung ziehen, so muss dieses Projekt sorgfältig und professionell geplant werden[27].
3.2 Positive und negative Effekte rechnergestützter Informations-systeme in der Medizin
Der Einsatz von CPOE-Systemen ist in mehrfacher Hinsicht positiv zu bewerten. Zwar kann man UAW nicht vollständig eliminieren, allerdings eine weitgehende Reduzierung erreichen[28]. Im Einzelnen lassen sich die Vorteile des CPOE-Systems folgendermaßen beschreiben:
Der Einsatz von Informationssystemen hat zur Folge, dass eine versiertere und schnellere Informationsfindung in einer medizinischen Einrichtung aufgebaut wird, dass der Zugriff auf Informationen nach verschieden, ggf. multidimensionalen Kriterien hergestellt wird oder auch dass eine größere Unabhängigkeit vom Wissensstand des behandelnden Arztes entsteht[29]. Aber auch in Bezug auf die Qualität der Behandlung und Kostenersparnis[30] lassen sich positive Effekte verzeichnen.
Durch einheitliche Gestaltung des Medikationsprozesses verläuft die Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegepersonal reibungsloser. Krankenhausmitarbeiter können Zeit für wechselseitige Konsultationen einsparen, weil das CPOE-System alle einschlägigen Informationen bereithält. Ärzte sparen Zeit bei Patientenvisitationen, wenn sie Tablets oder Laptops verwenden. Die Bestellung für Medikamente kann so schneller aufgegeben werden, Laboruntersuchungen angeordnet oder Laborergebnisse angezeigt werden sowie Entlassungspapiere ausgestellt werden, ohne zwischenzeitlich ein Büro aufzusuchen. Bestellungen von Medikamenten enthalten durch diese Vorgehensweise weniger Fehler und werden seltener von Laboranten oder Apothekern falsch entziffert, weil Unlesbarkeit der Handschrift durch klar lesbare Druckschrift ersetzt wird. Studien haben dazu gezeigt, dass CPOE-Systeme ein Viertel aller schädlichen UAW verhindern können[31].
Dennoch wird in neueren Publikationen vermehrt darauf hingewiesen, dass CPOE-Systeme auch eigene und neuartige Risiken mit sich bringen können[32], die nicht unterschätzt werden dürfen. Eine amerikanische Untersuchung beschreibt mehr als zwanzig Fehlerquellen, die nach Einführung eines gut erprobten CPOE-Systems identifiziert wurden, vorher nicht bekannt waren und spezifisch auf die Anwendung des rechnergestützten Verordnungssystems zurückzuführen waren[33]. Aus einem amerikanischen Kinderkrankenhaus wird sogar über eine höhere Mortalität in zeitlicher Folge nach Implementierung eines CPOE-Systems berichtet[34], ein Ergebnis, das allerdings an einem vergleichbaren Krankenhaus nicht bestätigt werden konnte[35]. In nicht-vorhandener Akzeptanz für das CPOE-System, fehlender Qualifikation, Desinteresse und in fehlendem Vertrauen des Personals in das System können die Ursachen für den Misserfolg eines CPOE-Systems liegen[36].
3.3 Kosten eines CPOE-Systems
Die Kosten der Einführung eines CPOE-Systems hängen von der vorhandenen Infrastruktur einer Einrichtung sowie von dessen Komponenten ab; auch Faktoren wie die Größe der Einrichtung sind relevant[37]. Die Gesamtkosten eines CPOE-Systems, zusammengesetzt aus Anschaffungs- und laufenden Kosten, bestehen je nach System aus vielfältigen Einzelkomponenten. Dazu zählen[38]:
Kosten für Hardware (z.B. Server, Handheld-Computer, Drucker, ggf. Upgrade der gesamten vorhandenen IT-Infrastruktur),
Kosten für Software (z.B. Lizenzen),
Personal- und Managementkosten (z.B. Einstellung von neuem Personal),
Implementierungskosten (z.B. Installation, anwendungs-spezifische Produktmodifikation, Adaptierung von Arbeitsabläufen, Netzwerkkosten),
Kosten für Support/Wartung/Aktualisierung (z.B. Schulungen, laufende technische Unterstützung).
Kostenangaben bzw. -schätzungen in der Literatur variieren dementsprechend und sind ohne genauere Aufschlüsselung nur begrenzt aussagekräftig. Für die Kosten relevant sind vor allem eine funktionierende Organisationsstruktur und Kooperationskultur in einer medizinischen Einrichtung[39]. Eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2003[40] berechnet anhand von fünf Beispielkrankenhäusern mithilfe eines Kostenmodells Anschaffungskosten von 7,9 Mio. USD (nach Maßgabe der o.g. Kostenpunkte) und laufende Kosten pro Jahr von 1,35 Mio. USD. Diese Schätzungen beziehen sich auf ein Krankenhaus mit ungefähr 500 Betten und 25.000 Patientenaufnahmen pro Jahr, in dem die meisten Verordnungen durch im Haus angestellte Ärzte durchgeführt wurden und das CPOE-System für alle Krankenhausabteilungen (exkl. der Notfallabteilung) eingeführt wurde sowie keine größeren Upgrades der Netzwerkinfrastruktur notwendig waren. Diese Anschaffungskosten verschleiern jedoch die Investitionsrentabilität, die nach einigen Jahren höchstwahrscheinlich zu erzielen wäre: daher benutzen nur 5% bis 10%[41] aller Krankenhäuser ein CPOE-System.
4 Fazit
Die Einführung von rechnergestützten Verordnungssystemen kann für Mediziner problematisch sein, weil diese sich häufig lieber auf ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse verlassen als auf ein elektronisches System. Deswegen sollte die Implementierung eines CPOE-Systems sorgfältig geplant und durchgeführt sowie an die Institution angepasst werden. Letztlich ist das wohl wichtigste Ziel, dass dazu beigetragen wird, UAW zu verringern und dem Patienten eine bessere Versorgung geboten wird. Dazu muss das rechnergestützte Verordnungssystem alle Informationen zur Verfügung stellen, welche für präzise Entscheidungen bzgl. der Durchführung exakter Versorgungsmaßnahmen relevant sind[42]. Die Einführung eines CPOE-Systems sollten in den kommenden Jahren größere medizinische Institutionen erwägen, sei es nun eine Einführung mit CDSS-Komponente oder ohne. Dieses System ist bei korrekter Anwendung nicht nur ein Sicherheitsgewinn für Patienten, sondern auch eine Arbeitsentlastung für das medizinische Personal[43] sowie eine Einsparungsinvestition.
Literaturverzeichnis
Monographien
Chamoni, Peter; Gluchowski, Peter (1999): Analytische Informationssysteme: Data Warehouse, 2. neubearb. Aufl., Berlin/Heidelberg 1999.
Holzer, Elke; Reich, Martin; Hauke, Eugen(2010): Controlling Ein Managementinstrument für die erfolgreiche Steuerung von Gesundheitsbetrieben, 1. Aufl., Österreich 2010.
Grabner, Georg (1985): WAMIS Wiener Allgemeines Medizinisches Informations-System, Berlin/Heidelberg 1985.
Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P.; Schoder, Detlef (2009): Wirtschaftsinformatik Eine Einführung, 2. Aufl., München 2009.
Leiner, Florian; Gaus, Wilhelm; Haux, Reinhold; Knaup-Gregori, Petra (1999): Medizinische Dokumentation, 3 Aufl., Stuttgart 1999.
Zeitschriften
Anderson, James G. (2003): A framework for considering business models, in: Studies in Health Technology and Informatics, Jg. 92, 2003, S. 3-11.
Ash, John S.; Stavri, Zoë P.; Kuperman, Gilad J. (2003): A consensus statement on considerations for a successful CPOE implementation, in: Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA), Jg. 10, Heft 3, 2003, S. 229-234.
Birkmeyer, Christian M.; Lee, Joshua; Bates, David W.; Birkmeyer, John D. (2002): Will electronic order entry reduce healthcare costs?, in: Effective Clinical Practice, Jg. 5, Heft 2, 2002, S. 67-74.
Bobb, Anne M.; Payne, Thomas H.; Gross, Peter A. (2007): Viewpoint: controversies surrounding use of order sets for clinical decision support in computerized provider order entry, in: Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA), Jg. 14, Heft 1, 2007, S. 41-47.
Callen, Joanne L.; Westbrook, Johanna I.; Braithwaite, Jeffrey (2006): The effect of physicians' long-term use of CPOE on their test management work practices, in: Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA), Jg. 13, Heft 6, 2006, S. 643-652.