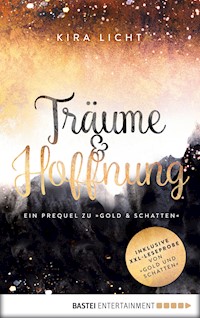9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Wilden Jagd gehört der Nachthimmel Triathletin Remy droht an ihrem abrupten Karriereende zu zerbrechen. Als sie in der Halloweennacht von zwei Reitern der Wilden Jagd in die Anderswelt entführt wird, ändert sich aber plötzlich alles. Sie soll Teil der Wilden Jagd werden und muss sich in einer gefährlichen Prüfung beweisen. Ihre Aufgabe: zu Ungeheuern gewordene menschliche Seelen auf der Erde jagen. Dabei lernt sie den attraktiven Kronprinzen Keon kennen. Remy ist die Einzige, die sich traut, ihm zu widersprechen. Dabei riskiert sie allerdings nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Herz ... Eine spicy Enemies to Lovers-Geschichte zwischen unserer Welt und der geheimnisvollen Welt der Fae von Bestseller-Autorin Kira Licht! Für alle Fans von Sarah J. Maas und Carina Schnell. Band 1: Crimson Sky − Die Seelenjägerin Band 2: Crimson Sky − Der Schattenprinz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Crimson Sky« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Redaktion: Cara Rogaschewski
Karte: Kristin Heldrung
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Stephanie Gauger, Guter Punkt München unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus und AdobeStock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Karte
SAMHAIN
Kapitel 1
USA, Atlanta, Campus der Georgia State University
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
YULE
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zitat
The Magic in me is old,
it sings the Songs of my Ancestors,
Words of the Forest Tongue, long forgotten.
– Galdorcræft
Karte
SAMHAIN
Kapitel 1
USA, Atlanta, Campus der Georgia State University
Das YouTube-Video hatte 2,8 Millionen Klicks.
2,8 Millionen Menschen hatten mit angesehen, wie sich Nancy Spencers Trinkflasche aus der Halterung an ihrem Rennrad löste und vor mir auf dem Asphalt landete. Es waren nur Sekunden, in denen ich weder bremsen noch ausweichen konnte. Sekunden, in denen ich über den Lenker geschleudert wurde und durch die Luft flog. Bei meinem Aufprall auf der Straße verlor ich das Bewusstsein.
2,8 Millionen Menschen hatten sich angesehen, wie sich mein Schienbein durch die Haut bohrte, während ich die Kontrolle über meine Körperfunktionen verlor. Ich lag auf dem Asphalt wie eine kaputte Puppe, in meinem eigenen Blut und umringt von Fremden.
Ich war an diesem Tag nicht gestorben, aber ich war seitdem nicht mehr dieselbe. Mein Leben hatte sich einmal um sich selbst gedreht, genau wie ich mich bei meinem unfreiwilligen Salto über den Lenker meines Rennrads.
Nicht nur die bittere Diagnose, eine Schrägfraktur des Schienbeins, riss mir den Boden unter den Füßen weg, sondern auch ihre Bedeutung für mein Leben. Meine Karriere war damit beendet.
Vor dem Unfall war ich eine Triathletin auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn gewesen, und noch heute hörte ich die begeisterten Worte meines Agenten Harry in meinem Kopf: »Dein strahlendes Lächeln wird Millionen Packungen Cornflakes verkaufen. Nike lädt dich zu einer Party mit anderen Testimonials ein, es wird alles bezahlt. Na klar bekommst du ein Stipendium fürs College. Du hast eine großartige Zukunft vor dir.«
Fehlanzeige.
Das alles war von dem einen auf den anderen Tag vorbei gewesen. Ein Missgeschick, ein Unfall, der Bruchteil einer Sekunde hatte über mein Schicksal entschieden.
Als sich die grüne Radlerhose zwischen meinen Beinen dunkel verfärbte, stoppte ich das Video schnell. Es war der Gipfel der Schmach, und die ekelhaften Kommentare toppten das noch. Ich wusste es, denn ich hatte sie alle gelesen.
Ich schnaubte leise, schloss die App und warf das Handy neben mich auf die Decke. Die Menschen bewunderten einen, wenn man ganz oben war. Doch sobald man fiel, stürzten sie sich auf einen wie ein Rudel tollwütiger Hunde.
Anfangs hatte Harry noch dafür gesorgt, dass diese Videos durch YouTube offline genommen wurden. Doch sie tauchten immer wieder auf, und irgendwann hatte er es wohl aufgegeben. Die Suchbegriffe »Remy Davis« und »Unfall« lieferten immer mehrere Treffer, die meinen Sturz aus den unterschiedlichsten Perspektiven zeigten. Die meisten Klicks, Likes und Kommentare bekamen die Versionen des Videos, die nichts verpixelten.
Mein Magen knurrte laut und fordernd. Wann hatte ich zuletzt etwas gegessen? Ich wusste es nicht mehr. Mein Blick glitt zum Fenster, dessen heruntergelassene Jalousien die Welt da draußen ausblendeten.
Heute müsste Montag sein, oder? Freitagmittag war die Übergabe. Ich hatte also noch etwas mehr als drei Tage, bis ich aus diesem Zimmer raus sein musste. Vielleicht sollte ich mir langsam überlegen, wie ich mein Zeug in einen Lagerraum bekam. Vielleicht sollte ich überlegen, wo ich unterkommen konnte. Vielleicht …
Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen und das nicht nur vor Hunger. Verdammt! Ich drückte mich von meinem Bett hoch und ächzte, als ich ausatmete. Mein Körper fühlte sich an, als wäre ich einen Marathon gelaufen, dabei hatte ich mich kaum bewegt in den letzten Tagen. Mühsam stand ich auf und streckte mich.
Die Luft in meinem Zimmer roch schal und abgestanden. Kein Wunder, ich hatte es seit Tagen kaum verlassen, und ans Lüften hatte ich ebenfalls nicht gedacht. Ein bitterer Geschmack machte sich in meinem Mund breit, als ich den Blick schweifen ließ. Gepackte Umzugskisten standen überall im Raum verteilt. Ich hätte sie an einer Wand stapeln können, aber in letzter Zeit war mir sowieso das meiste egal. Ich stand auf, wenn die Welt schlafen ging. Ich aß das, was sich in maximal zwei Minuten in meiner Mikrowelle zubereiten ließ. Ich wusste schon nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Hörsaal betreten hatte.
Bevor ich das Gewicht auf mein verletztes Bein verlagerte, erwartete ich den Schmerz, und er kam prompt. Ein Stich schoss mir siedend heiß hinauf bis in den Brustkorb, wie ein brennender Stachel, der all meine Nervenenden lichterloh entflammte. So war es immer, wenn ich das Bein nach längerem Liegen belastete. Laut meines Psychotherapeuten war es zum größten Teil Phantomschmerz und ein deutliches Zeichen dafür, dass wir noch einen langen Weg vor uns hatten. Ich erinnerte mich auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Termin bei ihm wahrgenommen hatte. Ich nahm zwar keine Drogen oder Medikamente, die mein Erinnerungsvermögen beeinträchtigten, aber ich hatte das Gefühl, dass mir mein Leben völlig entglitten war. Dass die Tage so gleich waren, dass sie zu einem einzigen verschwammen, und mein Verstand langsam, aber sicher völlig abschaltete.
Hunger! Mein Magen, mein Gehirn, mein ganzer Körper schrie mir wütend diese Forderung entgegen.
Auf der Mikrowelle fand ich nur zwei leere Packungen Pop-Tarts. Im Kühlschrank darunter herrschte gähnende Leere. Ob ich etwas bestellen sollte?
Ich griff nach meinem Portemonnaie, das direkt neben der Mikrowelle lag. Ein Dollar und fünfundsiebzig Cents. Das wäre noch nicht mal ein angemessenes Trinkgeld für den Lieferboten, geschweige denn, dass ich dafür etwas zwischen die Zähne bekam.
Ich fluchte leise und überlegte gerade, ob ich alle meine Taschen nach etwas Kleingeld durchsuchen sollte, als mein Handy einen Ton von sich gab. Ich ging zurück zum Bett und drückte auf »Lesen«, während ich es aufhob.
Hey. Sorry, das mit dem Zimmer klappt nicht. Hoffe, du bist okay, Steph.
Stephenie war eine ehemalige Teamkollegin von mir, die in einer WG nur ein paar Blocks entfernt wohnte. Nach dem Unfall hatte sie jeden Kontakt zu mir gemieden, fast so, als würde ich Unglück bringen. Ich hatte all meinen Stolz hinuntergeschluckt, als ich sie wegen des Zimmers kontaktiert hatte. Es war kaum mehr als eine Abstellkammer, aber günstig. Das Geld würde ich irgendwie aufbringen. Mit Steph hätte ich mich arrangieren können, sie sah das wohl anders.
Egal.
Ich schloss den Messenger, ohne ihr zu antworten. Steph war der letzte Versuch gewesen, meine drohende Obdachlosigkeit abzuwenden. Ich lachte bitter auf. Vielleicht konnte ich in den Lagerraum ziehen, in dem ich meine Kartons parken wollte? Drei Tage …
Drei Tage, um Geld zu verdienen, um irgendwie ein Zimmer zu finden. Wobei hier die Betonung auf »irgendwie« lag. Drei Tage …
Ich checkte meine Mails. Noch mal fünf Absagen. Hatte ich die Kraft, ein weiteres Mal im Netz nach Jobs zu suchen? Ich horchte in mich hinein, aber da war nichts. Keine Motivation, keine Energie. Irgendwie hatte ich mich bereits damit abgefunden, mit dem sozialen Abstieg, der Lethargie, der Obdachlosigkeit. Nach dem Unfall war ich mir sicher gewesen, dass ich mit dem unfreiwilligen Karriereende nicht tiefer hätte fallen können. Aber das stimmte nicht. Ich fiel noch immer. Und noch hatte ich den absoluten Tiefpunkt nicht erreicht.
Obdachlos. Das Wort hallte in meinem Kopf nach.
Mein Magen zog sich erneut zusammen, und dieses Mal gesellte sich ein leichter Schwindel dazu, der Lichtblitze vor meinen Augen tanzen ließ.
Ich wartete, bis ich wieder richtig sehen konnte, und griff nach dem Hoodie, das schief über der Lehne des Schreibtischstuhls hing. Dann streifte ich es mir über das verknitterte T-Shirt, in dem ich geschlafen hatte. Die Jogginghose tauschte ich gegen eine Röhrenjeans, die im Trockner um mindestens eine Größe eingelaufen war. Aber ich mochte das enge Gefühl an der Wade, weil es mir versicherte, dass zumindest der Stoff mein Bein zusammenhielt. Ich wachte immer noch oft nachts schreiend auf, mit der absoluten Überzeugung, dass mein Unterschenkel nichts mehr als ein gesplitterter Brei aus Muskeln und Knochen war.
Ich schlüpfte in meine Doc Martens, schnappte mir Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund und zog mir die Kapuze des Hoodies tief in die Stirn. Früher hatte ich beim Training und bei Wettkämpfen gern aufwendige Flechtfrisuren getragen. Heute war es mir nach dem Aufstehen sogar zu viel, zu duschen und mir die Haare zu kämmen. Aber dank der Kapuze würde das niemand sehen.
Meine Hand lag schon an der Türklinke, als ich wie automatisch einen kurzen Blick in den Spiegel warf. Ich erkannte mich selbst kaum wieder. Mein helles Haar quoll strähnig unter der Kapuze hervor. Ich war unnatürlich blass und meine Augenringe so groß, dass sie eine eigene Postleitzahl verdient hätten. Vielleicht hätte Concealer geholfen, doch nicht mal den besaß ich mehr.
Ich riss mich von meinem Anblick los und trat durch die Tür auf den Gang des Wohnheims. Hier war es ruhig, und nur die kleine Notbeleuchtung über dem Zugang zum Treppenhaus brannte. Viele hier hatten ebenso wie ich ein Sportstipendium und gingen nach dem Training am Abend sofort schlafen. Ich hätte das Flurlicht anschalten können, doch stattdessen schlich ich durch die Dunkelheit wie ein verwundetes Tier.
Als ich ins Treppenhaus abbiegen wollte, stieß ich mit jemandem zusammen. Papier raschelte, als ich zurückprallte.
»Wow!«, erklang eine dunkle Stimme. »Ich habe dich nicht gesehen, das tut mir so leid.«
»Kein Problem«, sagte ich schnell.
Ich hörte, wie der Lichtschalter gedrückt wurde. Im nächsten Moment sprangen die Halogenleuchten über uns mit einem leisen Sirren an.
Dunkelbraunes Haar, das ihm in leichten Wellen in die Stirn fiel. Breite Schultern, wunderschöne türkisfarbene Augen, ein Grübchen am Kinn. Sein Haar war noch leicht feucht, aber er hatte keine Sporttasche dabei.
Ich starrte ihn einen Moment an, dann glitt mein Blick zu dem, was er da vor sich hertrug. Es war ein Karton, der über und über gefüllt war mit Lebensmitteln. Milchbrötchen, Chips, Dosenobst, Cup-Nudeln, Oreo-Kekse, Twinkies … Vermutlich war er im Gemeinschaftsraum gewesen, wo auch die Päckchen gelagert wurden, die hier für uns ankamen.
»Meine Mutter denkt offenbar, hier gibt es nichts zu essen«, sagte der Dunkelhaarige. »Jede Woche schickt sie mir so ein Paket.« Er lachte dunkel. »Dabei verbietet mir mein Ernährungsplan das meiste davon. Aber das will Mom nicht verstehen.«
Was hätte ich für eine Mutter gegeben, die mir Pakete schickte! Und der Typ klang fast genervt. Wusste er, wie gut er es hatte?
Ich warf einen neidischen Blick in den Karton und entdeckte sogar ein paar beschriftete Tupperdosen: Cookies. Muffins. Das Lesen der kleinen, weißen Aufkleber sorgte dafür, dass mein Magen erneut vernehmlich knurrte.
»Sorry.« Schnell presste ich eine Hand auf meinen Bauch.
»Ähm … Möchtest du was haben?« Er hielt das Paket mit einem Arm und reichte mir dann eine kleine Tüte Chips. Seine Stimme klang nun weicher.
»Danke.« Barbecue-Geschmack. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, und zu gern hätte ich sie jetzt sofort aufgerissen. Gott, war mir das peinlich!
»Noch was?« Er schnippte den Deckel der Tupperdose mit dem »Muffins«-Schild auf.
Der süße Geruch von Zimt und Pekannüssen stieg mir in die Nase. Ich schluckte.
»Hier«. Er gab mir einen Muffin.
»Danke dir.« Ich sah zurück in sein Gesicht.
Er vertiefte das Lächeln, versuchte, meinen Blick zu halten, und ich sah nichts als Freundlichkeit und einen Hauch Neugier in seinen Augen. »Noch einen Wunsch?«
Ja. Ja! Dreh die Zeit zurück. Gib mir mein Leben zurück. Und dann treffen wir uns erneut, hier, auf diesem Flur, in dieser Nacht. Und dann … Vielleicht finde ich dann heraus, wie viel mehr hinter diesem sympathischen Lächeln steckt.
Traurigkeit umfing mich. Dann gesellten sich Wut und Verbitterung dazu. Neun Monate. Es war jetzt ein dreiviertel Jahr her.
Reiß dich zusammen. Komm endlich damit klar. Komm. Damit. Klar!
Er hielt mir eine Packung Twinkies hin. »Das hier?«
Ich schüttelte den Kopf. Er war so nett zu mir. Dabei kannten wir uns gar nicht.
»Nein, danke.« Ich holte entschlossen Luft, schluckte all die bitteren Gefühle herunter. »Aber das ist sehr lieb von dir.«
»Wirklich nicht?« Er tat so, als würden die Twinkies über den Rand des Pakets in meine Richtung tanzen.
Er war wirklich süß.
»Da ist es ja. Endlich.«
Ich sah neugierig zu ihm hoch.
Sein Blick war trotz der kühlen Farbe seiner Augen warm. »Ein Lächeln.«
Ich schnaubte leise, aber mein Lächeln wurde noch breiter. Er legte die Twinkies in den Karton und streckte mir die Hand hin. »Ich bin Neil, Zimmer 408, Leichtathletik. Aber ich wohne erst seit drei Wochen hier im Wohnheim«, fügte er noch hinzu.
»Remy, also eigentlich Remyra, Zimmer 414, Triathlon.« Ich brachte es nicht fertig, ihm zu erzählen, dass ich die Uni schon in drei Tagen verlassen würde.
»Freut mich, Remy.« Mein Vorname schien ihm nichts zu sagen, ein Glück. Sein Blick wurde ernst. »Wir kennen uns nicht, und das ist vielleicht zu persönlich, aber …« Er zögerte wieder, dann neigte er leicht den Kopf, als wollte er unter meine Kapuze sehen. »Geht es dir gut? Ich will nicht unhöflich sein, aber …«
Zeit für einen Abgang.
»Danke für die Chips.« Ich wollte ihn erneut anlächeln, aber ich war nicht sicher, ob es mir wirklich gelang. »Und für den Muffin.« Ich hob ihn hoch, als wollte ich Neil damit grüßen. »Wir sehen uns.« Ich nickte ihm knapp zu, dann schob ich mich an ihm vorbei.
»Ja, okay«, hörte ich seine Stimme hinter mir. Er klang überrumpelt und ein wenig … enttäuscht? »Wir sehen uns, Remy.«
Sicher nicht.
Ich beeilte mich extra, als ich die Stufen hinunterlief, und verschlang dabei den Muffin mit drei Bissen. Die zwei Stockwerke hatte ich trotz meines Beins schnell geschafft, und ich atmete erst auf, als ich hinaus in die winterliche Kälte trat. Vielleicht wäre ich unter anderen Umständen noch mal nach oben gegangen und hätte einen Mantel übergezogen. Ich dachte an Neils leuchtende Augen, sein sympathisches Lächeln, die Wärme in seiner Stimme.
Nein, ich wollte nicht, dass er mich noch mal sah. Mein Abgang war schon seltsam und peinlich genug gewesen.
Ich riss die Chipstüte auf und ließ meinen Blick über den Campus der Georgia State University gleiten. Grüne Wiesen, auf denen im Sommer Studenten saßen und lernten. Jetzt hing ein zarter Nebelschleier über den Halmen und ließ die Freiflächen aussehen wie den Schauplatz eines geheimnisvollen Märchens. Alte Bäume, die die Wege säumten und deren winterlich kahle Äste sich wie erstarrte Tentakel in Richtung Himmel reckten. Bänke aus Holz, auf denen Raureif glänzte wie ein Hauch Feenstaub. Mein Atem stieg in kleinen Wölkchen vor mir in der Dunkelheit auf, während ich die Chips knusperte. Das Salz belebte alle meine Sinne so wie der Zucker zuvor.
Wieder glitten meine Gedanken zu Neil. Ich war zwar pleite, hatte mein Stipendium verloren und war vom College geflogen, aber vielleicht könnten wir trotzdem mal einen Kaffee …
Bullshit. Als Nächstes glaubte ich wohl wieder an den Weihnachtsmann.
Vor meinem inneren Auge wischte ich Neils Lächeln entschieden fort.
Game over, Remy. Get over it.
Ich steckte die leere Tüte in meine Hosentasche, zog mein Handy hervor und warf einen schnellen Blick darauf. 21 Uhr, und es war schon komplett dunkel. Gelobt sei der Winter.
Ich schob die Hände in die Taschen meines Hoodies, als ich mit gesenktem Kopf loslief. Es war Zeit, mir mal wieder zu beweisen, wie tief ich tatsächlich gesunken war.
Kapitel 2
Ich legte im Gehen eine Hand an meine Stirn, als ich den Campus verließ. Mir war plötzlich so warm. Ob ich krank wurde? Ich zupfte am Kragen des Hoodies. Ich brauchte Luft, sonst würde ich als Nächstes schmelzen.
Eine gefrorene Pfütze knirschte, als meine Docs das Eis zerbrachen. Was war bloß los? Ich war mal an einer Grippe erkrankt. Da hatte ich wie eine Irre geschwitzt, und mir hatte alles wehgetan, aber jetzt war es ein anderes Gefühl von Wärme. Fast so, als hätte ich einen Hochofen verschluckt, als produzierte mein Körper so viel Energie, dass ich die wärmenden Lagen Stoff nicht brauchte.
Eigentlich wollte ich nicht mal die Kapuze abstreifen, weil ich aussah wie ein Geist. Und dann erst meine Haare …
Eine Hitzewelle durchflutete mich.
Okay, ich brauchte jetzt eine Lösung. Ich zog ein Zopfgummi von meinem Handgelenk. Es war schon ziemlich ausgeleiert, aber es reichte noch, um meine Haare in einem Knödel zu bändigen. Erleichtert riss ich mir das Hoodie über den Kopf, und kaum dass ich ihn mir um die Hüfte gebunden hatte, fühlte ich, wie ich zum ersten Mal seit Minuten wieder richtig Luft bekam.
Ich lief die Courtland Street hinab, passierte die Sports Arena, die zur Uni gehörte, ebenso wie die Volleyball-Courts. Bei Willys Mexican Grill war deprimierend wenig los, ebenso wie im Waffle House. Also nahm ich die Bahn Richtung Hotel District und stieg an der Station Peachtree aus. Rund um den Centennial Olympic Park gab es verschiedene angesagte Bars und Pubs, in denen Geschäftsleute gern den Feierabend einläuteten.
Wieder betastete ich prüfend meine Stirn. Nicht feucht. Auch meine Hände waren warm und trocken. Ein wohliges Feuer brannte in meinem Inneren, und der kalte Wind an meinen nackten Armen war nichts als eine sanfte Brise.
Seltsam. Sehr seltsam, aber definitiv nichts, das jetzt Priorität hatte. Und da ich keine Krankenversicherung mehr besaß, würde mir auch niemand helfen, bis ich auf offener Straße zusammenbrach.
Darauf würde ich es jetzt einfach ankommen lassen. Außerdem lenkten mich die beeindruckenden Hochhäuser, das viele Chrom und die teuren Limousinen am Straßenrand ab.
Ka-Ching. Hier saß das Geld locker, und ich war fest entschlossen, mir meinen Anteil davon zu sichern.
Ich hatte mit dem Klauen angefangen, als die Bank mir mein Konto sperrte. Als ich weder meinen Agenten oder sonst wen mehr um Geld bitten konnte. Als ich den Job als Küchenhilfe nach einem Tag verlor, weil ich nach drei Stunden nicht mehr stehen konnte. Als ich Hunger hatte und vor mir ein Kerl in Maßanzug und Designer-Lackschuhen seine Brieftasche nur locker in das vordere Fach seiner prolligen Aktentasche geschoben hatte.
Scham musste man sich leisten können. Wenn die Verzweiflung die Oberhand gewann, dann rechtfertigte man sein Handeln, um nicht daran zu zerbrechen.
Trotzdem überfielen mich vorher immer wieder Skrupel. Immer wieder entschloss ich mich dagegen, gerade dann, wenn das Geld für etwas war, das nichts mit reinem Überleben zu tun hatte. In den sechs Wochen, seit ich regelmäßig nachts durch die Straßen schlich, hatte ich immer wieder den Rückzug angetreten. Außerdem hatte ich Prinzipien. Keine Rentner und keine Familien mit Kindern. Und keine Studenten – auch wenn die manchmal schwer auszumachen waren, wenn sie mit Daddys Geld großkotzig in den Bars herumwedelten.
Ich war gerade auf das John Portland Boulevard abgebogen, als mir drei Typen aus der Hotelbar des Hyatt Regency vor die Füße taumelten. Sie schlugen sich immer wieder gegenseitig auf die Schulter, und als ich ihnen folgte, entnahm ich ihrer Unterhaltung, dass sie heute einen großen Deal abgeschlossen hatten. Sie sprachen über Häuser, aber ich hielt sie für Anwälte. Absolventen einer Eliteuni, die in einer der besten Kanzleien von Atlanta mit Immobilien-Spekulationen das große Geld machten. Und die alle schon ziemlich angeschickert wirkten.
Mein Glück.
Fast wäre ich in sie hineingelaufen, als sie vor einem Pub stehen blieben und lautstark diskutierten, ob sie sich dort noch einen Absacker gönnen sollten.
Ich machte einen halben Schritt zurück und zog alibimäßig mein Handy hervor. Mein Blick glitt über die fahrenden Autos zur anderen Straßenseite. Von dort grinsten mich zwei Typen an.
Ich sah schnell weg und direkt wieder hin. Nein, ich hatte mich nicht geirrt. Sie grinsten immer noch.
Ich brauchte einen Moment, um darauf zu kommen, was hier nicht ins Bild passte.
Beide in mittleren Jahren, beide mit Bart, und beide trugen … Reitstiefel? In den Hochhausschluchten von Atlanta?
Ich kniff die Augen zusammen, um ganz sicherzugehen.
Reitstiefel, weit geschnittene Stoffhosen und Westen.
Alles klar …
Ich sah weg. Jeder wie er mochte. Ich hatte kein Problem damit. Furries, Trekkies oder Hipster, jeder sollte sich kleiden, wie es ihm gefiel, und lieben, wen er oder sie wollte, dachte ich, während ich kurz vor der mit Halloween-Deko erschlagenen Auslage eines Elektronikgeschäfts stehen blieb. Auf den Flatscreens lief überall dasselbe Programm. Eine Doku eines Nachrichtensenders. Es schien um den heutigen Tag, den 31. Oktober, zu gehen.
Wahnsinn! Denen fiel auch echt nichts mehr ein.
»Samhain – eine Nacht voller Wunder« jagte gerade in verschnörkelter Schrift über die Bildschirme.
Ich schnaubte. Samhain, eine Nacht wie jede andere. Und war heute nicht Halloween?
Ich drehte mich weg und sah erneut kurz zur gegenüberliegenden Straßenseite. Als Paar sahen die beiden ganz niedlich aus. Und statt der Windjacke in gleichen Farben trugen sie eben Reitstiefel und Westen. Sei’s drum.
Aber selbst als die Anwälte weitergingen, wollte das Bild der zwei Typen mit den irgendwie altertümlich wirkenden Klamotten nicht aus meinem Kopf verschwinden. Sie hatten mich angegrinst, als würden wir uns kennen.
Doch jeder Gedanke an sie war vergessen, als ich sah, wie nachlässig der eine Anwalt seine Geldbörse in die Tasche seines Jacketts gestopft hatte. Ich steckte mein Handy weg und sprach mir selbst noch mal Mut zu.
Das hier war nicht einfach.
Es war nicht nur eine Straftat. Es war fremdes Eigentum, es war Geld, für das der Mann gearbeitet hatte. Es war hinterhältig und gemein.
Wieder fühlte ich mich wie im freien Fall. Haltlos, orientierungslos und ohne Boden in Sicht.
Reiß dich zusammen. Jetzt oder nie.
Ich schob mich an ihnen vorbei, murmelte eine Entschuldigung und griff gleichzeitig zu.
Das Leder schmiegte sich weich an meine Handfläche.
Geschafft.
Die Männer hatten mich nicht mal beachtet. Dennoch beschleunigte ich meine Schritte, bis ich in eine kleine Nebenstraße abbiegen konnte. Ich schob das Portemonnaie in die hintere Tasche meiner Hose, damit es unter dem umgebundenen Hoodie versteckt war.
Kein Geschrei, kein Rufen nach der Polizei. Auch das hatte ich schon erlebt und war nur knapp davongekommen.
War es erledigt, fand ich es klug, in der Dunkelheit zu verschwinden. Im Hinterhof eines Ladens zählte ich schnell meine Beute. Sechsundsiebzig Dollar und ein Portemonnaie von Burberry, das ich verkaufen könnte. Auf den Straßen Atlantas gab es genug Händler, die sich für »auf Umwegen« beschaffte Waren interessierten. Vierzig Mäuse waren da bestimmt drin, es sah aus wie neu.
Ich vermied einen Blick auf den Personalausweis. Den Namen wollte ich nie wissen, denn das machte es plötzlich persönlich. Ich warf ihn hinter mich in die Dunkelheit, genau wie die Kreditkarten. Die Nummer war mir einfach zu heiß. An allen Bankautomaten gab es Kameras, ebenso wie in den meisten Geschäften. Dort mit einer gestohlenen Karte aufgenommen zu werden, war mir zu riskant. Außerdem wollte ich gar nicht das große Geld. Ich brauchte nicht viel, und bald würde ich bestimmt einen neuen Job haben. Bald. Sehr bald. Meinen Hintern hochkriegen, die fünfte Runde Bewerbungen schreiben, sich vorstellen gehen, bald, ja, sehr, sehr bald …
Diebin und Heuchlerin, Glückwunsch, du Loser.
Ich wühlte noch weiter in dem Portemonnaie. Keine Fotos, ein Glück. Aber ein flacher Taschenspiegel.
Ernsthaft? So schön war der Typ nun wirklich nicht gewesen.
Ich betrachtete meine Reflexion in dem kleinen eckigen Plastikrahmen.
In diesem Moment brach der helle Wintermond durch die Wolkendecke. Ein leichter Wind kam auf. Ich konnte die Nacht schmecken. Ihre flirrende Kälte, die winzigen Eiskristalle in der Luft.
Mein Blick in dem Taschenspiegel sah aus, als hätte ich einen Geist gesehen.
Ich konnte den Wind hören, sein leises Flüstern, sein Versprechen von Freiheit.
Meine Augen wirkten riesig in dem leicht schmierigen Glas.
Schatten begannen zu flüstern, jedes Geräusch wurde messerscharf, jede Bewegung sichtbar. Die halb erfrorene Ratte vor der Mülltonne, das Rascheln einer Katze auf der Feuertreppe, der schiefe Gesang einer Frau aus einem der Fenster.
Dann schien das Blau in meinem linken Auge zu verschwimmen. Das Schwarz der Pupille dehnte sich aus, streckte sich, und ein scharfer Stich jagte mir bis ins Hirn. Ich stieß einen schmerzerfüllten Laut aus. O Gott, was passierte gerade? Ob ich auf diesem Auge spontan blind wurde?
Ich blinzelte, und dennoch konnte ich den Blick nicht abwenden. Was zur Hölle ging hier vor? War ich krank? Würde ich sterben? Jetzt, hier, sofort?
Der Schmerz verschwand, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Zurück blieb eine Träne, die mir aus dem Augenwinkel rann, und eine komplett schwarze Iris.
Was. Zur. Hölle …?
Ich starrte immer noch ungläubig in den Spiegel. Meine Sehkraft war unverändert gut, aber … Ich keuchte auf vor Schock. Eine Iris war blau, die andere schwarz! Das Weiß drum herum schien zum Glück unversehrt.
»Was …«
Eine Stimme ließ mich meinen gemurmelten Satz nicht beenden. »Hey, Süße!«
Ich hob den Kopf, überrascht und ertappt zugleich. Ein Typ kam lässig auf mich zu. Er war vielleicht fünf oder sechs Jahre älter als ich. Seine Klamotten wirkten okay, aber er könnte dringend mal einen Haarschnitt vertragen. Und seine Schuhe schienen buchstäblich auseinanderzufallen.
»Rück die Kohle raus. Ich weiß, du hast den Schnösel beklaut.« Er streckte mir auffordernd die Hand hin. »Los, mach schon, oder das hier wird hässlich.«
Ich, die immer noch Portemonnaie und Taschenspiegel hielt, konnte das schlecht leugnen. Hinzu kam, dass ich durch die Sache mit meinem Auge noch irgendwie leicht neben mir stand. Verständlicherweise. Ich rechnete immer noch damit, dass ich gleich nichts mehr sah.
»Hau ab«, sagte ich halbherzig. »Das geht dich nichts an.«
»’ne große Klappe hat sie auch noch.« Der Typ strich sich das dunkle Haar zurück und verzog verächtlich einen Mundwinkel, als er sich vor mir aufbaute. Seine Nägel waren ungepflegt, der Kinnbart zu lang, um hip zu sein.
Schwer zu sagen, ob er tatsächlich obdachlos war.
Sag Hallo zu deinen neuen Freunden, Remy, wisperte eine böse kleine Stimme in meinem Kopf.
»Ich gehe jetzt.« Ich wollte mich abwenden.
»Erst das Geld, Baby, und dann überlege ich mir, ob du gehen darfst.« Er griff nach mir. Brutal, ohne zu zögern und so unwirsch, wie man nach einem davonfliegenden Blatt greifen würde.
»Lass mich los.« Mein Herz überschlug sich vor Angst. Bisher hatte ich auf den Straßen Atlantas immer Glück gehabt. Doch ich wusste, wie gefährlich es war, sich als Frau allein im Dunkeln herumzutreiben. Und jetzt bekam ich die Quittung dafür.
Der Typ lachte, doch als sich unsere Blicke trafen, wich er überrascht zurück.
»Freak.« Er stieß das Wort hervor wie ein Schimpfwort.
Ich antwortete nicht, stattdessen versuchte ich, mich aus seinem Griff zu lösen. Das Portemonnaie fiel mir aus der Hand, der kleine Spiegel zerbrach auf dem Asphalt.
»Hilfe!« Ich schrie das Wort aus Leibeskräften. »Hilfe, bitte!«
Keine Reaktion.
Irgendwo wurde scheppernd ein Fenster zugeknallt.
Dann lagen seine Finger plötzlich um meinen Hals. Er würgte mich. Er schnürte mir die Luft ab!
Ich sollte vor Angst und Panik durchdrehen, doch ich fühlte nichts dergleichen mehr.
Nichts.
Da war eine seltsame Ruhe in mir, tief und endlos. Dunkel und voller Kraft. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm.
Ich schaffte es irgendwie, nach Luft zu schnappen, und sie prickelte, als würden winzige Kristalle aus gefrorenem Sauerstoff auf meiner Zunge schmelzen.
Dort, tief in meinem Bauch, wo das kleine Feuer mich wärmte, entzündete sich ein Funke. Tief in mir brannte eine Sicherung durch. Ich schlug zu.
Das Brechen seiner Nase verursachte ein hässliches Knirschen.
Der Typ schrie auf, ließ mich los und wollte zurückweichen. Doch wie in Trance griff ich nach ihm.
Es fühlte sich an, als machte mein Körper sich selbstständig. Als wüsste er instinktiv, wie und wo er zuschlagen musste. Ich war nie eins dieser zerbrechlichen Püppchen gewesen, die unter dem schützenden Arm des Freundes verschwinden wollten. Ich maß knapp 1,75 Meter, und jeder Muskel meines Körpers war durch das jahrelange Training gefordert und geformt worden. Ich hatte zwar eine Menge abgenommen in den letzten Monaten, aber ich war immer noch rank und sehnig wie ein grüner Ast.
Noch ein Schlag. Und noch einer.
Als mein Verstand wieder die Oberhand gewann, sah ich entsetzt auf meine blutigen Fingerknöchel. Es war nicht mein Blut, was mich noch mehr entsetzte.
Der Typ war ohnmächtig in sich zusammengesunken, ein Arm lag schlaff über meinen Docs. Blutstropfen glitzerten auf dem Asphalt.
Ich hatte einen Menschen geschlagen. Der Typ war bewusstlos! Ich atmete schwer, immer noch unfähig, mich zu bewegen. Innerlich jedoch fühlte es sich an, als wäre jede Zelle meines Körpers zu neuem Leben erwacht. Es war wie ein Rausch, wie ein Cocktail nie gekannter Emotionen. Ich wollte es herausschreien. Lachen, kichern, ausflippen.
Ich schämte mich dafür, und schnell presste ich eine Hand über meinen Mund. Doch ich kam nicht dagegen an. Ein irres Lachen kämpfte sich den Weg aus meiner Lunge. Es brannte in meiner Kehle, fordernd und so übermächtig, dass ich mich krümmte.
Dann kapitulierte ich.
Ich bog den Rücken durch, reckte den Kopf gen Himmel, hinauf zum Mond, den Wolken, den Sternen und lachte.
Ein wilder Schrei erklang. Triumphierend, high vor Blutlust. Ich brauchte einen Moment, um zu erkennen, dass es mein eigener Laut gewesen war. Ich atmete keuchend aus, und mein Blick fiel auf den Mann, den ich bewusstlos geschlagen hatte.
Passierte das hier wirklich? Oder hatte ich endgültig den Verstand verloren?
»So viel Wut«, erklang eine tiefe Stimme unweit hinter mir.
»So viel Wahnsinn«, diese andere Stimme klang sogar noch dunkler.
Ich schwang herum.
Da waren sie wieder. Die zwei Typen mit den Reitstiefeln und der seltsam aus der Mode gekommenen Kleidung.
»Sie gehört zu uns.« Der Grauhaarige sprach, als wäre ich gar nicht da.
Der Dunkelhaarige nickte beifällig. »Sie gehört definitiv zu uns.«
»Wie bitte?«, stieß ich hervor. Als eine Wolke den Mond wieder freigab, badete ein milchiges Licht den Hinterhof. Ein eisiger Schauer jagte mein Rückgrat entlang. Ich starrte die beiden an. Sie hatten meine Augen. Blau und Schwarz.
O. Mein. Gott!
»Hallo, Jägerin.« Die Stimme des Dunkelhaarigen klang nun wie ein Schnurren. Er war nur knapp so groß wie ich, doch seine Hände wirkten so kräftig, dass sie mich vermutlich mühelos in der Mitte durchbrechen konnten. »Es wird höchste Zeit, dass du deine Kohorte kennenlernst.«
Kapitel 3
»Was?« Einen ewigen Moment lang starrte ich die beiden an. Schon wieder zweifelte ich an meinem Verstand.
Passierte das hier wirklich? Oder würde ich gleich in meinem Wohnheimzimmer aufwachen?
In dem Hinterhof war es jetzt ganz still. Alle Tiere hatten sich verkrochen, und sogar die Nacht schien den Atem anzuhalten. Nur der Schmerz in meinen blutigen Fingerknöcheln pulsierte im Takt meines Herzens.
Babamm … Babamm … Babamm.
»Es wird höchste Zeit, dass du deine Kohorte kennenlernst, Jägerin«, wiederholte der Dunkelhaarige fast liebenswürdig. Sein Gesicht war eigentümlich, mit einer zu großen Nase, buschigen Brauen und geröteten Wangen. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig, also etwa zehn Jahre jünger als den Grauhaarigen, der einen ebenso beeindruckenden Schnauzbart besaß wie er.
»Jägerin? Kohorte?« Ich wollte darüber lachen, doch das hier war alles so surreal, dass mein Körper sich gerade nicht entscheiden konnte, wie ich reagieren sollte.
Ein Stöhnen erklang. Der Typ, den ich bewusstlos geschlagen hatte, regte sich. Ich riss meinen Blick von dem Duo in Reitstiefeln los und sah auf ihn hinunter. Es stieg kein Ekel in mir auf, als ich das viele Blut sah. Seine Braue war rot verklebt, sein Auge schwoll bereits zu.
In diesem Moment wusste ich, dass ich es wieder tun würde.
Der Typ versuchte, sich auf den Rücken zu rollen. Völlig emotionslos sah ich ihm dabei zu, zuckte nicht zusammen, als seine andere Gesichtshälfte noch mehr Verletzungen offenbarte. Ich bewegte meine Finger, spürte, wie das Blut klebrig wurde, als es trocknete.
»Zeit für einen Abflug.« Die Stimme des Dunkelhaarigen ließ mich den Kopf wieder heben. »Du kommst mit uns, Jägerin.«
Ich wich zurück und fixierte die zwei Typen. »Was immer hier abgeht …« Meine Stimme brach, als ich plötzlich eine Idee hatte. »Ist das ein YouTube-Prank?« Ich sah mich hektisch um. Stand im Dunkeln jemand mit einem Handy und filmte alles? Hatte die Häme im Netz mir gegenüber jetzt neue Dimensionen erreicht? »Scheiße, das ist nicht lustig!« Meine Stimme war jetzt so laut, dass sie zwischen den Hauswänden hinauf Richtung Mond hallte. Ich hasste es, dass ich so verzweifelt klang. Dass ich zurückwich wie ein verletztes Tier. Dass der Unfall mich für immer gebrochen hatte.
»Das ist Barnabas, und mein Name ist Jacques«, sprach der Dunkelhaarige weiter und ignorierte meine Frage. »Wir erklären dir alles, wenn du mit uns kommst.«
»Was?« Ich klang wie eine kaputte Schallplatte. Das hier konnte nur ein Prank der übelsten Sorte sein.
»Fuck!« Der Typ auf dem Boden drückte sich mit einem Stöhnen hoch. »Wo …?« Er blinzelte, rieb mit der Hand über sein geschwollenes Auge, dann drehte er sich. Und sah direkt durch mich hindurch. »Wo ist die Schlampe hin?«, nuschelte er, dann spuckte er eine Mischung aus Schleim und Blut auf den Asphalt.
Ich stand nur zwei Schritte entfernt. Schon wieder glitt sein Blick zu mir, schon wieder sah er mich nicht.
Mit einem leisen Zirpen knallte eine Sicherung in meinem Kopf durch. Ich begann zu kichern. Es war ein verzweifeltes, schmerzerfülltes Geräusch, dennoch kontrahierten meine Bauchmuskeln sich rhythmisch, und ich konnte einfach nichts dagegen tun.
Glückwunsch, Remy, jetzt bringen sie dich in die Einrichtung, in der sie auch deine Mommy eingesperrt haben.
Ich hatte den Verstand verloren. Es war alles nur Einbildung. Ich hatte mein Zimmer nie verlassen. Es war alles …
»Lass mich dir helfen, Jägerin.« Jacques stiefelte mit entschlossenem Blick auf mich zu.
»Komm mir ja nicht zu nah.« Ich wich weiter zurück.
Der Typ, den ich verprügelt hatte, zog die Nase hoch und sah sich erneut leise fluchend um.
»Na, komm schon.« Jacques ging direkt durch den Typen hindurch, als wäre er aus Nebel.
O. Mein. Gott! Weg von hier. Egal, was gerade passiert war, erst mal weg von hier. Ich nahm die Beine in die Hand und floh. Der Schmerz kam sofort. Mein verletztes Bein protestierte, als die Sohle des Stiefels hart auf den Boden traf. Und noch mal und noch mal, noch mal, egal, es ist nur in deinem Kopf, nur in deinem Kopf! Ich jagte raus aus dem Hinterhof. Wenn ich es bis auf die Hauptstraße schaffte …
Am Straßenrand neben dem Elektronikgeschäft stieg eine Frau aus einem Kleinwagen.
»Hallo!«, rief ich. »Hallo, Ma’am, ich brauche Hilfe!«
Sie reagierte nicht.
»Ma’am, bitte!« Ich wedelte mit den Armen. »Ma’am!« Sie konnte mich unmöglich überhören. Sie konnte mich unmöglich übersehen.
Meine Verfolger holten auf, denn das Geräusch schwerer Sohlen kam immer näher. Verdammt! Ich beschleunigte meinen Lauf. Der Schmerz war wie ein Dorn, der sich tief in mein Fleisch bohrte. Ich keuchte auf. Mein Knie knickte weg, doch ich zwang mich humpelnd weiter. Die Frau schloss die Tür des Wagens und lief direkt auf mich zu.
»Hallo?« Ich war so nah, dass ich sie fast berühren konnte. »Helfen Sie mir, bitte.«
Die Frau lief durch mich hindurch. Es war wie eine kühle Brise, die durch meinen Körper strich. Ich schluchzte auf in einer Mischung aus Überraschung und Verzweiflung.
»Ganz ruhig.« Die Stimme drang an mein Ohr, da fühlte ich schon Hände schwer auf meinen Schultern. Jacques drehte mich zu sich um.
»Nein«, würgte ich hervor. Mit beiden Händen schlug ich nach ihm.
»Alles wird gut.« Jacques lächelte und holte mit seiner riesigen Faust aus. Schmerz explodierte in meinen Kopf, und dann wurde erst alles gleißend hell und dann schwarz.
*
Ich zuckte zusammen, als etwas meine Wange berührte, und schlug die Augen auf. Zunächst sah ich alles nur verschwommen. Farben, die kaleidoskopartig ineinanderglitten, durchzogen von Blitzen aus Helligkeit. Ein dumpfer Schmerz hämmerte in meinem Kopf. Ich stöhnte auf und hob eine Hand an mein Gesicht. Auf diesem Weg streifte ich etwas Warmes und zuckte zurück. Ich blinzelte, und endlich nahm meine Sicht Konturen an. Etwas … jemand beugte sich über mich. Ein spitzes, kleines Gesicht, riesige Augen, ein buntes Tuch um das dunkle Haar. Die Finger, die ich berührt hatte, endeten in hellbraunen Krallen.
Ich schrie auf und versuchte reflexartig, mich von dieser Gestalt wegzuschieben. War ich jetzt also nicht mehr unsichtbar?
Meine Beine strampelten wie unter Wasser, meine Finger gruben sich in kühle feuchte Erde. Ich kam kaum voran, aber das war mir egal.
»Ganz ruhig«, sagte das Wesen, die Frau, die sich über mich gebeugt hatte. In ihrer Stimme schwang ein leichtes Zischen mit. Jetzt hatte sie beide Hände gehoben, als wollte sie ein scheuendes Pferd beruhigen. Sie kam mir nicht nach, was dafür sorgte, dass ich meinen jämmerlichen Fluchtversuch beendete und sie einfach nur anstarrte. Sie sah nicht wirklich bedrohlich aus. Ihr Gesicht war freundlich, wenn auch nicht ganz menschlich. Mit diesen großen, dunklen Augen, einer spitzen Nase und den abstehenden runden Ohren erinnerte sie mich an eine Maus. Sie war klein, kaum größer als ein zehnjähriges Kind, und trug Kleidung, die mich entfernt an die Kostümierungen von Mittelaltermarkt-Besuchern erinnerte. Ein schlichtes, braunes Unterkleid, das knapp über ihren Knöcheln endete, darüber eine graue Schürze mit Stickereien an den Trägern. Der einzige Farbklecks war das bunte Tuch um ihre Haare.
Ich wollte gerade etwas erwidern, da schien mein rationaler Verstand wieder zum Leben zu erwachen. Mit ihm kam die Erinnerung zurück. Eins meiner Augen hatte die Farbe gewechselt, dann hatte ich jemanden bewusstlos geschlagen. Ich erinnerte mich an die zwei Typen in den Reitstiefeln und an meine Flucht. An das Gefühl, wie die Frau direkt durch mich hindurch gelaufen war. Und jetzt saß ich einem Wesen gegenüber, das aussah wie eine Mischung aus Mensch und Maus.
Ich kam so schnell wie möglich auf die Füße, knickte aber kurz um, und wieder jagte ein schmerzhafter Stich durch mein Bein.
»Bist du verletzt?« Jetzt kam sie doch weiter auf mich zu. »Ich bin Isla. Kann ich dir helfen?«
Ich ignorierte ihre Worte und wich mehrere Schritte zurück. »Wo bin ich hier?« Ich sah mich um. Und wie bin ich hierhergekommen? Ich befand mich auf einer Art Acker, auf dem sich hartes, dunkles Gras einen Platz zwischen großen Pfützen aus Matsch erkämpft hatte. Überall brannten Fackeln und erhellten die Dunkelheit. Rechts von mir entdeckte ich ein paar winzige Häuser. Schmale, aus groben Planken gezimmerte Behausungen, auf deren Dächern Moos wuchs. Sie waren kaum größer als ein Gartenhaus. Zu meiner Linken begann ein Wald aus hochgewachsenen Bäumen, und ein Pferd mit flammend roten Augen stupste gerade einem knapp zwei Meter großen Hund freundschaftlich gegen den Hals.
Das Pferd … und der riesige Hund …
Fast wären mir die Beine erneut weggeknickt. »Wo haben sie mich hingebracht? Wo …?« Meine Stimme brach. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Ich befand mich in einer Traumwelt. Mein Verstand hatte kapituliert und die große, böse Realität ausgesperrt. Vermutlich würde als Nächstes ein rosa Einhorn vorbeitraben. Das Pferd mit den Feueraugen jedenfalls schien wie sein düsterer Zwilling.
»Du musst dich beruhigen.« Die Frau, ihren Namen hatte ich vergessen, kam mir erneut nach. »Es wird alles gut.«
Ich wich nach hinten aus. Meine Flucht endete, als einer meiner Stiefel so tief im Matsch versank, dass ich abrupt ausgebremst wurde. Ich kippte nach hinten, ruderte verzweifelt mit den Armen und landete schließlich auf dem Hintern. Sofort drang Feuchtigkeit durch den Stoff meiner Jeans. Ich drückte die Handflächen in die weiche Erde, um wieder hochzukommen, doch meine Sohlen fanden einfach keinen Halt. Ich gab einen so wütenden Laut von mir, dass die kleine Frau erschrocken vor mir zurückwich.
»Ich soll mich beruhigen?« Meine Stimme überschlug sich fast. »Alles wird gut? Hast du eine App für diese Kalendersprüche? Ich will mich nicht beruhigen, und gar nichts ist gut. Und es wird auch nie wieder gut. Mein Leben ist eine einzige Katastrophe, und heute Abend ist alles noch schlimmer geworden. Kennst du die Steigerung von Katastrophe? Gibt es eine Steigerung davon?« Ich lachte hysterisch auf. »Nein. Gibt es nicht.« Ich deutete auf die Gegend um mich herum. »Und trotzdem befinde ich mich jetzt in einer Traumlandschaft voller seltsamer Tiere. Ich rede mit Fantasiewesen. Und ausgerechnet ich soll mich beruhigen?« Ich deutete mit dem Finger auf sie. »Und du versprichst mir, dass alles gut wird? Lächerlich!«
»Na, na, na …«, erklang hinter mir eine Stimme. Ich erkannte sie sofort wieder. Es war dieser Jacques, der mich zusammen mit dem anderen Kerl entführt hatte. Er umrundete mich, während ich ihn wütend ansah.
»Wo habt ihr mich hingebracht? Ich werde jetzt sofort die Polizei rufen und Anzeige erstatten. Ihr habt mich entführt, und du hast mich geschlagen. Das wird ein Nachspiel haben.« Ich schob meine dreckverkrustete Hand in meine Jeanstasche und zog mein Handy hervor. Kein Empfang. Alles auf dem Display wirkte seltsam verzerrt, als hätten eine wichtige Schaltstelle der Grafikkarte einen Kurzschluss erlitten.
Im nächsten Moment wurde ich grob auf die Füße gerissen. Ich war so beschäftigt mit meinem Telefon gewesen, dass ich gar nicht auf Jacques geachtet hatte.
»Aua«, zischte ich und schubste ihn grob vor die Brust. Er rührte sich keinen Zentimeter. Wir waren gleich groß, doch ich hatte ihn wohl richtig eingeschätzt. Er konnte mich in der Mitte durchbrechen, wenn er wollte.
»Mitkommen«, knurrte er. Schon hatte er seine Finger um meinen rechten Oberarm geschlungen und zog mich mit sich.
»Hey!«
Mein Protest ließ ihn ungerührt, stattdessen drehte er den Kopf nach hinten. »Isla?« Selbst ich erkannte, dass diese Frage ein getarnter Befehl war. Ich zappelte in seinem Griff, trat sogar nach ihm, doch er schleifte mich einfach weiter.
»Lass mich sofort frei. Es gibt niemanden, der Lösegeld bezahlen kann. Mein Vater ist abgehauen, und meine Mutter ist sehr krank. Meine Sponsorengelder sind schon lange aufgebraucht. Bei mir ist nichts zu holen.«
Jacques brummte irgendetwas, doch ich verstand ihn nicht.
»Was hast du gesagt?« Um nicht auch noch mein Telefon zu verlieren, schob ich es schnell zurück in meine Tasche.
»Spare deine Kräfte, du wirst sie in den nächsten Tagen brauchen.«
»Was soll das heißen? Du lässt mich jetzt sofort los. Wenn du mir sagst, wo ich bin, und mich gehen lässt, dann verzichte ich auf eine Anzeige. Und wenn …«
Ich redete gegen eine Wand. Erst verhandelte ich, dann drohte ich Jacques. Und er? Er sah mich nicht mal mehr an.
Mittlerweile hatten wir den Waldrand erreicht und passierten den großen, dunkelbraunen Hund. Ich hielt in meiner Tirade inne und warf ihm einen interessierten Blick zu. Wenn das eine Requisite war, dann war sie verdammt lebensecht.
Das Pferd mit den glühenden Augen war verschwunden. Der Hund senkte den Kopf und schnüffelte in meine Richtung. Alles an ihm wirkte so … real. Ein Schauer jagte mir die Wirbelsäule hinab wie eine düstere Vorahnung. Dann hörte ich das Johlen. Applaus gesellte sich dazu und ein wuterfülltes tiefes Brüllen, das die Vögel in den Bäumen über uns aufschreckte. Die Haare auf meinen Armen richteten sich auf. Vielleicht war ich in so einer abgedrehten japanischen Gameshow gelandet? Einer, bei der die Teilnehmer wie Fantasie-Gladiatoren gekleidet in einer Arena mit Waffen aus Kunststoff kämpfen mussten. Hatte mein Agent mich dafür angemeldet und nur vergessen, mir Bescheid zu sagen? Das klang unwahrscheinlich. Auch wenn er immer noch sporadisch auf meine Nachrichten antwortete, wusste ich, dass ich schon längst eine Karteileiche war.
Ich reckte den Kopf nach rechts in Richtung der Geräusche. Doch der Wald war zu dicht, und trotz der Fackeln, die den Weg säumten, war es zu dunkel, um etwas zu erkennen.
»Das reicht. Ich will nach Hause.« Noch mal versuchte ich, meinen Arm aus Jacques’ Griff freizubekommen. Mein Schultergelenk protestierte vehement.
Jacques blieb so abrupt stehen, dass ich mir fast den Arm abriss, als ich weiterlief.
»Herrgott, verdammt noch mal!«, rief ich und rieb mit der freien Hand über meinen Oberarm. »Was stimmt nicht mit dir?«
»Das ist jetzt dein Zuhause«, erwiderte Jacques, und wieder spielte da so ein liebenswürdiges Lächeln um seine Mundwinkel. »Du bist jetzt ein Teil der Wilden Jagd. Deine Augen, schon vergessen?«
»Wie? Meine Augen?« Das sollte alles an Erklärung dazu sein? »Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und was ist die Wilde Jagd?« War das nicht so eine Truppe übernatürlicher Geisterjäger, mit deren Schauergeschichten man Kinder an den Weihnachtstagen früh ins Bett schicken konnte?
Jacques gab ein genervtes Schnauben von sich, dann zog er mich weiter. »Ich erkläre dir alles, wenn du die Prüfung bestanden hast«, brummte er. »Wäre sonst vergebliche Mühe.«
»Entschuldige mal, ich …«, begann ich mit scharfer Stimme, dann stockte ich. »Was für eine Prüfung?«
Jacques erwiderte nichts.
Okay, Schluss mit lustig. Mein Hintern war klatschnass, ich war schlammverkrustet, und an meinen Fingern klebte immer noch Blut. Ich war müde, hungrig und mit meiner Kraft am Ende. Mein Entschluss war gefasst. Ich würde mich genau jetzt umdrehen und so lange in die andere Richtung rennen, bis ich wieder in der Zivilisation ankam. Und das zur Not auch mit ausgekugeltem Arm, wenn ich nur so aus Jacques’ Griff entkommen konnte.
Ich wartete auf den richtigen Moment. Das sagte ich mir zumindest, denn eigentlich sammelte ich Mut. Als erneut Johlen und Applaus durch die dicht stehenden Bäume drang, wurde mir klar, dass mir die Zeit davonlief. Ich biss die Zähne zusammen und warf mich herum. Und ich schaffte es, mich loszureißen. Jacques brüllte wütend auf. Isla duckte sich, als ich an ihr vorbeirannte. Ich jagte den Weg hinunter, fest entschlossen, diesen Ort so schnell wie möglich hinter mir zu lassen.
Kapitel 4
Mein Adrenalinspiegel war so hoch, dass ich den Schmerz in meinem Bein kaum wahrnahm. Noch ein Baum und noch ein Baum und noch ein Baum. Ich zählte sie wie automatisch, nahm sie als Maß für den Weg, der mich in die Freiheit führte. Noch ein Baum und noch … Ich fiel der Länge nach auf den Waldboden. Sternchen tanzten vor meinen Augen. Das hatte echt wehgetan. Ich wollte mich aufrichten, doch ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen! Panisch rollte ich mich auf den Rücken. Ich schmeckte Erde auf meinen Lippen, winzige Pflanzenteile hingen an meinen Wimpern und fielen mir in die Augen. Mein Gesicht brannte wie Feuer, doch das war mir im Moment egal. Hektisch rieb ich mir über die Augen und über den Mund.
Warum konnte ich meine Beine nicht bewegen? Himmel, bitte nicht noch mehr Verletzungen! Bitte, ich brauchte meine Beine. Ich brauchte … Meine Sicht verschwamm kurz, mein Herzschlag beschleunigte sich rasant. Ich stand am Rand einer Panikattacke.
Über mir tauchte ein Gesicht auf. Jacques schüttelte missbilligend den Kopf, während er neben mir in die Hocke ging. »Wo willst du denn hin?«
Ich hustete, holte Luft, und meine Stimme klang kratzig. »Weg.«
Jacques hob die linke Braue und sah dann zu Isla, die sich jetzt auch über mich beugte. »Sie wollte weg.«
Isla nickte, doch ihr Gesicht zeigte keine Regung.
Jacques hob meine Beine an und machte sich an meinen Knöcheln zu schaffen.
Ich, die immer noch versuchte, regelmäßig zu atmen, wehrte sich nicht. Als er eine Schnur hochhielt, an deren Enden je ein Stein befestigt war, wurde mir alles klar. Er hatte mich zu Fall gebracht. Vergessen war meine Angst, jetzt war ich einfach nur noch wütend. Ich setzte mich auf.
»Ich werde dich wegen Körperverletzung verklagen«, rief ich und deutete mit dem Finger auf Jacques. »Wenn irgendetwas mit meinem Bein ist, dann schicke ich dir die Rechnung. Du magst Teil der Show sein, aber das geht zu weit. Glaub mir, du hörst von mir, sobald ich von hier verschwunden bin und ein paar Dinge geordnet habe. Dein Name. Los, sag mir deinen vollen Namen.«
»Du kannst nicht einfach aus der Anderswelt verschwinden.« Jacques nahm beide Steine in die Hand, als prüfte er ihr Gewicht. »Es gibt Tore, aber die kannst du nicht einfach öffnen.« Dann richtete er sich auf und befestigte die Steine samt Kordel an seinem Gürtel.
»Du bleibst echt in deiner Rolle, oder?« Ich rieb mir noch mal mit der Hand über das Gesicht. Kein Blut, ein Glück. »Ich werde das, was auch immer das hier ist, an dieser Stelle abbrechen. Ich habe das Memo mit dem großen Spieleabend im Auenland nicht bekommen, und jetzt möchte ich einfach nur duschen und ins Bett. Es wird doch irgendeinen Set-Runner geben, der jetzt gerade Zeit hat und mich zum Ausgang begleiten kann. Ich bin hier fertig.«
Über mich hinweg wechselten Jacques und Isla einen Blick.
Ich sah zwischen den beiden hin und her. »Was? Habe ich mich unklar ausgedrückt? Worauf warten wir?« Ich hustete noch mal. »Außerdem brauche ich etwas zum Desinfizieren.« Mein Gesicht pochte und brannte gleichzeitig. Es war mir völlig egal, wie ich aussah. Aber bei meinem Glück würden sich die kleinen Schnittwunden entzünden durch den ganzen Dreck.
»Desin–…?«, begann Isla.
»Säubern«, unterbrach Jacques sie barsch. Wieder wandte er seinen Todesgriff an und zog mich auf die Füße. Zum Glück schien mit meinem Bein alles okay.
»Sie will ihre Wunden säubern.« Er legte beide Hände auf meine Schultern und sah mich ernst an. »Glaub mir, Jägerin, diese kleinen Kratzer sind im Moment nicht dein Problem. Wir säubern uns nicht vor einem Kampf, wir säubern uns danach.«
Ich starrte Jacques an. Wenn er noch einmal säubern sagte, würde ich schreien. Und ich würde garantiert mit nichts und niemandem kämpfen. Sie konnten mich schlecht zwingen.
»Los.« Jacques umgriff wieder meinen Arm und gemeinsam liefen wir den Pfad wieder in die entgegengesetzte Richtung.