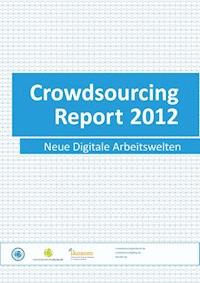
Crowdsourcing Report 2012 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Beim Crowdsourcing handelt es sich um ein Set von Prinzipien, Prozessen und Plattformen zur Steuerung von offenen Arbeitsprozessen. Dies schließt nicht nur die (mitunter globale) Ausschreibung sondern auch die Auswertung und Aggregation der Ergebnisse mit ein. Die Annahme ist einfach wie verlockend: Durch kollaborative Kreativ-Wettbewerbe, Wissens- und Ideensammlungen, Bewertungen oder Vorhersagen wird ein besseres Ergebnis erzielt, als wenn sich Individuen diesen Aufgaben annehmen würden. Durch massiv verbesserte technische Möglichkeiten auf der einen und durch erhöhten Effizienzdruck auf der anderen Seite wird die Nutzung von Crowdsourcing immer attraktiver für Unternehmen und Institutionen. Insbesondere Web-2.0-Mechanismen emöglichen und fördern die Vernetzung - mit durchaus weitreichenden Folgen. Die Entstehung globaler Plattformen und Kommunikationsnetze bietet den Zugriff auf eine immer größere Crowd mit unterschiedlichsten Qualifikationen – eine gigantische "global Workforce", die das intellektuelle Kapital verschiedenster Kulturkreise in sich vereint. Neue Technologien und Kommunikationssysteme erlauben überhaupt erst das Aufteilen von Tasks oder ganzen Arbeitsabläufen. In den vergangenen Jahren hat sich durch die Entstehung neuer Benutzerschnittstellen, Micropayment-Lösungen, Flatrates, Cloud-Services sowie die zunehmende mobile Internetnutzung eine digitale Infrastruktur entwickelt, deren logische Folge ein virtueller Workspace ist. Mit dem Crowdsourcing Report erfolgt erstmals eine systematische Bestandsaufnahme der hierzulande anzutreffenden Ausprägungen und Einsatzbereiche von Crowdsourcing. Die Autoren blicken hinter die Kulissen von beispielhaften Projekten und skizzieren förderliche Rahmenbedingungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Crowdsourcing-Report 2012 - Neue Digitale Arbeitswelten Claudia Pelzer, Karsten Wenzlaff, Jörg Eisfeld-Reschke published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de Copyright: © 2012 Claudia Pelzer, Karsten Wenzlaff, Jörg Eisfeld-Reschke ISBN 978-3-8442-2358-3
Herausgeben von: Claudia Pelzer (CrowdsourcingBlog) Karsten Wenzlaff (ikosom) Jörg Eisfeld-Reschke (ikosom)
Vorwort der Herausgeber
There is a new kid in town... Ein neuer Mechanismus vielmehr. Aber was genau hat es auf sich mit Crowdsourcing? Wo kommt es her, wo geht es hin, wie wird es bislang und zukünftig eingesetzt und wieso ist Crowdsourcing mehr als nur ein weiteres Web 2.0 Buzzword? Wie geht der internationale Markt und wie geht Deutschland mit diesen Prozessumwälzungen um?
Diese Fragen und weitere sollen auf den folgenden Seiten beantwortet werden - und zwar vom winzigsten Microtask bis zum großen Gesamtbild und der Aufgabenstellung, unsere Arbeitswelten von morgen mitzugestalten, denn
"was dem Schwarm nicht nützt, das nützt auch der einzelnen Biene nicht“ (Mark Aurel)
Die Herausgeber möchten sich herzlich bei allen Unterstützern dieses Reports bedanken, insbesondere den zahlreichen Start-Ups und Crowdsourcing-Experten, die sich mit Hinweisen und Informationen an uns gewandt haben. Ein besonders herzlicher Dank geht an die Autoren, die einzelne Texte zu ihren Spezialthemen beisteuerten. Dieser Report wäre nicht möglich gewesen durch die Partner des Crowdsourcing-Blogs und die Anzeigenpartner. Auch dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
Claudia Pelzer, Karsten Wenzlaff, Jörg Eisfeld-Reschke
Herausgeber und Autoren
Claudia Pelzer
Claudia Pelzer ist Medien-Ökonomin, hat ein internationales MBA-Studium absolviert und promoviert derzeit zum Thema Crowdsourcing. Sie arbeitet in Köln als Medien-Beraterin, Autorin und Bloggerin, verfasst Studien und organisiert Branchenevents. Ende 2011 hat sie den Deutschen Crowdsourcing Verband (DCV) e.V. gegründet.
Das CrowdsourcingBlog ist eine zentrale Informationsplattform für Themen wie Crowdsourcing, Open Innovation und Future of Work. News, Interviews und Fallbeispiele aus der Branche dokumentieren die aktuelle Entwicklung und deren wirtschaftliche wie gesellschaftliche Auswirkungen. www.crowdsourcingblog.de
Karsten Wenzlaff
Gründer des Instituts für Kommunikation in sozialen Medien (ikosom) und beschäftigt sich vor allem mit den Themen Crowdfunding, Crowdinvesting, Urheberrecht und Journalismus 2.0
Jörg Eisfeld-Reschke
Gründer des Instituts für Kommunikation in sozialen Medien (ikosom). Der Experte für Digital Fundraising, ePartizipation und Social Media Governance vermittelt sein Wissen als Autor, Berater und Seminarleiter.
Im Institut für Kommunikation in sozialen Medien (ikosom) arbeiten Experten aus unterschiedlichen Bereichen der digitalen Kommunikation. ikosom beschäftigt sich mit Themen wie Community Management, Digitales Fundraising, Government 2.0, ePartizipation und Urheberrecht. www.ikosom.de
Anu Beck
Co-Founderin des betahaus Köln und Co-Working Pionierin. Sie arbeitete im Modemarketing bis sie 2010 ein Freund erstmalig auf das betahaus brachte. Anu war sich sofort sicher, dass sie diesen Ort nach Köln bringen will und begann unmittelbar mit der Aufbauarbeit. Mit dem betahaus bietet sie viel mehr als nur einen Heimathafen für gestrandete Freelancer - nämlich eine innovative Arbeitsumgebung und gleichermaßen eine Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen.
Simone Janson
Studium von Geschichte und Linguistik in Deutschland und Italien, Journalistin und Expertin für neue Formen der digitalen Arbeit am Institut für Kommunikation in sozialen Medien, Vortragende und Lehrbeauftragte an diversen Universitäten. Auf ihrem Blog Berufebilder.de beleuchtet sie mit über 50 Autoren neue Arbeitsformen und interviewt Menschen weltweit zu Berufsbildern und innovativen Ideen. Sie hat über 20 Bücher geschrieben, darunter "Die 110%-Lüge“, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde. In Ihrem aktuellen Buch "Nackt im Netz“ geht es um Social Media und den digitalen Wandel.
Konrad Lauten
Studium der Sozialwissenschaften, speziell Stadtsoziologie. Als Nutzer und Gestalter städtischer Freiräume im Berlin der 90er und 00er Jahre und Produkteentwickler für außergewöhnliche Getränke sowie als Händler ethnobotanischer Pflanzen, Plattenlabel- und Barbetreiber oftmals Beschäftigung mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten in sozialen Netzen der offline-Welt. Nach einer intensiven Zeit als Catering und bar-Mitarbeiter der bar25 in Berlin und begonnenem Studium der Agrarwissenschaften Übertragung dieser Erfahrungen auf die Möglichkeiten, die das web für Fundraising, Marketing und Beratung bietet. Gründung der Inkubato UG Anfang 2010.
Torsten Meyer
Jahrgang 79, hat an der Martin Luther Universität in Halle/S. Betriebswirtschaft studiert. Während der Absolvierung eines internationalen Management Traineeprogramms zeichnete sich schnell seine Leidenschaft für das Marketing und die strategische Unternehmensführung ab. Seit 2009 ist Torsten im Berliner Startup Umfeld unterwegs. Mit der Gründung von UI-Check.com erfüllte er sich seinen langgehegten Traum des eigenen Geschäftes. Bei UI-Check betreut er das Business Development und den Partnerbereich.
Eva Missling
Geschäftsführerin und Gründerin von 12designer. com, der führenden europäischen Plattform für Design-Wettbewerbe. 12designer ist seit März 2009 auf dem deutschen Markt, mittlerweile ist 12designer in fünf europäischen Sprachen verfügbar. Zuvor war sie mehrere Jahre in der Agenturbranche als strategische Beraterin für DAX-Unternehmen tätig.
Sandro Morghen
Verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der systematischen Entwicklung von Ideen. Im Laufe seiner Karriere, welche bei der Schweizer Ideenfabrik BrainStore begann, hat er über 600 Ideenfindungsprojekte für rund 300 namhafte Kunden in über 20 verschiedenen Branchen inhaltlich und methodisch geführt. Seit Anfang 2011 baut er als Co-Founder den Web-Startup yutongo.com auf. yutongo bietet Ideen-Crowdsourcing mit einem neuartigen Ansatz.
Bernd Oswald
War nach einer Redakteursausbildung an der Deutschen Journalistenschule u.a. als Ressortleiter Nachrichten/Aktuelles für süddeutsche.de tätig. Seit 2009 arbeitet er als Autor und Trainer für digitalen Journalismus. Er zählt zu den Autoren des Fachblogs onlinejournalismus.de und bloggt auf seinem PIN-Blog über Politik im Netz.
David Röthler
Studium der Rechtswissenschaften; Berater, Erwachsenenbildner, Uni-Lektor, Medienjournalist; im Fokus stehen partizipative Medien und deren Nutzung für Politik, Bildung, Kultur und internationale Projektarbeit.
Anna Theil
Anna Theil ist bei der Crowdfunding-Plattform start-next.de verantwortlich für Kooperationen (Institutionen, Festivals, Hochschulen, Städte ...) und betreut die Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich kuratiert sie die co:funding Konferenzen und Workshops, die sich um Crowdfunding und Crowdinvesting drehen. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Crowdfunding und öffentliche Kulturförderung zusammen passen.
Dorothea Utz
Dorothea Utzt ist Mitgründerin und CMO der Streetspotr GmbH & Co. KG. Nach einem Lehramtsstudium und Ausflügen in den Journalismus berät sie seit 2008 Web 2.0-orientierte Internetfirmen in den Bereichen Marketing, PR und Strategie und promoviert derzeit nebenberuflich.
Christine Weißenborn
Christine Weißenborn ist freiberufliche Journalistin für Print/Online/Radio - und interessiert sich für alles rund um die Themen "Entrepreneurship" und "Crowdsourcing“. Nach einem Studium der Kulturwirtschaft in Passau und Chile, Stationen unter anderem beim ZDF, dem Tagesspiegel, der Zeit und einem Volontariat bei der Verlagsgruppe Handelsblatt, schrieb sie mehrere Jahre über Handels- und Konsumgüterthemen für das Handelsblatt.
Markus Winkler
Markus Winkler, Jenenser und Wahlberliner, widmet sich seit mehreren Jahren Kampagnen im Netz und Kampagnen fürs Netz. Dafür beschäftigt er sich mit der Transformation digitaler Gesellschaften, der Netzpolitik und der E-Partizipation. Er ist Projektleiter bei ikosom und arbeitet für den WWF Deutschland als Social Media Redakteur.
Abstract
Wir leben im Zeitalter des Zugangs. Globale Netzwerke ermöglichen den Zugang zu Informationen, Wissen, Meinungen, Arbeit, Expertentum, Ideen und Kapital. Seit einigen Jahren haben sich nun immer fortschrittlichere Mechanismen herausgebildet, die durch die Beteiligung der Masse Mehrwerte erzeugen. In 2006 folgte dann der passende Name: Crowdsourcing.
Beim Crowdsourcing handelt es sich um ein Set von Prinzipien, Prozessen und Plattformen zur Steuerung von offenen Arbeitsprozessen. Dies schließt nicht nur die (mitunter globale) Ausschreibung sondern auch die Auswertung und Aggregation der Ergebnisse mit ein. Die Annahme ist einfach wie verlockend: Durch kollaborative KreativWettbewerbe, Wissens- und Ideensammlungen, Bewertungen oder Vorhersagen wird ein besseres Ergebnis erzielt, als wenn sich Individuen diesen Aufgaben annehmen würden. Durch massiv verbesserte technische Möglichkeiten auf der einen und durch erhöhten Effizienzdruck auf der anderen Seite wird die Nutzung von Crowdsourcing immer attraktiver für Unternehmen und Institutionen. Die steigende Nachfrage nach Crowdsourcing-Dienstleistungen und -Produkten basiert dabei auf sechs Grundprinzipien (s. Kasten).
1. Das grundlegende Wesen der Arbeit wandelt sich. Die Komplexität für die Arbeitnehmer und die Anforderungen an ihre technischen und sozialen Kompetenzen steigen.
2. Moderne Kommunikations-Technologien fördern den fließenden Übergang von Arbeit und Freizeit.
3. In der Wissens- und Kreativ-Ökonomie werden Produkte durch Ideen, Innovationen und Informationen ersetzt.
4. Damit werden auch Arbeitszeiten und Löhne flexibler. Humankapital wird infolge dessen noch wertvoller.
5. Alte Wertschöpfungsketten weichen auf. Der Konsument greift mitunter sogar in diese ein.
6. Konsumenten können mittels Crowdfunding und Crowdinvesting Produkte für die Produktionsreife finanzieren, noch bevor sie am Markt sind.
Insbesondere Web-2.0-Mechanismen emöglichen und fördern die Vernetzung - mit durchaus weitreichenden Folgen. Die Entstehung globaler Plattformen und Kommunikationsnetze bietet den Zugriff auf eine immer größere Crowd mit unterschiedlichsten Qualifikationen - eine gigantische "global Workforce", die das intellektuelle Kapital verschiedenster Kulturkreise in sich vereint. Neue Technologien und Kommunikationssysteme erlauben überhaupt erst das Aufteilen von Tasks oder ganzen Arbeitsabläufen. In den vergangenen Jahren hat sich durch die Entstehung neuer Benutzerschnittstellen, Micropayment-Lösungen, Flatrates, Cloud-Services sowie die zunehmende mobile Internetnutzung eine digitale Infrastruktur entwickelt, deren logische Folge ein virtueller Workspace ist.
Mit dem Crowdsourcing Report erfolgt erstmals eine systematische Bestandsaufnahme der hierzulande anzutreffenden Ausprägungen und Einsatzbereiche von Crowdsourcing. Die Autoren blicken hinter die Kulissen von beispielhaften Projekten und skizzieren förderliche Rahmenbedingungen.
1. The Rise of Crowdsourcing: Entwicklung & Treiber
Der Begriff Crowdsourcing wurde im Jahr 2006 erstmals von Jeff Howe in einem Wired-Artikel erwähnt1 . Seitdem hat er sich mehr und mehr etabliert und Begriffe wie ,Schwarmauslagerung' in den Hintergrund gedrängt. Bei Howe's Wortneuschöpfung handelt es sich um einen Neologismus, der sich aus 'Crowd' und 'Outsourcing' zusammensetzt.
Der Prozess ist eng verwandt mit Web Phänomenen wie der 'Open Source Bewegung' oder 'User Generated Content' (UGC) und beschreibt die Auslagerung von Arbeits- und Kreativprozessen sowie gleichermaßen die Einlagerung von Wissen, Kapital und Zeit (aus der Crowd) in ein Unternehmen oder eine Organisation.
Crowdsourcing hat unterschiedliche Erscheinungsformen, unter anderem:
Crowdfunding (die Community finanziert gemeinsam ein Projekt)
Co-Creation (die Community erschafft emein-sam ein kreatives Werk)
Microworking (die Community erfüllt kleinere (Teil-)Aufgaben, wie z.B. Adressrecherchen, die final wieder zu einem Gesamtergebnis zusammengesetzt werden)
Die Crowdsourcing Timline "Artificial Artificial Intelligence" (Quelle: Eigene Darstellung)
Crowdsourcing wurde und wird überhaupt erst durch bestimmte (in erster Linie technische) Voraussetzungen und Weiterentwicklungen möglich. Der wohl wichtigste ,Enabler' ist dabei der immer schneller stattfindende digitale Fortschritt.
Insbesondere Web 2.0 Mechanismen fördern die Vernetzung von Usern und die Entstehung von Crowdsourcing-Communities. Auch die Nutzung von Online- und Micropayment-Modellen ist essentiell für viele Ausprägungen von Crowdsourcing Diensten.
Die Digitalisierung liefert nicht nur das notwendige Handwerkszeug durch günstigeres und besseres technisches Equipment (Beispiel: Die Foto-Community iStockphoto wäre nicht möglich ohne professionelle, erschwingliche Digitalkameras).
Der digitale Fortschritt bildet auch einen unverzichtbaren Grundstein für die Entwicklung der Branche. Nehmen wir die Fragmentierung von Aufgaben: Neue Technologien und Kommunikationssysteme ermöglichen ein Unterteilen und Aufteilen von Tasks oder ganzen Arbeitsabläufen, die zuvor nur von einer Person beziehungsweise an einem Ort ausgeführt werden konnten.
Damit entstehen neue Organisationsstrukturen, die eher einem belebten Bazar entsprechen, als einer hierarchischen Struktur. Die Entstehung globaler Plattformen und Kommunikationsnetze ermöglichen in diesem Zusammenhang den Zugriff auf eine größere und diversifiziertere Crowd - eine gigantische ,global Workforce', die das intellektuelle Kapital verschiedenster Kulturkreise in sich vereinen kann.
Neben den Veränderungen, die auf technischer Ebene geschehen, ist auch auf ökonomischer und gesellschaftlicher Ebene ein entsprechender Wandel zu beobachten. Zum einen befördert dieser Wandel die Online-Auslagerung von Aufgaben und Kreativprozessen, auf der anderen Seite wird er durch Crowdsourcing weiter vorangetrieben. Man kann durchaus sagen, dass sich die Entwicklungen gegenseitig bedingen.
Demokratisierung und De-Industrialisierung
Zum Beispiel erfährt die ehemals zentral gesteuerte Produkthoheit einen Wandel: einst passive Konsumenten werden zu ,Prosumenten' und bringen nun aktiv ihre Bedürfnisse und Wünsche ein.
Ein Phänomen, das bereits 1980 von Futurist Adam Toffler in seinem Buch The Third Wave vorhergesagt wurde. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt: Durch digitale Plattformen müssen Arbeitsabläufe und Aufgaben weniger zentral verwaltet und gesteuert werden. Vielmehr kann sich die Crowd nun zum Teil eigenständig vernetzen und organisieren.
Mehr Transparenz und Wettbewerb
In einer digitalen Lebenswelt ist Transparenz gefragter denn je. Foren und Reviews im Web liefern Informationen zu Unternehmen und Institutionen, zu Produkten und Personen.
Dieser ungehinderte Informationsfluss wird mehr und mehr vorausgesetzt - wer nicht mitmacht, könnte gar etwas zu verbergen haben. Um sich mit dem Rest der Online Gemeinde zu messen, werden Badges, Reviews, Freunde, Likes, Follower, etc. gesammelt.
Mehr Work-Life Integration
Daneben werden Themen wie ,Work Life Integration' immer wichtiger im Kontext des modernen Arbeit-ens. Menschen sind bereit, mehr von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Dieser Trend geht einher mit einer zunehmenden Mobilität der Arbeitsplätze. Laptops und Smartphones sowie verbesserte Datenspeicherung und Vernetzung erlauben es, klassische nine-to-five Job-Strukturen aufzuweichen. Verbesserte Bedienbarkeit und Informationsfilterung gewinnen in diesem mobilen Umfeld massiv an Relevanz.
Zeitgleich steigt die Bereitschaft zur Beteiligung. Nutzer tragen gerne zur Verbesserung einzelner Services bei, wenn sie am Ende selbst von der besseren Benutzerführung profitieren. Diese neue Denkweise ist ein Wegbereiter für jegliche Crowdsourcing Mechanismen.
"Increasingly, work is something people do rather than a place people go." (Gist, CRM Anbieter)
Das neue Hyperexpertentum
Es zeichnet sich zudem ab, dass sich die Profile der Leistungserbringer weiter festigen und vertiefen, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war. Es ist in vielen Fällen wirtschaftlicher, sich eine bestimmte Nische zu suchen und (z.B. über spezielle Crowdsourcing Plattformen) nur noch nach Aufgabenfeldern zu suchen, die zum eigenen Profil passen - bzw. sich idealerweise einfach dort von Auftraggebern finden zu lassen.
,The Age of Hyperspecialization' titelt vor einigen Monaten die Harvard Business Review2 und spricht in einem Zuge von einer ,Division of Labor', also einer Aufspaltung von Aufgabengebieten, die zuvor noch als Ganzes behandelt wurden.
Als Grund wird auch hier die fortschreitende Entwicklung der Kommunikations-Technologie genannt sowie die Tatsache, dass Arbeit zunehmend wissensbasiert vollzogen wird. Diese hochgradig effizienzgetriebene Entwicklung hat laut der Harvard Experten Vorteile im Hinblick auf Kosten, Qualität und Zeit - die Arbeitnehmer profitieren zudem von der Möglichkeit, frei über die Annahme von Aufträgen und entsprechende Zeiteinteilung entscheiden zu können.
Um die Aufgabenteilung zu definieren und die gelieferten Teil-Tasks wieder zu einem Gesamtergebnis zusammenzusetzen, braucht es zusätzlich zu den Hyperexperten verschiedenster Fachrichtungen aber auch eine neue Art von Intermediären mit entsprechenden Fähigkeiten.
Die Crowdsourcing Treiber (Quelle: Eigene Darstellung)
1http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
2http://hbr.org/2011/07/the-big-idea-the-age-of-hyperspecialization/ar/1
2. Crowdsourcing Kategorien und Ausprägungen
Da es sich bei Crowdsourcing um einen Mechanismus handelt, der als Tool in sehr unterschiedlichen Segmenten, Branchen und Geschäftsbereichen einsetzet wird, muss man sich zunächst die entsprechenden Ausprägungen ansehen. Die wohl bekanntesten Segmente sind das Crowdfunding, also die Schwarmfinanzierung von Inhalten und die kollektive Sammlung von Wissen (am prominentesten Vertreten durch die Wikipedia). Crowdsourcing wird darüber hinaus aber auch als Innovations-Tool, in Form von Kreativ-Marktplätzen oder im Microtask Bereich eingesetzt - sprich zur Distribution von winzigsten Teilaufgaben, wie final wieder zu einem Datensatz zusammengesetzt werden. Auch im NonProfit Sektor haben sich bereits verschiedene Dienste angesiedelt. Das folgende Kapitel widmet sich im Einzelnen den genanten Segmenten und gibt eine Auswahl an Fallbeispielen.
2.1 Microworking und -tasks
Crowdsourcing Ausprägungen (Quelle: Eigene Darstellung)
Nach wie vor gibt es Aufgaben, die gar nicht oder nur unzureichend maschinell erledigt werden können. Stattdessen braucht es die Sorgfalt oder das kontex-tuelle Denken eines Menschen erfordern.
Da es sich für Unternehmen - insbesondere bei einmaligen Projekten - nicht lohnt, diese Kapazitäten fest in die eigenen Personalstrukturen zu integrieren, bieten sich flexible und leicht skalierbare Crowdsourcing Lösungen an.
Dawson und Bynghall (2011) sprechen in diesem Zusammenhang von 50 bis 90 Prozent Kostenreduktion für Unternehmen gegenüber in-house Abwicklung oder traditionellem Outsourcing.
Unternehmen können Microtasks dabei in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern einsetzen:
Erstellung von für Suchmaschinen optimierten Texten
Editing und Proofreading
Kategorisierung von Inhalten (z.B. nach Kontext oder Qualität)
Tagging von Bildern, Video- und Audiofiles
Web Recherche und Verifizierung von Daten
Digitalisierung von Texten und Dokumenten (Visitenkarten etc.)
Validierung von Ergebnissen der Optical Character Recognition (Optische Zeichenerkennung)
Transkribierung von Audio- und Video-Inhalten
Die bekanntesten Anbieter von Microworking Diensten sind Amazons Mechanical Turk (auch 'MTurk', benannt nach dem vorgeblichen Schachroboter von 1769) oder die größte deutsche Plattform Click-worker.
Eine Vielzahl von Plattformen, beispielsweise Crowd-flower, fungieren als Layer aufsetzend auf Mechanical Turk und übernehmen dabei die Funktion eines Content- und Qualitätsfilters. Sie bilden gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen Technologie und Endkunden. Ihr Service umfasst neben der Qualitätssicherung auch das Projektmanagement und regelmäßiges Reporting, die Definition der Tasks und die Ansprache übernehmen sogenannte Crowd-worker. Mitunter bauen sich diese Anbieter eigene (qualitätsgeprüfte) Communities innerhalb der Crowd auf. Manche bieten eigene, benutzerfreundliche Oberflächen und Self-Service Tools an - ein bedeutender Mehrwert gegenüber den eher zweckdienlich gestalteten MTurk Interfaces.
Für die praktische Anwendung von Microtasks muss berücksichtigt werden, dass die Aufgaben crowdgerecht zerlegt und aufbereitet werden - das Briefing und die Zielvorgaben müssen klar und unmissverständlich ausformuliert sein. Der Crowd-worker kennt schließlich weder den Hintergrund noch den Gesamtzusammenhang der Aufgaben (und in manchen Fällen ist das von den Auftraggebern auch gar nicht erwünscht). Insbesondere, wenn es sich um sensiblere Daten handelt, sollte die Ebene der Aufbereitung und Verteilung dies berücksichtigen.
Beim Festlegen der Bezahlung je Task sollte, im Hinblick auf eine zufriedenstellende Qualität der Ergebnisse, eher großzügig kalkuliert werden. Insbesondere bei sehr speziellen Tasks von ausreichendem Volumen können Trainings vorangestellt werden, um eine qualitativ hochwertige Workforce zu schaffen. So erhält der Auftraggeber weniger AusschussErgebnisse und kann die eingesparten Ressourcen in Form von höherer Entlohnung an die Crowdworker weitergeben. Letztlich sind faire Bezahlung und Qualität der Ergebnisse unabdingbar miteinander verbunden.
Um die praktische Umsetzung und Qualität der Tasks zu verbessern, empfiehlt es sich, z.B. auch objektive und gut vergleichbare Inhalte zu nutzen, sowie die Tasks möglichst präzise zu benennen. Da die meisten Arbeiten keine spezifische Qualifizierung erfordern, ist die Fehleranfälligkeit der Ergebnisse dennoch höher, als bei anderen Crowdsourcing Aufgaben.
Dieses Problem kann umgangen werden, indem ein und derselbe Task an zwei oder drei Crowdworker vergeben wird, oder indem einige Ergebnisse noch einmal von einer Kontrollgruppe überprüft werden müssen. Häufig wird auch mit einem so genannten 'Gold-Standard' gearbeitet. Bei dieser Methode platzieren die Auftraggeber einen Task innerhalb der Datenmenge, dessen Ergebnis sie sich 100 Prozent sicher sind, um diesen als Qualitäts-Kontrollmecha-nismus zu nutzen.
Arbeit statt Almosen - Microtasks im sozalen Kontext
Eine Brücke zwischen Microworking und sozialem Engagement schlägt die Plattform Samasource. Seit 2008 vermittelt die US-Nonprofitorganisation online Micro-Jobs an Auftragnehmer in wirtschaftlich benachteiligten Regionen. Sama kommt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie 'Gleichheit'. Menschen aus Haiti, Indien oder Afrika erhalten über Plattformen wie Samasource nicht nur ein kleines finanzielles Zubrot, sondern auch eine Aufgabe und erlernen dabei Basis-Computer-Skills.
Darf's noch etwas nebenbei sein? Microtasks und Information-Gathering als wertvolle 'Abfallprodukte'
Ein dem Microworking sehr eng verwandter Begriff ist Human Computation. Dieser Prozess berücksichtigt die Tatsache, dass nicht alle Aufgaben maschinell ausgeführt werden können und lässt einzelne Aufgaben von Menschen ausführen, um sie anschließend von Computern wieder zusammensetzen zu lassen.
Das wohl bekannteste Beispiel für Human Computation sind die reCAPTCHAs. Diese Eingabefelder schützen nicht nur Websites von unerlaubten Zugriffen durch Bots, sie helfen auch Texte zu digitalisieren, bei denen die Optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition (OCR)) versagt hat, wie beispielsweise die alten Archive der New York Times.
Auch Social Search nutzt ,ganz nebenbei' den Output der Masse, z.B. deren Nutzungsgewohnheiten oder persönliche Meinung. Oft gelesene bzw. wiedergegebene sowie gut bewertete Inhalte werden als relevanter bewertet und prominenter platziert. Damit helfen die Nutzer, indem sie sich durchs Web bewegen und ihr Feedback hinterlassen (ob bewusst oder unbewusst), die Qualität des Web zu verbessern.





























