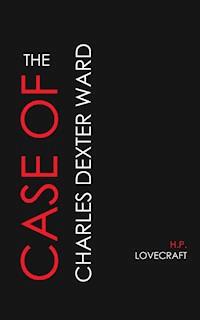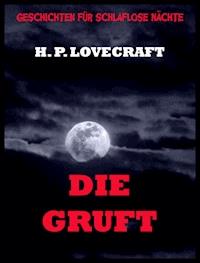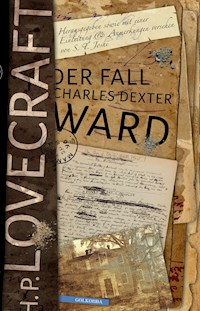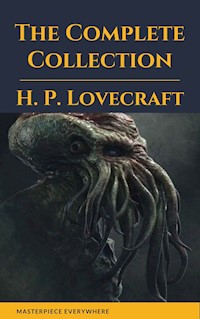14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Horror-Klassiker in einer modernen Ausgabe: die besten Erzählungen des Meisters der unheimlichen Phantastik in der hochgelobten Neuübersetzung H. P. Lovecraft ist neben Edgar Allan Poe der Klassiker der modernen Horrorliteratur. Seine phantastischen Erzählungen erscheinen in hohen Auflagen und finden weltweit allergrößte Leserresonanz. Phantastik-Experte Andreas Fliedner präsentiert in »Cthulhus Ruf – Das Lesebuch« eine Gesamtschau des Lovecraft'schen Werkes in vierzehn ausgewählten Erzählungen, ergänzt um eine allgemeine Einführung zu Autor und Werk sowie Einleitungen zu den jeweiligen Schaffensphasen. »Der bedeutendste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts.« Stephen King Inhalt I. Die Straße nach Arkham: Klassisches und modernes Grauen Das Bild im Haus, Die Musik des Erich Zann, Der Außenseiter, Die Ratten in den Mauern, Das Fest, Kühle Luft II. Schwarze Ozeane der Unendlichkeit: Kosmischer und irdischer Horror Cthulhus Ruf, Die Farbe aus dem All, Der Flüsterer im Dunkeln, Der Schatten über Innsmouth, Der Schrecken der Finsternis III. Das Tor der Träume: Poetische Schrecken und Bekenntnisse Die Katzen von Ulthar, Hypnos, Der silberne Schlüssel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
H. P. Lovecraft
Cthulhus Ruf. Das Lesebuch
Über dieses Buch
Der Horror-Klassiker in einer modernen Ausgabe: die besten Erzählungen des Meisters der unheimlichen Phantastik in der hochgelobten Neuübersetzung
H. P. Lovecraft ist neben Edgar Allan Poe der Klassiker der modernen Horrorliteratur. Seine phantastischen Erzählungen erscheinen in hohen Auflagen und finden weltweit allergrößte Leserresonanz. Phantastik-Experte Andreas Fliedner präsentiert in »Cthulhus Ruf – Das Lesebuch« eine Gesamtschau des Lovecraft‘schen Werkes in vierzehn ausgewählten Erzählungen, ergänzt um eine allgemeine Einführung zu Autor und Werk sowie Einleitungen zu den jeweiligen Schaffensphasen.
»Der bedeutendste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts.« Stephen King
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
H. P. Lovecraft (1890-1937) ist der einflussreichste und beliebteste Horror-Autor des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen erschienen zu seinen Lebzeiten vor allem in Magazinen wie »Weird Tales« und werden heute in Millionenauflagen gedruckt und gelesen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock, SARANYA_V und Stephanie Gauger
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491095-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Ein Träumer aus Providence
I. Die Straße nach Arkham: klassisches und modernes Grauen
Das Bild im Haus
Die Musik des Erich Zann
Der Außenseiter
Die Ratten in den Mauern
Das Fest
Kühle Luft
II. Schwarze Ozeane der Unendlichkeit: kosmischer und irdischer Horror
Cthulhus Ruf
I. Das tönerne Grauen
II. Der Bericht von Inspektor Legrasse
III. Der Wahnsinn aus dem Meer
Die Farbe aus dem All
Der Flüsterer im Dunkeln
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Der Schatten über Innsmouth
I.
II.
III.
IV.
V.
Der Schrecken der Finsternis
III. Das Tor der Träume: poetische Schrecken und Bekenntnisse
Die Katzen von Ulthar
Hypnos
Der silberne Schlüssel
Quellenangaben und Übersetzungen
Ein Träumer aus Providence
Anmerkungen zu H.P. Lovecrafts Leben und Werk
»Zu keiner Zeit in seinem Leben empfand Howard Angst vor dem Unbekannten«, erzählte Frank Belknap Long über seinen engen Freund H.P. Lovecraft. »Er glaubte nicht daran, dass es etwas gab, das diese Angst rechtfertigen würde, da in seinen Augen der Tod doch nur ein langes Vergessen war und deshalb willkommen geheißen werden sollte.« Lovecraft änderte diese stoische Einstellung nicht, als er die unerträglichen Schmerzen eines Krebsleidens erduldete, an dem er am 15. März 1937 im Alter von sechsundvierzig Jahren starb. In den letzten Wochen seines Lebens notierte er akribisch die Krankheitssymptome, doch wich er bis zuletzt nicht von seiner Überzeugung ab, dass auf der anderen Seite kein Gott, keine spirituelle Erlösung wartete.
Dieser kompromisslose Materialismus wurzelte in einer gründlichen Beschäftigung mit den naturwissenschaftlichen Entdeckungen seiner Zeit und dem darwinistischen Weltbild, das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts das Selbstverständnis des Menschen als Krone der Schöpfung immer weiter aus den Angeln gehoben hatte. Der überschaubare Zeitraum von wenigen Jahrtausenden, den die biblische Überlieferung der Menschheitsgeschichte zumaß, wich einem Abgrund aus Zeit, einem endlosen Zyklus des Werdens und Vergehens, dem Lebensformen ebenso unterworfen waren wie Zivilisationen, Spezies ebenso wie Planeten und Sterne. Aus diesen erschreckenden neuen Gewissheiten schöpfte Lovecraft das schleichende Unbehagen, das viele seiner Erzählungen prägte. Das übernatürliche Grauen, das er in seiner Literatur heraufbeschwor, basierte weniger auf der Angst vor dem Unbekannten als auf der Angst vor der Wahrheit; einer Wahrheit, die zu groß und entsetzlich ist für den fragilen Verstand eines Sterblichen.
Wahnsinn war gewissermaßen ein fester Bestandteil von Lovecrafts wechselvoller Familiengeschichte. Sein Vater, Winfield Scott Lovecraft, war Handlungsreisender für eine Silberschmiede. Während einer Geschäftsreise erlitt er einen schweren psychischen Zusammenbruch und wurde ins Butler Hospital für Geisteskranke in seiner Heimatstadt Providence eingewiesen, wo er bis zu seinem Tod fünf Jahre später interniert blieb. Ursache war vermutlich eine damals nicht diagnostizierte Syphilis im Endstadium. Welche seelischen Spuren diese unbegreifliche Katastrophe bei Frau und Kind hinterließ, kann man sich nur schwer vorstellen; dass sie den weiteren Lebensweg des Sohnes beeinflusste, steht außer Frage.
Howard Phillips Lovecraft wurde am 20. August 1890 in Providence, Rhode Island, geboren und war erst sieben Jahre alt, als sein Vater starb. Die Beziehung zu seiner Mutter, Sarah Susan Phillips, die einer altehrwürdigen neuenglischen Familie entstammte, dürfte nach diesem Verlust enger, aber auch schwieriger geworden sein. Sein Großvater, Whipple Van Buren Phillips, ein umtriebiger und gebildeter Geschäftsmann, der über eine umfangreiche Bibliothek verfügte, sorgte jedoch nicht nur für ein sicheres Zuhause, sondern weckte früh seine Liebe für das Gespenstische und Wunderbare. Er erzählte seinem gebannt lauschenden Enkel »improvisierte Geschichten über dunkle Wälder, unergründliche Höhlen, geflügelte Monstren«. Auch die Bücherschätze des Großvaters mögen dem jungen Lovecraft einen gewissen Trost geboten haben. Als Kind liebte er die Märchen aus tausendundeiner Nacht sowie Samuel Coleridges düstere Ballade vom »alten Seemann«. Er entdeckte die griechischen Heldenepen, die unheimlichen Geschichten Edgar Allan Poes, aber auch die schlicht gestrickten Abenteuer der Pulp-Magazine, und begann selbst frühreife Imitationen der Texte zu schreiben, die er mit Begeisterung las.
Die Naturwissenschaften, vor allem Chemie und Astronomie, begannen sein jugendliches Interesse zu wecken. Statt literarischen Vorbildern nachzueifern, verfasste der Zwölfjährige nun wissenschaftliche Abhandlungen. Diese Obsession führte schließlich sogar zur Herausgabe einer kleinen Zeitschrift, des Rhode Island Journal of Astronomy. Lovecraft schrieb alle Beiträge und druckte das Blatt selbst, und dies über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Seine weitreichende Bildung erwarb er überwiegend durch selbständige Lektüre, während er den Schulbesuch immer wieder aus gesundheitlichen Gründen aussetzen musste und letztlich ohne regulären Abschluss blieb. Sein ungeheures Wissen in Sachen Astronomie lässt sich an kleinen Details in seinen Erzählungen ermessen: Wann immer er eine Mondphase oder Sternenkonstellation mit einem bestimmten Datum in Verbindung bringt, kann man davon ausgehen, dass die Angabe auf sorgfältigen Recherchen beruht.
Angesichts der wechselhaften Bedingungen, unter denen Lovecraft aufwuchs, seines sensiblen Temperaments, des Einflusses seiner psychisch labilen Mutter und der finanziellen Schwierigkeiten, die nach dem Tod des Großvaters bedrohliche Ausmaße annahmen, erscheint es wenig verwunderlich, dass der junge Mann im Alter von achtzehn Jahren einen Nervenzusammenbruch erlitt. Unfähig, einen Einstieg in ein gewöhnliches Berufsleben zu finden, lebte er zurückgezogen wie ein Einsiedler und vergrub sich in seine Bücher. Ihn mit dem grauenvollen »Außenseiter« und Gruftbewohner aus seiner gleichnamigen Erzählung zu identifizieren erscheint dennoch übertrieben. Er war durchaus fähig und willens, seine Isolation zu durchbrechen. Vor allem durch intensiv gepflegte Briefwechsel mit einer ganzen Reihe von Seelenverwandten, die seine Leidenschaft für Literatur, Amateurjournalismus und Wissenschaft teilten und später zu echten Freunden wurden. Gelegentlich half er seinen Brieffreunden als Ghostwriter oder Lektor und veröffentlichte kleine Artikel in den Providence Evening News. Lovecraft hatte bereits mit fünfzehn eine erste phantastische Geschichte geschrieben, »The Beast in the Cave«. Rund zwölf Jahre später bestärkte ihn einer seiner Bekannten darin, zu der alten Vorliebe für unheimliche Phantastik und Schauerliteratur zurückzukehren. »Dagon« war eine der Kurzgeschichten, die aus dieser Anregung entstanden. Obwohl der Stil überdeutlich an Edgar Allan Poe erinnert, enthält der Text bereits viel von dem, was Lovecraft als Autor unverwechselbar macht: eine albtraumhafte Landschaft, Spuren einer vorzeitlichen Zivilisation, eine unerträgliche Erkenntnis, die zu Wahnsinn und Selbstmord führt. Nebenbei ist diese Geschichte ein lebhaftes Zeugnis für Lovcrafts neurotische Abneigung gegen Fisch, die in der späteren Novelle »Shadow over Innsmouth« (»Schatten über Innsmouth«) noch einmal äußerst wirkungsvoll zum Vorschein kommt, und die Gestalt des Meeresgottes Dagon sollte im furchterregenden Pantheon einer erfundenen Mythologie ihren würdigen Platz finden.
Von dieser Mythologie, seiner vielleicht größten Schöpfung, war Lovecraft zu Beginn der 1920er Jahre noch weit entfernt. Ein Nervenzusammenbruch der Mutter, die schließlich wie ihr Mann geistig umnachtet im Butler Hospital in Providence starb, führte zu einer neuen Lebenskrise und sogar zu Selbstmordgedanken. »Meine Mutter war aller Wahrscheinlichkeit nach der einzige Mensch, der mich ganz und gar verstanden hat«, schrieb er am 1. Juni 1921 an eine Bekannte. Lange Zeit konnte er weder schlafen noch arbeiten, doch die Krise mündete in einer überraschenden Wendung: Lovecraft, der amouröse Verwicklungen bislang erfolgreich gemieden hatte, begegnete der verwitweten Sonia Greene, einer energischen Hutmacherin, die in denselben Kreisen aus Amateurjournalisten und Hobbyautoren verkehrte wie er. Er hielt sich für zu hässlich, um je von einer Frau geliebt zu werden. Um so hilfloser reagierte er auf das eindeutige Interesse der russischstämmigen Jüdin, die etwas älter war, eine besondere Vorliebe für asketische und schüchterne Männer hegte und in Lovecraft das Genie erkannte, das ihm selbst verborgen blieb.
Sonia Greene lockte den eingefleischten Junggesellen, der mit seiner Tante Annie E. Gamwell zusammenlebte, aus seiner geliebten Heimatstadt Providence nach New York. Der Versuch, in der Metropole Fuß zu fassen, Arbeit zu finden, ein normales Leben an der Seite einer liebenden Frau zu führen, war jedoch fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Obwohl er anlässlich der Hochzeit einen gewissen Stolz erkennen ließ, brachte Lovecraft nie ein schlichtes »Ich liebe dich« über die Lippen. »Du weißt nicht, wie sehr ich dich schätze«, war für ihn der stärkste Ausdruck von Zuneigung. Trotz der absehbaren Konflikte, die sich aus dem Zusammenleben zweier gegensätzlichen Temperamente ergaben, kann man Lovecrafts Jahre in New York nicht als hoffnungslose Zeitverschwendung betrachten. Im Gegenteil: Die zahlreichen guten wie schlechten Erfahrungen, die ihm die neue Beziehung und Umgebung boten, dürften einen belebenden Einfluss auf seine literarische Arbeit gehabt haben. In New York bekam er außerdem viel öfter die Gelegenheit, Gleichgesinnte persönlich zu treffen, mit denen er bislang meist nur schriftlich verkehrt hatte; Amateurschriftsteller, die wie er die eine oder andere Kurzgeschichte veröffentlicht hatten und darauf brannten, über ihre Ideen, Pläne und Träume zu sprechen; Randfiguren des Literaturbetriebs wie Samuel Loveman, Paul Cook und Frank Belknap Long, die Lovecraft anspornten, weiterzuschreiben. Geschichten wie »Cool Air« (»Kühle Luft«) und »The Horror at Red Hook« (»Das Grauen von Red Hook«), die er in dieser Lebensphase schrieb, zeugen allerdings von einem tiefempfundenen Grauen vor den urbanen Milieus mit ihren trostlosen Mietwohnungen und einem verrohten Proletariat, von dem er sich durch konservative Kleidung und ausgesuchte Höflichkeit, aber auch durch die Übernahme der kruden Rassentheorien seiner Zeit und eine antidemokratische Haltung selbstbewusst distanzierte.
Eine Oase inmitten des Lärms und der Hektik New Yorks boten Museen und Bibliotheken. Auf Paul Cooks Anregung begann er in der Public Library Material zu sammeln für einen Essay über die Geschichte der unheimlichen Phantastik, der schließlich unter dem Titel The Supernatural Horror in Literature(Das übernatürliche Grauen in der Literatur) veröffentlicht wurde.
Lovecraft hatte sich sein Leben lang mit verstaubten Relikten der Kolonial- und Familiengeschichte beschäftigt, und seine literaturhistorische Arbeit bedeutete für ihn wohl auch eine besondere Art Ahnenforschung; es lag ihm viel daran, die Themen und Stilmittel, die ihm persönlich wichtig waren, zu definieren und in den Werken anderer Autoren aufzuspüren. Aus der intensiven Auseinandersetzung mit den Klassikern und modernen Größen des Genres gewann Lovecraft ein gestärktes Bewusstsein dafür, was er von seiner eigenen Literatur erwartete: Atmosphäre, eindrückliche Bilder und eine »kosmische« Perspektive waren ihm wichtiger als ein ausgefeilter Plot. Was mit kosmischer Perspektive gemeint ist, wird in seinem Konzept der Ästhetik unheimlicher Phantastik deutlich: »Alle meine Erzählungen basieren im Wesentlichen auf dem Grundsatz, dass gewöhnliche menschliche Gesetze & Interessen im ungeheuren Gesamtkosmos weder Gültigkeit noch Bedeutung haben … Um zum Wesen des wahrhaftigen Kosmos vorzudringen, ob zeitlich, räumlich oder dimensional, muss man vergessen, dass solche Dinge wie organisches Leben, Gut & Böse, Liebe & Hass & alle hiesigen Eigenschaften einer unbedeutenden & vergänglichen Rasse namens Menschheit überhaupt existieren.«
Auf den ersten Blick wirkt Lovecrafts Konzept wie eine entschlossene Abkehr von der klassischen Phantastik und deren Wurzeln in Aberglaube und Folklore. An die Stelle der allegorischen Bedrohung des Lebens durch den Tod, der Liebe durch den Hass – verkörpert durch klar definierte Spukgestalten wie Vampir und Werwolf, die durch einfache Mittel wie Kreuz und Silberkugel überwunden werden – tritt die Bedrohung des Verstandes durch die Erkenntnis um die Machtlosigkeit des Menschen und die Bedeutungslosigkeit der menschlichen Spezies. Lovecrafts Kreaturen sind nicht im herkömmlichen Sinne böse und können nicht mit den klassischen Mitteln des Guten – Tapferkeit, Selbstaufopferung, religiöse Symbole – besiegt werden, auch wenn sich einige als verletzbar oder lichtscheu erweisen. Die bloßen Spuren ihrer Existenz, rätselhafte Ruinen, vermoderte Manuskripte, fremdartige Fossilien, genügen, um traditionelle Weltbilder ins Wanken zu bringen. Das ist es, was Lovecraft unter »kosmisches Grauen« versteht und was den besonderen Reiz vieler seiner Geschichten ausmacht: die Ahnung, dass wir nur einen winzigen Ausschnitt des Kosmos erfassen können und dass ein verbotener Blick auf das große Ganze absolut unerträglich wäre.
So originell Lovecrafts Konzept anmutet, greift es doch auf ältere Ideen zurück, die nicht nur innerhalb des phantastischen Genres bedeutsam waren. Der klassische Schauerroman, von Ann Radcliffes Udolpho bis Mary Shelleys Frankenstein, nutzte das für die romantische Dichtung so wichtige Bild des Erhabenen, verdeutlicht durch die Konfrontation des Menschen mit einer unermesslichen, menschenfeindlichen Natur. Von der Ehrfurcht vor den Wundern der Schöpfung bis zum Grauen vor einem unendlichen, gleichgültigen Kosmos ist es nur ein kleiner Schritt, und das Bild von Naturgewalten, die jedes menschliche Streben vergeblich erscheinen lassen, findet sich häufig in der Literatur des 19. Jahrhunderts, zumal in dem wohl einflussreichsten amerikanischen Roman, Melvilles Moby-Dick, aber auch in weniger bekannten Werken wie Lafcadio Hearns kreolischer Novelle Chita und Henry David Thoreaus Reisebericht Ktaadn, auf den Lovecraft in einer seiner Erzählungen anspielt.
In Lovecrafts literarischer Ahnengalerie stehen freilich jene Autoren im Vordergrund, die sich bevorzugt dem »übernatürlichen Grauen« widmeten – auch wenn die Grenzen zwischen natürlich und übernatürlich stets fließend sind und eigentlich nur vom Leser individuell definiert werden können. Der bedeutendste unter diesen Phantasten war zweifellos Edgar Allan Poe, dessen Werk Lovecraft nahezu manisch bewunderte: »In Poes Prosa öffnet sich vor uns der wahrhaftige Schlund der Grube – unvorstellbare Abnormitäten, die uns listig eingeflüstert werden, bis sie in unserem Geist den Charakter eines grässlichen Halbwissens annehmen, mit Worten, die uns zunächst unschuldig erscheinen, bis die irre Anspannung in der dumpfen Stimme des Erzählers uns ihre versteckte Bedeutung fürchten lässt. Dämonische Muster und Wesen schlummern giftig, bis sie einen angstvollen Augenblick lang zu einer kreischenden Offenbarung erwachen, die sich zu kicherndem Wahnsinn steigert oder in denkwürdigen und kataklysmischen Echos explodiert. Ein Hexensabbat des Grauens, der seine prächtigen Gewänder abwirft und blitzartig vor uns auftaucht – ein Anblick, der noch ungeheuerlicher wirkt, weil er jede Einzelheit mit wissenschaftlicher Präzision arrangiert und in eine augenscheinliche Beziehung zur geläufigen Grausamkeit des materiellen Lebens gebracht wird.«
Die »kreischende Offenbarung« finden wir in vielen frühen Kurzgeschichten Lovecrafts wieder, gelegentlich sogar als Todesschrei wie in »The Statement of Randolph Carter« (»Randolph Carters Aussage«). In dieser Geschichte schimmert jedoch bereits ein zweiter wichtiger Einfluss durch – der sarkastische Humor von Ambrose Bierce. Weitere Autoren, die Lovecraft besonders schätzte, waren Samuel Johnson, einer der großen englischen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, Nathaniel Hawthorne, der in seinen abgründigen, teils phantastischen Erzählungen die heuchlerische Moral der Puritaner bloßstellte, Algernon Blackwood, Arthur Machen und M.R. James, deren Gespenstergeschichten vom unheimlichen Fortleben urzeitlicher Mächte künden. Besonders wichtig war ihm allerdings der irische Erzähler Lord Dunsany. Dessen visionäre Fantasygeschichten inspirierten etliche Geschichten Lovecrafts, in denen der Protagonist – oft unter Einfluss von Drogen – im Traum zu fremden, märchenhaften Ländern reist. Die immer wiederkehrenden Namen der Traumländer und Traumstädte wie Sarnath, Ulthar und Kadath verbinden die düsteren, exotisch schillernden Erzählungen zu einem bemerkenswerten Zyklus. Lovecraft beschrieb Dunsanys Texte als Mischung aus orientalischer Farbenpracht, hellenischer Form, teutonischer Melancholie und keltischer Wehmut, und diese Merkmale charakterisieren auch seine eigenen Traumgeschichten, unter denen The Dream-Quest to Unknown Kadath (dt. Die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath) die umfangreichste ist.
Dream-Quest zählte zu den ersten literarischen Projekten, mit denen Lovecraft sich nach seiner Trennung von Sonia und der Rückkehr ins heimatliche Providence im Jahr 1926 beschäftigte. Die Flucht aus New York, wo er zuletzt unter kümmerlichen Bedingungen gehaust hatte, schien seine schriftstellerischen Ambitionen neu zu beflügeln, und er schrieb in rascher Folge einige seiner besten Werke, darunter seinen umfangreichsten Roman The Case of Charles Dexter Ward(Der Fall Charles Dexter Ward) sowie die Meistererzählungen »The Call of Cthulhu« (»Cthulhus Ruf«) und »The Colour Out of Space« (»Die Farbe aus dem All«).
Seine Arbeiten erschienen nun regelmäßig in dem Pulp-Magazin Weird Tales, wo sie die Aufmerksamkeit anderer Meister des Phantastischen wie Clark Ashton Smith und Robert E. Howard weckten, die bald einen lebhaften Briefwechsel mit Lovecraft führten. Weird Tales war die wohl berühmteste Zeitschrift für phantastische Literatur und erschien in den USA von März 1923 bis September 1954. Auf billigem Papier (»pulp«) gedruckt, mit zahlreichen Schwarzweißillustrationen und einem grellbunten Cover, bot sie vielen Autoren eine Bühne, die man heute zu den Klassikern des Genres zählt: Neben C.A. Smith und Howard, dem Conan der Barbar zu Weltruhm verhalf, waren dies Edmund Hamilton, August Derleth, Seabury Quinn und Robert Bloch, der später mit Psycho einen der bekanntesten Thriller verfasste. Viele dieser Autoren ließen sich ihrerseits von Lovecraft inspirieren, übernahmen aus seinen Geschichten Orte wie Arkham und Innsmouth, Kreaturen wie die furchterregenden Shoggothen und den blinden Gott Azathoth, erfundene Bücher wie die Pnakotischen Manuskripte und das legendäre Necronomicon, und arbeiteten mit ihm gemeinsam am sogenannten Cthulhu-Mythos, den John Belknap Long vielleicht treffender als die große Weird Tales-Saga bezeichnete.
Der Mythos nahm mit der Erzählung »The Call of Cthulhu« (1928) zum ersten Mal Gestalt an, obwohl weniger ausgereifte Vorläufer bereits in älteren Kurzgeschichten wie »Dagon« und »Nyarlathotep« auszumachen sind. In den neuen Texten begann Lovecraft, inspiriert durch Bram Stokers Dracula, allerlei Zeitungsausschnitte, Tagebucheinträge, Briefe und sogar Phonographaufnahmen einzuflechten, und erzeugte so einen pseudodokumentarischen Hintergrund, der seinem Konzept des »kosmischen Grauens« einen zusätzlichen Reiz und eine gewisse Glaubwürdigkeit verlieh. Die Grundidee des Mythos ist, dass in vorgeschichtlichen Zeiten fremdartige Wesen über die Erde herrschten, gewaltige Städte errichteten und Kriege gegen außerirdische Invasoren ausfochten. Spuren dieser vormenschlichen Zivilisationen, deren Erben und Bezwinger insgeheim immer noch aktiv sind, finden sich in uralten Chroniken und Manuskripten oder in den Ruinen, die an unzugänglichen Orten auf ihre Entdeckung warten.
In seinem Essay über die Geschichte der unheimlichen Phantastik hatte Lovecraft es stets als Mangel betrachtet, wenn ein Spuk oder ein anderes unerklärliches Ereignis durch eine rationale Erklärung aufgelöst wird, so wie es die meisten Autoren der klassischen Schauerliteratur wie Charles Brockden Brown und Ann Radcliffe handhabten. Seine eigene Methode, die er in den Cthulhu-Erzählungen besonders wirkungsvoll einsetzte, bestand darin, Erklärungen zu präsentieren, die allein deshalb rational erscheinen, weil die Protagonisten dieser Geschichten überwiegend vernünftig argumentierende Wissenschaftler oder Studenten sind und über einen akademischen Wortschatz verfügen. Eigentlich wirken die Erklärungen aber noch viel phantastischer als die unheimlichen Ereignisse und Phänomene, um die sich die Handlung dreht: Dämonen erweisen sich nicht als Hirngespinste, sondern als Besucher aus anderen Zeiten oder von anderen Planeten, Hexen entpuppen sich als Reisende zwischen mathematisch definierbaren Dimensionen, von Geheimkulten verehrte Götter sind nichts anderes als Angehörige mächtiger außerirdischer Spezies. Lovecraft arbeitete wie ein Science-Fiction-Autor mit wissenschaftlichen Spekulationen und schuf innerhalb der phantastischen Literatur etwas völlig Neues, eine Parallelwelt, in der Wissenschaft und Aufklärung die Trugbilder des Aberglaubens nicht lediglich als falsch entlarven, sondern ihre Echtheit bestätigen, indem sie moderne, schockierende Erklärungen für sie liefern. Lovecraft erfand also eine ganz neue Spielart der Schauerliteratur, deren Schrecken selbst für jene wirksam bleiben, die den kindlichen Glauben an traditionelle, folkloristische und religiöse Überlieferungen, an das Übernatürliche allgemein, längst verloren haben.
Eine weitere Besonderheit dieser literarischen Schöpfung ist, dass sie von ihrem Autor nicht eifersüchtig als Privatbesitz beansprucht wurde. Lovecraft lud andere Pulp-Autoren ein, an der Ausarbeitung und Weiterführung seines Mythos mitzuwirken, und bediente sich gleichzeitig selbst beim kunterbunten Inventar seiner Kollegen, so dass es mitunter schwierig ist, einen bestimmten Begriff, einen Ort oder eine Figur der Weird Tales-Saga auf ihren Erfinder zurückzuführen. Manch ein originell wirkender Name lässt sich sogar bereits in den klassischen Texten von Poe und Bierce entdecken. Man könnte den Cthulhu-Mythos also durchaus als erstes interaktives Werk der Weltliteratur bezeichnen.
Da Lovecraft nicht nur zu den stilistisch besten und eigenwilligsten Autoren von Weird Tales zählte, sondern auch als Lektor weniger begabten Schreiberlingen zu Achtungserfolgen verhalf, wurde ihm bereits 1924 angeboten, die Herausgabe des populären Magazins zu übernehmen. Unter all den in Frage kommenden Kandidaten wäre er zweifellos der geeignetste für diesen Posten gewesen. Doch da dies eine Rückkehr in sein geliebtes Providence verhindert hätte und er nach Chicago hätte umziehen müssen, sagte er höflich, aber entschlossen ab. Bis zu seinem Tod blieb er ein Autor, der nur von einem kleinen Kreis treuer Leser bewundert wurde, der fast ausschließlich in Pulp-Magazinen veröffentlichte und keines seiner großen Werke in Buchform gedruckt sehen durfte. Neben den angesehenen und erfolgreichen amerikanischen Schriftstellern seiner Zeit – Theodore Dreiser, Upton Sinclair, Sinclair Lewis, F. Scott Fitzgerald – wirkt er wie ein exzentrischer Sonderling, aber war er wirklich der krasse Außenseiter im Literaturbetrieb, als der er rückblickend erscheinen mag?
Eigentlich sind Themen, Motive und Visionen der Schauerliteratur seit jeher ein bedeutender, prägender Bestandteil in der Geschichte der amerikanischen Literatur gewesen. Deren wichtigste Vertreter im 19. Jahrhundert – darunter Charles Brockden Brown, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry James – schrieben herausragende Werke der unheimlichen Phantastik und inspirierten nicht nur Lovecraft, sondern auch die obengenannten Autoren des frühen 20. Jahrhunderts. F. Scott Fitzgerald war ebenso wie Lovecraft von Poe fasziniert, ließ sich in seinen frühen Kurzgeschichten wie »The Mystery of the Raymond Mortgage« und »The Ice Palace« von ihm inspirieren und fügte in seine Romane wie This Side of Paradise zahlreiche Anspielungen auf Leben und Werk des Klassikers ein. Auch der schönste Roman des Jazz-Zeitalters The Great Gatsby enthält Motive, die an die Schauerliteratur erinnern, wie die albtraumhafte Beschreibung der »Aschenlande«. Upton Sinclair, der mit sozialkritischen Werken wie The Jungle berühmt wurde, ist nicht so weit entfernt von Lovecraft, wenn man bedenkt, dass er seine Karriere als Autor von Dutzenden Abenteuergeschichten begann, die als »Dime-Novels« oder in Pulp-Magazinen erschienen. Dies gilt auch für andere berühmte Literaten: So war der erste Roman des späteren Nobelpreisträgers Sinclair Lewis eine Science-Fiction-Geschichte für Jugendliche, und er verdiente sein erstes Geld damit, reißerische Plots an Jack London zu verkaufen, der seinerseits etliche phantastische Erzählungen schrieb. Sogar Theodore Dreiser, einer der bedeutenden Naturalisten, schrieb mit »McEwen of the Shining Slave Makers« eine bizarre Novelle, die bei Weird Tales gut aufgehoben gewesen wäre; sie handelt von einem Mann, der sich im Traum in eine schwarze Ameise verwandelt und gegen die roten Ameisen in den Krieg zieht. In der Anthologie Creeps by Night von 1931 erschien eine Erzählung von William Faulkner, der oft als moderner Edgar Allan Poe bezeichnet wurde, neben Lovecrafts »The Music of Erich Zann« (»Die Musik des Erich Zann«). Diese Beispiele zeigen, wie durchlässig die Grenzen zwischen Realismus und Phantastik, engagierter Avantgarde und Pulp-Fiction im Grunde waren und sind, auch wenn Phantastik und Pulp-Fiction von Literaturwissenschaftlern und -kritikern mitunter allzu stiefmütterlich behandelt werden.
Obwohl Lovecraft die avantgardistische Literatur seiner Epoche ablehnte, kam sie seinen Ideen und Vorlieben gelegentlich verblüffend nahe, und einige seiner besten Arbeiten stehen dem Surrealismus merklich näher als der kommerziellen Phantastik der Pulp-Ära. Anders als Sinclair, Fitzgerald und Faulkner blieb ihm freilich eine breite öffentliche Anerkennung zu Lebzeiten verwehrt, und es ist wohl nur dem Engagement seiner Freunde August Derleth und Donald Wandrei zu verdanken, dass er heute nicht nur als würdiger Erbe Poes gilt, sondern als Klassiker der amerikanischen Literatur, dessen beängstigende Vorstellungswelt bis heute lebendig geblieben ist und von modernen Literaten wie Joyce Carol Oates, Matt Ruff und Michel Houellebecq gewürdigt wird.
Derleth und Wandrei gründeten den Verlag Arkham House eigens, um Lovecrafts Erzählungen in Buchform zugänglich zu machen. Vom ersten Band The Outsider and Others wurden 1939 lediglich 1268 Exemplare gedruckt, die sich anfangs nur schlecht verkauften. Der zweite Band, Beyond the Wall of Sleep, erschien erst 1943 und enthielt auch einige Gedichte und Kollaborationen mit anderen Autoren, während Something About Cats von 1949 auch einige Essays vorstellte. Diese Bücher kursierten zunächst nur unter Sammlern und Liebhabern, sie bildeten jedoch die unverzichtbare Grundlage für Lovecrafts heutigen, nahezu legendären Ruf. Seine frühen Horrorgeschichten, sein visionärer Traumzyklus und die furchterregenden Abgründe, die in den Cthulhu-Erzählungen aufklaffen, belegen bei jeder Lektüre aufs Neue, dass dieser Ruf gerechtfertigt ist.
Alexander Pechmann
I.Die Straße nach Arkham: klassisches und modernes Grauen
Lovecrafts Frühwerk reicht von seinen ersten Gehversuchen als unheimlicher Erzähler bis zum Ende seiner New Yorker Zeit Anfang 1926. In Auseinandersetzung mit der klassischen Phantastik des 19. Jahrhunderts, aber auch mit so unterschiedlichen Einflüssen wie den Science-Fiction- und Fantasygeschichten der frühen Pulp-Magazine, der französischen Dekadenzliteratur oder der poetischen Fantasy Lord Dunsanys entwickelt Lovecraft die Themen und Motive, die er in seinen späteren großen Erzählungen ausarbeiten und variieren wird. Über allem schwebt jedoch der Einfluss Edgar Allan Poes, und Texte wie »Das Bild im Haus«, »Der Außenseiter« und »Kühle Luft« zeigen, wie Lovecraft Poes Auffassung der Kurzgeschichte, aber auch sein musikalisch-rhythmisches Sprachverständnis aufnimmt und fortschreibt.
Der Begriff »Frühwerk« sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich unter den Texten dieser Zeit bereits Meistererzählungen von höchster Geschlossenheit und atmosphärischer Dichte finden wie »Die Musik des Erich Zann«. Das Gespenstische, so der englische Kulturwissenschaftler Mark Fisher, entsteht, wenn da nichts ist, wo etwas sein sollte – was sich in dieser kurzen Geschichte bestätigt, die Lovecraft selbst für eine seiner vollendetsten hielt.
»Der Außenseiter« gilt als die Erzählung, die den Grundstein zum biographischen »Lovecraft-Mythos«, dem Verschwimmen der Grenze zwischen dem Werk und seinem Schöpfer, gelegt hat. Jenseits dessen bleibt »Der Außenseiter« ein Sprachkunstwerk von hysterischer, sich überschlagender Wucht, ein aufs höchste verdichtetes Beispiel jener »orchestrierten Prosa«, die Fritz Leiber, einer der ersten und scharfsinnigsten Kommentatoren von Lovecrafts Werk, als kennzeichnend für dessen Schreiben ausgemacht hat.
In »Die Ratten in den Mauern« gewinnt das Grauen, das sich unter den Gemäuern eines englischen Schlosses verbirgt, bereits jene universale, allumfassende Qualität, die für Lovecrafts spätere kosmische Erzählungen charakteristisch ist. Und muss man nicht angesichts der Unterwelt, die sich dort auftut, an die kommenden Schrecken des 20. Jahrhunderts denken, die Lovecraft in einer blitzhaften Vision vorausgeahnt und in die Vergangenheit projiziert zu haben scheint?
Im Dezember 1922 erkundete Lovecraft zum ersten Mal die alten neuenglischen Städte Salem und Marblehead, und rückblickend bezeichnete er den ersten Anblick Marbleheads im Sonnenuntergang als »den machtvollsten gefühlsmäßigen Höhepunkt« seines Lebens. Kingsport, der Schauplatz der etwa ein Jahr später entstandenen Erzählung »Das Fest«, ist ein bis in die topographischen Einzelheiten genaues Porträt der alten Küstenstadt. Das Einswerden mit der Vergangenheit, von Lovecraft bei seinem Besuch im realen Marblehead als mystisch-ekstatisches Erlebnis empfunden, offenbart in »Das Fest« jedoch einen im buchstäblichen Sinne doppelten Boden.
Als Lovecraft im Frühjahr 1924 Sonia Greene heiratete und zu ihr nach New York zog, machte er sich durchaus Hoffnungen, einen Platz im literarischen Betrieb der Metropole zu finden. Anders als der Protagonist von »Kühle Luft« fand er jedoch nicht einmal »irgendeine triste und schlechtbezahlte Arbeit bei einer Zeitschrift« und blieb in der Stadt »ein unassimilierter Fremder«, wie er es selbst formulierte. In der noch in New York niedergeschriebenen Erzählung vermag Lovecraft jedoch aus der Reflexion seiner Situation im Spiegel einer großstädtischen Horrorgeschichte – die sich durchaus als eine auf den neuesten Stand der Technik gebrachte Variation von Poes »The Facts in the Case of M. Valdemar« lesen lässt – noch Funken schwarzen Humors zu schlagen. Von der Zeitschrift Weird Tales, zu deren Stammautor Lovecraft mittlerweile avanciert war, wurde die Erzählung mit der Begründung abgelehnt, dass sie zu drastisch sei – was umso bemerkenswerter ist, als sich die Schilderung des eigentlichen Grauens im Grunde auf einige wenige Andeutungen und sprechende Details beschränkt.
Das Bild im Haus
Jene, die dem Grauen nachjagen, besuchen oft seltsame, entlegene Orte. Die Katakomben des Ptolemäus und die gemeißelten Mausoleen der Albtraumländer sind nach ihrem Geschmack. Sie klettern hinauf zu den vom Mond beschienenen Türmen von Burgruinen am Rhein und taumeln in Asien unter den verstreuten Steinen vergessener Städte schwarze Treppen voller Spinnweben hinab. Der Geisterwald und der unwirtliche Berg sind ihre Schreine, und sie verweilen bei unheimlichen Monolithen auf unbewohnten Inseln. Doch der echte Gourmet des Grauens, für den ein neuer Schauder unaussprechlichen Entsetzens das höchste Ziel und die Rechtfertigung seines Daseins darstellt, schätzt die uralten, einsamen Bauernhäuser der abgelegenen Wälder Neuenglands am allermeisten; den hier vereinen sich die dunklen Elemente der Willenskraft, Verlassenheit, Abartigkeit und des Unwissens zur Vollkommenheit des Abscheulichen.
Am allergrausigsten sind die kleinen ungestrichenen Holzhäuser, die fernab von benutzten Wegen für gewöhnlich auf einem feuchten, grasbewachsenen Hang kauern oder gegen einen riesigen, aus der Erde ragenden Felsen lehnen. Seit zweihundert Jahren oder mehr lehnen oder kauern sie dort, während die Kletterpflanzen wucherten und die Bäume wuchsen und ihre Wipfel ausbreiteten. Heute sind sie fast gänzlich im ungehörig üppigen Grün verborgen und in wachthaltende Schatten gehüllt; doch die schmalen Fenster starren immer noch furchtbar, als blinzelten sie durch eine tödliche Betäubung, die den Wahnsinn abwehrt, indem sie die Erinnerung an Unsagbares dämpft.
In solchen Häusern haben Generationen merkwürdiger Leute gewohnt, deresgleichen die Welt noch nicht gesehen hat. Im Banne eines düsteren und fanatischen Glaubens, der sie ihrem Volk entfremdete, suchten ihre Ahnen die Wildnis, um frei zu sein. Dort gediehen die Nachfahren einer Rasse von Eroberern frei von den Einschränkungen ihrer Mitmenschen, duckten sich jedoch in abstoßender Knechtschaft vor ihren eigenen trostlosen Hirngespinsten. Abgeschnitten von zivilisierter Aufklärung, wurde die Willenskraft jener Puritaner in eigenartige Bahnen gelenkt, und in ihrer Isolation, ihrer morbiden Askese und im Überlebenskampf gegen eine unbarmherzige Natur traten bei ihnen dunkle, heimliche Merkmale aus den vorgeschichtlichen Tiefen ihres nordländischen Erbes hervor. Aus Notwendigkeit praktisch gesinnt und Anhänger einer strengen Philosophie, gingen diese Leute unschön mit ihrer Sündhaftigkeit um. Machten sie Fehler, wie dies alle Sterblichen tun, wurden sie von ihren strengen Regeln vor allem anderen gezwungen, diese zu verheimlichen; so gingen sie bei dem, was sie verheimlichten, immer geschmackloser vor. Nur die stillen, schläfrigen, starrenden Häuser in der tiefsten Provinz können von all dem berichten, was seit den frühen Tagen verborgen wurde; und sie sind nicht gesprächig und hassen es, jene Mattigkeit abzuschütteln, die ihnen hilft zu vergessen. Manchmal spürt man, dass es ein Gnadenakt wäre, diese Häuser abzureißen, denn sie träumen wohl häufig.
An einem Nachmittag im November 1896 wurde ich von einem Regen, der so kalt und heftig war, dass jeder Schutz dem Nasswerden vorzuziehen war, in eines dieser verwitterten Gebäude getrieben. Ich war seit einer Weile bei den Bewohnern des Miskatonic Valley unterwegs, um bestimmte genealogische Daten zu sammeln; und da mein Pfad so abgelegen, gewunden und unwegsam war, hatte ich es trotz der späten Jahreszeit für angemessen befunden, mit einem Fahrrad loszuziehen. Nun befand ich mich auf einer offenkundig aufgegebenen Straße, die ich als schnellste Abkürzung nach Arkham gewählt hatte. Dort, an einer Stelle, die weit von jeder Stadt entfernt lag, wurde ich von dem Unwetter eingeholt und sah keinen anderen Unterschlupf als das uralte und abstoßende Holzhaus, das mit trüben Fensterscheiben zwischen zwei großen blattlosen Ulmen in der Nähe des Fußes eines felsigen Hügels hervorblinzelte. Obwohl es von der kaum noch als solche erkennbaren Straße entfernt stand, machte das Haus, gleich als ich es zum ersten Mal erblickte, einen ungünstigen Eindruck auf mich. Ehrliche, gesunde Bauwerke starren Reisende nicht derart verschlagen und gespenstisch an, und in meinen genealogischen Forschungen war ich auf Legenden aus dem vorigen Jahrhundert gestoßen, die mich gegenüber solchen Orten voreingenommen machten. Es schüttete allerdings dermaßen heftig, dass ich meine Bedenken überwand und nicht zögerte, mein Rad die unkrautüberwucherte Anhöhe hinauf bis zu der geschlossenen Tür zu schieben, die mich mit einem Geheimnis zu locken schien, das sie zugleich hüten wollte.
Ich hatte es irgendwie für selbstverständlich gehalten, dass das Haus unbewohnt war, doch als ich mich näherte, kamen mir Zweifel; denn obwohl die Wege von Unkraut bedeckt waren, schien dieses seine natürlichen Triebe doch zu sehr im Zaum zu halten, um auf vollständige Verlassenheit hinzudeuten. Deswegen versuchte ich nicht, die Tür zu öffnen, sondern klopfte an, wobei ich ein Zittern verspürte, das ich kaum erklären konnte. Als ich auf dem groben, moosbewachsenen Stein wartete, der als Schwelle diente, warf ich einen Blick auf die Fenster direkt daneben und auf die Glasscheiben des Oberlichts über der Tür und stellte fest, dass sie zwar alt, klapprig und vor Schmutz fast undurchsichtig, aber nicht zerbrochen waren. Das Gebäude musste also, trotz seiner Abgelegenheit und allgemeinen Vernachlässigung, noch bewohnt sein. Mein Klopfen blieb allerdings unbeantwortet, deshalb ergriff ich nach einer zweiten Bitte um Einlass die rostige Türklinke und fand das Schloss unverriegelt. Dahinter lag ein kleines Vorzimmer, von dessen Wänden der Verputz abbröckelte, und durch den Eingang strömte mir ein schwacher, aber merkwürdig widerlicher Geruch entgegen. Ich trat, mein Fahrrad tragend, ein und schloss die Tür hinter mir. Vor mir erhob sich eine schmale Stiege, daneben eine kleine Tür, die wohl in den Keller führte, während links und rechts geschlossene Türen zu den Zimmern des Erdgeschosses führten.
Ich lehnte mein Fahrrad gegen die Wand, öffnete die linke Tür und betrat eine kleine, niedrige Kammer, in die durch zwei staubige Fenster kaum Licht fiel und die äußerst sparsam und primitiv eingerichtet war. Es schien sich um eine Art Wohnzimmer zu handeln, denn es gab einen Tisch und mehrere Stühle und einen riesigen Kamin, auf dessen Sims eine antike Uhr tickte. Es waren nur sehr wenige Bücher und Zeitungen vorhanden, und in der herrschenden Düsternis konnte ich ihre Titel nicht gleich entziffern. Was mich faszinierte, war die gleichförmig archaische Ausstrahlung, die jedem sichtbaren Detail innewohnte. In den meisten Häusern dieser Region hatte ich zahlreiche Relikte der Vergangenheit entdeckt, doch hier wirkte das Altertümliche sonderbar allgegenwärtig, denn ich konnte im ganzen Zimmer keinen einzigen Gegenstand ausmachen, der eindeutig aus der Zeit nach dem Unabhängigkeitskrieg stammte. Wäre die Einrichtung weniger bescheiden gewesen, dann hätte der Raum sich als Paradies für Sammler erwiesen.
Während ich mich in diesem wunderlichen Zimmer umsah, spürte ich, wie jene Abneigung, die anfangs durch das düstere Äußere des Hauses geweckt worden war, stärker wurde. Was genau ich fürchtete oder verabscheute, konnte ich beim besten Willen nicht benennen; doch etwas an der gesamten Atmosphäre schien von gottlosem Alter, unerfreulicher Rohheit und Geheimnissen, die man lieber vergessen sollte, zu zeugen. Ich wollte mich ungern setzen, wanderte umher und sah mir die verschiedenen Gegenstände, die mir aufgefallen waren, genauer an. Das Erste, was meine Neugier auf sich zog, war ein Buch von mittlerer Größe, das auf dem Tisch lag und so vorsintflutlich anmutete, dass ich mich wunderte, es außerhalb eines Museums oder einer Bibliothek vorzufinden. Es war in Leder gebunden, besaß einen Metallrahmen und war ausgezeichnet erhalten; im Großen und Ganzen ein ungewöhnlicher Band für eine derart schlichte Behausung. Als ich die Titelseite aufschlug, staunte ich noch mehr, denn es erwies sich als nichts Geringeres denn Pigafettas Beschreibung des Königreichs Congo, nach den Notizen des Seemanns Lopez auf Latein geschrieben und 1598 in Frankfurt gedruckt. Ich hatte oft von diesem Werk mit seinen kuriosen Illustrationen der Brüder De Bry gehört, so dass ich nur noch die vor mir liegenden Seiten umblättern wollte und dabei vorübergehend mein Unbehagen vergaß. Die Stiche waren wirklich interessant, denn sie basierten nur auf Phantasievorstellungen und ungenauen Beschreibungen und zeigten Neger mit weißer Haut und kaukasischen Gesichtszügen. Ich hätte den Band nicht so rasch wieder zugeschlagen, wenn nicht ein äußerst banaler Umstand meine müden Nerven angegriffen und mein Gefühl des Unbehagens neu belebt hätte. Was mich irritierte, war schlicht und einfach die Hartnäckigkeit, mit der das Buch immer wieder bei Tafel XII aufklappte, die grauenhaft detailliert ein Schlachthaus der Anziken-Kannibalen darstellte. Ich schämte mich ein wenig, dass ich auf eine solche Kleinigkeit derart empfindlich reagierte, doch die Zeichnung verstörte mich trotzdem, insbesondere in Verbindung mit einigen Passagen, in denen die Tischsitten des Anziken-Volkes geschildert wurden.
Ich hatte mich einem nahebei stehenden Regal zugewandt und untersuchte seinen kärglichen literarischen Inhalt – eine Bibel aus dem 18. Jahrhundert, eine Ausgabe von The Pilgrim’s Progress aus derselben Epoche, illustriert mit grotesken Holzschnitten und gedruckt von dem Almanachverleger Isaiah Thomas, ein verfaulter Foliant von Cotton Mathers Magnalia Christi Americana und einige andere Bücher, die offenkundig ebenso alt waren –, als meine Aufmerksamkeit durch das unverwechselbare Geräusch von Schritten im Zimmer über mir geweckt wurde. Zunächst war ich, eingedenk der ausgebliebenen Antwort auf mein Klopfen an der Tür, erstaunt und verblüfft, doch dann schloss ich, dass der oben Umhergehende eben aus einem tiefen Schlaf erwacht sein musste, und lauschte weniger überrascht, als die Schritte auf der knirschenden Treppe erklangen. Ihr Tritt war schwer, schien aber eine eigenartige Behutsamkeit aufzuweisen; eine Eigenschaft, die mir umso weniger gefiel, als die Schritte so schwer waren. Nach dem Betreten des Zimmers hatte ich die Tür hinter mir geschlossen. Nun, nach einem Moment Stille, in dem die Person, deren Schritte ich vernommen hatte, vielleicht mein Fahrrad im Vorzimmer inspizierte, hörte ich, wie jemand an der Klinke herumtastete, und sah die getäfelte Tür erneut aufschwingen.
Im Türrahmen stand eine Person von so einzigartiger Gestalt, dass ich laut aufgeschrien hätte, hätte meine gute Erziehung mich nicht zurückgehalten. Alt, mit weißem Bart und zerlumpt, besaß mein Gastgeber ein Gesicht und einen Körperbau, die mich gleichzeitig staunen ließen und mir Respekt einflößten. Er mochte nicht kleiner als sechs Fuß sein, und obwohl er allgemeine Spuren von Alter und Armut zeigte, war sein Körper stämmig und kräftig. Sein Gesicht, fast verborgen hinter einem langen Bart, der bis hoch auf den Wangen wuchs, wirkte außergewöhnlich gesund und weniger faltig, als man hätte erwarten können, während über eine hohe Stirn ein weißer Haarschopf fiel, der von den Jahren kaum ausgedünnt worden war. Seine blauen Augen waren zwar ein klein wenig blutunterlaufen, wirkten aber unerklärlich scharf und brennend. Wäre er nicht so schrecklich ungepflegt gewesen, hätte der Mann ebenso ehrwürdig wie eindrucksvoll ausgesehen. Diese Ungepflegtheit machte ihn jedoch trotz seines Gesichts und seiner Gestalt abstoßend. Woraus seine Kleidung bestand, konnte ich kaum feststellen, denn sie sah aus, als bestehe sie nur aus einem Haufen Lumpen über einem Paar hoher, schwerer Stiefel; und sein Mangel an Reinlichkeit spottete jeder Beschreibung.
Das Erscheinungsbild dieses Mannes und die instinktive Furcht, die es weckte, ließen mich mit etwas wie Feindseligkeit rechnen, so dass ich vor Überraschung und wegen eines Gefühls unheimlicher Unvereinbarkeit fast erschauderte, als er mich zu einem Sessel führte und mit einer dünnen, schwachen Stimme, erfüllt von schmeichlerischem Respekt und kriecherischer Gastfreundlichkeit, ansprach. Seine Redeweise war sonderbar, eine extreme Form des Yankee-Dialekts, die ich für längst ausgestorben gehalten hatte; und ich spitzte die Ohren, als er sich mir gegenüber niederließ, um ein Gespräch zu beginnen.
»Vom Regen überrascht, hä?«, begrüßte er mich. »Gut, dasse nah beim Haus warn, und so schlau warn, gleich reinzukommen. Muss wohl geschlafen ham, sonst hätt ich’s gehört – bin nich mehr der junge Kerl von früher und brauch heutzutag ne gute Mütze voll Schlaf. Weit gereist? Hab nich mehr viele Leut auf dieser Straße gesehen, seit die Arkham-Kutsche nich mehr fährt.«
Ich erwiderte, ich sei auf dem Weg nach Arkham, und entschuldigte mich für mein unhöfliches Eindringen in sein Haus, woraufhin er fortfuhr.
»Bin froh, Sie zu sehn, junger Sir – neue Gesichter sin hier selten, und ich hab hier heut nich mehr viel, was mich aufheitern tut. Sind von Boston hergekommen, hä? War nie dort, erkenne aber ’nen Stadtmensch, wenn ich ihn seh – vierundachtzig hatten wir einen als Bezirksschulmeister, doch der hat bald hingeschmissen, und wir ham nichts mehr von ihm gehört seitdem –« An dieser Stelle verfiel der Alte in eine Art Kichern, für das er mir jedoch keine Erklärung gab, als ich ihn nach dem Grund fragte. Er schien bei bester Laune zu sein, aber auch jene Schrullen zu besitzen, die sein Aufzug nahelegte. Eine Zeitlang plapperte er mit einer fast fieberhaften Herzlichkeit weiter, da kam es mir in den Sinn, ihn zu fragen, wie ein so seltenes Buch wie Pigafettas Regnum Congo in seinen Besitz gelangt war. Der Eindruck, den dieser Band bei mir hinterlassen hatte, hatte sich nicht verflüchtigt, und ich spürte einen gewissen Unwillen, ihn zu erwähnen, doch die Neugier überwand all die vagen Ängste, die sich seit meinem ersten Blick auf das Haus stetig angesammelt hatten. Zu meiner Erleichterung schien die Frage dem Alten nicht unangenehm zu sein, denn er antwortete freimütig und ausführlich.
»Oh, das Afrikabuch? Hauptmann Ebenezer Holt hat’s mir achtundsechzig verkauft – er fiel im Krieg.« Etwas an dem Namen Ebenezer Holt ließ mich aufmerken. Ich war in meiner genealogischen Arbeit auf ihn gestoßen, allerdings nur in Aufzeichnungen aus der Zeit vor dem Unabhängigkeitskrieg. Ich fragte mich, ob mir mein Gastgeber bei meinen Forschungen helfen könnte, und beschloss, ihn später zu fragen. Er fuhr fort.
»Ebenezer diente auf ’nem Kauffahrer aus Salem und las in jedem Hafen allerhand seltsamen Kram auf. Das hier hatte er aus London, schätz ich – er kaufte Sachen in den Läden. Einmal war ich bei ihm zu Haus, oben aufm Hügel, Pferde verkaufen, da sah ich das Buch. Mir gefielen die Bilder, also ging er auf ’nen Tauschhandel ein. Ist ’n komisches Buch – na, wolln mal die Augengläser holen …« Der Alte kramte in seinen Lumpen herum und förderte eine schmutzige und erstaunlich vorsintflutliche Sehhilfe mit kleinen achteckigen Gläsern und Stahlbügel zutage. Nachdem er sie aufgesetzt hatte, griff er nach dem Band auf dem Tisch und blätterte liebevoll darin.
»Ebenezer konnt ein wenig hiervon lesen – das Lateinische –, ich aber nich. Ich hab mir von zwei, drei Schulmeistern was vorlesen lassen, und von Pastor Clark, der angeblich im Teich ertrunken ist – können Se was damit anfangen?« Ich sagte ihm, ich könne, und übersetzte ihm zuliebe einen Absatz auf den ersten Seiten. Falls ich Fehler machte, war er nicht gebildet genug, mich zu korrigieren, denn er zeigte kindliche Freude an meiner englischen Übertragung. Seine Nähe wurde allmählich ziemlich unangenehm, doch sah ich keine Möglichkeit, ihm zu entfliehen, ohne ihn zu kränken. Die kindliche Begeisterung dieses unwissenden Alten für Bilder in einem Buch, das er nicht lesen konnte, erheiterte mich, und ich fragte mich, ob er die englischen Bücher, die den Raum zierten, denn wesentlich besser zu lesen verstand. Diese Offenbarung eines schlichten Gemüts zerstreute viel von der schwer zu benennenden Furcht, die ich verspürt hatte, und ich lächelte, als mein Gast weiterplapperte:
»Schon komisch, wie Bilder einen zum Grübeln bringen. Zum Beispiel das hier, fast am Anfang. Ham Se je solche Bäume gesehn, mit großen Blättern, die auf und ab schaukeln? Und diese Männer – die könn doch keine Nigger sein –, die sind das Beste. Wie Rothäute, schätz ich, auch wennse in Afrika leben. Ein paar von den Viechern sehn wie Affen aus oder wie ’ne Mischung aus Affe und Mensch, doch von so was hab ich noch nie gehört.« Mit diesen Worten deutete er auf ein Fabelwesen des Künstlers, das man als eine Art Drache mit Alligatorkopf beschreiben könnte.
»Aber jetzt zeig ich Ihnen das Beste – hier drüben, so etwa inner Mitte …« Die Stimme des Alten klang ein klein wenig dumpfer, und seine Augen leuchteten etwas heller; seine tastenden Hände bewegten sich zwar anscheinend unbeholfener als zuvor, zeigten sich ihrer Aufgabe jedoch völlig gewachsen. Das Buch öffnete sich fast wie von selbst, als hätte man es schon oft an derselben Stelle aufgeschlagen, bei der zwölften Bildtafel, die das Schlachthaus der Anziken-Kannibalen zeigte. Meine Unruhe kehrte zurück, auch wenn ich sie nicht offen zur Schau stellte. Das besonders Bizarre daran war, dass der Künstler seine Afrikaner wie Weiße aussehen ließ – die Glieder und Körperteile, die im Schlachthaus hingen, waren schaurig, während der Metzger mit seinem Beil schrecklich unpassend wirkte. Doch meinen Gastgeber schien das Bild so sehr zu begeistern, wie ich es verabscheute.
»Was halten Se davon – ham hier noch nie was Ähnliches gesehen, hä? Wo ich es gesehn hab, sagte ich zu Eb Holt: ›Das is schon was, das einen aufstachelt und das Blut in Wallung bringt.‹ Als ich inner Heiligen Schrift vom Hinschlachten las – so wie die Ismaeliten hingeschlachtet wurden –, konnt ich mir so meine Gedanken machen, hatte aber kein Bild davon. Hier kannste alles sehen – ist wohl sündhaft, aber sind wir nich alle sündhaft geboren und leben in Sünde? – Der Kerl, der in Stücke gehackt wird, reizt mich jedes Mal, wenn ich ihn anseh – muss ihn ständig ansehn – Sehn Se, wie der Metzger ihm die Füße abschneidet? Das ist sein Kopf dort auf der Bank, daneben ein Arm, und der andre Arm liegt am Boden neben dem Hackklotz.«
Während der Mann in seiner schockierenden Verzückung weiterbrabbelte, nahm sein behaartes, bebrilltes Gesicht einen unbeschreiblichen Ausdruck an, doch seine Stimme wurde eher leiser als lauter. Meine eigenen Gefühle lassen sich kaum niederschreiben. Der ganze Schrecken, den ich zuvor nur vage empfunden hatte, trat nun rege und lebhaft zutage, und mir wurde klar, dass ich das uralte und scheußliche Geschöpf, das so dicht vor mir saß, mit unendlicher Inbrunst hasste. Dass er wahnsinnig oder zumindest irgendwie verkehrt im Kopf war, schien unbestreitbar. Nun flüsterte er beinahe, mit einer rauen Stimme, die entsetzlicher klang als jeder Schrei, und ich zitterte, während ich lauschte.
»Wie ich schon sagte, is doch komisch, wie Bilder einen zum Grübeln bringen. Wissen Se, junger Sir, ich bin ganz verschossen in das hier. Nachdem ich Eb das Buch abgekauft hatte, hab ich’s mir oft angeschaut, besonders wenn ich Pastor Clark mit seiner großen Perücke bei seiner Sonntagspredigt hab schwafeln hörn. Hab mal was Witziges probiert – na, junger Sir, Sie müssen keine Angst ham – hab mir nur mal das Bild angeschaut, bevor ich die Schafe für den Markt geschlachtet hab – hat irgendwie mehr Spaß gemacht, das Schafeschlachten, nachdem ich’s mir angeschaut hab …« Die Stimme des Alten wurde nun sehr leise, so sehr, dass man seine Worte kaum noch verstehen konnte. Ich lauschte dem Regen und dem Rütteln der verschmierten kleinen Fensterscheiben und bemerkte ein näher kommendes Donnergrollen, das für die Jahreszeit recht ungewöhnlich war. Einmal erschütterte ein furchtbarer Blitz und Donnerschlag das wacklige Haus bis ins Fundament, doch der Flüsterer schien es nicht zu bemerken.
»Schafe schlachten machte irgendwie mehr Spaß – aber, wissen Se, es war nich richtig befriedigend. Schon komisch, wie ’ne Gier einen packen kann – bei der Liebe des Allmächtigen, junger Mann, erzählen Se’s niemandem, aber ich schwör bei Gott, das Bild weckte in mir ’nen Hunger nach ’ner Speise, die ich weder züchten noch kaufen konnte – na, beruhigen Se sich, was ham Se denn? – hab doch nichts gemacht, hab mich nur gefragt, wie’s wär, wenn ich’s tun würd – man sagt, vom Fleisch kriegt man Blut und Muskeln, man kriegt neues Leben, also hab ich mich gefragt, ob’s das Leben eines Menschen nich noch mehr verlängern würd, wenn’s mehr von derselben …« Doch der Flüsterer brachte den Satz nie zu Ende. Die Unterbrechung wurde nicht durch meine Angst verursacht, auch nicht von dem rasch stärker werdenden Gewittersturm, in dessen Toben ich jeden Moment damit rechnete, auf eine rauchende Einöde aus schwarzen Ruinen zu blicken, wenn ich die Augen öffnete. Schuld daran war ein ganz einfacher, aber etwas ungewöhnlicher Zwischenfall.
Das Buch lag flach zwischen uns, so dass das Bild uns ekelhaft anstarrte. Als der Alte die Worte »mehr von derselben« flüsterte, hörte man ganz leise einen Tropfen aufschlagen, und etwas breitete sich auf dem vergilbten Papier des geöffneten Bandes aus. Ich dachte an den Regen und ein undichtes Dach, doch Regen ist nicht rot. Auf dem Schlachthaus der Anziken-Kannibalen schimmerte malerisch ein kleiner roter Spritzer, der dem Grauen des Stiches zusätzliche Lebendigkeit verlieh. Der Alte sah ihn und hörte auf zu flüstern, bevor mein erschreckter Aufschrei ihn unterbrechen konnte; er sah den Spritzer und blickte rasch hinauf zum Boden des Zimmers, das er vor einer Stunde verlassen hatte. Ich folgte seinem Blick und bemerkte genau über uns auf dem lockeren Verputz der uralten Decke einen großen unregelmäßigen, feuchten, dunkelroten Fleck, der sich auszubreiten schien, während ich hinsah. Ich schrie und bewegte mich nicht, sondern schloss nur die Augen. Einen Moment später schlug der gewaltigste aller Blitze ein; er zerfetzte das verfluchte Haus voller unsagbarer Geheimnisse und brachte ein Vergessen, das allein meinen Verstand zu retten vermochte.
Die Musik des Erich Zann
Mit größter Sorgfalt habe ich die Stadtpläne durchforscht, doch die Rue d’Auseil habe ich niemals wiedergefunden. Es waren nicht nur moderne Pläne, denn ich weiß, dass Namen sich ändern können. Ich habe, ganz im Gegenteil, in jedem alten Winkel der Stadt herumgestöbert und persönlich jede Gegend erkundet, wie auch immer sie heißen mochte, die auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit jener Straße aufwies, die ich als Rue d’Auseil kannte. Doch am Ende all meiner Bemühungen steht die beschämende Tatsache, dass ich weder das Haus noch die Straße, noch auch nur das Viertel finden kann, wo ich, in den letzten Monaten meines kärglichen Daseins als Student der Metaphysik, die Musik des Erich Zann hörte.
Dass mein Gedächtnis Schaden genommen hat, wundert mich nicht. Denn sowohl meine körperliche als auch meine geistige Gesundheit hat während der Zeit, als ich in der Rue d’Auseil wohnte, schwer gelitten, und ich erinnere mich, dass ich keinen meiner wenigen Bekannten dorthin einlud. Aber dass ich nicht mehr in der Lage bin, die Örtlichkeit wiederzufinden, ist ebenso sonderbar wie bestürzend. Denn sie war nicht mehr als eine halbe Stunde Fußweg von der Universität entfernt und wies Eigentümlichkeiten auf, die niemand, der je dort war, hätte vergessen können. Ich habe niemals jemanden getroffen, der die Rue d’Auseil kannte.
Die Rue d’Auseil lag jenseits eines dunklen Flusses, dessen Ufer von steil aufragenden blindfenstrigen Lagerhäusern aus Backstein gesäumt waren und den eine massive Brücke aus dunklem Mauerwerk überspannte. Entlang des Flusses war es immer dämmrig, so als ob der Qualm naher Fabriken die Sonne fernhielt. Auch dünstete der Fluss üble Gerüche aus, die ich nie irgendwo anders gerochen habe und die mir vielleicht eines Tages helfen werden, ihn wiederzufinden, da ich sie sofort erkennen würde. Jenseits der Brücke lagen enge kopfsteingepflasterte Straßen mit Geländern, und dahinter stieg der Weg zunächst allmählich an und wurde dann, wenn man die Rue d’Auseil erreichte, unglaublich steil.
Ich habe niemals eine so enge und abschüssige Straße gesehen wie die Rue d’Auseil. Sie glich beinahe einem Steilhang und war für alle Fahrzeuge gesperrt. An mehreren Stellen ging sie in Treppen über und endete am oberen Ende in einer hohen, efeuüberwachsenen Mauer. Der Straßenbelag war unregelmäßig und bestand mal aus Steinplatten, mal aus Pflastersteinen und mal aus nackter Erde, aus der sich eine spärliche, grünlich-graue Vegetation hervorkämpfte. Die Häuser waren hoch, mit spitzen Dächern, unglaublich alt und neigten sich auf irrwitzige Weise hintüber, nach vorn und zur Seite. Manchmal berührten sich zwei vorwärtsgeneigte Häuser über der Straße fast wie ein Bogen, und zwangsläufig hielten sie das meiste Licht vom Boden unter ihnen ab. Hier und da führten weit oben Brücken von Haus zu Haus über die Straße.
Die Bewohner der Rue d’Auseil machten einen sonderbaren Eindruck auf mich. Anfangs dachte ich, der Grund sei, dass sie allesamt schweigsam und abweisend waren. Doch später gelangte ich zu der Überzeugung, dass der eigentliche Grund ihr hohes Alter war. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, in einer solchen Straße zu wohnen, aber ich war nicht ich selbst, als ich dorthinzog. Ich hatte in vielen ärmlichen Bleiben gehaust und war immer wieder aus Geldmangel vor die Tür gesetzt worden, bis ich schließlich auf jenes baufällige Haus in der Rue d’Auseil stieß, das von dem Säufer Blandot verwaltet wurde. Es war das dritte Haus vom oberen Ende der Straße gezählt und bei weitem das höchste von allen.
Mein Zimmer lag im fünften Stock. Ich war auf dieser Etage der einzige Mieter, da das Haus fast unbewohnt war. In der Nacht meiner Ankunft hörte ich seltsame Musik aus der spitzgiebligen Mansarde über mir, und am nächsten Tag fragte ich den alten Blandot danach. Er sagte mir, dass dort ein alter deutscher Violaspieler wohne, ein seltsamer, stummer Mann, der mit dem Namen Erich Zann unterzeichnete und an den Abenden im Orchester eines billigen Theaters spielte. Er fügte hinzu, dass Zanns Bedürfnis, nachts, nach seiner Rückkehr aus dem Theater, noch sein Instrument zu spielen, der Grund war, warum er dieses hochgelegene und einsame Mansardenzimmer gewählt hatte, dessen Giebelfenster der einzige Punkt der Straße war, der einen Blick über die Mauer an ihrem Ende und auf den Hang und das Panorama gestattete, die dahinter lagen.
Von da an hörte ich Zann jede Nacht, und obwohl er mich um den Schlaf brachte, zog mich die Absonderlichkeit seiner Musik in ihren Bann. Auch wenn ich selbst kaum etwas von dieser Kunst verstand, war ich doch sicher, dass seine Harmonien in keinerlei Beziehung zu irgendeiner mir bekannten Musik standen, und kam zu dem Schluss, dass er ein Komponist von ganz einzigartiger Begabung war. Je länger ich ihm lauschte, desto faszinierter war ich, bis ich mich nach einer Woche entschloss, die Bekanntschaft des alten Mannes zu machen.
Eines Abends, als er von seiner Arbeit zurückkam, fing ich Zann im Hausflur ab und sagte ihm, dass ich ihn gern kennenlernen und ihm Gesellschaft leisten wolle, wenn er sein Instrument spielte. Er war ein kleiner, schmächtiger, verkrümmter Mann, schäbig gekleidet, mit blauen Augen, einem fratzenartigen, satyrhaften Gesicht und beinahe kahlem Schädel. Bei meinen Worten wirkte er zunächst halb verärgert und halb verängstigt. Er ließ sich jedoch schließlich von meiner offensichtlichen Freundlichkeit erweichen und bedeutete mir widerwillig, ihm die dunklen, knarrenden und wackligen Stufen zum Dachgeschoss hinauf zu folgen. Sein Zimmer, eines von nur zweien unter der steilen Dachschräge, lag auf der Westseite, in Richtung auf die hohe Mauer, die das obere Ende der Straße bildete. Es war sehr groß und wirkte aufgrund der äußerst spärlichen Einrichtung und seines vernachlässigten Zustandes noch größer. Die Möblierung beschränkte sich auf ein schmales eisernes Bett, eine schmutzige Waschschüssel auf einem Ständer, einen kleinen Tisch, ein großes Bücherregal, ein eisernes Notenpult und drei altmodische Stühle. Auf dem Boden stapelten sich durcheinandergeworfene Notenblätter. Die Wände bestanden aus blanken Brettern und hatten möglicherweise niemals einen Verputz gekannt, während ein Übermaß an Staub und Spinnweben den Raum eher verwaist denn bewohnt wirken ließ. Offenkundig lag Erich Zanns Welt der Schönheit in irgendeinem weit entfernten Kosmos der Phantasie.
Nachdem er mir bedeutet hatte, mich zu setzen, schloss der Stumme die Tür, schob den großen hölzernen Riegel vor und zündete eine Kerze an, um das Licht derjenigen, die er mitgebracht hatte, zu ergänzen. Dann nahm er seine Viola aus ihrer mottenzerfressenen Hülle und setzte sich, indem er das Instrument ergriff, auf den am wenigsten unbequemen der drei Stühle. Weder machte er Gebrauch von dem Notenpult, noch fragte er mich nach meinen Wünschen, sondern spielte aus dem Gedächtnis und bezauberte mich für über eine Stunde mit Klangfolgen, die ich nie zuvor gehört und die er sich offenbar selbst ausgedacht hatte. Es handelte sich um eine Art Fuge, mit sich wiederholenden Passagen von ungeheurer Eindringlichkeit. Was mir jedoch auffiel, war das völlige Fehlen der absonderlichen Töne, die ich in anderen Nächten von unten aus meinem Zimmer belauscht hatte.
Jene gespenstischen Tonfolgen hatten sich meinem Gedächtnis eingeprägt, und ich hatte sie oft ungeschickt vor mich hin gesummt oder gepfiffen, und als der Violaspieler schließlich seinen Bogen sinken ließ, bat ich ihn, einige davon erklingen zu lassen. Bei den ersten Worten meiner Bitte verlor das faltige satyrhafte Gesicht den gelangweilten Gleichmut, den es während der bisherigen Vorführung gezeigt hatte, und es schien sich dieselbe merkwürdige Mischung von Ärger und Furcht darauf abzuzeichnen, die mir schon aufgefallen war, als ich den alten Mann zum ersten Mal angesprochen hatte. Zunächst wollte ich ihn durch gutes Zureden überzeugen, da ich den Launen des Alters keine große Bedeutung zumaß, und versuchte sogar, meinen Gastgeber in die entsprechende Stimmung zu bringen, indem ich einige der Tonfolgen pfiff, denen ich in der Nacht zuvor gelauscht hatte. Doch gab ich diesen Versuch rasch auf, denn als der stumme Musiker die gepfiffene Melodie erkannte, verzerrte sich sein Gesicht plötzlich zu einem Ausdruck, der sich jeglicher Deutung entzog, und er streckte seine schmale, kalte und knochige rechte Hand aus, um meinen Mund zu verschließen und die unbeholfene Nachahmung zum Schweigen zu bringen. Dabei stellte er ein weiteres Mal sein exzentrisches Wesen unter Beweis, indem er einen erschrockenen Blick in Richtung auf das einzige, von Vorhängen verdeckte Fenster warf, so als ob er dort einen Eindringling fürchten würde – ein Blick, der deshalb doppelt absurd wirkte, weil der Giebel sich hoch und unzugänglich über allen benachbarten Dächern erhob und dieses Fenster, wie mir der Concierge erzählt hatte, der einzige Punkt der steilen Straße war, von dem aus man die Kuppe jenseits der Mauer sehen konnte.
Der Blick des alten Mannes rief mir Blandots Bemerkung ins Gedächtnis, und aus einer Laune heraus verspürte ich den Wunsch, das weite und schwindelerregende Panorama der mondbeschienenen Dächer und der Lichter der Stadt jenseits der Anhöhe zu überblicken, das von allen Bewohnern der Rue d’Auseil einzig dieser griesgrämige Musiker sehen konnte. Ich ging auf das Fenster zu und hätte die unansehnlichen Vorhänge zur Seite gezogen, wenn mich der stumme Bewohner der Mansarde nicht mit einer ängstlichen Wut, die noch größer war als zuvor, daran gehindert hätte. Diesmal deutete er mit Kopfbewegungen auf die Tür, während er gleichzeitig nervös versuchte, mich mit beiden Händen dorthinzuzerren. Ich hatte mittlerweile mehr als genug von meinem Gastgeber, befahl ihm, mich loszulassen, und sagte ihm, dass ich auf der Stelle gehen würde. Sein Griff lockerte sich, und als er meinen Abscheu und Ärger bemerkte, schien seine eigene Wut sich zu besänftigen. Er verstärkte seinen gelockerten Griff wieder, diesmal jedoch auf freundliche Art, und nötigte mich auf einen Stuhl. Dann ging er mit reumütigem Ausdruck hinüber zu dem unordentlichen Tisch, wo er mit Bleistift viele Worte im mühseligen Französisch eines Ausländers niederschrieb.
Das Blatt, das er mir schließlich reichte, war eine Bitte um Nachsicht und Vergebung. Zann schrieb, er sei alt und einsam und leide unter seltsamen Ängsten und nervösen Störungen, die mit seiner Musik und anderen Dingen zusammenhingen. Er habe es genossen, mir seine Musik vorzuspielen, und hoffe, dass ich wiederkommen und mich nicht an seinen Eigenheiten stören würde. Allerdings könne er niemand anderem seine absonderlichen Harmonien vorspielen und ertrage es nicht, sie von jemand anderem zu hören. Genauso unerträglich sei es ihm, wenn jemand anderes etwas in seinem Zimmer berühre. Vor unserer Unterhaltung im Hausflur habe er nicht gewusst, dass sein Spiel bis in mein Zimmer dränge, und nun bat er mich, mir von Blandot ein weiter unten gelegenes Zimmer anweisen zu lassen, wo ich ihn nachts nicht hören könne. Für die Differenz in der Miete, so schrieb er, würde er aufkommen.
Während ich so dasaß und sein erbarmungswürdiges Französisch entzifferte, wuchs meine Nachsicht mit dem Alten. Genau wie ich war er ein Opfer körperlicher und nervlicher Leiden, und meine metaphysischen Studien hatten mich Mitgefühl gelehrt. In der Stille erklang ein schwaches Geräusch vom Fenster her – der Fensterladen hatte wohl im Nachtwind geklappert –, und aus irgendeinem Grund fuhr ich fast genauso heftig zusammen wie Erich Zann. Nachdem ich fertiggelesen hatte, schüttelte ich also meinem Gastgeber die Hand und schied als Freund von ihm. Am nächsten Tag gab mir Blandot ein teureres Zimmer im dritten Stock, zwischen der Wohnung eines betagten Geldverleihers und dem Zimmer eines biederen Polsterers. Im vierten Stock wohnte niemand.