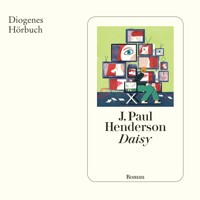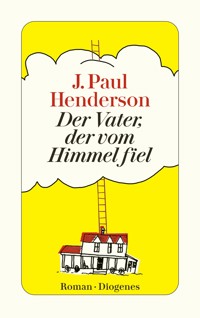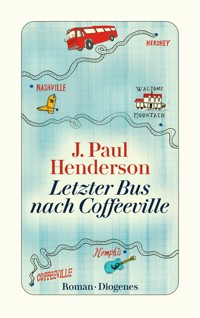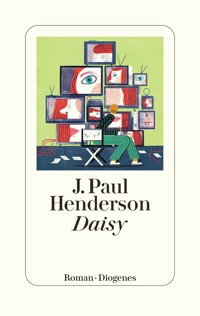
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Herod sich nicht gerade in Tagträumen verliert, sitzt er auf dem Sofa und schaut in die Röhre. Er ist eher unter- als überambitioniert und fiebert schon in jungen Jahren dem Ruhestand entgegen. Doch als er sich Hals über Kopf verliebt, muss auch Herod mal in die Gänge kommen. Ein Privatdetektiv findet die Angebetete, aber hat Daisy auch Augen für den sympathischen Kauz von der Insel?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
J. Paul Henderson
Gestatten, Herod »Rod« Pinkney, verliebt in eine gewisse
Daisy
Roman
Aus dem Englischen von Britta Waldhof
Diogenes
Lieber geträumt und aufgewacht als gar nicht geträumt
Alfred Lord Tennyson (leicht abgewandelt)
Anfang
Meiner Ansicht nach besteht die Welt aus zwei Arten von Mensch: Die einen reden gern von sich, die andern nicht. Ich gehöre zur zweiten Sorte.
Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Herod S. Pinkney und bin verliebt in eine gewisse Daisy Lamprich.
Das genügt wohl fürs Erste.
7. Juni 2019
Ich zeigte die soeben von Ihnen gelesene Seite meinem Agenten, der im Lansdowne, einem hiesigen Pub, die Gläser einsammelt. Auf der Seite steht nicht viel, aber fürs Schreiben habe ich lange gebraucht. Erste Sätze sind wichtig.
Er las den getippten Text und nickte langsam. Der Einstieg sei interessant, meinte er. Um das Interesse eines Verlegers zu wecken, müsse ich allerdings weit mitteilsamer sein.
»Der Leser will was über dich erfahren, Rod, wissen, wie du tickst«, sagte er. »Und um Daisy zu erwähnen, ist es noch zu früh. Erst mal muss er sich für dich interessieren. Du musst ihn ködern und an der Angel haben – ihn dazu kriegen, dass er sich auf dich einlässt.«
Wir unterhielten uns noch ein Weilchen, aber dann wurde es voll im Pub, und der Wirt scheuchte ihn an die Arbeit.
»Mit dem Krüppel kannst du in deiner Freizeit reden.«
Sie sehen schon, der Wirt ist kein netter Mensch, und würde mein Agent nicht hier arbeiten, wär ich nicht sein Kunde. Es stimmt auch gar nicht, dass ich ein Krüppel bin. Nicht jeder, der E-Mobil fährt, ist gleich gehbehindert.
Ich leerte mein Glas und fuhr den kurzen Weg nach Haus. Seit ein paar Jahren schon wohne ich in einer ruhigen Straße in Battersea, in einem Reihenendhaus nicht weit vom Park. Jetzt, wo es unterkellert ist, hat es vier Etagen und alles, was man sich nur wünschen kann. Die Fassade und die Seitenwand sind begrünt – ein Wandgarten, der für die kleinen Gärten vor und hinter dem Haus entschädigt. Auf die Idee bin ich durchs Athenaeum Hotel an der Piccadilly gekommen, und ich konnte dafür sogar den Mann, der dort die Fassade begrünt hatte, gewinnen. Kurioserweise hatte er Höhenangst. In der Zeit, in der er an meinem Haus arbeitete, erlitt er zwei Panikattacken und lächelte kein einziges Mal. Jetzt kümmert sich Edmundo um die Pflanzenwände. Edmundo kümmert sich um fast alles.
Nachdem ich es mir bequem gemacht hatte, schenkte ich mir ein Gläschen Whisky ein und grübelte über die Worte meines Agenten nach. Er heißt übrigens Ric, aber an seinen Nachnamen erinnere ich mich beim besten Willen nicht. Er klingt fremd und sieht aus wie Buchstabensalat, was er in seinem Beruf für einen Vorteil hält.
»Dadurch heb ich mich von der Masse ab, Rod – so ähnlich wie du mit deinem Namen.«
Damit liegt er wohl nicht ganz falsch, auch wenn mir mein Name nicht gefällt und ich gern irgendwo dazugehöre. Ich finde es schön, wie andere zu sein. Darum lasse ich mich heute lieber Rod als Herod nennen, das traue ich mich aber erst seit dem Tod meiner Eltern. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, von ihnen zu erzählen.
Bestimmt würde Ric das so wollen.
Fortsetzung 1
Pinkney Industries
Mein Vater war George Pinkney, Gründer der Pinkney Werke. Er war ein kräftig gebauter Mann mit Stiernacken und Schuhgröße fünfundvierzig, einem kantigen Kinn und eng anliegenden Ohren, wie akkurat angebügelt. Außerdem hatte er einen dicken Schnurrbart, der ihm über die Oberlippe hing, und schmierte sich so viel Pomade ins Haar, dass sein Kopf praktisch wasserdicht war. Werktags trug er Anzug und Krawatte, an Wochenenden und Feiertagen hingegen bevorzugte er einen Krawattenschal.
Mein Vater war ein Selfmademan, was er gern bei jeder Gelegenheit erzählte. Zu seinen Lebzeiten habe ich für ihn gearbeitet, trotzdem habe ich kaum eine Vorstellung davon, womit er sein Geld verdiente. Ehrlich gesagt glaube ich, mein Vater hat mich mit Absicht im Dunkeln gelassen. Ich hatte den Eindruck, dass er mich nicht mochte, auch weil er mir ständig unter die Nase rieb, was für ein schwacher Ersatz für Solomon ich sei. Denn das war meine Rolle in der Familie: einen toten Bruder zu ersetzen, der mehr Grips im kleinen Finger hatte als ich in der Birne – jedenfalls bekam ich das andauernd von meinem Vater zu hören.
Solomon starb an seinem sechzehnten Geburtstag bei einem Kopfsprung ins flache Ende eines Schwimmbeckens. Wenn er so blitzgescheit war, wie mein Vater immer behauptete, fragt man sich unweigerlich, wie ihm entgehen konnte, dass sich die Sprungbretter nicht ohne Grund am anderen Ende des Beckens befanden. Diesen Gedanken behielt ich jedoch lieber für mich. Als wandelnde Enttäuschung war das Leben schon schwer genug.
Weil ich für meinen Vater eine Enttäuschung war, war ich es selbstverständlich auch für meine Mutter. Sie vergötterte ihn und gewann seine Zuneigung, indem sie sich kritiklos seinen Launen und Entscheidungen fügte. Nichts anderes erwartete er von einer Gattin.
Meine Mutter galt als Schönheit, auch wenn mir das ein Rätsel war. Ihre Lippen waren immer dünn, wenn sie mit mir sprach, ihre Augen stets zusammengekniffen, und das Lächeln, das angeblich die Londoner Salons erstrahlen ließ, kam für mich kein einziges Mal zum Vorschein. Meinem Onkel Horace zufolge, der mit ihrer Schwester Thelma verheiratet war, hätte sie unter den begehrtesten Junggesellen Londons wählen können, hatte sich aber wegen seiner majestätischen Ader für meinen Vater entschieden. (Das hab ich nie ganz verstanden. Mein Vater war nicht blaublütig.)
Falls meine Mutter sich mehr Kinder wünschte, behielt sie es für sich. Mir hätte sie es ohnehin nicht verraten. Mein Vater hingegen machte unmissverständlich klar, dass er nur ein Kind wollte: einen Sohn, den er nach seinem Bilde formen und dem er das Familienimperium vermachen konnte. Dieser Sohn war nicht ich, sondern Solomon. Aus mir sollte ein zweiter Solomon werden, aber der Plan schlug fehl.
Ich kam achtzehn Monate nach dem Tod meines Bruders zur Welt. Schon als ich drei Jahre alt war, wusste mein Vater, dass aus mir nie ein zweiter Solomon werden würde. Zum einen fand er mein Gesicht zu dick, zum anderen störte ihn meine sesshafte Natur.
»Jedes Mal, wenn ich durch diese Tür komme, Herod, sitzt du auf deinen verflixten vier Buchstaben«, sagte er immer. »Was ist los mit dir, Junge? Willst du, dass dein Hintern so breit wird wie dein Gesicht? Jetzt renn mal drei Runden!«
(Und unser Wohnzimmer war groß.)
Wenn ich hilfesuchend zu meiner Mutter blickte, sagte sie schlicht, ich solle tun, wie mein Vater mir geheißen, und fügte hinzu, Solomon habe sich nur zum Essen auf einen Stuhl gesetzt. Das glaubte ich keine Sekunde, aber auch wenn Solomon allgegenwärtig war – seine Trophäen und Preise zierten im Wohnzimmer Wände und Regale –, konnte ich ihn nicht fragen.
Ich fing an, mich heimlich hinzusetzen, wann immer meine Eltern sich nicht im Zimmer oder, besser noch, außer Haus befanden, was keine Seltenheit war. Auch dann musste ich noch auf der Hut sein, wenn die Putzfrau oder ein Babysitter in der Nähe war, denn mein Vater hatte ihnen strikte Anweisung gegeben, mich auf Trab zu halten und ihm zu melden, falls sie mich auf einem Sessel oder gar der Länge nach auf einem Sofa ausgestreckt erwischten. Mein Vater glaubte fest an die Überzeugungskraft des Geldes, und jedes Mal, wenn sie mich verrieten, bekamen sie eine Prämie.
Der sicherste Sitzplatz war die Toilette, und solange ich zu Hause wohnte, wurde sie mein zweites Zuhause. Dort behelligte mich niemand, und um nicht überrascht zu werden, verriegelte ich die Tür, auch wenn das gegen die Regeln verstieß. Die glücklichste Zeit meiner Kindheit waren die Stunden, in denen ich auf der Toilette saß und einen Comic las oder einfach vor mich hin träumte – etwas, das mein Vater ebenfalls missbilligte.
Darum freute ich mich wie ein Schneekönig, als meine Eltern mich mit sieben aufs Internat schickten. Die Schule lag in einer Kleinstadt in Wiltshire und riet von Elternbesuchen während des Trimesters ab. Das passte mir ausgezeichnet, besonders aber beglückte mich, dass ich an den meisten Wochentagen in einem Klassenzimmer sitzen sollte, und zwar auf einem Holzsitz, der nicht minder komfortabel war als die elterliche Klobrille. Das Lernen wurde zum Vergnügen, wenn auch vermutlich aus dem falschen Grund.
Körperliche Betätigung ließ sich an einer Schule, an der Charakterbildung auf dem Spielfeld großgeschrieben wurde, natürlich nicht ganz vermeiden, aber im Frühling und Sommer war ich wegen meiner Gräser- und Pollenallergie, die mitunter zu schweren Asthmaanfällen führte, vom Sport im Freien entbunden. Der Direktor erlaubte mir, in dieser Zeit statt der bewegungsintensiveren Sportarten Schach zu spielen, und im Sitzen bekundete ich meine Schulbegeisterung sehr viel lieber.
Zwar war ich kein Meister im Schach und verlor sogar gegen viel jüngere Schüler, aber Verlieren machte mir nichts aus – zweifellos eine weitere Eigenschaft, in der ich mich auf unvorteilhafte Weise von meinem verstorbenen Bruder unterschied, der auf dem gleichen Internat gewesen war.
Die Lehrer scheuten sich nicht, mir zu sagen, was für ein blasses Abbild Solomons ich sei, auch schulisch sei er begabter gewesen. Ich war nicht dumm, allerdings litt ich, wie sich erst nach meiner Schulzeit herausstellte, an Legasthenie. Inzwischen ist sie weniger schlimm und mit einem Rechtschreibprogramm kein Grund mehr zur Sorge. Ab und zu werfe ich noch Wörter oder Zahlen durcheinander, aber nicht so oft, dass es ein Problem wäre, und da ich nicht mehr berufstätig bin, spielt es kaum noch eine Rolle.
Alles in allem verlief meine Schulzeit ohne Zwischenfälle, und ich fand gute Freunde. Das Einzige, womit ich aufgezogen wurde, war mein Name: Herod.
»Warum heißt du wie der Kindermörder?«, wurde ich immer wieder gefragt. »Du weißt doch, dass Herodes Jesus umbringen wollte, oder?«
Tatsache war, ich wusste es nicht. Obwohl mein Vater für seine Söhne biblische Namen bevorzugt hatte, war die Bibel selbst aus dem Haus verbannt, und kein einziges Mal ging er oder meine Mutter mit mir in die Kirche. Ich glaube, er war Atheist, und wenn er es war, dann meine Mutter natürlich auch. Vielleicht entwickelte ich deshalb ein Interesse an Religion: Wenn mein Vater nicht an Gott glaubte, gab es für mich allen Grund, seine Existenz anzuerkennen – und sei es nur, um meinen Vater zu ärgern und der Gefahr zu entgehen, ihm im Jenseits in die Arme zu laufen.
Als er in den Schulferien einen Gewaltmarsch an der Themse mit mir machte, befragte ich ihn zu meinem Namen. Warum war ich nach einem König der Antike benannt, der Hunderte Kleinkinder abgeschlachtet hatte und Jesus umbringen wollte? Und wozu der zusätzliche Buchstabe, wo ich doch gar keinen zweiten Vornamen hatte? Wieso Herod S. Pinkney?
»Weil Herodes ein bedeutender Mann war«, antwortete mein Vater, »und weil ich gehofft hatte, dass seine Qualitäten auf dich abfärben, wenn ich dich nach ihm nenne. Und den Kindermordquatsch, den vergiss mal schön, das stimmt nämlich gar nicht, und selbst wenn, nur mal rein theoretisch, dann wurden höchstens zwanzig getötet. Es gibt dafür keinen historischen Beleg, und wenn er Jesus nicht erwischt hat … tja, dann war das eben sein einziger Fehlschlag.
Wissen musst du über König Herodes, dass er ehrgeizig, skrupellos und einer der größten Baumeister aller Zeiten war. Er wusste, wie man was auf die Beine stellt, und hat nicht zugelassen, dass ihm irgendwer in die Quere kommt – nicht mal seine eigene Familie. Wenn du im Leben Erfolg haben willst, Herod, dann musst du seine Qualitäten haben, erst recht mit einem so dicken Gesicht.«
Ich war es leid, dass mein Vater mir immer wieder sagte, ich hätte ein dickes Gesicht. Andere Jungen in meinem Alter hatten auch Pausbacken, und inzwischen habe ich ganz sicher keine mehr. Ich lob mich ja ungern selbst, aber die meisten Leute finden mich sogar gutaussehend, und ich habe keinerlei Grund, ihnen zu misstrauen.
Doch ich schweife ab, das sähe Ric vielleicht nicht gern.
»Was ist denn mit dem zusätzlichen Buchstaben, Rod?«, höre ich ihn fragen. »Wozu das S?«
Nun, das S stand, wie sich herausstellte, für Solomon, doch sollte meine Geburtsurkunde diesen Umstand nur widerspiegeln, wenn ich meinem Bruder ähnelte, was meinem Vater zufolge zunehmend unwahrscheinlich schien.
»Ich habe Solomon wegen seines klugen Gesichts so genannt«, sagte er. »Er wirkte so weise für sein Alter, schon am Tag seiner Geburt, als hätte er im Bauch deiner Mutter die ganze Zeit nachgedacht. Einen Jungen, der gebildeter aussieht, hätte ich mir nicht wünschen können.«
Wieder musste ich daran denken, wie Solomon gestorben war, und mich über seine angebliche Weisheit wundern. Abgesehen von seinem Tod – obwohl, wenn ich’s mir recht überlege, eigentlich auch damit – hatte mein großer Bruder immer nur Glück gehabt. Ich hingegen nie. Na ja, ich hab’s überlebt.
Das Leben ging also weiter, ohne dass sich viel änderte.
In der Schule schlug ich mich ganz passabel, aber nicht gut genug für Oxford oder Cambridge, und da mein Vater es keinesfalls zuließ, dass ein Pinkney eine Allerweltsuni besuchte, arbeitete ich schließlich für ihn.
Obwohl mein Vater und ich unter demselben Dach wohnten, fuhren wir getrennt in die Firma, er mit dem Wagen, ich mit dem Rad oder dem öffentlichen Verkehr. Bei ihm war es in Ordnung, wenn er komfortabel saß, bei mir nicht. Ich musste auf Trab bleiben.
Auch sämtliche Aufgaben, die er mir bei Pinkney Industries übertrug, waren mit Bewegung verbunden. Wenn ich nicht für die Poststelle in einem vierstöckigen Gebäude ohne Lift Briefe und Pakete verteilte, arbeitete ich für eine Abteilung, die sich heute Facility-Management nennt, und wurde jedes Mal, wenn mein Vater beschloss, das Unternehmen umzustrukturieren – was häufig vorkam und wohl in erster Linie dazu diente, mich zu beschäftigen –, damit beauftragt, Büromöbel umzuräumen.
Eine Zeit lang dachte ich, mein Vater lasse mich ganz unten im Unternehmen anfangen, damit ich alles von der Pike auf lerne, bevor er mich auf einen verantwortungsvolleren Posten hebt, doch in dieser Annahme ging ich fehl. Mein Vater wollte, dass ich für immer unten blieb.
In Anbetracht meiner Bildung deutete ich eines Abends beim Essen an, dass ich ihm vielleicht von größerem Nutzen sein könne, wenn ich etwas anderes machte als in der Poststelle oder im Facility-Management, und überraschenderweise stimmte er zu. In einem der amerikanischen Unternehmen, an denen er Anteile besitze, sei eine Stelle frei geworden, und wenn ich bereit sei, in die Vereinigten Staaten zu reisen, gehöre sie mir. Ich ergriff die Gelegenheit beim Schopf, doch im Nachhinein betrachtet hätte ich es besser wissen sollen, als sein großzügiges Angebot unbesehen anzunehmen. Die fragliche Stelle entpuppte sich als die eines einfachen Matrosen auf einem Mississippi-Schubboot, und es waren die schlimmsten sechs Monate meines Lebens.
Als ich aus Amerika zurückkehrte, hatte ich kein Gramm Fett mehr am Leib, und selbst mein Vater musste zugeben, dass mein Gesicht weniger speckig war als sonst. Und was war die Belohnung? Ich landete wieder im Facility-Management!
Wäre mein Vater nicht unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben, hätte ich wahrscheinlich bis ans Ende meines Arbeitslebens Schreibtische verrückt und Glühbirnen gewechselt. Aber er starb nun mal tatsächlich an einem Herzinfarkt und lag, als seine Sekretärin ihm den Nachmittagskaffee bringen wollte, zusammengesunken über dem Schreibtisch.
Mich rief man nicht hinzu, da in der Firma niemand wusste, dass ich sein Sohn war. Er hatte keinem von unserem Verwandtschaftsverhältnis erzählt, und auch ich durfte es nicht erwähnen, damit meine Beschäftigung nicht als Vetternwirtschaft ausgelegt wurde. Bei Pinkney Industries kannte man mich als Brian Beasley. Unterm Strich hätten die meisten Leute meine Anstellung wohl eher als Bestrafung denn als unverdienten Karrieresprung gewertet, aber wie immer tat ich wie angewiesen und schwieg.
Vom Tod meines Vaters erfuhr ich erst, als ich nach Hause kam und meine Mutter laut weinend auf dem Küchenboden vorfand. Sie lag zusammengekrümmt da, und es dauerte eine Weile, sie aus dieser Haltung zu lösen und zum Sitzen zu bewegen, und noch länger, sie zu beruhigen. Als sie endlich mit dem Schluchzen aufhörte, schrie sie mich an.
»Dein Vater ist tot, Herod, und das ist deine Schuld! Er ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern aus Enttäuschung – Enttäuschung über dich!«
Die neue Familiendynamik fing nicht vielversprechend an.
Es fällt mir schwer zu erklären, wie ich mich fühlte, als mein Vater starb. Kein geliebter Mensch war von mir gegangen, und doch hatte eine vertraute Umgebung sich verändert, als wäre ein Gebäude, an dem ich mein Leben lang tagtäglich vorbeigekommen war, plötzlich abgerissen worden. Es war eine Leere da, weder willkommen noch unwillkommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich weinte damals nicht, auch nicht bei der Beerdigung, die groß und unnötig pompös war, und als ich meine Mutter bei der Trauerfeier trösten wollte, stieß sie meinen Arm beiseite. An dem Tag konnte ich ihr nichts recht machen: Alles, was ich tat oder sagte, war falsch. Auch in den Wochen darauf wurde es zwischen uns nicht besser. Sie verbarrikadierte sich in ihrem Zimmer, weigerte sich, mit mir zu reden, und kam nur zum Vorschein, um sich mit dem Anwalt meines Vaters oder dem Finanzleiter der Firma zu treffen.
Eines Abends klopfte ich an ihre Schlafzimmertür, und als sie nicht reagierte, trat ich zögernd ein. Meine Mutter starrte vor sich hin und nahm keine Notiz von mir.
»Mutter, ich mache mir Sorgen um dich«, sagte ich. »Ich will dir beistehen, aber du lässt mich nicht. Wie kann ich dir helfen?«
Sie starrte weiter in die Luft und antwortete mit kalter, monotoner Stimme, ich könne ihr am besten helfen, wenn ich das Haus verlasse und zu Tante Thelma ziehe.
»Und komm ja nicht auf die Idee, den Wagen zu nehmen«, fügte sie überflüssigerweise hinzu.
Ich wusste nicht mal, wie man fährt.
So zog ich also zu meiner Tante. Tante Thelma war die Schwester meiner Mutter und wohnte in Vauxhall, nicht weit von der Firma. Ihr Mann Horace, Leiter einer Barclays-Filiale, öffnete mir die Tür und fragte als Erstes, was ich denn mit dem Koffer wolle. Noch bevor ich antworten konnte, rief er die Frage auch seiner Frau zu. Wie sich herausstellte, hatte meine Mutter es versäumt, ihnen Bescheid zu geben.
Über meine Zeit bei Thelma und Horace kann ich allenfalls sagen, dass sie mich höflich behandelten, es aber jeden Morgen eine Erleichterung war, aus dem Haus zu gehen und zur Arbeit zu radeln, wo ich weiterhin dem Facility-Management unterstand. Ich rechnete täglich damit, zwecks neuer Aufgabenzuweisung in die Vorstandsetage zitiert zu werden, doch drei Wochen zogen ins Land, und es geschah noch immer nichts.
Am Tag vor meinem Geburtstag richtete Tante Thelma mir dann einen Anruf meiner Mutter aus: Ich solle morgen Abend nach Hause kommen und zur Feier des Tages mit ihr essen. Ich war gerührt, dass meine Mutter in einer für sie so traurigen Zeit an meinen Geburtstag gedacht hatte, und betrachtete es als gutes Zeichen: ein Neuanfang zwischen uns, und vielleicht gab es auch Neuigkeiten zu meiner Zukunft bei Pinkney Industries.
Tags darauf fuhr ich nach der Arbeit kurz zu Tante Thelma, um mich schnell in meinen besten Anzug zu werfen, und winkte dann ein Taxi herbei, schließlich hatte ich Geburtstag. Bei meiner Mutter klopfte ich aus Respekt erst an die Haustür, bevor ich aufschloss. Laute Musik schallte mir entgegen, doch die Platte hatte einen Sprung, sodass schwer zu hören war, was spielte. Ich rief den Namen meiner Mutter (sie hieß Mutter, so wie mein Vater immer Vater geheißen hatte) und hob die Nadel von der sich auf dem Teller drehenden Vinylscheibe. Es war eine Aufnahme von We’ll Meet Again, gesungen von Vera Lynn, eine der Lieblingsplatten meines Vaters.
In den Zimmern unten im Haus regte sich nichts. Der Esstisch war ungedeckt, und nichts deutete darauf hin, dass in der Küche Essen zubereitet worden war. Kurzum, keine Spur vom versprochenen Festmahl.
Ich wollte schon die Treppe hinauf, da sah ich, dass die Flügeltür zur Terrasse weit offen stand. Es war Hochsommer und ein lauer Abend, und mir kam der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht einen Tisch im Garten hergerichtet hatte und ich sie dort fände. Damit lag ich halb richtig und halb falsch. Auf dem Gartentisch stand zwar kein Essen, aber meine Mutter fand ich. Ihr lebloser Körper baumelte am Ast einer großen Eiche.
Der Tod meiner Mutter, für mich eindeutig Selbstmord, galt erst als Suizid, nachdem die Putzfrau in der darauffolgenden Woche einen Abschiedsbrief unter ihrem Kopfkissen gefunden hatte. Bis dahin ging die Polizei davon aus, dass ich sie am Baum erhängt hatte, und sei es auch nur, um ihr heimzuzahlen, dass sie mir kein Geburtstagsessen gekocht hatte.
Später erfuhr ich, dass ich mir das Misstrauen der Ermittler zugezogen hatte, weil sie mich mit einem Käse-Schinken-Sandwich in der Hand auf einem Sessel angetroffen hatten, scheinbar ungerührt vom Tod meiner Mutter. Meine Erklärung, mir sei flau gewesen, weil ich seit dem Morgen nichts zu mir genommen hätte, ließ sie kalt.
»Wie kann man bei so was bloß ans Essen denken?«, bemerkte ein Polizist so laut, dass ich es hören konnte.
Sie bohrten nach und kamen zu dem Schluss, dass ich ein dünnhäutiger junger Mann sei – ein Sohn voller Groll auf seine Eltern, die ihm verwehrt hatten, was ihm zustand. Mein Vater, konstatierten sie, hatte mich in seiner Firma mit einem niederen Posten abgespeist und mich darauf schmoren lassen, während meine Mutter, die mir eine Mitschuld am Tod ihres Mannes gab, mich des Hauses verwiesen und zu einer Tante abgeschoben hatte, die von mir, wie durchklang, nicht gerade angetan war. Durch den Tod meiner Mutter hätte ich ausschließlich Vorteile, behaupteten sie, und nicht meine Mutter, sondern ich selbst hätte We’ll Meet Again aufgelegt, um die Aufmerksamkeit von mir auf ihre fragile seelische Verfassung zu lenken.
Wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß, sollte man Ehrlichkeit unter solchen Umständen tunlichst vermeiden. Auf die Frage, ob ich meine Eltern geliebt hätte, erwiderte ich ausweichend, ich hätte nicht den Eindruck gehabt, dass sie mich liebten, doch auf hartnäckige Nachfrage musste ich einräumen, dass ich es wahrscheinlich nicht getan hatte. Deshalb sei ich aber noch lange kein Mörder, fügte ich hinzu.
»Darüber entscheiden wir«, entgegnete der leitende Ermittlungsbeamte, und erst der aufgetauchte Abschiedsbrief überzeugte sie von meiner Unschuld.
Der Brief war mit grüner Tinte von Hand geschrieben und an mich gerichtet. Zuerst ging es um Solomon und darum, was für ein wunderbarer Sohn er gewesen war, und dann zählte meine Mutter die vielen Enttäuschungen auf, die ich ihr und meinem Vater bereitet hatte. Besonders blamabel fand sie, dass ich trotz des ganzen Geldes, das sie in meine Bildung gesteckt hatten, noch immer nicht richtig schreiben konnte.
Anschließend kam sie zum zentralen Punkt ihrer Pein: dem Tod meines Vaters. Er sei die Liebe ihres Lebens gewesen, der Grund ihres Seins, und ohne ihn habe das Leben keinen Sinn. Sie bedauerte, nach seinem Tod nicht bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden zu sein – wie es in einigen Gegenden Indiens (wo mein Vater ebenfalls Anteile besaß) üblich sei –, solch ein kurzzeitiger Todeskampf sei nichts im Vergleich zu den Qualen, die sie nun leide. Sie habe abgeschlossen mit dieser Welt, mit mir, mit Pinkney Industries und sich aufgemacht, George zu finden, ihren lieben dahingeschiedenen Ehemann, der, so glaubte sie, in der kurzen Zeit seit seinem Tod nicht allzu weit geschweift sein könne.
Der Selbstmord meiner Mutter war an sich nicht verwerflich, dass sie sich dafür meinen Geburtstag ausgesucht hatte, damit ich sie finde, allerdings schon.
Wenn meine Eltern mir zu Lebzeiten Zuwendung geschenkt hätten und ich zwischen ihrer Liebe und ihrem Geld hätte wählen müssen, hätte ich mich mit Freuden für ihre Liebe entschieden. So nahm ich, als sie nicht mehr da waren, ihr Geld. Über Nacht wurde ich ein reicher Mann.
Na ja, ich sage über Nacht, aber ganz so einfach war es nicht. Zum einen musste eine Menge Papierkram erledigt werden, zum anderen musste mein Onkel Horace das Testament meiner Mutter anfechten, da sie ihren gesamten Besitz meinem verstorbenen Bruder Solomon vermacht hatte.
Warum sie ihr Testament nie à jour gebracht hatte, blieb allen ein Rätsel, für mich aber war es ein Glücksfall, denn sie hätte ihr Vermögen wohl lieber einem Tierheim hinterlassen als mir. So gingen das Haus, ihre geerbten Ersparnisse und Pinkney Industries in meine Hände über, und als ich das nächste Mal ins Büro meines Vaters kam, wurde ich gefeiert wie ein König:
»Hallo, Brian. Was suchst du denn hier?«
Sowohl mir als auch den übrigen Vorstandsmitgliedern wurde schnell klar, dass ich überfordert und die Zukunft des Unternehmens unter meiner Federführung alles andere als sicher war. Ich will mich ja nicht selber loben, aber ich glaube, ich hab’s als Erster gemerkt.
Nachdem ich einen Monat lang durchgehalten hatte, bat ich den Finanzleiter in mein Büro. Er hieß Robert Green und war so freundlich gewesen, mich in der kurzen Zeit, die ich dabei war, unter seine Fittiche zu nehmen. Er war es auch, der mich darauf brachte, dass ich Legastheniker bin, jedenfalls fiel ihm keine andere Erklärung für meine sonderbaren Memos ein.
Wir setzten uns, und die Sekretärin brachte Kaffee. Gerade wollte er in seinen Keks beißen, da stellte ich ihm die Frage, über die ich mir schon seit meinem ersten Tag in der Firma den Kopf zerbrach.
»Was macht Pinkney Industries eigentlich, Robert? Was stellen wir her?«
Tatsache war, wir stellten überhaupt nichts her, und seiner Meinung nach war der Firmenname von jeher irreführend. Das Unternehmen besitze Immobilien, sagte er, tätige Investitionen, kaufe und verkaufe immaterielle Güter und halte ebenso viele Anteile in Übersee wie im Vereinigten Königreich.
»Ohne herablassend klingen zu wollen, Herod, es ist ein wenig kompliziert.«
In der Beziehung konnte man mir nichts vormachen.
Nach weiterer Besprechung kamen wir überein, dass es das Beste sei – sowohl für mich als auch für alle, deren Lebensunterhalt von Pinkney Industries abhing –, wenn ich als CEO zurückträte und das Unternehmen in handliche Portionen unterteilt und liquidiert würde. Mir lag daran, dass dadurch keiner der Beschäftigten seine Arbeit verlor, vor allem in der Poststelle und im Facility-Management. Das konnte Robert zwar nicht garantieren, aber seiner Ansicht nach war die Wahrscheinlichkeit für Stellenverluste größer, wenn ich die Firma weiterführte.
Schließlich reichten wir uns die so ungleich fähigen Hände, und das war leider der Anfang vom Ende von Pinkney Industries. Dass sich mein Vater und damit automatisch auch meine Mutter in dem Augenblick vielleicht im Grabe umdrehten, war mir herzlich egal.
Und dann kam der Tag, an dem Robert mich ins Büro lud und mir einen Scheck über elf Millionen Pfund überreichte.
»Die ganze Welt steht Ihnen offen, Herod«, sagte er. »Haben Sie vor zu reisen?«
O ja, erwiderte ich, ich würde auf ein paar Tage Bournemouth hoffen.
Als Robert mich zum Parkplatz begleitete, war er überrascht, dass auf dem für meinen Vater reservierten Platz mein Fahrrad stand.
»Ich dachte, Sie wären mit dem Wagen Ihres Vaters hergekommen«, sagte er.
Es gebe da ein paar Probleme mit meiner Führerscheinprüfung, erklärte ich, genau genommen sei ich schon zwei Mal durchgefallen – ein Mal, weil ich ein »Durchfahrt verboten«-Schild missachtet, und ein weiteres Mal, weil ich eine Schlange parkender Autos irrtümlich für einen Stau gehalten hätte. Dass ich beim ersten Mal nicht bestanden hatte, sah ich ja ein, aber beim zweiten Mal führte ich es auf die schlechte Laune des Fahrprüfers zurück. Es erschüttert mich immer noch, dass er eine geschlagene Viertelstunde keinen Ton sagte – die Hälfte der Prüfungszeit!
Robert meinte, ich solle mich nicht entmutigen lassen, und ich beherzigte seinen Rat. Ein Jahr und nur drei Versuche später hatte ich meinen Führerschein.
Elf Millionen Pfund war eine Menge Geld, viel zu viel für einen allein, darum beschloss ich, die Hälfte meines Erbes für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Ich wollte etwas im Land bewirken, irgendwas tun, womit man auf einen Schlag Armut bekämpfen und das Leben Bedürftiger verbessern, jedwede Form von Leid lindern und dafür sorgen konnte, dass alle Bürger Zugang zu guter Schulbildung und kostenloser Krankenversorgung hatten.
Einen Monat lang ließ ich mir die Sache durch den Kopf gehen, überlegte hin und her, und eines Morgens nach dem Frühstück traf ich die Entscheidung, von der ich glaubte, dass sie wohl jeder in meiner Lage getroffen hätte: Ich stellte einen Scheck über fünfeinhalb Millionen Pfund aus und schenkte ihn der Conservative Party.
Dann musste ich Entscheidungen für mein eigenes Leben treffen: Wo wollte ich wohnen, was wollte ich tun? An meinem Elternhaus hing ich nicht – dort kam ich mir vor wie ein ungebetener Gast, wie schon zu Lebzeiten meiner Eltern. Es barg keine schönen Erinnerungen, und auch wenn die Eiche inzwischen gefällt war, meinte ich noch zu spüren, wie an ihrem unsichtbaren Ast meine Mutter baumelte. Die Frage war nicht ob, sondern wann ich ausziehen würde, und sie klärte sich, als ich ein Vierteljahr später über das Haus stolperte, in dem ich nun wohne.
An dem Tag hatte ich Miss Wimpole aufgesucht, eine Legasthenietherapeutin mit Praxis im Stadtteil Battersea. Ihre Räumlichkeiten lagen nur ein paar Straßen von meinem jetzigen Wohnort, aber ein gutes Stück von der Busroute entfernt, und auf meinem Fußmarsch von der Haltestelle zu ihr kam ich an dem Schild mit der Aufschrift »Zu verkaufen« vorbei, das im Garten des Hauses stand.
Die Gegend hatte mir schon bei früheren Besuchen bei Miss Wimpole gefallen, und da sie durchblicken ließ, dass wir mindestens drei Jahre lang das Vergnügen miteinander haben würden, hielt ich es für vernünftig, in ihre Nähe zu ziehen. Ich fand schon immer, dass Bequemlichkeit viel für sich hat.
Bevor ich von meinem Haus anfange, sollte ich aber erst von meiner Therapeutin zu Ende erzählen. Bestimmt würde Ric das mal wieder so wollen.
Miss Wimpole war Anfang sechzig, sah jedoch älter aus, als würde sie von einem starken Rückenwind durchs Leben geblasen. Sie war unverheiratet, trug Strickjacken und dicke Wollröcke und hatte einen Kater namens Pedro, der nie das Zimmer verließ. Mein Hausarzt hatte sie mir empfohlen, und sie sprach mit mir, als wäre ich sechs – in dem Alter kamen die meisten Patienten wahrscheinlich zum ersten Mal zu ihr.
»So, Herzchen, warum glaubst du denn, dass du Legastheniker bist?«, fragte sie mich bei meinem ersten Termin.
Ich erwiderte, ich sei mir da eigentlich gar nicht sicher, weil es mir nie gelungen sei, das Wort im Lexikon zu finden, aber Robert vermute das, und meine Mutter habe meine Rechtschreibschwäche in ihrem Abschiedsbrief erwähnt.
»Herrje, Herzchen, das tut mir aber leid«, sagte sie mitfühlend.
Dann gab sie mir ein paar Testaufgaben und kam zu dem Schluss, dass ich tatsächlich Legastheniker war – allerdings beileibe nicht der schlimmste Fall, der ihr in ihrem Berufsleben untergekommen sei.
»Das heißt natürlich nicht, dass du dumm bist, Herzchen, falls du das denkst.«
Nein, entgegnete ich, der Gedanke sei mir bis jetzt, da sie davon spreche, eigentlich nie gekommen.
»Na, dann verscheuch ihn mal sofort wieder, Herzchen«, sagte sie, »du bist nämlich gar nicht dumm – du hast nur eine Behinderung.«
Das Wort »Behinderung« beunruhigte mich mehr als das Wort »dumm«, was Miss Wimpole nicht entging. Sie tätschelte mir das Knie und lächelte teilnahmsvoll.
»Für Selbstmitleid haben wir keine Zeit, Herzchen. Vor uns liegt wichtige Arbeit!«
In den darauffolgenden drei Jahren arbeiteten wir an meinen »phonologischen Fähigkeiten«, wie sie es nannte, und als unsere Wege sich schließlich trennten – sie setzte sich zur Ruhe und zog zu ihrer verwitweten Schwester nach Cornwall –, blieb das zugrundeliegende Problem zwar bestehen, aber der Schweregrad meiner Symptome hatte sich deutlich verringert.
Während meiner Therapie bei Miss Wimpole wurde das Haus in Battersea zu meinem Lebensinhalt. Es war ein solider Bau, das Interieur hingegen sträflich vernachlässigt, als seien die Vorbesitzer blind für seinen Verfall gewesen. Die Renovierungsarbeiten übernahm ich nicht selbst, sondern engagierte stattdessen einen Bauunternehmer. Ich bat Mr Axelrod – ein Mann in den Fünfzigern, dessen Unterarme so dick wie meine Oberschenkel waren –, das Haus geräumiger und freundlicher zu gestalten, und er übertraf all meine Erwartungen.
Die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer wurde herausgerissen und der so vergrößerte Raum durch eine breite zweiflügelige Glastür mit dem Wohnzimmer verbunden. Die gusseisernen Heizkörper wurden ausgetauscht, in den oberen Zimmern neu installiert und der Kaminabzug von Verstopfungen befreit und gefegt. Zu guter Letzt kamen die Blümchentapeten herunter, die Wände wurden vollständig frisch verputzt und einfarbig gestrichen.
Ein Jahr verging, bis das Haus komplett umgestaltet war, und währenddessen bewohnte ich immer nur ein einziges Zimmer, mal auf einer Etage, mal auf einer anderen, je nachdem, wo die Handwerker gerade beschäftigt waren.
Übrigens ist es kein Zuckerschlecken, in einem Haus zu wohnen, das modernisiert wird, und es war bestimmt nicht so vorgesehen. Mein Elternhaus hatte sich jedoch schneller verkauft als erwartet, und um dem Zeitplan des neuen Eigentümers nicht im Weg zu stehen, musste ich das Grundstück räumen und mich dem Zeitplan meines Bauunternehmers beugen.
Es verblüfft vielleicht, dass ein vermögender Mann wie ich, dessen Reichtum sich durch den Verkauf eines beträchtlichen Anwesens kürzlich noch gemehrt hatte, lieber auf einer Baustelle hauste, als zum Beispiel ins Ritz zu ziehen. Es verblüffte auch Mr Axelrod, der mich eines Tages fragte, ob ich mich vor irgendwem versteckte.
Die Auflösung ist aber ganz simpel: Ich konnte mich nicht an die Vorstellung gewöhnen, reich zu sein.
Geld hatte ich noch nie gehabt, und das kleine Gehalt von Pinkney Industries hatte gerade mal für Kost und Logis bei meiner Mutter und später bei Tante Thelma gereicht. Ich hatte gelernt, den Penny zu ehren und über die Runden zu kommen, und gemerkt, dass es meinen Kollegen in der Poststelle und im Facility-Management genauso erging. Da ich nicht wusste, wie man sich mit Geld verhält, verhielt ich mich wie jemand ohne Geld, fuhr lieber mit dem Bus als mit dem Taxi und ging in kleine Cafés statt in schicke Restaurants. Darin lag für mich auch die Attraktivität von Battersea, einem gemischten Viertel, keiner Betuchtengegend. Sein eintöniger Charakter gefiel mir, und ich fand, dass ich gut hierherpassen würde.
Die Handwerker hinterließen mir ein blitzblankes Gehäuse, das nun noch eingerichtet werden musste. Wie schon die Renovierungsarbeiten legte ich auch die Innenausstattung vertrauensvoll in fremde Hände.
Trudy Barnes war die Ehefrau eines der Stukkateure, und ich sah keinen Grund, an der Empfehlung eines Mannes zu zweifeln, der meine Wände so wunderbar verputzt hatte. Sie war ein zierliches Persönchen, kaum größer als ein Meter fünfzig, aber sie jagte mir eine Höllenangst ein. Es war ihr künstlerisches Temperament, nahm ich an, das sie so kratzbürstig machte, auch wenn ich diese Veranlagung bisher nie mit Heimtextilien in Verbindung gebracht hatte. Wie dem auch sei, sie erledigte ihre Arbeit – die von ihr ausgewähl-ten Vorhänge waren zwar einen Tick zu schrill, aber erfreulicherweise hatte sie überall den gleichen Teppich verlegt.
Später erfuhr ich, nämlich vom Metzger, dass Trudy farbenblind war, und er mutmaßte, das sei in ihrem Beruf eventuell von Nachteil. Noch später allerdings hörte ich aus anderer Quelle, dass der Metzger einen Groll gegen Trudy hegte, weil sie ein Huhn reklamiert habe, das kurz vorm Verderben gewesen sei, daher solle ich seine Äußerungen lieber mit Vorsicht genießen. Es war ein schönes Gefühl, auf eine Gemeinschaft gestoßen zu sein, in der die Leute sich so füreinander interessierten.
Mit Trudys Auswahl konnte ich jedenfalls leben, und nach einiger Zeit, als auch die Möbel meiner Eltern im Haus aufgestellt waren, schrillten die Vorhänge nur noch ganz leise.
Vom Mobiliar meiner Eltern übernahm ich nur das, was mir gefiel, darunter die Sessel und Sofas, auf denen ich nie sitzen sollte. Die einzigen Andenken, die ich behielt, waren Fotografien von meinen Eltern und Solomon – eher zum Beweis, dass ich nicht im Waisenhaus aufgewachsen war, als aus Sentimentalität – sowie eine Anzahl Krawattenschals meines Vaters, die ich immer bewundert hatte. Ich trage sogar gerade einen: blau mit weißen Pünktchen und aus feinster Seide.
Als Nächstes machte ich mir Gedanken über eine Arbeit. Ich brauchte natürlich keine, aber ich hoffte, dass ich durch irgendeine Betätigung neue Leute kennenlernen und, wenn alles nach Plan lief, Freunde finden würde.
Zu den meisten meiner früheren Mitschüler pflegte ich keinen Kontakt mehr – viele hatten nach der Schule studiert und arbeiteten nun in höheren Berufen oder im Familienunternehmen –, und mein Sozialleben war, seit ich in der Firma meines Vaters angefangen hatte, bestenfalls dürftig. Da mein Gehalt ebenso bescheiden gewesen war wie das jedes anderen Mitarbeiters in der Poststelle oder im Facility-Management von Pinkney Industries, konnte ich mir den Luxus, in den gesellschaftlichen Kreisen meiner ehemaligen Freunde zu verkehren, keinesfalls leisten – etwas, das ich ganz beiläufig an einem Samstagabend mit Gerald Smithson lernte.
Gerald war ein Jahr älter als ich, hatte aber wie ich dem Schachclub der Schule angehört, und auch wenn wir nie beste Freunde gewesen waren, hatten wir gern Zeit miteinander verbracht. Ich begegnete ihm eines Tages zufällig auf der Regent Street, nachdem ich in einem Büro in einer der Nebenstraßen persönlich ein Päckchen zugestellt hatte, und es ließ sich schwer sagen, wer von uns beiden überraschter war. Er war auf dem Weg zum Lunch mit einem Kunden und schon spät dran, schlug aber vor, mich am darauffolgenden Samstagabend mit ihm und Charlie auf »ein, zwei Weinchen« zu treffen und noch jemanden mitzubringen. Ich stimmte freudig zu, und als ich wieder in der Firma war, fragte ich Trevor, ob er an dem Abend Zeit habe.
Trevor arbeitete ebenfalls in der Poststelle und war so ziemlich der Einzige bei Pinkney Industries, mit dem ich mich gut verstand. Er spielte für sein Leben gern Snooker, und in der Mittagspause begleitete ich ihn manchmal in die Snookerhalle. Ich selbst spielte nie – man musste dabei für meinen Geschmack zu viel stehen –, aber ich war gern bereit, ihm beim Bälleversenken zuzusehen, während ich im Sitzen mein Sandwich aß.
Unseligerweise hatte Trevor angenommen, dass es sich bei dem Ausgehabend zu viert um eine Snookerpartie handelte, und als er an der Kensington High Street aus der U-Bahn kam, trug er einen Queue in der Hand. Ich erwartete einen Männerabend, an dem man zusammen was trank und gemütlich plauderte – so wie damals auf dem Schubschiff –, aber da befand ich mich genauso auf dem Holzweg wie Trevor mit seiner Annahme, wir würden ein paar Kugeln stoßen.
Wie sich herausstellte, war Geralds Freund Charlie eine Frau, und Gerald hatte erwartet, dass ich ebenfalls eine Frau mitbringe und keine »Nervensäge mit Billardstock«, wie er sich später ausdrückte. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, wie der Abend laufen würde, als wir die Weinbar betraten und der Betreiber darauf bestand, dass Trevor seinen Queue im Schirmständer an der Tür ließ. Nachdem wir uns dann zu Gerald und Charlie an den Tisch gesetzt hatten, zeigte sich schnell, dass keiner von uns beiden genug Geld für mehr als zwei Getränke dabeihatte, es sei denn, wir wollten zu Fuß nach Hause gehen.
Charlie, die mit vollem Namen Charlotte hieß, war hübsch, aber distanziert, und schwieg die meiste Zeit. Trevor, der sich an ihr ein Beispiel hätte nehmen sollen, bewies keine solche Zurückhaltung, sondern sprach ausführlich über die Feinheiten des Snookerspiels, selbst nachdem Gerald ihm klipp und klar gesagt hatte, dass ihn Snooker nicht interessiere.
»Aber nur, weil du es nicht verstehst«, entgegnete Trevor und redete dann weiter.
Wegen Trevor war es schwierig, auch mal zu Wort zu kommen, und das war häufig frustrierend. Als Gerald erwähnte, er sei Aktuar, und ich bemerkte, ich wisse nicht, was das sei, erklärte Trevor, ein Aktuar sei jemand, der sein Geld mit der Herstellung von Uhren verdiene.
»Stimmt das, Gerald?«, fragte ich, von seiner Berufswahl überrascht.
Nein, sagte Gerald, und wer das denke, habe wahrscheinlich zu oft eins mit dem Queue über die Rübe bekommen. Er erstelle und analysiere Statistiken, um Versicherungsrisiken und -prämien zu berechnen, und Trevor habe das Wort wohl mit Accurist, einer Uhrenmarke, verwechselt. Dann schob er seinen Hemdärmel hoch und zeigte uns seine Armbanduhr, die sich genau als solche erwies: eine Accurist.
»Dann lag ich ja gar nicht so daneben, was?«, sagte Trevor.
Nichts klappte an dem Abend, und ich war erleichtert, als Gerald und Charlie zu dem Restaurant aufbrachen, in dem sie einen Tisch bestellt hatten.
»Wir haben eigentlich für vier reserviert«, sagte Gerald, »aber das wird wohl kein Problem sein. Ich bin einer ihrer treusten Gäste.«
Mit Gerald treffe ich mich noch ab und zu, aber Trevor habe ich aus den Augen verloren. Zwei Wochen nach unserem gemeinsamen Abend wurde er bei Pinkney Industries von niemand Geringerem als meinem Vater, der ihn schlafend unter seinem Schreibtisch gefunden hatte, entlassen. Bis heute habe ich keine Erklärung, warum Trevor sich ausgerechnet diesen Platz ausgesucht hat, außer dass der Teppich im Büro meines Vaters hochfloriger war. Manchmal, wenn im Fernsehen ein Snookerturnier ausgestrahlt wird, halte ich nach ihm Ausschau, aber bisher habe ich ihn noch nicht entdeckt.
Jedenfalls war ich nun überzeugt, dass ein Beruf mir am ehesten zu einem Sozialleben verhelfen würde, blieb nur die Frage, welcher, und da schien es mir sinnvoll, professionellen Rat einzuholen.
Aus der Zeit, in der ich zu Fuß zu Pinkney Industries und wieder zurück gegangen war, wusste ich von einer Stellenvermittlung auf der Stamford Street – im Stadtteil Lambeth, gleich südlich der Themse –, und dort ließ ich mir einen Termin bei Adrian Crusher geben, dem leitenden Personalberater.
Mr Crusher war ein korpulenter Mann Anfang fünfzig und trug einen auffälligen dunklen Nadelstreifenanzug. Er hatte dichtes schwarzes Haar und Schuppen, die er sich von Zeit zu Zeit von den Schultern wischte.
»Ja, ja, ich weiß«, sagte er, als er meinen Blick auf die weißen Flöckchen bemerkte.
Ich wurde rot und setzte zu einer Entschuldigung an, aber er unterbrach mich.
»Schon gut, Mr Pinkney. Katharina die Große litt an Schuppen, und wenn sie damit leben konnte, soll’s mich auch nicht jucken.«
Ich war beeindruckt von seinem Wortwitz und fragte ihn, ob er Schriftsteller sei. War er nicht.
Mr Crusher las die handgeschriebenen Notizen, die ich ihm reichte, und kratzte sich dann am Kopf, was erneutes Geriesel auslöste.
»Das ist so ziemlich der seltsamste Lebenslauf, den ich je gelesen habe«, sagte er, was zugegebenermaßen eine treffende Beschreibung war.
Abgesehen von meiner Zeit als Matrose auf dem Mississippi hatte ich nur in einer Poststelle und im Facility-Management gearbeitet, und keine dieser Tätigkeiten hatte mich augenscheinlich auf die Aufgaben eines Vorstandsvorsitzenden vorbereitet.
Ich erklärte Mr Crusher, so gut es ging, die Firmen- und Familienverhältnisse und fügte hinzu, dass ich einen Neuanfang suche und auf seine Orientierungshilfe zähle. Er stellte mir daraufhin viele Fragen über mich selbst, meine Vorlieben und Abneigungen und meine Erwartungen ans Leben. Ich war es nicht gewohnt, befragt zu werden, darum fand ich das Gespräch schrecklich anstrengend und überaus passend, dass der Mann, der mich so ausquetschte, Crusher hieß. Nach etwa einer halben Stunde legte er seinen Stift aus der Hand, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte die Hände im Nacken.
»Gut, Mr Pinkney, mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe – wenn nicht, korrigieren Sie mich bitte. Erstens: Sie sind Privatier und verfügen über eine große Anzahl Krawattenschals. Zweitens: Sie sitzen gern, reden hingegen ungern über sich selbst. Drittens: Es geht Ihnen weniger um einen Broterwerb als um die Begegnung mit Menschen und darum, Freunde zu finden, die Sie derzeit nicht haben. Und viertens: Sie besitzen keinerlei Ehrgeiz und sind nicht an Geld interessiert, weil Sie davon schon genug haben.«
Ich nickte jeden Punkt ab.
»Anders und kurzum, Mr Pinkney, wenn Sie die richtige Sorte Mensch einfach im Bus treffen könnten, wären Sie glücklich und froh, den ganzen Tag durch die Gegend zu gondeln.«
Mr Crusher war ein Ass – er hatte mich bis aufs i-Tüpfelchen getroffen, wie ich ihm sagte.
»Also schön, dann habe ich vielleicht genau die richtige Stelle für Sie.«
Sprach’s und zog aus einer der unteren Schreibtischschubladen eine Akte.
18. Juni 2019
Ich wollte gerade zum Lansdowne, um Ric eine Kopie meines ersten Kapitels zu geben, da hörte ich, wie Lydia Walker meinen Namen rief. Lydia ist meine nächste Nachbarin und ihr Mann Donald neben Edmundo mein bester Freund. Sie ist eine stattliche Frau, eher stabil als dick, und sieht aus wie eine Kugelstoßerin. (Donald hat mir erzählt, sie hätte in ihrer Jugend auf dem Bau gearbeitet, aber das war wohl ein Scherz. Manchmal lässt sich das bei Donald schwer sagen.)
Lydia hat eine schrille Stimme, die Aufmerksamkeit verlangt, und als ich sie hörte, stieg ich auf die Bremse.
»Hast du Donald gesehen, Rod? Er geht nicht ans Handy.«
Es tue mir leid, nein, sagte ich, aber vielleicht mache er grad Straßenmusik mit Edmundo. (Donald spielt Posaune und Edmundo Panflöte.) Aus Erfahrung weiß ich, dass man jede Antwort an Lydia am besten mit einer Entschuldigung anfängt, denn sie ist im günstigsten Fall schwierig und bei jedem bisschen beleidigt. Man muss sie mit Samthandschuhen anfassen – wie ein Experte in einer Antiquitätensendung eine alte Glasscherbe inspiziert.
Lydia quittierte meine Antwort mit dem Schließen ihrer Haustür, und erst dann, als ich wusste, dass meine Entschuldigung angenommen war, traute ich mich, meine Fahrt fortzusetzen.
Ich freute mich auf Ric und war gespannt, wie er darauf reagieren würde, dass ich meinen Entwurf »Fortsetzung 1« statt »Kapitel 1« genannt hatte. Seine Bemerkung über auffällige Namen war mir im Gedächtnis geblieben, und ich hoffte, dass meine Wortwahl in einer Welt von Büchern, die in Kapitel unterteilt waren, hervorstechen würde.
Es erscheint vielleicht merkwürdig, dass Ric in einem Pub arbeitet statt in einer herkömmlichen Literaturagentur, aber das kümmert mich nicht. Er war davor für Agenturen tätig und verfügt noch über die nötigen Kontakte. Heute schämt er sich für seine berufliche Vergangenheit, und Gläser einzusammeln behagt ihm mehr.
»Das ist eine Welt voller Egos, Rod, voll geschniegelter Ganoven und so falsch wie ein Zwei-Dollar-Schein. Agenten und Verleger sind an echter Literatur gar nicht interessiert, nur daran, was sich verkauft und wie viel Geld dabei für sie rausspringt. Wenn sich irgendein Mist verkauft, dann verlegen sie ihn. So einfach ist das. Guck dir doch bloß mal die Bestsellerlisten an. Und glaub ja nicht, ein Buch, das den Booker-Preis gewinnt, wär irgendwie besser – das heißt nur, dass es langweiliger Mist ist!«
Es gefiel mir, dass Ric Prinzipien besaß und dass er der Verlagsbranche aus Liebe zur Literatur den Rücken gekehrt hatte, um seinen eigenen Acker zu bestellen, der sich, wie er mir bei unserem Kennenlernen gestand, als so fruchtbar erwies wie ein »Scheißziegelstein«. Es war offenherzig von ihm, mir das zu erzählen – ein Charakterzug, den ich an einem Menschen schätze –, aber er war wegen seiner Lage nicht übermäßig besorgt: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis man das richtige Saatgut fand. Er war zuversichtlich, dass ihm mit meiner Geschichte, die er als »eine Suche nach Liebe in einer ungewissen Zeit« beschrieb, der Durchbruch gelingen würde: der erste Bestseller, der kein Mist wäre!
Ich hoffe, dass er recht hat und meine Geschichte ein Happy End.