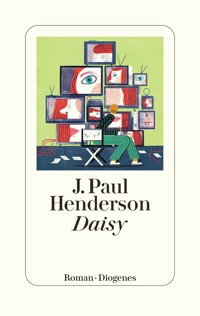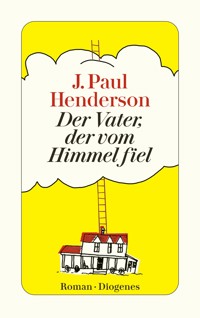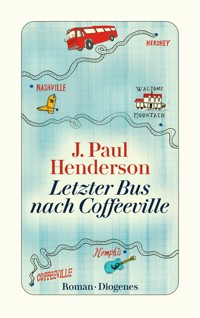
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei in jeder Hinsicht ziemlich älteste Freunde reisen in einem klapprigen Tourbus der Beatles quer durch die USA bis nach Mississippi. Mit an Bord: Alzheimer, die grausame Krankheit des Vergessens. Nach und nach steigen noch andere Passagiere mit kunterbunten Lebensläufen zu, die verrückt genug sind, um es mit so einem heimtückischen Mitreisenden aufzunehmen. Ein Buch, bei dem man ebenso oft Tränen weint wie Tränen lacht und das man dabeihaben will, wenn’s im eigenen Leben mal nichts mehr zu lachen gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
J. Paul Henderson
Letzter Bus nach Coffeeville
Roman
Aus dem Englischen von Jenny Merling
Diogenes
Im Gedenken an Amanda und Stanley
{7}Prolog
»Es ist so weit, Gene.« Die Stimme klang älter und tiefer, als er sie in Erinnerung hatte, aber es bestand kein Zweifel daran, wem sie gehörte. Im selben Moment wurde ihm auch klar, was sie meinte.
»Bin sofort da, Nancy.«
Erst nachdem er aufgelegt hatte, fiel ihm ein, dass er gar nicht wusste, wo Nancy überhaupt war.
Man kann viel ausdrücken mit neun Wörtern, aber eben nicht alles.
{9}TEIL IEntwurzelung
{11}Gene und Nancy
Docs Geburtstag
Eugene Chaney, oder Doc, wie ihn die meisten nannten, saß auf der Veranda hinter seinem Haus, trank Kaffee und fragte sich, ob die Vögel heute irgendwie falsch zwitscherten.
»Haltet endlich die verdammten Schnäbel!«, rief er.
Tatsächlich sangen die Vögel heute so wie immer, nicht schöner und nicht schiefer. Sie betrachteten Doc, der sich wieder hinsetzte.
Seine Launen waren für sie nichts Neues, trotzdem kam er ihnen heute anders vor als sonst. Er war es auch, denn heute war sein zweiundsiebzigster Geburtstag.
Heute war es sieben Jahre her, dass Eugene Chaney III. seine Praxis aufgegeben und nahtlos zu einem Lebensabschnitt übergegangen war, den seine Nachbarn als misanthropisch bezeichneten. Doc hätte sich gegen diesen Begriff verwahrt. Er ging ungern unter Menschen, das stimmte, aber war er deshalb gleich ein Menschenfeind?
Am Tag seines Rentenantritts hatte er alle seine Anzüge samt den Krawatten und Fliegen, die ihn sein Berufsleben hindurch begleitet hatten, in den Müll geworfen und sie durch karierte Hemden und Cordhosen ersetzt. Das weiße {12}Haar trug er lang und zurückgekämmt wie Grandpa Walton aus der Fernsehserie. Außerdem ließ er sich einen dichten Schnurrbart stehen wie Frank Zappa, und er fing wieder mit dem Rauchen an.
Sein Alltag hatte die alte Struktur verloren. Morgens stand Doc auf, ging hinunter ins Wohnzimmer und machte den Fernseher an. Meistens verbrachte er seine Zeit mit Lesen. Manchmal ging er auch spazieren oder fuhr mit dem Auto irgendwohin. Er versuchte die Zeit totzuschlagen. Jeden Abend trank er zwei Gläser Rotwein, und nachts schlief er unruhig und hatte düstere Träume. Er war ständig müde.
Nur der Jahrestag seiner Geburt bildete eine Ausnahme. Dies war der einzige Tag im Jahr, an dem er sich erlaubte, die Ereignisse seines Lebens Revue passieren zu lassen und über die Tatsache nachzudenken, dass er seinem Ende entgegenging. Dieses Nachdenken war ein ebenso gefährliches wie notwendiges Ventil.
Gene fragte sich, wie ein Mensch zweiundsiebzig Jahre auf diesem Planeten verbringen und dann doch nur zehn Meilen entfernt von seinem Geburtsort wohnen konnte. Er dachte darüber nach, dass er sein Leben damit verbracht hatte, anderen beizustehen, sich selbst jedoch nicht hatte helfen können, und er versuchte zu ergründen, wieso er die Einsamkeit mittlerweile der Gesellschaft anderer Menschen vorzog. Vor allem jedoch kreisten seine Gedanken darum, wie schnell das Leben vorbei sein konnte, dass niemand seinen Sinn kannte und wie schmerzhaft es war, jemanden zu verlieren.
{13}Arzt war nicht Eugene Chaneys Traumberuf gewesen, ihm war einfach nichts Besseres eingefallen.
In Docs Familie gab es viele Ärzte. Sein Urgroßvater Robert Chaney hatte zwar über keinerlei medizinische Ausbildung verfügt, es jedoch mit dem Verkauf von Quacksalbermittelchen zu einer gewissen Bekanntheit und nebenbei auch noch zu einem kleinen Vermögen gebracht, das Docs Großvater Eugene Chaney wie auch seinem Vater Eugene jr. ein regelgerechtes Studium und später die Niederlassung als Allgemeinmediziner ermöglichte.
In der Kleinstadt, in der die Familie lebte, war der Name Eugene Chaney schließlich untrennbar mit dem Beruf des Arztes verbunden, und so wurde auch von Eugene Chaney III. erwartet, den mittlerweile etwas ausgetretenen Familienpfad zu beschreiten. Und Doc enttäuschte die Erwartungen nicht. Zwar brannte er nicht gerade darauf, anderen zu helfen, war aber auch nicht abgeneigt, den Lebensstandard, an den er von Haus aus gewöhnt war, beizubehalten. Nicht zuletzt gefiel ihm auch der soziale Status, der mit dem Doktortitel einherging.
So schrieb er sich denn aus Phantasielosigkeit, und weil er von jeher einen Sinn für wissenschaftliche Zusammenhänge hatte, zum Wintersemester 1960 an der Duke University ein. In einem nagelneuen Auto, einem Geschenk seiner Eltern, fuhr er nach North Carolina. Das Leben war schön und konnte eigentlich nur noch schöner werden. Genau das tat es auch eine Weile lang, doch dann plötzlich nicht mehr. Das Leben spielte eben, wie das Leben manchmal so spielt.
{14}Wie sich herausstellen sollte, hatte Eugene Chaney zum Zeitpunkt seines Studienabschlusses bereits jeglichen Ehrgeiz in puncto Geld und Status verloren. Im Gegenzug hatte er beizeiten das fast zwanghafte Bedürfnis entwickelt, sich so oft wie möglich die Hände zu waschen, und nach der traumatischen Sezierung des Kadavers, den man ihm im zweiten Studienjahr zugeteilt hatte, einen Ekel vor Rindfleisch.
Viel schlimmer für einen Mann, der die nächsten vier Jahrzehnte seines Lebens als Arzt verbringen wollte, war jedoch die Tatsache, dass er mit bestandenem Staatsexamen auch jegliches Interesse daran verlor, überhaupt als Arzt tätig zu sein. Zum Glück war er sich der Grenzen seiner Kompetenz bewusst und verwies, sobald er sich bei einer Diagnose nicht ganz sicher war, seine Patienten freudig und geradezu erleichtert an einen Spezialisten.
Die Patienten konsultierten ihn wegen der verschiedensten Gebrechen. Doc untersuchte dann Teile ihrer Anatomie, die er nicht unbedingt wiedersehen wollte, und musste Tag für Tag mit ansehen, wie ursprünglich gesunde Körper von Krankheit und Alter zerstört wurden. Die Macht und die Verantwortung, die sein Beruf mit sich brachten, wurden ihm manchmal zu viel. Er sollte Menschen das Leben erleichtern, allzu oft musste er jedoch stattdessen Erwartungen dämpfen, Patienten eröffnen, dass ihr Leiden chronisch war, und manchmal sogar die schlimmste aller Nachrichten überbringen.
Im Gegensatz zu seinen Patienten war sich Doc im Klaren darüber, dass die Medizin keine exakte Wissenschaft war, und verglich sich insgeheim mit einem {15}Automechaniker in einer Kleinstadt, der geheimnisvolle elektrische Probleme in einem teuren europäischen Importwagen aufspüren soll. Ehrlich gesagt, war er fast überraschter als die Betroffenen selbst, wenn diese wieder gesund wurden. Die einzige Erfüllung fand er im Entfernen von Ohrenschmalz.
Obwohl ihn in dieser Lebensphase sicher noch niemand als menschenscheu empfand, hätte ihn umgekehrt wohl auch niemand als gesellig bezeichnet. Dennoch fanden ihn seine Patienten liebenswürdig, insbesondere wegen seiner warmen, beruhigenden Stimme. Seinen Patienten verdankte er auch seinen Spitznamen, Doc.
Docs erste Vollzeitstelle führte ihn in eine kleine Stadt in Maryland, die inmitten von Apfelgärten am Fuße des Catoctin Mountain lag. Dort verliebte er sich vier Jahre nach seinem Umzug in seinem Leben zum zweiten Mal. Sie hieß Beth Gordon, war fünfundzwanzig und arbeitete unweit seiner Praxis in einem kleinen Blumenladen.
Einer seiner Kollegen im Ort hatte ihn zum Dinner eingeladen, und Doc wollte der Gastgeberin einen Blumenstrauß mitbringen. Er freute sich nicht gerade auf den vor ihm liegenden Abend. Die Männer würden medizinische Themen und Praxiserweiterungen diskutieren, während ihre Frauen Apfelkuchenrezepte austauschten und geeignete Heiratskandidatinnen für Doc, den einzigen Junggesellen in der Runde durchhechelten; den galt es unbedingt zu verkuppeln.
Als Doc den Blumenladen betrat, waren dort zwei Verkäuferinnen. Beth begrüßte ihn zuerst. »Hallo! Was kann ich für Sie tun?«
{16}»Ich möchte Blumen kaufen«, antwortete Doc.
»Dann sind Sie hier genau richtig, das hier ist ein Blumenladen.«
Doc mochte sie auf Anhieb. Er erklärte ihr, wofür er den Strauß wollte, und bat sie, ihm etwas Passendes zusammenzustellen. Während Beth Blumen farblich aufeinander abstimmte, noch ein wenig Grün dazutat, in Zellophan einwickelte und mit einer Schleife verzierte, redeten die beiden ununterbrochen miteinander. Es war nicht lediglich zielloses Geplauder, eher ein fröhliches Pingpong mit Worten. Doc war mit dem Strauß schon halb zur Tür hinaus, als er sich noch einmal umdrehte und sie fragte, ob sie nicht Lust hätte, ihn zu der Dinnerparty zu begleiten.
»Klar, warum nicht«, antwortete Beth.
»Ziehen Sie sich was Passendes an, keine Jeans! Ich hole Sie um sieben ab.«
Zwei Jahre später waren sie verheiratet.
»Du hast nicht zufällig Lust zu heiraten, oder?«, hatte Doc sie gefragt.
»Klar, warum nicht«, erwiderte Beth. »Wen denn?«
Daraufhin hatte ihr Doc den Ring an den Finger gesteckt, den er am nächsten Tag beim Juwelier gegen einen eintauschte, den Beth passender fand.
»Einverstanden?«, fragte sie.
»Einverstanden«, stimmte er zu. »Dir ist übrigens schon klar, dass ich in unserer Familie die Hosen anhaben werde, oder?«
»Aber sicher, mein Schatz, Röcke und Kleider nur an hohen Feiertagen.«
Innerhalb eines Jahres wurde Beth schwanger, und neun {17}Monate später wurde Doc Vater eines knapp dreieinhalb Kilo schweren Mädchens – Esther. Wie etwas so Kleines sie beide so glücklich machen konnte, war ihm ein Rätsel. Wenn er seine schlafende Tochter betrachtete, hatte er oft das Gefühl, das Herz könnte ihm zerspringen. So leer für Doc der Arbeitsalltag war, so sehr erfüllte ihn seine kleine Familie.
Dieses Glück sollte ihm jedoch lediglich ein Jahr beschieden sein. Kurz nach dem ersten Geburtstag seiner Tochter wurden Beth und Esther von einem riesigen Donut getötet.
Der Unfall ereignete sich an einem Herbsttag, der wie für einen Ausflug mit dem Cabrio gemacht war: Es war warm, fast windstill, die Luft war trocken. Normalerweise saß Doc am Steuer der blauen Corvette Stingray der Chaneys, aber heute war er auf Beths Bitte hin mit dem Kombi zur Arbeit gefahren – sie hatte einige Besorgungen zu machen und wollte das gute Wetter noch ein wenig genießen.
Beth klappte das Dach auf, befestigte Esthers Babyschale sicher auf dem Beifahrersitz und machte sich auf in die Stadt. Die Sonne auf ihrem Gesicht und der warme Fahrtwind in ihren neuerdings kurzen Haaren fühlten sich herrlich an. Beth war die Strecke schon tausendmal gefahren und hätte sie wahrscheinlich blind zurücklegen können. An der Kreuzung kurz vor dem Stadtzentrum hielt sie an, sah nach links, nach rechts, dann noch einmal nach links und fuhr dann an. Weder die Fahrschule noch ihre eigene Erfahrung hatten sie darauf vorbereitet, auch nach oben zu schauen, um nicht von herabfallenden Donuts überrascht zu werden. Das war ein Fehler.
{18}Der riesige Donut war aus dem Greifer eines Krans gerutscht, der ihn gerade an einem hohen Werbemast gegenüber einem Donutgeschäft anbringen sollte. Ohne Vorwarnung krachte er auf die Corvette und begrub das Auto unter sich. Beth und Esther waren sofort tot. Docs Sterben hingegen zog sich über die nächsten vierzig Jahre hin. Die Erinnerung an die beiden blieb ihm sein ganzes Leben erhalten: gleichzeitig frisch wie Gänseblümchen und trocken wie altes Laub.
Ein solcher Verlust kann weder durch Worte noch durch Schmerzensgeld gelindert werden, und Gott ist schlau genug, sich in solchen Momenten aus dem Spiel zurückzuziehen und in der Hoffnung, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, von der Seitenlinie aus zuzusehen. Alles, was Doc wichtig gewesen war, war mit einem Schlag fort. An diesem Tag starb seine Seele. An diesem Tag verlor er außerdem für immer die Lust auf Donuts.
Alles erinnerte ihn in Maryland an Beth und Esther, er war nirgends mehr vor den Erinnerungen sicher. Als sein Vater ihn anrief und ihm seinen Entschluss mitteilte, mit der Praxis aufzuhören, und ihm vorschlug, sie zu übernehmen, stimmte Doc deshalb sofort zu. Die Überreste seiner ehemaligen Familie nahm er mit: zwei Urnen, eine etwas kleiner als die andere.
Doc freute sich auf seine Eltern und darauf, künftig mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Er hatte sie zuletzt an Halloween gesehen und sie als typisches älteres Ehepaar empfunden, so wie man sie von Anzeigen von Telefongesellschaften kennt, die Söhne und Töchter dazu bringen sollen, ihre {19}Eltern wieder öfter anzurufen. Bei seiner Ankunft musste er jedoch mit Schrecken feststellen, dass sie richtig alt geworden waren.
Es musste sehr plötzlich geschehen sein, und nichts hatte ihn darauf vorbereitet.
Da beide um den Schmerz ihres Sohns wussten, hatten die Eltern die Krebserkrankung der Mutter in ihren Briefen und Telefonaten nie erwähnt. Der Krebs stellte sich als tödlich heraus, und Doc und sein Vater mussten hilflos zusehen, wie er im Körper der Mutter grausam wütete und sie langsam dahinraffte. Je weiter der körperliche Verfall der Mutter voranschritt, desto mehr verließen auch Docs Vater die Kräfte. Er verlor seinen berühmten Humor und schlurfte nur noch als Schatten seiner selbst durchs Haus. Drei Jahre nach Docs Rückkehr starb seine Mutter an ihrer Krankheit, und sechs Monate später folgte ihr Docs Vater an gebrochenem Herzen. Nun lagen beide Eltern Seite an Seite auf dem kleinen Friedhof der Episkopalkirche, in der sie geheiratet hatten und in der Eugene getauft worden war.
In etwas weniger als acht Jahren seines jungen Lebens erlitt Doc Verluste, die sich bei anderen Menschen auf ein ganzes Leben verteilen oder nie passieren. Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst zog er sich daraufhin immer mehr von der Welt zurück und verkroch sich in sich selbst, schützte sich vor weiteren Schicksalsschlägen mit einer rauhen Schale aus Abweisung. Die nächsten vierzig Jahre weinte er kein einziges Mal mehr.
{20}Die Sonne stieg höher, sein zweiundsiebzigster Geburtstag würde warm werden. Doc schob seinen Stuhl ein Stück in den Schatten, schenkte sich Kaffee nach und zündete sich eine Zigarette an. Nachdem er die einzelnen Fäden seiner Lebensjahre entwirrt hatte, teilte er sie nun in mehrere Stränge und flocht sie zu einer endlosen Aufzählung von Ratschlägen zusammen, die seiner Meinung nach jeder Vater seinen Kindern mitgeben sollte. Kinder, so seine Überzeugung, sollten von ihren Eltern auf alles vorbereitet werden, was ihnen im Leben zustoßen könnte.
Man sollte ihnen klar sagen, dass es im Leben nur selten bergauf und meist bergab ging, dass sie dabei öfter auf Schwierigkeiten treffen würden als auf schöne Dinge und dass sie sich auf Enttäuschungen einstellen müssten. Man sollte ihnen vermitteln, dass Misserfolge häufiger waren als Erfolge, dass man nur mit sehr viel Glück einen Beruf fand, der einen erfüllte, und dass man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sein gesamtes Arbeitsleben hindurch zu Tode langweilte. Sie würden mit einem gebrochenen Herzen umzugehen lernen müssen, und sie würden Beziehungen erleben, die in Flammen aufgingen oder zu Staub zerfielen. Manchmal würden sie den Grund dafür kennen, meistens jedoch nicht. Sie würden Trauer und Verlust ertragen müssen, und es würde Zeiten geben, in denen sie einfach nur vor sich hin vegetieren würden. Und nach alldem wären sie nicht etwa bessere oder auch schlechtere Menschen, sondern einfach nur andere.
Im Alter sollten sie dann Fotos von sich als Kinder mit ihrem jetzigen Aussehen vergleichen, sich dabei besonders ihre Augen ansehen, denn in den Augen eines Menschen {21}spiegelt sich seine Lebensgeschichte, nicht in Falten oder einem Doppelkinn. Sie müssten natürlich damit rechnen, dass ihre Augen sehr viel trauriger aussähen als früher, dass kein Funkeln mehr darin zu finden sei, sondern nur noch Erschöpfung und ein gehetzter Ausdruck.
Wenn man Kindern schon früh beibrachte, dass solche Katastrophen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Leben auf sie zukamen, dann würden diejenigen unter ihnen, die davon verschont blieben, ihr glückliches Leben vermutlich mehr zu schätzen wissen, wohingegen die anderen dadurch lernten, die wenigen schönen Momente in ihrem Leben noch mehr zu genießen. Davon war Doc überzeugt. Und er schärfte innerlich beiden Gruppen ein, die Menschen, mit denen sie ihre Glücksmomente teilten und die nicht selten sogar dafür verantwortlich waren, immer in dankbarer Erinnerung zu behalten.
Dann hatte ihn vor fünf Jahren völlig überraschend Nancy angerufen und eine Beziehung wiederaufleben lassen, die vor fast fünfundvierzig Jahren von einem Tag auf den anderen plötzlich zu Ende gewesen war.
Doc ging davon aus, dass sie auch diesmal nicht lange halten, sondern bald wieder von Nancy beendet würde.
Nicht gerade gutbürgerlich
Als die Uhren am Silvesterabend 1959 zwölf schlugen, ahnte sicher kaum jemand, dass dem Land eine Ära des Umbruchs bevorstand und welche Kräfte dabei freigesetzt würden. Eisenhowers Zeit war eine selbstgerechte Zeit {22}gewesen, in der wenig hinterfragt wurde. Die Generation von Docs Eltern hatte nicht viel übrig für Selbstkritik. Sie hatte die Weltwirtschaftskrise durchgestanden und in einem Weltkrieg gekämpft, und nun führte sie ein angenehmes Leben. Sie hatte wirklich allen Grund, das Amerika ihrer Geburt nicht zu kritisieren, sondern zu feiern.
Dennoch lag Veränderung in der Luft, fuhr ihren Kindern durch die länger werdenden Haare und kratzte an ihrem Gewissen. Als Doc sich für ein Medizinstudium an der Duke University einschrieb, begann seine Generation bereits, die Werte dieser Nation in Frage zu stellen – besonders in Bezug auf das Thema Hautfarbe. Noch immer wurden Farbige in fast allen Bereichen des täglichen Lebens diskriminiert, herrschte in Geschäften, Restaurants und Hotels nach wie vor Rassentrennung. Docs Generation hatte jedoch instinktiv erkannt, dass Vorurteile gegenüber einer Rasse grundsätzlich falsch waren, ein Übel, das beseitigt werden musste.
Vor seiner Ankunft in Durham hatte Doc wenig von den Diskriminierungen bemerkt, denen Farbige tagtäglich ausgesetzt waren. Seine Heimatstadt war fast völlig weiß, deshalb hatte es dort auch keine Rassentrennung gegeben. Er hatte eine behütete Kindheit verbracht, und der Erfolg des lokalen Highschool-Footballteams oder die Suche nach einer Begleitung für den Abschlussball war immer wichtiger gewesen als irgendwelche Nachrichten aus Washington.
Das änderte sich an der Duke University. Docs neue Freunde waren Intellektuelle, Menschen, denen Kreativität und Individualität wichtig waren. Sie neigten von Natur aus eher dazu, traditionelle Werte zu hinterfragen, und {23}schon bald sah Doc die Dinge wie sie. Zwei Freunde waren insbesondere dafür verantwortlich, dass er zum Bürgerrechtler wurde. Aufgerüttelt vom Sit-in einer Gruppe schwarzer Studenten im Stehimbiss einer Woolworth-Filiale im nahegelegenen Greensboro, in dem Schwarze und Weiße noch getrennt essen mussten, traten sie der Bürgerrechtsorganisation Congress of Racial Equality bei und veranstalteten von da an gemeinsam mit einem Studenten namens Steve Barrentine regelmäßig Versammlungen und Aktionen auf dem Campus. Bei einer dieser Versammlungen lernte Doc Nancy kennen.
An jenem Abend waren etwa zwanzig junge Menschen in Steve Barrentines Wohnung versammelt. Es war das erste Treffen dieser Art, an dem Doc teilnahm. Er kannte niemanden außer den zwei Freunden, und keiner der beiden hatte erwähnt, dass es für die Neuen üblich war, von ihren eigenen Erfahrungen mit Rassendiskriminierung zu erzählen und mögliche Lösungen zur Änderung des unerträglichen Status quo vorzuschlagen. Als Doc an der Reihe war, fühlte er sich dementsprechend überrumpelt, nun völlig unvorbereitet frei vor einer Gruppe sprechen zu müssen. Er gab zunächst einmal klugerweise zu, dass er Diskriminierung nie am eigenen Leib erfahren hatte, und versuchte dann einen Witz. Es würde bestimmt mehr Farbige in seinem Freundeskreis geben, wenn mehr von ihnen eine Klimaanlage in der Wohnung hätten. »Alle Farbigen, die ich kenne, waren arm«, sagte er, »und jetzt mal ehrlich, wer will schon mit armen Freunden spielen, wenn draußen fünfunddreißig Grad sind?«
Betretenes Schweigen. Die Leute schüttelten den Kopf, {24}manche sahen zu Boden. Nur ein einziges unterdrücktes Lachen war zu hören. Es kam anscheinend von einem dünnen Mädchen, das im Schneidersitz auf dem Boden saß und eine Zigarette rauchte. Ein lautes, tiefes Lachen aus der Küche unterbrach die Stille und rettete Doc. Ein breitschultriger Schwarzer kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu.
»Keine Ahnung, wer du bist, Mann, aber du hast den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Ich hab keine Klimaanlage, und ich hab auch keine Bürgerrechte, und das eine hat auf jeden Fall ’ne ganze Menge mit dem anderen zu tun. Wenn ich und meine Leute von der Regierung so ’ne Belüftung eingebaut kriegen würden wie die Weißen, wären wir der Gleichberechtigung schon ein ganzes Stück näher!«
Da der Mann der einzige Schwarze im Raum war, begann man zu lächeln und zu nicken. »Interessanter Gedanke, Bob«, sagte Steve Barrentine. »Das sollten wir beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher diskutieren.«
Bob zog Gene beiseite.
»Danke, dass du eingeschritten bist. Ich hab mich schon wie Jesus am Kreuz gefühlt. Auf dein Wort wird hier anscheinend viel gegeben.«
»Bloß weil ich schwarz bin und die nicht. Ich könnte absolute Scheiße reden, und die würden mir trotzdem zustimmen. Das eben war aber ziemlich dumm von dir. Die verstehen hier keine Witze, Gene. Hast du Lust, mit mir was trinken zu gehen, wo man auch mal ’nen Witz machen kann?«
»Gerne«, sagte Gene (wie wir ihn während seiner Zeit an der Uni nennen werden, so wie wir Schwarze oder Afroamerikaner Farbige nennen werden, denn das hat man zu {25}der Zeit zu ihnen gesagt). »Du, Nancy?«, rief Bob dem dünnen Mädchen zu. »Wir wollen was trinken gehen. Kommst du mit?«
Nancy nickte und holte ihre Jacke. »Wir können zu mir«, sagte sie. Die drei verließen die Wohnung. Gene, der zu Fuß gekommen war, kletterte auf den Beifahrersitz von Bobs klapprigem alten Auto.
»Sitzt du zum ersten Mal bei einem Schwarzen mit im Auto?«, fragte Bob.
»Ja«, gab Gene zurück. »Und mir wurde eine große Zukunft prophezeit, also fahr vorsichtig.«
Bob lachte wieder sein kehliges Lachen.
Nancy wohnte nicht in einer Wohnung, sondern in einem Haus und lebte im Gegensatz zu den meisten anderen Studenten an der Uni allein. Sie warf ihre Jacke über eine Sessellehne und holte drei Bierflaschen aus dem Kühlschrank. Sie reichte Gene eine und stellte sich als Nancy Travis vor.
»Tolles Haus!«, sagte Gene. »Das ist mindestens so groß wie das von meinen Eltern!«
»Nancy hat eben reiche Eltern, nich’ wahr?«, zog Bob sie auf. »Ein reiches Mädchen aus Mississippi. Was würde Daddy wohl sagen, wenn er wüsste, dass ein Schwarzer auf deiner Couch sitzt, Nancy?«
»Er hätte bestimmt nichts dagegen«, sagte Nancy. Sie klang verärgert. »Bei uns gehen ständig Schwarze ein und aus.«
»Schon klar, Bedienstete, stimmt’s?«
»Das sind auch unsere Freunde, und manche von denen gehören so gut wie zur Familie. Das kann sich hier nur {26}keiner vorstellen. Hier denken immer alle, in Mississippi ist alles schlecht. Aber so einfach ist das nicht.«
»Ich will dich doch nur ein bisschen ärgern, Süße. Kein Grund, böse zu sein.«
»Bin ich doch gar nicht.«
»Ihr zwei kennt euch schon länger, was?«, unterbrach Gene. »Wie habt ihr euch denn kennengelernt?«
»Bei einer Versammlung«, antwortete Nancy. »Bobs damalige Freundin hat ihn angeschleppt, hatte dann aber selbst irgendwann keine Lust mehr. Auf ihn übrigens auch nicht, und das kann ich nur zu gut verstehen.«
Bob ging Richtung Bad. »Woher willst du eigentlich wissen, dass sie mich verlassen hat und nicht umgekehrt?«, rief er ihnen im Rausgehen zu.
»Aber ihr seid doch Freunde, oder?«, fragte Gene.
»Ja, schon«, sagte Nancy lachend. »Aber manchmal treibt er mich einfach in den Wahnsinn!«
Bob kam zurück ins Zimmer. »Ich telefonier mal kurz.«
Er wählte eine lange Nummer, grunzte ein paarmal in den Hörer, legte auf und verkündete dann, dass er jetzt gehen müsse, weil ihm etwas Wichtiges dazwischengekommen sei.
»Kommst du allein nach Hause, Gene?«
Gene sah Nancy an, in seinen Augen die Frage, ob er noch ein bisschen bleiben könnte.
»Ja, ich fahr ihn dann«, sagte sie zu Bob.
»Bist du beim nächsten Treffen auch wieder dabei?«, fragte Gene.
»Sicher nicht«, antwortete Bob und zog sich die Jacke an. »Ich hab echt Besseres zu tun, als mir von Steve Barrentine {27}was über Klimaanlagen anzuhören. Ach übrigens, Nancy, das Top steht dir überhaupt nicht, sieht aus wie ’n Badvorleger.«
Gene hatte zwar richtig bemerkt, dass es Nancy gewesen war, die zuvor bei seinem verunglückten Witz hatte lachen müssen, bei näherer Betrachtung war sie jedoch nicht annähernd so dünn, wie sie anfangs auf ihn gewirkt hatte. Sie war eher schlank als dünn, etwa einen Meter siebzig groß und sehr hübsch, mit großen grünen Augen, für teures Geld perfekt ebenmäßig geformten Zähnen und dichtem, rotblondem Haar. Außerdem hatte sie einen ebenso verführerischen wie schleifenden Südstaatenakzent. Gene war ihr sofort verfallen.
Als sie ihn vor seiner Wohnung absetzte, bat er sie um ein Date. Nach kurzem Zögern willigte sie ein.
»Ich muss dir aber noch was sagen.«
Gene schlug das Herz bis zum Hals. Bestimmt stand sie eigentlich auf Frauen oder war drogenabhängig.
Aber dann sagte Nancy nur: »Ich bin aus dem Delta. Über ein getoastetes Käsesandwich werden meine Kochkünste also leider nie hinausgehen.«
Das Delta
Nancy Travis kam aus einer reichen Familie, der große Ländereien im Mississippidelta gehörten. Am Tag ihrer Geburt waren es achtunddreißig Grad gewesen, exakt dieselbe Temperatur wie im Inneren ihrer Mutter. Das Zusammenspiel aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit hatte ihr den {28}Weg in diese Welt leicht gemacht, und das Vermögen und die soziale Stellung ihrer Eltern taten ihr Übriges dafür, dass ihr gesamter Lebensweg aller Wahrscheinlichkeit nach ein angenehmer und unkomplizierter sein würde.
Der Familie Travis gehörten knapp zweieinhalbtausend Hektar fruchtbaren Ackerlands mit einer acht Meter dicken Mutterbodenschicht im Tallahatchie County. Darauf wurde Baumwolle angebaut. Die nächste Ortschaft war Summer und die nächste größere Stadt Clarksdale. Die Familie war 1835 aus Virginia zugezogen, zwei Jahre nachdem das Land überhaupt erst für Siedler zugänglich gemacht worden war, und hatte mit Hilfe ihrer Sklaven die Wälder und Sümpfe in einen der besten Böden im ganzen Bundesstaat verwandelt. Im neunzehnten Jahrhundert überlebten sie Malaria, Gelbfieber, den Bürgerkrieg und die Überschwemmungen von 1882 bis 1884. Im zwanzigsten Jahrhundert nutzte man dankbar den technischen Fortschritt in Form von Maschinen und Pestiziden und überlebte die Überschwemmungen von 1931 und 1933.
Die Familie genoss ein schönes Leben und viele Annehmlichkeiten, die mit Reichtum einhergehen. Man veranstaltete opulente Feste, flog zu Opernaufführungen und Einkaufsorgien nach New York, verbrachte die Ferien in Europa oder der Karibik, leistete sich eine Suite im Peabody Hotel in Memphis, die stets reserviert war, und Nancys Vater Hilton Travis ging auf Safari in Afrika. Schwarze Köche bereiteten ihnen das Essen zu, schwarze Putzfrauen hielten das Haus sauber, und schwarze Gärtner kümmerten sich um die Grünanlagen.
Nancy war das jüngste von vier Kindern und ein Unfall {29}gewesen. Ihre Mutter Martha Travis hatte ihre ersten drei Kinder nacheinander mit Mitte zwanzig bekommen. Nancy hingegen wurde gezeugt, als ihre Mutter bereits vierundvierzig war. (Bob mit seinem unnachahmlichen Charme erklärte ihr später, sie könne von Glück sagen, ohne Hirnschaden auf die Welt gekommen zu sein.) Zwischen Nancy und ihrer ältesten Schwester lagen über vierzehn Jahre. Sie hatte einen Bruder und zwei Schwestern: Brandon, Daisy und Ruby. Als Nesthäkchen stand sie viele Jahre im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Brandon hatte die Landwirtschaftsschule in Starkville besucht und half mittlerweile seinem Vater dabei, die Farm zu führen. Daisy und Ruby hatten beide früh und reich geheiratet, Daisy einen Zahnarzt aus Memphis und Nancys Lieblingsschwester Ruby einen Farmer aus dem benachbarten County Leflore. Nancy war das erste Familienmitglied, das studierte.
Martha und Hilton Travis wollten für ihre jüngste Tochter nur das Beste. Ihre ersten drei Kinder waren noch in einer Zeit aufgewachsen, in der soziale und kulturelle Normen als wichtiger galten als eine akademische Ausbildung. Brandon war lediglich für den Erwerb praktischen Wissens auf die Landwirtschaftsschule gegangen. Ihnen wurde jedoch klar, dass Nancys Zukunft im Gegensatz zu der ihrer Geschwister durchaus von der Wahl des Colleges und der Ausbildung abhing, die sie dort genoss.
Schon vor dem Urteil des Supreme Court im Jahr 1954, mit dem die Rassentrennung an staatlichen Schulen abgeschafft wurde, waren die Schulen in Mississippi arm. Die Privateinrichtungen, die daraufhin vom White Citizen {30}Council eröffnet wurden, verschlechterten den Standard der staatlichen Schulen noch mehr. Deshalb schickten Martha und Travis Hilton Nancy mit zwölf Jahren auf eine private Mädchenschule in Richmond, Virginia. 1960 schrieb sie sich dann an der Duke University ein. Daher rührte Nancys Interesse an Themen wie Rassismus.
Nancy war zwar in Mississippi geboren, ihre geistige Heimat lag jedoch nicht dort. Sie liebte diesen Bundesstaat und das Delta sehr, vor allem jedoch liebte sie ihre Eltern und Geschwister. Sie spürte instinktiv, dass ihre Eltern gute Menschen waren, und konnte sich nicht erinnern, dass sie den Farbigen, die für sie arbeiteten, jemals anders als höflich und freundlich entgegengetreten wären. Als sie Bob erklärte, die Bediensteten seien wie Freunde und teilweise sogar als Teil der Familie behandelt worden, hatte sie damit nicht übertrieben.
In der Schule und an der Universität hatte es jedoch anders ausgesehen. Viele Studenten kamen aus dem Norden, aus politisch fortschrittlicheren und liberaleren Familien. Sie empfanden Mississippi als exotisch, und Nancy fühlte sich oft herausgefordert, die Zustände dort zu erklären und zu rechtfertigen, was ihr im Laufe der Zeit zunehmend schwerer fiel.
Das erste – und schlimmste – Aufeinandertreffen der Realität mit ihrer inneren Überzeugung fand kaum ein Jahr nach ihrem Umzug nach Richmond statt, als in ihrer Heimat die übel zugerichtete Leiche eines vierzehnjährigen farbigen Jungen aus dem Tallahatchie River gezogen wurde. Sein Gesicht war völlig verstümmelt, die Nase gebrochen, sein rechtes Auge fehlte, und er hatte ein Loch im Kopf. {31}Der Junge hieß Emmett Till, kam aus Chicago und war zu Besuch bei Verwandten im Nachbarcounty gewesen. Er hatte einer weißen Frau entweder hinterhergepfiffen oder sie ›Baby‹ genannt, das wusste später niemand mehr so genau.
Auf jeden Fall hatte Emmett ein geradezu engelsgleiches Wesen beleidigt, darin war man sich einig. Daraufhin wurde der aufmüpfige Nigger, der sich anscheinend nicht zu benehmen wusste, drei Tage später mitten in der Nacht aus dem Bett gezerrt und brutal getötet. Seine Mörder legten sich an diesem Abend mit vollkommen ruhigem Gewissen schlafen, genauso wie die Jury, die sie in der darauffolgenden Verhandlung freisprach.
Der Mord an Emmett Till schockierte Nancy, ihre Familie und das ganze Land. Für Nancy ließ sich das Verhalten der Verantwortlichen durch nichts rechtfertigen, auch Unwissenheit und Engstirnigkeit konnte man nicht mehr als Entschuldigung gelten lassen. Diese Tat war vollkommen untypisch für Menschen aus Mississippi, da war sie sich ganz sicher. Nach einer Weile geriet sie dann doch ins Grübeln.
Je mehr Zeit Nancy weit weg von zu Hause verbrachte, desto ferner rückten auch die romantischen Erinnerungen an ihr Kindheitsidyll. Mit diesem Abstand sah sie im Verlauf ihrer Besuche im Delta die Dinge schließlich auch immer klarer. Ihr fielen die Armut auf und der tiefe Graben zwischen dem Lebensstandard der wenigen reichen Weißen und dem der vielen armen Schwarzen. Sie sah die Hütten der Farbigen endlich als das, was sie waren: Verschläge, in denen man vielleicht Hühner hätte halten können, die {32}jedoch kaum als Behausung für Menschen in Frage kamen. Undichte Dächer, kaputte Fenster, vor die man Pappe genagelt hatte, zerrissene Fliegengitter und keinerlei sanitäre Anlagen. Ihr fielen die zerfurchten Gesichter der Farbigen auf und dass die meisten viel älter aussahen, als sie waren. Am schlimmsten traf sie jedoch die Erkenntnis, dass das Vermögen ihrer eigenen Familie auf dieser Armut gründete.
Nancys Eltern waren Patriarchen im besten Sinne, doch in dieser Bezeichnung lag eben das Problem: Die Beziehung zwischen ihnen und ihren Farbigen war nie eine von Gleich zu Gleich gewesen. In Wahrheit sahen ihre Eltern sie als unmündige Kinder an, um die sie sich zu kümmern hatten. Im Gegenzug gab es die unausgesprochene Abmachung, dass sich die Farbigen dafür ihnen gegenüber auf eine ganz bestimmte Art zu verhalten hatten: Sie beugten sich ihrem Urteil, widersprachen nicht und vergriffen sich – Gott bewahre – auch nie im Ton.
Im Kreis der Familie kritisierte ihr Vater die Lage in Mississippi, dass Farbige von einer weißen Gruppe Geschworener keine Gerechtigkeit erwarten konnten und sie über keinerlei demokratische Grundrechte verfügten, obwohl sie doch angeblich im demokratischsten aller Länder lebten. Er gab zu, dass sich einiges ändern müsse, meinte aber, dieser Wandel könne nur von innen heraus geschehen und würde langsam vonstattengehen. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass von außen Druck auf den Staat ausgeübt werde. Seiner Meinung waren Menschen umso prinzipientreuer, je weniger sie von der Situation unmittelbar betroffen waren.
{33}Von seinem Abonnement der Delta Democrat Times abgesehen, der einzigen liberalen Tageszeitung in Mississippi, machte ihr Vater jedoch nicht die geringsten Anstalten, diesen geforderten Wandel auch nur ansatzweise selbst herbeizuführen. Er war beispielsweise gegen das Urteil im Fall Emmett Till, jedoch nur im privaten Kreis. Hilton Travis konnte es sich nicht leisten, bei der weißen Bevölkerung als »Niggerfreund« verschrien zu sein. Amerika standen vielleicht die sechziger Jahre bevor, in Mississippi war man jedoch noch nicht weiter als 1890.
Nancy trat an der Duke University der Bürgerrechtsbewegung bei, mit dem Vorbehalt, an Aktionen in Mississippi grundsätzlich nicht teilzunehmen. Für sie lief eine Teilnahme an Aktionen im Mississippi auf dasselbe heraus, wie ihren Eltern die Fenster einzuwerfen, und sie wusste genau, wie sehr sie ihnen damit weh tun würde. Genau wie ihr Vater war sie ein Kind ihrer Zeit, gebunden an den Ort ihrer Kindheit, ihres Zuhauses, ihrer Familie.
Freedom Riders
Zwischen Gene und Bob entwickelte sich überraschend eine Freundschaft. Bob fuhr des Öfteren spontan mit seinem klapprigen Wagen bei Genes Studentenwohnheim vor, und wenn dieser nicht gerade zu einer Vorlesung musste oder Leichen zu sezieren hatte, gingen sie zusammen essen oder tranken wenigstens einen Kaffee. Obwohl sich die beiden über die Bürgerrechtsbewegung kennengelernt hatten, unterhielten sie sich nie darüber. Stattdessen sprachen {34}sie über Bobs Armeezeit, über seine Stationierung in Vietnam, einem Land, von dem viele Amerikaner zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gehört hatten, über Genes Leichen, über ihre Familien, ihre Zukunftspläne und über Nancy.
Obwohl Bob stets ohne Vorankündigung auftauchte, konnte Gene seine Besuche nach einer Weile gut vorhersagen. Bobs Auspuff war so alt wie der Rest seines Autos und schon von weitem zu hören. Außerdem zog er immer eine dichte Wolke blauen Qualms hinter sich her.
»Wieso kaufst du dir nicht einfach mal ein neues Auto?«, hatte Gene ihn einmal gefragt.
»Ich bin schwarz und hab keinen Job, Mann. Wenn ich jetz hier plötzlich mit ’nem El Dorado oder so was aufkreuze, denken die Bullen doch gleich, ich bin Zuhälter und hab den geklaut. Ich führ lieber ein unauffälliges Leben, weißte, bleibe lieber unter dem Radar.«
»Dir ist aber schon bewusst, dass du mit dem Lärm, den deine Karre veranstaltet, alles andere als unauffällig bist, oder? Ein paar von meinen Freunden denken schon, du verkaufst hier Drogen, und vor allem, dass ich dein bester Kunde bin!«
»Das is so was von rassistisch. Kannste mal sehen, was meinen Brüdern und mir immer gleich so unterstellt wird.« Er warf Gene einen Blick zu. »Außer du willst gerade was kaufen …?«
»Also echt jetzt, Bob! Ich hab keine Lust, von der Uni zu fliegen!«
»War ja nur ’ne Frage.« Plötzlich grinste er. »Nancy raucht Gras … und hat trotzdem super Noten. Kriegt das {35}Zeug von mir. Die hat kein Problem damit, ’nem Schwarzen was abzukaufen.«
»Nancy raucht Gras? Wusste ich gar nicht.« Gene konnte seine Überraschung nicht verbergen.
»Wie lange seid ihr jetzt zusammen, vier Monate?«
»Ja.«
»Und du hast das noch nicht mitgekriegt?«
»Nein.«
»Liegt wohl daran, dass sie’s gar nicht macht! Hast dich verarschen lassen, Medizinmännchen!«
»Mein Gott, Bob! Wieso sagst du so was? Wieso musst du Leute immer auf den Arm nehmen?«
»Das is nun mal die Bürde des schwarzen Mannes, Gene. Ich such mir das ja nich aus. Irgendwas muss man doch machen, irgendwie ein paar Wellen schlagen, sonst kommt der müde alte Mann im Ruderboot nie am Ufer an.«
»Pass bloß auf, dass du ihn dabei nicht aus dem Boot kippst«, sagte Gene. Von Nancy hatte er gelernt, dass man Bob manchmal kurz abfertigen musste. »Ich muss zur Vorlesung«, sagte er. »Wir sehen uns heute Abend beim Meeting. Gibt anscheinend was Wichtiges.«
Wie immer riss Steve Ballentine sofort die Zügel an sich. Er erklärte der kleinen versammelten Runde (die Meetings hatten immer noch nicht mehr als etwa zwanzig Teilnehmer), dass der Congress of Racial Equality (CORE) beschlossen hatte, stichprobenartig die Umsetzung der Entscheidung des Supreme Court zu überprüfen, derzufolge ab sofort jegliche Diskriminierung, unabhängig von den jeweiligen Gesetzen vor Ort, in den Busbahnhöfen des {36}Fernverkehrs verboten war. Rassentrennung in den Wartehallen, den Restaurants und den Toiletten war damit zumindest theoretisch aufgehoben.
»Aber wir wissen ja alle, wie das so ist mit der Theorie, nicht wahr?«, fragte Steve in die Runde.
»Sie ist nur theoretisch!«, warf Bob ein.
»Ganz genau!«, stimmte Steve ihm ernsthaft zu, ohne den Witz zu bemerken. »Und wenn wir nicht versuchen, sie umzusetzen, wird sie das auch bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass aus der Theorie Praxis wird. Deshalb hat CORE eine Busreise durch den Süden der USA organisiert. Anfang Mai geht es in Washington los in Richtung Mississippi, und unterwegs sammeln wir noch mehr Aktivisten ein. Wenn man uns provoziert, reagieren wir wie immer friedlich und gewaltlos.
Wir wurden gebeten, drei Freiwillige als Abgesandte dort hinzuschicken, und ich freue mich, dass wir tatsächlich drei Kandidaten haben. Bob, Nancy, Gene, steht doch mal kurz auf. Wir sind euch alle sehr dankbar.«
Die anderen applaudierten. Bob erhob sich mit einem breiten Grinsen und verbeugte sich übertrieben. Gene und Nancy sahen einander nur verwirrt an: Sie hörten gerade zum ersten Mal davon. Bob zwinkerte ihnen zu und flüsterte: »Erklär ich euch später!«
Nach dem Treffen ging Nancy schnurstracks auf Bob zu. »Ab zu mir nach Hause. Keine Widerrede.«
»Was hast du dir bloß dabei gedacht?«, fauchte sie, sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte. »Du musst uns bei so was doch erst mal fragen! Gene und ich müssen zu Vorlesungen und haben Hausarbeiten zu schreiben! Wir {37}können hier nicht einfach alles stehen- und liegenlassen. Außerdem hab ich dir doch schon gesagt, dass ich nicht nach Mississippi mitkomme.«
»Ach komm schon, Nancy. Das Semester is doch fast vorbei. Wenn’s so weit is, sind die Vorlesungen und Prüfungen doch schon längst erledigt, und wenn du noch nich fertig bist, fragste eben, ob du später abgeben kannst. Wir reden hier von zwei, drei Wochen. Das is ’ne Chance für dich, für uns alle, mal zur Abwechslung wirklich was zu erreichen, anstatt immer nur drüber zu reden. Und es wird bestimmt lustig. Wenn du willst, kannst du ja auch schon in Alabama aussteigen, musst gar nicht mit bis nach Mississippi.
Und Gene – deine Leichen sind auch noch hier, wenn du wieder da bist. Die warten auf dich, Mann. Is ja nich so, dass die nich mal kurz ohne dein Geschnippel auskommen, oder? Die freuen sich doch bestimmt über ne kleine Erholungspause!«
Die drei stießen in Richmond, Virginia, zum Rest der Gruppe. Die ersten paar Tage passierte so gut wie nichts: Sie stiegen aus dem Bus, aßen etwas in kleinen Lokalen, in denen Schwarze und Weiße immer noch getrennte Bereiche hatten, und stiegen wieder ein. Die einzige Gefahr weit und breit waren höchstens Hämorrhoiden vom langen Sitzen. In North Carolina änderte sich das jedoch. In Charlotte wollte ein Schwarzer aus der Gruppe zum Friseursalon des Busbahnhofs, doch dort weigerte man sich, ihn zu bedienen. Daraufhin weigerte er sich, den Laden zu verlassen, und wurde wegen Hausfriedensbruch verhaftet. Der Bus {38}fuhr ohne ihn weiter. In Rock Hill, South Carolina, wurden drei Mitfahrer von einer wartenden Menge angegriffen.
In Atlanta teilten sich die Freedom Riders, wie sie sich mittlerweile nannten, in zwei Gruppen und machten sich getrennt auf den Weg nach Birmingham, Alabama: die einen in einem Bus der Firma Trailways, die anderen in einem Greyhound. Bob, Gene und Nancy bestiegen den Greyhound. Bob streckte sich auf der hintersten Sitzbank aus und schlief sofort ein. Als sechs Meilen vor Anniston plötzlich ein Stein durchs Fenster flog, schlief er einfach weiter. Die Brandbombe, die folgte, weckte ihn ebenfalls nicht.
Sie stürzten aus dem Bus. Während Gene noch damit beschäftigt war, die Schläge der versammelten Ku-Klux-Klan-Mitglieder abzuwehren, ging ihm plötzlich auf, dass Bob noch im Bus lag, der mittlerweile lichterloh brannte. Er überzeugte sich, dass Nancy einen Moment ohne ihn auskam, rammte dann noch schnell ganz friedlich und gewaltlos die Faust in das nächstbeste Gesicht und kletterte zurück in den Bus. Er kämpfte sich durch Flammen und Rauch zu der Sitzbank, auf der Bob immer noch schlief. Er verpasste ihm eine Ohrfeige, schrie ihm ins Ohr, zerrte ihn hoch und ohrfeigte ihn noch einmal. Die beiden stolperten aus dem brennenden Bus und hatten sich gerade so in Sicherheit gebracht, da explodierte das Fahrzeug auch schon. Nancy brach in Tränen aus. Gene nahm sie fest in die Arme.
»Das war echt das letzte Mal, dass ich Schlaftabletten genommen habe!«, sagte Bob nur.
Auf der Weiterreise durch Alabama war die Stimmung in der Gruppe gedrückt. In Birmingham wurden sie noch {39}einmal angegriffen, und drei mussten sogar ins Krankenhaus. In Montgomery wurde es noch schlimmer, dort fand ihre Reise ihr Ende.
Der Polizeikommissar der Stadt hatte verkündet, den Freedom Riders keinerlei Hilfe zukommen zu lassen, und als sie im Union Bus Terminal von Montgomery ankamen, war der Bus blitzschnell von rund dreitausend aufgebrachten Menschen umringt. Diesmal waren auch weiße Frauen in der Menge, sie schrien die Mädchen der Gruppe an und schwangen ihre Handtaschen.
Nancy wurde getroffen, jedoch nicht verletzt, Gene und Bob trugen lediglich ein paar Kratzer und blaue Flecken davon. Einige Schwarze, die sich im Busbahnhof befunden und dem Spektakel zugesehen hatten, waren nicht so glimpflich davongekommen; manche hatten Knochenbrüche, andere wurden sogar angezündet. Am nächsten Tag marschierten vorsorglich Bundespolizei und Nationalgarde auf, mittlerweile hatte sich die Gruppe der Bürgerrechtler jedoch schon für den Abbruch der Aktion entschieden. Gene, Nancy und Bob machten sich wieder auf den Weg nach Hause. Mississippi wäre sicher noch schlimmer gewesen, das stand für sie fest.
In das Leben der drei kehrte nun wieder Normalität ein. Für ihre Freunde in der Bürgerrechtsgruppe waren sie Helden, besonders Gene wurde gelobt, nachdem Bob allen erzählt hatte, wie sein Medizinmännchen ihm in Anniston das Leben gerettet hatte. Für die nächste Zeit legten sie ihren Aktivismus jedoch erst einmal auf Eis. Bob widmete sich wieder ganz seinem Dasein als Bob, und Gene und Nancy widmeten sich einander.
{40}Androklus und die Löwin
»Die beiden sind so unglaublich nett, Gene. Ich kann’s gar nicht glauben. Bist du sicher, dass das deine Eltern sind?«
Nancy und Gene hatten über Thanksgiving ein paar Tage bei Genes Familie verbracht und waren auf dem Rückweg nach Durham.
»Wieso überrascht dich das so, dass sie nett sind? Soll das heißen, ich bin nicht nett?«
»Doch, du bist schon ganz okay.« Nancy tätschelte ihm das Knie. »Du nervst mich zumindest nicht. Aber deine Eltern gehen viel offener auf Leute zu als du, das musst du zugeben.«
»Ich bin auch offen gegenüber Leuten, ich mag nur Smalltalk nicht.«
»Schön zusammengefasst!« Nancy lachte. »Und jetzt fahr endlich schneller, sonst ist der Film vorbei, bevor wir da sind. Ich versuche hier, ein bisschen Kultur in dein Leben zu bringen, und das ist der Dank dafür …«
»Ich habe schon genug Kultur in meinem Leben, ich bin schließlich mit dir zusammen.«
»Sei bloß still! Wie oft muss ich dir denn noch erklären, dass das Leben mehr ist als deine Couch und dein Labor? Es gibt so vieles zu entdecken, so viele Erfahrungen, die man sammeln kann.«
»Und wie hilft das meinen Patienten? Wenn ich nicht weiß, was mit ihnen nicht stimmt, was soll ich denen dann sagen? ›Tut mir sehr leid, Mrs. Forrester, ich kann Ihnen leider nicht genau sagen, woran Sie leiden, aber falls es Sie tröstet – ich erzähle Ihnen gern was über den Fellini-Film, {41}den ich gestern Abend gesehen habe, oder zeige Ihnen ein paar Fotos, die ich letzten Sommer in London geschossen habe!‹«
»Fahr einfach, Gene. Dich interessiert es vielleicht nicht, was das Leben sonst noch so zu bieten hat, aber mich schon.« Sie pikte ihn mit dem Finger in die Seite. Gene zuckte zusammen.
»Nancy, bitte nicht, während ich fahre! Sonst bau ich noch einen Unfall!«
Nancy fing an zu lachen und pikte ihn noch einmal.
»Ich warne dich, mach das nicht noch mal, sonst kannst du nach Hause laufen. Ich mein’s ernst!«
»Tust du nicht. Dafür liebst du mich viel zu sehr.«
»Als ich dir das gesagt hab, war ich bestimmt betrunken.«
»Du musstest mir das gar nicht sagen, ich wusste es schon vorher. Ich kenn dich besser als du selbst. Und ich weiß ganz genau, dass es völlig ungefährlich ist, über sechzig zu fahren!«
»Du hast mir nie gesagt, dass du mich auch liebst«, grummelte Gene. »Du liebst mich doch, oder?«
»Sollte man das nicht merken, wenn einen jemand liebt?«
»Wieso sagst du es dann nicht einfach mal?«
»Darum.«
»Wie, darum?«
»Einfach so.«
Nancy lächelte, rutschte ein Stück zu ihm heran und lehnte den Kopf an seine Schulter.
»Ich weiß nicht, ob wir jemals heiraten, aber ich bin sicher, wir bleiben auf jeden Fall für immer Freunde. Du würdest alles für mich tun, oder?«
{42}»Im Moment gerade nicht.«
Nancy hob den Kopf, küsste Gene aufs Ohr und leckte sanft mit der Zunge darüber. »Sicher?«
»Nancy!«
Sie kamen rechtzeitig zum Film in Durham an und fuhren danach zu einem neueröffneten Restaurant mit rohgezimmerten Tischen und Bänken und Hausmannskost.
»Hast du Lust, mit mir über den Film zu reden, oder ist dir das peinlich?«
»Mir ist lediglich peinlich, dass ich fünf Dollar dafür bezahlt habe. Ich kann doch kein Französisch, Nancy! Wie soll ich mich mit dir über einen Film unterhalten, den ich überhaupt nicht verstanden habe?«
»Der Film hatte doch aber Untertitel. Die musst du doch mitlesen.«
»Ging nicht, ich hatte meine Brille vergessen.«
»Wieso hast du das denn nicht gesagt? Wir hätten einfach gehen können.«
»Weil er dir so gefallen hat. Und mir macht es eben nichts aus, mal zwei Stunden meines Lebens abzuschreiben, wenn es dich glücklich macht. Daran kannst du ruhig das nächste Mal denken, wenn du deine Zeit wieder mal mit mir im Auto verschwendest!«
Nancy grinste und strich ihm über die Wange. »Du Armer. Du hast es ganz schön schwer mit mir, hm? Wenn du mich so behandeln würdest wie ich dich, würde ich dich in den nächsten See schubsen.«
Der Rest des Abends verlief in ähnlicher Streitharmonie. Die Rechnung kam. Nancy zahlte. »Ich mach das«, sagte sie. »Du hast ja das Kino bezahlt.«
{43}Sie standen auf. Plötzlich schrie Nancy auf. »O Gott, Gene, schau mal!« Sie hielt ihm ihren Zeigefinger hin. »Meinst du, ich muss damit zur Notaufnahme?«
Gene betrachtete den Finger. Ein langer Splitter hatte sich ins Fleisch gebohrt, und es blutete. »Dafür brauchst du nicht zur Notaufnahme, ich kümmere mich schon darum.« Er wickelte ihr eine Serviette um den Finger und führte sie zum Auto.
»Das tut aber weh, Gene. So richtig! Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie weh das tut. Ich glaube, ich kipp gleich um.«
Gene versuchte, nicht zu lachen, und fuhr mit ihr in seine Wohnung. Dort bettete er Nancy auf die Couch und holte eine Pinzette aus einem kleinen Etui in seinem Nachttisch. Er hielt Nancys Hand fest und begann den Splitter langsam und vorsichtig herauszuziehen.
»Aua, au! Gene, du tust mir weh!«
»Halt still, ich hab ihn ja gleich. Halt einfach nur still.«
Aber Nancy rutschte hin und her. Sie zog die Hand weg, und der Splitter brach in der Pinzette ab, ein kleines Stück blieb in ihrer Haut stecken.
»Scheiße, Nancy! Jetzt muss ich es mit einer Nadel machen. Wieso kannst du nicht ein Mal tun, was man dir sagt?«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und er musste plötzlich lachen.
»Das ist überhaupt nicht lustig, Gene!«
»Tut mir leid, weiß ich ja. Aber eines Tages erinnern wir uns bestimmt hier dran und müssen beide lachen.«
»Ach ja?! Du bist manchmal echt so ein Blödmann! Außerdem ist es deine Schuld, dass ich mir den Splitter {44}überhaupt eingerissen habe, du musstest ja unbedingt in dieses blöde Restaurant.«
Nancy schmollte. Gene holte das kleine Nähset aus der Küche, das ihm seine Mutter gekauft und beim Auszug mitgegeben hatte. Bei der Gelegenheit goss er Nancy gleich noch einen großen Brandy ein.
»Verdammt noch mal, Gene, es ist 1962! Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter! Wir hätten doch zur Notaufnahme fahren sollen, die hätten das bestimmt mit örtlicher Betäubung gemacht.«
»Von denen hättest du nicht mal ein Bier gekriegt! Jetzt sei nicht so ein Angsthase, trink das endlich.«
Er riss ein Streichholz an, hielt die Nadel eine Weile in die Flamme und ließ sie wieder abkühlen. Nachdem Nancy sich ein wenig beruhigt hatte, nahm er wieder ihren Finger, ein wenig fester diesmal, und stach mit der Nadel vorsichtig in die Stelle.
»Ich hasse dich, Gene. Ganz ehrlich«, schimpfte Nancy, die Zunge bereits ein wenig schwer. »Von jetzt an bin ich nie wieder nett zu dir.«
»Meinst du, ich werde den Unterschied merken?« Gene grinste.
»Garantiert, du Idiot.«
Gene bohrte weiter an Nancys Finger herum, bis er den Splitterrest vollständig entfernt hatte. Er betupfte die Wunde mit Desinfektionsmittel und klebte am Schluss noch ein Pflaster drauf.
»Soll ich dich nach Hause fahren?«
»Nein, ich bleib lieber über Nacht hier. Falls der Finger abfällt, brauche ich doch jemanden, der ihn mir wieder {45}annäht. Aber denk ja nicht, dass ich dir schon verziehen habe, das habe ich nämlich nicht.«
Nancy machte sich nicht die Mühe, ihre Tasche auszupacken, putzte sich nur schnell mit Genes Zahnbürste die Zähne und kletterte dann in sein Bett. Gene legte sich dazu, und Nancy kuschelte sich eng an ihn.
»Tut mir leid, dass ich so eine Memme bin. Schmerz halte ich einfach nicht gut aus. Und ich hab das alles nicht ernst gemeint, was ich gesagt habe, das weißt du, oder? Es ist wirklich beeindruckend, wie du mit meinen Launen umgehst, du bist so gut darin. Jedenfalls: Danke, dass du mich vorhin gerettet hast. Du bist immer für mich da, wenn ich dich brauche. Du bist mein persönlicher Androklus.«
»Wer ist denn Androklus?«
Nancy stützte den Kopf in die Hand. »Willst du etwa sagen, du kennst die Geschichte von Androklus und dem Löwen nicht?«
»Ich hab weder von ihm noch von seinem Löwen jemals gehört.«
»O Mann, Gene! Siehst du, das hast du davon, dass du dein Leben auf der Couch verbringst.« Sie boxte ihn gegen den Arm und drehte sich auf den Rücken. »Du solltest dich was schämen. Jetzt werd ich wirklich nicht mehr nett zu dir sein.«
»Das würde ich von einer Patientin auch nie erwarten, Nancy, das widerspricht den ethischen Prinzipien eines Arztes. Dafür könnte ich von der Uni fliegen.«
»Na dann freu dich schon mal auf deinen Rausschmiss, ich muss mich nämlich nicht an ärztliche Prinzipien halten!«
{46}Es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt, und viele Millionen davon lebten in den Sechzigerjahren in den USA. Theoretisch, und wenn man ihnen genug Zeit gegeben hätte, hätten sich Gene und Nancy auch in hundert andere Leute verlieben können. Sie verliebten sich aber ineinander und waren fest davon überzeugt, im anderen die Liebe ihres Lebens, in ihrer Stadt die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen gefunden haben. Sie sprachen von einer gemeinsamen Zukunft und vom Heiraten.
Wie die meisten Paare stritten sie auch ab und zu miteinander; vielleicht etwas mehr als andere Paare. Aber das fanden sie nicht schlimm, sie hatten eher Zweifel an der Haltbarkeit einer Beziehung, in der nie gestritten wurde.
Es war jedoch vielmehr die Stille, die ab und zu zwischen ihnen entstand, wenn sie beieinander waren, die Gene verwirrte und ihm Sorgen machte. Manchmal lagen sie nebeneinander, berührten sich oder auch nicht, und plötzlich spürte er einen Graben von geradezu unfassbarer Tiefe zwischen ihnen. Nancy war dann wie in ihrer eigenen Welt, weit weg und nicht greifbar, in Gedanken versunken, die sie nie mit ihm teilte und die zu haben sie sogar abstritt.
»Ich würde zu gern wissen, was du gerade denkst«, sagte Gene dann manchmal.
»Nichts Bestimmtes, wieso?« Sie lächelte verkrampft.
»Ich liebe dich, das weißt du, oder?«
»Natürlich«, antwortete sie und rutschte ein Stück von ihm ab. Gene war sich da nicht so sicher.
Im Sommer des Jahres 1963 waren sie jedoch glücklich miteinander, und Nancy lud Gene ein, die letzte Augustwoche mit ihr bei ihrer Familie im Delta zu verbringen.
{47}Oaklands
Gene und Nancy flogen nach Memphis, wo sie am Flughafen von Nancys Schwester Ruby und einer Backofenhitze begrüßt wurden. Während Gene sich noch mit den Koffern abmühte, rannten die beiden Schwestern schon aufeinander zu und fielen sich um den Hals. Gene streckte Ruby die Hand hin, die schob sie jedoch beiseite und umarmte ihn ebenfalls. Sie freue sich, ihn endlich kennenzulernen, und tadelte Nancy, dass sie ihn der Familie nicht schon früher vorgestellt hatte.
»Sie hatte bestimmt bloß Angst, dass du dich in mich verliebst«, sagte Ruby.
Klein, rundlich, mit olivfarbenem Teint und pechschwarzen Haaren, wirkte sie auf Gene wie das pure Gegenteil von Nancy, zumal sie pausenlos redete und möglichst viel über den Freund ihrer Schwester erfahren wollte.
Auf der Fahrt Richtung Süden fragte sie ihn auch, was Nancy ihm denn so über das Delta erzählt hatte.
»Nur dass es dort ziemlich flach ist«, sagte Gene.
»Also wirklich, Nancy, schäm dich. Du hast Gene nicht erzählt, woher der Name kommt?«
»Nein. Hast du das jetzt etwa vor?«
»Aber klar doch, Schwesterlein. Also pass auf, Gene, falls dich irgendwann deine Freunde zu Hause danach fragen. Das Delta heißt so, weil es die Form von einem griechischen D hat, einem ›Delta‹. Wusstest du das?«
Gene nickte.
»Es erstreckt sich über etwa zweihundert Meilen, von Memphis im Norden bis Vicksburg im Süden, da unten {48}gibt’s übrigens noch ein großes Schlachtfeld aus dem Bürgerkrieg, und an der breitesten Stelle ist es über fünfundachtzig Meilen breit. Und wenn man von Memphis einen geraden Strich nach Vicksburg ziehen würde und dann noch eine Linie über die Stelle, wo es am breitesten ist, dann hätte man ein griechisches Δ. Toll, oder? Mom und Pop wohnen im Tallahatchie County, aber es gibt noch elf andere. Ich wohne im Leflore County, bleiben noch zehn. Nancy, zähl doch Gene mal auf, wie die anderen heißen.«
»Das interessiert ihn doch gar nicht.«
»Klar interessiert ihn das, und seine Freunde zu Hause bestimmt auch. Oder, Gene?«
Gene meinte, es würde ihn durchaus interessieren.
»Also, in alphabetischer Reihenfolge sind das Bolivar, Coahoma, Humphreys, Issaquena – mein Lieblingsname –, Quitman, Sharkey, Sunflower, Tunica, Washington und Yazoo. Und weißt du, wie groß das Delta ist? Über anderthalb Millionen Hektar! Wusstest du das, Nancy?«
»Nein«, gab Nancy zurück. »Wieso kaufst du dir eigentlich keinen Bus und wirst Reiseleiterin?«
»Gar keine schlechte Idee«, sagte Ruby fröhlich. »Ich finde es wunderschön hier. Ich würde nirgendwo anders auf der Welt leben wollen, und ich bin schon ganz schön rumgekommen, Gene. Aber ich will hier sterben und auch hier begraben werden. Dann wird die Erde noch fruchtbarer. Das kannst du gern mitschreiben: Der Mutterboden hier ist über acht Meter dick! So einen tollen Boden gibt’s in ganz Amerika kein zweites Mal!«
»Und das liegt daran, dass die gute alte Misses Sippi als letzter Bundesstaat aus dem Sumpf gekrochen ist.«
{49}»Also wirklich, Nancy, jetzt komm mir nicht mit solchen Ostküstenwitzen. Dir gefällt’s hier doch auch, tu nicht so. Los, sag sofort, dass es dir hier gefällt, sonst kannst du ab hier laufen.«
»Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen!«, rief Nancy sarkastisch.
»… und so wird dann auch ihre Antwort auf die Frage klingen, die du ihr bestimmt bald stellst, Gene!« Ruby fing an zu lachen und hörte gefühlte drei Meilen lang nicht mehr damit auf.
Nancy verdrehte die Augen, aber es war offensichtlich, dass sie jeden Moment mit ihrer Schwester genoss. »Denk nicht drüber nach, was sie gesagt hat«, flüsterte sie Gene zu. Der lächelte, fühlte sich jedoch etwas verunsichert.
»Wie geht’s Homer eigentlich?«, erkundigte sich Nancy.
»Dem geht’s bestens, Süße. Ich würde sogar sagen richtig gut. Er trägt mich auf Händen und macht mir Geschenke. Wenn er jetzt noch endlich seinen blöden Nachnamen ändern würde, wäre alles perfekt.«
»Homer heißt mit Nachnamen Comer«, erklärte Nancy Gene.
»Kaum zu glauben, oder? Homer Comer! Einmal ist er bei Rot über eine Ampel gefahren und wurde angehalten. Die Polizisten haben nach seinem Namen gefragt, und als er sagte ›Homer Comer‹, dachten die natürlich, er will sie ver-A-R-S-C-H-en. Der hätte seinen Allerwertesten fast für eine Nacht im Kittchen parken können, so sauer waren die.«
Sie verließen den Highway und fuhren nun durch das eigentliche Delta. Nancy hatte erzählt, es sei flach hier, aber Gene war nicht sicher gewesen, was er sich darunter {50}vorzustellen hatte. Das Delta war nicht einfach nur flach, es war topfeben. Unfassbar weit und unfassbar schön. Baumwollbällchen bedeckten die flachen Felder, schneeweiß im gleißenden Sonnenlicht.
Als Nancy sich nach ihrer Mom erkundigte, wurde die Unterhaltung der beiden Schwestern ernst.
»Ganz gut, würde ich sagen«, antwortete Ruby. »Genauso vergesslich wie eh und je, na ja, vielleicht etwas mehr als früher. Neulich hat sie mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Wir waren unterwegs nach Memphis, weil wir Daisy besuchen wollten. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten, und plötzlich dreht sie sich zu mir um und fragt, wer ich eigentlich bin. Ich hab gesagt: ›Ich bin’s, Ruby, deine Tochter!‹, und da sah sie so froh und erleichtert aus, dass mir fast die Tränen gekommen wären. Es macht mir wirklich Angst, Nancy. Ich hoffe nur, dass es mit ihr nicht so kommt wie mit Grandma. Daddy meint, das wird nicht passieren und dass er mit ihr schon zu den besten Ärzten geht. Er war mit ihr bei einem in Memphis und bei einem in Jackson, und jetzt hat er sich noch einen Spezialisten in New York rausgesucht.«
»Es ist einfach nicht fair«, sagte Nancy. »Sie ist doch gerade mal Anfang sechzig. Sie darf nicht so enden wie Grandma.«
Die nächste Viertelstunde sprachen sie kaum, irgendwann schwiegen sie ganz. Alle waren erleichtert, als Ruby plötzlich quiekte: »Oaklands!« Das Auto fuhr zwischen zwei Backsteinsäulen eine von hohen Bäumen gesäumte Einfahrt hinauf.
»Sind das Eichen?«, fragte Gene.
{51}»Ja«, sagte Nancy. »Die Familie Travis hatte schon immer viel Phantasie, auch wenn ihr Gedächtnis gerade im Arsch ist.«
»Nancy! Wie redest du denn!«, schimpfte Ruby. »Lass das ja Mommy und Daddy nicht hören.«
»Tut mir leid, ich meinte natürlich A-R-S-C-H.«
Gene hatte solche Häuser schon in einer Zeitschrift gesehen, aber nie erwartet, einmal selbst eins zu betreten. Das Walmdach ruhte auf sechs riesigen dorischen Säulen. Die Fassade des zweistöckigen Gebäudes war streng symmetrisch. Im oberen Stockwerk verlief ein Balkon um das gesamte Haus herum und um das Erdgeschoss direkt darunter eine Veranda.
»Wow, so was sieht man nicht alle Tage«, stellte Gene fest. »Wie alt ist das Haus denn?«
»Es wurde ursprünglich 1853 gebaut«, sagte Ruby, die fröhlich wieder in ihre Rolle als Reiseleiterin zurückfand. »1952 hat hier der Blitz eingeschlagen, dabei ist es abgebrannt. Granddaddy hat es dann wiederaufgebaut, aber statt aus Holz aus Backstein. Er dachte sich, falls – Gott bewahre – noch mal ein Feuer ausbricht, brauchen die Flammen länger, und die Feuerwehr hat mehr Zeit, um den Brand zu löschen. Holz brennt einfach viel zu schnell. Die Säulen sind aber noch original, die waren nicht aus Holz. Von der Sorte gibt’s hier in Mississippi eine ganze Menge, und die sind alle in diesem griechischen Stil gebaut. Weißt du, wieso?«
Gene verneinte.
»Weil das antike Griechenland für Demokratie steht. Das dachte man damals zumindest.«
{52}Gene sah Ruby überrascht an, konnte jedoch keine Spur von Ironie in ihrem Gesicht entdecken. Demokratie und Mississippi – für ihn war das ein Widerspruch in sich.
Zwei Jagdhunde kamen hinter dem Haus hervorgeschossen und liefen schnurstracks auf Nancy zu, die sie überschwenglich und mit Namen begrüßte: Jefferson und Franklin. Wie auf ihr Kommando ging fast gleichzeitig die Haustür auf, und eine ältere schwarze Bedienstete in entsprechender Uniform und einer langen weißen Schürze trat heraus.
»Was steht ihr denn hier in der prallen Sonne rum? Los, Nancy, lass dich drücken, und dann möchte ich bitte den netten Gentleman dort vorgestellt bekommen.«
Nancy ließ von den Hunden ab, lief auf die Frau zu und umarmte sie fest.
»Nancy, Mädchen, du bist ja nur noch Haut und Knochen! Da hat man ja gar nichts zum Drücken! Sag bloß, die lassen dich im Norden verhungern. Wie willst du denn mit solchen schmalen Hüften jemals Kinder in die Welt setzen? Du musst doch essen, wenn du groß und stark werden willst.«
»Ich glaube, ich wachse nicht mehr, Dora, und mit meinen Hüften ist alles in Ordnung, danke der Nachfrage. Und außerdem – wer sagt denn, dass ich überhaupt Kinder will? Wer soll dich denn dann besuchen kommen, wenn ich eine eigene Familie habe?«
»Ach, du! Als ob ich jemanden bräuchte, der nach mir sieht. Was meinst du denn, wozu ich meinen Ezra geheiratet hab? Etwa weil er so gut aussieht? Aber jetzt stell mir endlich den netten Herrn an deiner Seite vor.«
{53}»Gene, das ist Dora. Dora lebt schon bei uns, seit ich denken kann, weil Mommy und Daddy sich nicht trauen, sie rauszuschmeißen. Pass bloß auf, dass du dich nicht mit ihr anlegst, sonst hast du ganz schnell eine Gabel im Rücken!«
Dora lachte und schüttelte Gene die Hand. »Mr. Gene, freut mich. Wie halten Sie’s bloß mit Nancy aus? Für so ein dünnes Mädel hat sie eine ganz schön große Klappe, was?«
Gene lächelte und sagte, er freue sich auch, sie kennenzulernen. »Nancy hat mir schon von Ihnen erzählt. Sie sollen die beste Köchin im ganzen Delta sein.«
»Kann man wohl sagen, Mr. Gene. Und die wird euch jetzt ein bisschen aufpäppeln.«