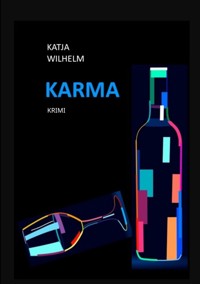9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Krimi
- Serie: BEWEIS_LAST
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet in der hochherrschaftlichen Villa der renommierten Wiener Industriellenfamilie Ledec wird die Schwiegertochter der reichen Süßwarenfabrikanten eines Morgens tot am Treppenabsatz von ihrem Ehemann aufgefunden. Die Patriarchin der Familie pflegt das Motto »Keine Schmutzwäsche vor Fremden!« auch der Polizei gegenüber. Im Laufe der Untersuchungen stellt sich schnell heraus, dass alle Familienmitglieder vom Tod der Schwiegertochter profitieren. Und tatsächlich ergibt die Obduktion, dass der praktische Treppensturz nur der Auftakt für einen eiskalten Mord war. Major Cornelius Metz und seine beiden Mitstreiter Hilde Attensam und Kevin Wiesinger stellen bald fest, dass ein Mord in diesen erlauchten Kreisen selten allein kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katja Wilhelm
DAME VERNICHTET
BAND 2
DER KRIMIREIHE
»BEWEIS_LAST«
© 2023 Katja Wilhelm
Umschlag, Illustration: Katja Wilhelm
Korrektorat: Mona Jakob, Textfein
@katja_wilhelm_autorin
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-347-95738-1
e-Book
978-3-347-95739-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1: Endstation Prunktreppe
Kapitel 2: Stille Reserve
Kapitel 3: Tafelrunde
Kapitel 4: Stille Post
Kapitel 5: Hilf dir selbst
Kapitel 6: Treppensturz nach Art des Hauses
Kapitel 7: Okkasion
Kapitel 8: Leiche im Keller
Kapitel 9: Sibirien
Kapitel 10: Gute Zeiten
Kapitel 11: Beschädigte Ware
Kapitel 12: Alles im Griff
Kapitel 13: Das Böse ist menschlich
Kapitel 14: Der Giftschrank
Kapitel 15: Dienstbare Geister
Kapitel 16: Robin Hood
Kapitel 17: Fest im Sattel
Kapitel 18: Ein wahrhaft schönes Stück
Kapitel 19: Jetzt wird alles gut
Kapitel 20: Schöner Schein
Kapitel 21: Exil
Kapitel 22: High End
Kapitel 23: Domino
Kapitel 24: Brüderlein fein
Kapitel 25: Feine Dame
Epilog
Dame vernichtet
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1: Endstation Prunktreppe
Epilog
Dame vernichtet
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
Kapitel 1: Endstation Prunktreppe
Die Waffe lag schwer in seiner Hand. Tonnenschwer. Sie glühte förmlich in einer Sekunde, in der nächsten war sie kalt wie ein Klumpen Eis. Er hatte schon viel zu lange gezögert. Opfer oder Täter? Das war es doch immer, worauf es im Leben hinauslief, oder? Wollte er immer noch das Opfer sein? Eher nicht. Er hob die Hand, die die Pistole hielt, und warf noch einen flüchtigen Blick darauf. Sie zitterte. Doch er musste es tun, ob er wollte oder nicht. »Was ist da los?«, rief plötzlich eine Männerstimme. Er zuckte zusammen. Fast hätte er die Waffe fallen lassen. »Was soll das werden, wenn’s fertig ist?« Der Mann kam nun näher, stand plötzlich dicht hinter ihm. »Ich kann nicht«, sagte Major Cornelius Metz und legte die Waffe weg. Er nahm die Brille und den Gehörschutz ab und legte sie zu seiner Dienstpistole. »Immer noch traumagebeutelt was, Conny?«, fragte der Schießtrainer wenig mitfühlend. Alle Polizist*innen kannten das. Jeder kam früher oder später an einen Punkt, wo die Waffe nicht mehr dein Freund war, sondern dein schlimmster Feind. Der erste tödliche Schuss war so ein Punkt. Nur den wenigsten Kolleg*innen war es vergönnt, diese Erfahrung niemals machen zu müssen. Es veränderte einen, wenn man ein Leben ausgelöscht hatte. Wenn die eigene Frau sich mit deiner Dienstwaffe das Leben genommen hatte, veränderte das alles. Metz wollte gerade unverrichteter Dinge von dannen ziehen, als der Trainer ihn aufhielt. »Was soll das, Conny? Du weißt, dass du darum nicht herumkommst, wenn du wieder Teil der Truppe sein willst.« Metz nickte. Natürlich wusste er das. Dieser Termin heute war schon die Nachfrist. Leo Katzinger würde nur darauf warten, dass der Schießstand rotes Licht für Metz und das Tragen einer Dienstwaffe meldete. »Weißt du noch, der Einsatz damals in dem Einkaufszentrum? Amoklauf in der Wiener City. Wer hätte das gedacht?« Metz nickte. Natürlich wusste er das noch. Sie beide waren damals im Einsatzteam ganz vorne mit dabei gewesen. »Es war schon cool, wie du die jungen Leute da einfach aus der Schusslinie geholt hast.« Metz schüttelte nur leicht den Kopf. »Das war der Job. Da hat man nicht großartig darüber nachgedacht.« »Ich habe darüber nachgedacht. Jeden Tag fast, seitdem«, führte der Schießwart aus. »Meine Tochter war damals im selben Alter. Wenn ich dran denke, dass sie genauso gut unter den Opfern hätte sein können …« Und mit diesen Worten blickte der erfahrene Polizist mit den grauen Schläfen und der Figur eines Profi-Schwimmers kurz nach links und rechts und aus alter Gewohnheit noch schnell in den toten Winkel, nahm Metz’ Dienstwaffe und feuerte mehrmals kurz hintereinander auf den Bogen mit dem Fadenkreuz. Er holte ihn heran. »Treffer versenkt, würde ich sagen. Du hast es immer noch drauf, Conny. Ich schick meinen Bericht gleich an die Chefetage. Wird dem Katzbuckler nicht gefallen, dass du wieder ›on Stage‹ bist.« Und mit diesen Worten gab er Metz die Waffe zurück und schickte sich an, zu gehen. »Wieso machst du das?«, fragte dieser. »Das kann dich deinen Job kosten, wenn das jemand erfährt.« »Muss ja keiner erfahren. Gibt viel zu wenig Gute wie dich in dem Laden. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass du wieder unter den Lebenden weilst.« Noch bevor Metz etwas entgegnen konnte, war der Herr des Hauses schon wieder verschwunden. Metz hatte eigentlich vorgehabt, an diesem Vormittag noch eine Hürde zu nehmen, oder besser gesagt, es zu versuchen und dem Friedhof einen Besuch abzustatten. Doch auch vor diesem Canossagang bewahrte ihn das Schicksal. Sein Handy klingelte. »Guten Morgen, Chef«, meldete sich Gruppeninspektorin Hilde Attensam, knapp wie immer. »Was gibt’s, Kollegin?«, fragte Metz, doch er konnte es sich schon denken. Ein Anruf um die Uhrzeit bedeutete Arbeit. Er ließ sich die Adresse schicken und fuhr los. Der Friedhof und die Rückkehr in sein Leben würden warten müssen. Am Weg zum Tatort warf er einen Blick in den Rückspiegel seines Dienstwagens. Er war noch immer eine stattliche Erscheinung für einen Mittfünfziger. Stahlblaue Augen, blondes Haar, das von gerade so viel Grau durchzogen war, dass es die Frauenwelt ausreichend verrückt machen konnte. Seine Nase war ein wenig zu lang, aber genau das bewahrte sein Gesicht vor dem Prädikat ›langweilig‹. Die Lachfältchen um seine Augen herum verrieten, dass er jenseits seines Berufes ein angenehmer Mensch gewesen war, jedenfalls bis vor zweieinhalb Jahren. Doch auch zu seinen Bestzeiten hatte er nie in dem Ruf gestanden, ein Frauenheld zu sein. Über sein Privatleben war außer dem Drama, in welchem es geendet hatte, nie viel bekannt geworden, und das sollte auch so bleiben. Alle, die je mit ihm gearbeitet hatten, schätzten seine professionelle Art inklusive der kunstvoll gewahrten Distanz sehr. Seine Arbeit zeichnete ihn aus, mehr gab es über ihn nicht zu wissen. Die weiblichen Polizeibeamten jedenfalls bissen sich die Zähne an ihm aus, für die männlichen Interessenten war er eindeutig zu hetero, fast ein Macho, aber eben auch wieder nicht. Er passte in keine Schublade, dabei war es aus seiner Sicht genau umgekehrt. Die passende Schublade war nur noch nicht erfunden worden. Natürlich kursierten die wildesten Gerüchte über ihn, als er vor einigen Monaten nach zweijähriger Abstinenz wieder zurück in den aktiven Dienst berufen worden war. Das merkwürdige Team, dem er seit damals vorstand, hatte schon bald den Beinamen Soko ›Reha‹ erhalten. Es bestand aus ihm mit seinem ›Dachschaden‹, seiner Gruppeninspektorin, die wegen gefährlicher Körperverletzung an einem Kollegen fast suspendiert worden war, und dem Neffen des Sektionschefs im Innenministerium, Kevin Wiesinger. Dieser war bei Tag Polizist, bei Nacht ein Hacker von zweifelhaftem, wenn auch internationalem Ruf. Seine Recherchen waren nicht immer legal, aber bislang hilfreich und zielführend gewesen. Der Deal, den Cornelius Metz mit der Chefetage hatte schließen müssen, glich ein wenig dem Pakt mit dem Teufel. Er bekam die ›heiklen‹ Fälle zugeteilt. Im Insiderjargon bedeutete das, dass es nicht immer erwünscht sein würde, diese auch zu lösen. Wien war ein Dorf. Die Schickeria, zu der sich auch das mittlere und höhere Beamtentum zugehörig fühlte, führte das eigentliche Regiment. Seine tadellosen Umgangsformen und sein nicht minder tadelloser Ruf als integrer Polizist machten ihn zum perfekten Ermittler für Fälle, die Fingerspitzengefühl und Diskretion bedurften, aber nicht unbedingt einer Lösung. Früher hätte er so einem Arrangement niemals zugestimmt. Doch angesichts seiner Lage hatte er keine Wahl. Am Ermitteln konnte ihn niemand hindern. Was die Staatsanwaltschaft dann mit seinen Ergebnissen tat, lag ohnehin außerhalb seines Wirkungskreises.
Am Tatort angekommen, stieg er aus seinem Dienstwagen aus und trat durch das imposante, schwarz lackierte schmiedeeiserne Gartentor in eine gepflegte Parkanlage. Ein gepflasterter Weg führte direkt zum Haus. Wobei Haus die Untertreibung des Jahrhunderts war. Die weiße Jugendstilvilla mit zwei Türmchen links und rechts, wo bei anderen Menschen maximal ein Dachfenster für Licht sorgte, ragte wie ein Felsen aus dieser grünen Idylle. Die Industriellenfamilie Ledec zählte zu den Big Playern, wenn es um große Namen und große Bedeutung ging. Den Namen hielten die Süßwarenfabrikanten jedoch gekonnt aus sämtlichen Medien heraus. Jedenfalls bis heute. Hilde Attensam, wie fast immer in Uniform, erwartete ihn an der Haustür. Sie kam sich vor wie ein törichter Teenager, der seinem Schwarm die Haustür öffnete, der zum ›Lernen‹ zu ihr nach Hause kam, verdrängte den dummen Vergleich aber sofort wieder. Auch sie hatte die 50 schon ein Weilchen hinter sich gelassen. Ihre stämmige Statur mit den farblosen, schulterlangen dunklen Haaren und ihrem ›Topfgesicht‹ – wie ihre Mutter es immer genannt hatte – war nicht ihr Kapital, und das wusste sie. Allerdings hatte sie in all den Jahren eine halbwegs passable Polizistin abgegeben. Bis zu ihrem ›Ausrutscher‹ eben. Die Stelle bei Metz in der Soko ›Reha‹ war ihre allerletzte Chance, wenn sie ihre Tage nicht für einen privaten Wachdienst schuften oder auf dem elterlichen Bauernhof im Burgenland dahinfristen wollte. »Was haben wir?«, fragte Metz sie knapp wie immer. Sie antwortete: »Linda Ledec, die Schwiegertochter des Hauses. Ihr Mann hat sie in den frühen Morgenstunden tot am Treppenabsatz liegend vorgefunden.« »Endstation Prunktreppe«, dachte Metz. »Professor Hagedorn und sein Team sind schon hier. Im Moment gilt noch: Alles ist möglich«, fuhr Hilde fort. Sie betraten das Haus durch die imposante weiße Haustür mit den bunten Bleiglasfenstern und einem Löwenkopf aus Messing, der zweifelsohne die Funktion eines Türklopfers innehatte. Im Eingangsbereich der Villa wimmelte es von Polizist*innen, Mitarbeiter*innen der Gerichtsmedizin, aber auch Sanitäter*innen waren noch vor Ort. Die Beleuchtung hier im Inneren raubte einem fast das Augenlicht. Die Kollegen kannten ihn und begrüßten ihn mit einem respektvollen, flüchtigen Kopfnicken. Der Gerichtsmediziner, ein hünenhafter Riese mit schneeweißem wehenden Haar, nickte ihm, so freundlich es die klamm sitzende Kapuze seines Schutzanzuges zuließ, zu. Professor Gunter Hagedorn stand streng genommen schon seit Jahren kurz vor dem Ruhestand, den er mangels Privatleben allerdings niemals antreten würde. Stattdessen kniete er augenblicklich neben der Leiche, die ausgestreckt und bäuchlings auf dem makellosen Fliesenboden der beeindruckenden Eingangshalle lag. Cornelius Metz musste unweigerlich an Walhalla denken, als er sich kurz in dem riesigen Eingangsbereich umsah. Die Liebe zu Bleiverglasungen von künstlerischem Seltenheitswert dominierte den gesamten Treppenaufgang. Das Sonnenlicht wurde von den bunten Scheiben in allen Farben des Regenbogens gebrochen. Die tote Frau am Boden wirkte grotesk, nahezu störend, wie ein Objekt, das nicht hierhergehörte.
Der Gerichtsmediziner besah sich gerade ihre Hände. »Abwehrverletzungen?«, fragte der Kommissar. »Guten Morgen, und nein, keine Spur davon«, antwortete der Pathologe. Er fuhr fort, da er zum einen ein alter Fuchs in diesem Geschäft war, zum anderen so schnell wie möglich frühstücken wollte. »Es schaut auf den ersten Blick nach einem ganz klassischen Unfall aus. Hohe Absätze, die sich auf der obersten Treppenstufe an der Teppichleiste verfangen haben. Im Anschluss: Sturz über die komplette Galerie und Exitus.« Der Kommissar deutete auf das Smartphone, das in einigem Abstand zur Leiche am Boden lag, bereits perfekt nummeriert und mit einer gelben Nummer 2 versehen. 1 war so gut wie immer die Leiche. »Was hat es damit auf sich?« »Nichts, soweit wir das bis jetzt feststellen können.« Der Pathologe richtete sich auf und stemmte die behandschuhten Hände in seine schlanken Hüften. »Er könnte problemlos den weißen Magier in einer Fantasy-Saga spielen«, dachte Metz für einen flüchtigen Moment. Doch er schätzte ihn als Fachmann, und er war erfreulich wenig an persönlichem Kontakt interessiert. Das kam beiden Seiten sehr gelegen. »Könnte sie gestoßen worden sein?«, fragte er, kannte die Antwort aber bereits. Der Winkel des Aufpralls und die Lage der Toten waren klassisch für einen Sturz ohne Fremdeinwirkung. Der Pathologe bestätigte diese Vermutung. »Außerdem gibt es keinerlei Anzeichen für Kampfspuren oder verdächtige Wunden am Hinterkopf, keine Hämatome in den Kniekehlen. Wie es auf ihrem Rücken aussieht, kann ich nach der Obduktion sagen, ich würde aber klar dagegen wetten, und ich wette bekanntlich nie.« Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Dennoch ergänzte er seine kurzen Ausführungen noch mit einem Fingerzeig Richtung Obergeschoss: »Auch den Ball spielenden Hund können wir ausschließen, wie es aussieht. Der Flur wird die ganze Nacht über beleuchtet, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken.« Der Kommissar war überfordert mit dieser Wortmeldung, nicht so seine Kollegin. Die Vorliebe des Mediziners für Krimis von Agatha Christie war legendär. Und Hilde Attensam teilte sie uneingeschränkt. Sie klärte ihren Chef daher auf: »Das ist ein Roman von Agatha Christie. Eine alte Dame wird darin mit einem fingierten Treppensturz getötet. Der Mörder hat oben am Treppengeländer eine dünne Schnur gespannt und die Glühbirne herausgedreht. Die Frau stürzt in den Tod, anschließend wurde die Schnur entfernt und die Glühbirne wieder korrekt montiert. Es gibt keine Spuren am Treppenabsatz, die auf verräterischen Stolperdraht oder Ähnliches hinweisen würden. Die weißen Randleisten sind makellos und weisen keine Löcher auf, in denen man einen Nagel oder eine Schraube hätte versenken können.« Metz nickte. Ein Unfall also. Nichtsdestotrotz würde er mit der Familie sprechen müssen. Das verlangte sein Job, aber auch der allgemeine Anstand. Polizeipräsident Leo Katzinger war bestimmt schon im Bilde über den prominenten Fall. Solche Familien wie jene der Ledecs waren nie gleich wie alle anderen, sie waren gleicher. Wer das leugnete, lebte nicht in Wien, ja, nicht einmal in Österreich.
Kapitel 2: Stille Reserve
Die Mitarbeiter*innen der Gerichtsmedizin machten jede Menge Fotos, und die Leiche konnte schließlich abtransportiert werden. »Die Frau Gräfin lässt bitten«, ertönte es plötzlich ganz formvollendet. Die Hausangestellte im grauen Kleid stand in der Tür, welche in den angrenzenden Salon führte. Der Kommissar wandte sich Hilde zu, die ihn mit einer kaum wahrnehmbaren Kopfbewegung in das Zimmer lotste. Ihr Metier waren diese Kreise und ihre Menschen absolut nicht. Man bekam das Kind aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Kind heraus. Im Salon, einem hellen, lichtdurchfluteten Raum voll historisch anmutendem Schnickschnack, hatte sich die Familie der Toten versammelt. Es war nicht ganz das übliche Bild, das sich nach einem plötzlichen Todesfall bot, aber fast. Ein Mann saß in sich zusammengesunken auf einem sehr teuer wirkenden Biedermeiersessel und hatte den Kopf in beide Hände gestützt. Er trug eine Uniform des Roten Kreuzes, daher schlussfolgerte Metz sogleich, dass es sich bei ihm um den Ehemann der Toten handeln musste. Am Weg hierher war er von Hilde am Telefon kurz gebrieft worden, welche einflussreiche und auch sonst sehr reiche Familie hier vom Schicksal – oder eben nicht – heimgesucht worden war. Der Mann der Toten, der einen ehrlich betroffenen Eindruck machte, war Stefan Ledec, zweiter Sohn der legendären Süßwarenmanufaktur von Weltruf. Er arbeitete einmal im Monat ehrenamtlich als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz und hatte seine Frau in den frühen Morgenstunden tot im Eingangsbereich der Villa gefunden. Mit ihm und seiner Familie wohnten noch die alte Gräfin, die eigentlich keine mehr sein durfte, aber dennoch darauf bestand, seine beiden Brüder Martin und Amon Junior sowie dessen Frau Chantal in der riesigen Villa am Stadtrand von Wien. Die alte Gräfin saß im Rollstuhl, was ihrer Noblesse und ihrem Pflichtbewusstsein als Gastgeberin – selbst in dieser tragischen Situation – aber keinen Abbruch tat. »Ganz alte Schule«, dachte der Kommissar, als er den Raum betrat und die zerbrechlich wirkende alte Dame sofort das Wort an sich riss. Ihrem messerscharfen Verstand schien die körperliche Gebrechlichkeit nichts anhaben zu können. »Guten Morgen, Herr Kommissar. Wir sind alle erschüttert. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten?« Eine andere Dame, einfach gekleidet mit altmodischem grauen Dutt am Hinterkopf schickte sich an, den Herrschaften von der Polizei eine Tasse Tee einzuschenken. Es war ein halbherziger Versuch. Niemand im Raum nahm ernsthaft an, dass Fußvolk wie die Polizei so etwas Elegantes wie Tee trinken würde. Metz lehnte dankend ab und entbot der Frau Gräfin und der Familie sein aufrichtiges Beileid. Er hatte Übung darin. Eine Aufforderung zum Tanzen käme ihm schwerer über die Lippen als das. Ein eleganter Mann um die 50 stand neben der Dame im Rollstuhl. Sie übernahm gekonnt die Vorstellrunde, als ob es sich tatsächlich um ein Teekränzchen handelte und man nicht soeben die Leiche ihrer Schwiegertochter in einem Leichensack Richtung Gerichtsmedizin abtransportiert hätte. »Das ist mein ältester Sohn und Erbe, Martin Ledec, Stefan, unsere stille Reserve, wie mein Mann immer zu sagen pflegte, und Amon Junior, die Notlösung.« Bei Letzterem deutete sie flüchtig auf den schmächtigen jungen Mann, der auf einem Biedermeierzweisitzer saß und kalkweiß wie die Wand war. Die Seitenhiebe seiner Mutter war er offensichtlich gewohnt. Eine Reaktion abringen konnten sie ihm jedenfalls nicht. Neben ihm saß seine Frau, die fast in dem schmalen Spalt zwischen ihm und der kunstvoll geschnitzten, mit Blattgold überzogenen Armlehne zu verschwinden drohte. Trotz der frühen Morgenstunde wirkte sie – ähnlich wie die elegante Frau Gräfin – perfekt in Schale und trug – was Hildes geschultes Auge sofort erkannte – von Kopf bis Fuß namhafte und teure Designer. Sie hatte rot geweinte Augen, was ihr ausgesprochen hübsches Gesicht aber nicht zu entstellen vermochte. Ihre langen blonden Haare fielen ihr in perfekt geformten Wellen über die Schultern. Sie sah aus wie eine dieser Porzellanpuppen, die spät nachts im Fernsehen verkauft wurden, und wirkte auch ähnlich zerbrechlich. Die alte Gräfin stellte sie als »meine Schwiegertochter Chantal« vor und entschuldigte sie auch gleichzeitig mit: »Sie spricht unsere Sprache leider immer noch sehr schlecht, n’est pas, Chérie? Du siehst mitgenommen aus, meine Liebe.« Ihr Mann – offensichtlich darin geschult– ging sofort in den Verteidigungsmodus über. »Die ganze Sache ist ihr auf den Magen geschlagen.« »Wohin sonst?«, gab die alte Gräfin spitz zurück. Und murmelte dann noch, gerade so laut, dass es alle hören konnten: »Um ihr zu Kopf zu steigen, müsste sie erst einen haben.« Der Kommissar hatte in seinem Berufsleben schon ausreichend reizende alte Damen vom Schlag der Frau Gräfin kennengelernt, um zu wissen, mit welchem Kaliber er es hier zu tun hatte. Dennoch las er zwischen den Zeilen ihrer hämischen Bemerkungen noch etwas anderes heraus, was ihre Schwiegertochter betraf: »Finger weg von unserem zerbrechlichen, kleinen Vögelchen!« Er respektierte diese unausgesprochene Warnung, zumindest vorerst. So lange Professor Hagedorns erster Eindruck ›Tod durch Unfall‹ nicht widerlegt wurde, war er hier als Freund und Helfer, nicht als Ermittler in einem Todesfall. Der elegante Sohn und Erbe ergriff nun das Wort. Er war anscheinend seit dem Tod des Seniors das unfreiwillige Familienoberhaupt der Ledecs. »Wir stehen Ihnen natürlich für Fragen zur Verfügung, auch wenn ich Sie bitten würde, meine Mutter und meine Schwägerin sich noch ein wenig sammeln zu lassen. Es war für uns alle ein Schock, als Stefan Alarm schlug.« Dieser, seinen Namen aus dem Mund des älteren Bruders hörend, hob erstmals den Kopf, seit der Kommissar und seine Kollegin den Raum betreten hatten. Er weinte, anscheinend war seine Trauer echt, oder zumindest sein Schock. »Es tut mir leid, Herr Ledec, dass ich Sie mit meinen Fragen belästigen muss. Aber je eher wir Ungereimtheiten ausschließen können, desto eher kann Ihre Familie sich der Trauer widmen. Wann haben Sie Ihre Frau gefunden?« Stefan schniefte vernehmlich. Die vornehme Linie der Familie schien an ihm insgesamt ein wenig vorübergegangen zu sein. Auch optisch ähnelte er seinen beiden Brüdern nicht. Diese waren blond und von schmaler, sehniger Statur. In den 1930er-Jahren hätten sie perfekte NS-Athleten abgegeben. Martin, der ältere, war schon vornehm ergraut, was seiner Attraktivität jedoch keinen Abbruch tat. Hilde erkannte einen feschen Mann, wenn er vor ihr stand. Ihn umspielte dieselbe traurige Aura, wie sie sie bei ihrem Chef bisweilen entdeckte, wenn dieser sich unbeobachtet fühlte. Der jüngste der Ledec-Brüder war vielleicht Anfang 30 und ein ›halbes Hemd‹, wie man es in ihrer Kindheit genannt hätte. Beide hatten blaue Augen, auch wenn Junior bei der Verteilung symmetrischer Gesichtszüge nicht in der ersten Reihe gestanden hatte. Seine Ehefrau – eine Trophy Wife par excellence – hatte sicher seine inneren Werte im Sinn gehabt bei der Heirat. Zumindest jene seines Aktiendepots. Stefan hingegen, die stille Reserve, war mittelgroß, stämmig und breitschultrig. Sein Kopf mit den dichten schwarzen Haaren war fast quadratisch, und seine dunklen Augen lagen tief in ihren Höhlen. »Attraktiv geht eindeutig anders«, dachte Hilde Attensam bei sich, konzentrierte sich jedoch mehr auf die Antwort. Wie immer notierte sie alles fleißig. Man konnte nie wissen. Außerdem waren ihre Hände so beschäftigt. Im Angesicht des Todes wusste sie nie recht, wohin mit ihren ›Klodeckeln‹, wie ihre Mutter sie immer genannt hatte. Der frisch verwitwete Fred Feuerstein antwortete: »Ich kam wie immer nach meinem Nachtdienst gegen 6:30 Uhr nach Hause. Als ich die Tür aufschloss, sah ich sie sofort. Ich überprüfte ihre Vitalfunktionen, konnte aber nichts mehr für sie tun. Sie war tot.« Der Kommissar ließ ihn kurz durchatmen und vernahm dabei eine deutliche Ungeduld, die sich bei den anderen Anwesenden im Raum breitzumachen schien. Er ignorierte es. Dass der Tod von Angehörigen nicht immer ein schmerzvoller Verlust war, wusste man nach über 30 Jahren im Polizeidienst mehr als einem lieb war. Auch hier schien sich die Trauer insgesamt stark in überschaubaren Grenzen zu halten. Das junge Pärchen war noch am ehesten erschüttert, aber vielleicht war das auch nur die Wirkung einer Leiche im noblen Haus, von der Polizei ganz abgesehen. »Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal lebend gesehen?« Die stille Reserve schniefte erneut vernehmlich, dann antwortete er: »Gestern Abend beim Essen. Wir aßen noch gemeinsam, ich brachte die Kinder ins Bett und fuhr dann zum Dienst. Alles war wie immer.« Nun ergriff der kühle Martin das Wort. »Können wir die Befragung nicht so lange aussetzen, bis die Todesursache klar ist? Ich meine, wir sind uns hier alle sicher, dass es ein Unfall gewesen sein muss. Ein Fremder hätte sich keinen Zutritt zum Haus verschaffen können. Alles ist alarmgesichert. Und wir sind so einiges, Herr Kommissar, aber sicher keine kaltblütigen Mörder.« Der gewagte Scherz am Schluss misslang. »Er ist nicht der Typ für lockeren Small Talk«, dachte Metz. Oder irgendetwas Lockeres. Und auch Hilde malte sich im Geiste aus, wie lähmend und langatmig wohl ein ganzer Abend mit Martin Ledec sein musste. Nicht dass Frauen wie sie Chancen bei einem wie ihm gehabt hätten. Aber ein geborener Alleinunterhalter war der Erbe definitiv nicht. »Wieso sind Sie sich so sicher, dass kein Fremder im Haus gewesen sein könnte? Kameras in der Einfahrt oder am Tor habe ich keine bemerkt.« Nun antwortete der Junior mit leiser Stimme, aber bestimmt: »Unsere Außentüren sind nur mit unseren Fingerabdrücken zu öffnen. Das ist die neueste Technik und ausgesprochen sicher. Und nein: Wir haben keine Kameras. Mein Vater war immer der Meinung, dass diese Dinger zwielichtige Gestalten eher einladen als fernhalten würden.« Damit hatte der Herr Papa vermutlich sogar recht gehabt, mutmaßte der Kommissar im Stillen und blickte ein letztes Mal in die Runde. »Wir melden uns, sobald wir Näheres wissen. Im Moment können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen Unfall handelt. Ihre Schwägerin war nicht gerade im typischen Alter für einen Treppensturz.« ›Alter‹ war vermutlich das Stich- oder eher Reizwort für die alte Dame gewesen. Einen ›Trigger‹ nannte es Metz’ Therapeutin immer. Sie schien sich berufen zu fühlen, mit dem starken Arm des Gesetzes ein wenig zu ringen. »Sie sollten auf jeden Fall mich zuerst verhören, Herr Kommissar. Die Schwiegermütter haben schon seit jeher keine guten Karten, wenn es um tote Schwiegertöchter geht.« Metz konterte amüsiert, aber um Ernsthaftigkeit bemüht: »Hätten Sie denn einen Grund gehabt, Ihre Schwiegertochter zu ermorden?« Das Gesicht der Gräfin glich dem einer Sphinx, als sie antwortete: »Wahrscheinlich nicht nur einen. Aber wie Sie sehen können«, und bei diesen Worten hob sie ihre arthritischen Hände, »ist Handarbeit nicht mehr meine Stärke. Das Alter macht einem vieles unmöglich, auch das Morden, Herr Kommissar.« Der Sohn des Hauses geleitete ihn mit einer eleganten Handbewegung in Richtung Tür und bedankte sich. »Wenn wir Ihre Arbeit irgendwie unterstützen können, sind wir natürlich gerne behilflich. Aber im Moment sind wir Ihnen ausgesprochen dankbar, wenn wir uns mit der Situation erst einmal vertraut machen können. Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen. Wenn wir irgendwie helfen können, lassen Sie es mich bitte wissen.« Und zu Junior gewandt ergänzte er, wieder ganz der gefasste und gediegene Unternehmer: »Wir sollten ein kurzes Statement für die Presse vorbereiten, bevor die Gerüchteküche zu brodeln beginnt.« Amon Junior nickte. Für Widerspruch gab es in dieser Familie anscheinend wenig Raum. Am Weg Richtung Tür ergänzte Metz noch: »Wir bräuchten Ihre Aussagen noch schriftlich. Wer außer Ihnen wohnt noch im Haus?« Martin Ledec erwiderte: »Die beiden Kinder von Stefan und Linda natürlich. Außer uns nur noch unsere Hausdame Ida Wagner. Sie haben sie bereits kennengelernt.« Cornelius Metz drehte sich ein letztes Mal zu den Versammelten um, konkret zur Dame des Hauses, der der Rollstuhl aber auch nicht einen Funken ihrer Würde und Eleganz zu nehmen vermochte. »Frau Ledec, haben Sie vielen Dank. Und nochmals: mein aufrichtiges Beileid.« Und genau, wie er gedacht hatte, traf er damit den nächsten wunden Punkt der alten Dame. »Wahrscheinlich erinnert sie mich zu sehr an meine Mutter, und ich kann es deshalb nicht lassen, sie zu ärgern«, dachte er. Prompt rief sie ihm nach: »Mein Name ist Charlotte de la Warenne. Ich habe nach dem Tod meines Mannes wieder meinen Mädchennamen angenommen. Und ja, ich scheue mich mit meinen mehr als 80 Jahren nicht, es wieder so zu nennen. Mädchennamen. Sehr modern und gewagt, finden Sie nicht, Herr Kommissar?«
Der Abschied aus der eleganten Villa, die nun vermutlich für immer den Beinamen ›Todesvilla‹ oder ähnlich Geschmackvolles tragen würde – der Presse sei Dank –, zog sich noch ein wenig hin, hauptsächlich weil die Spurensicherung noch mit ihrer Arbeit beschäftigt war. Die Tür zum Salon jedoch wurde geflissentlich geschlossen. Sein Instinkt sagte Cornelius Metz, dass es sich – Unfall oder nicht – auf jeden Fall extrem lohnen würde, dort in diesem Raum eine Fliege an der Wand zu sein. Solche Familien hatten immer etwas zu verbergen. »Hinter jedem großen Vermögen steht ein großes Verbrechen«, dachte Metz bei sich. Dieses Zitat aus dem »Graf von Monte Christo« hatte ihm schon immer gefallen. Die Leichen im Keller der Familie Ledec waren sicher vorhanden. Man wurde nicht zum ›Chocolatier du Monde‹, ohne potenzielle Konkurrenten aus dem Weg zu räumen oder andere moralische Missgriffe billigend in Kauf zu nehmen. Fraglich war nur, ob es ihm oblag, die Leichen auszugraben. Fürs Erste musste er sich mit jener vom Treppenabsatz befassen. Sein Instinkt sagte ihm, dass sich hinter der kühlen und noblen Fassade dieser Familie schon so einige Dramen ereignet hatten. Wo viel Geld im Spiel war, waren Neid und Missgunst niemals weit. Mord auch nicht. Und genau danach schrie gerade alles in dem erfahrenen Ermittler, der er war. ›Unfall‹ schrie hingegen außer der derzeitigen Beweislage gar nichts.
Sie fuhren zurück ins Präsidium. Dort würden sie Kevin mit Hintergrundrecherchen zur Toten und zur illustren Familie beauftragen. Er war schnell in solchen Dingen, auch wenn die Wege, die ihn ans Ziel führten, nicht immer ganz legal waren. Bis der Un-Fall offiziell vom Tisch und geschlossen war – und danach sah es im Moment verdächtig aus –, würden sie ermitteln. Das war schließlich ihre Aufgabe. Leo Katzinger würde mit seinem Pfiff in die Chefetage nicht lange auf sich warten lassen. Metz wusste schon jetzt, dass die Soko ›Reha‹ bei diesem Fall an der ultrakurzen Leine hängen würde, sofern es überhaupt zu Ermittlungen kommen sollte. Doch das kümmerte ihn nicht. Alle Toten hatten das Recht auf Gerechtigkeit. Wenn Linda Ledec einem Unfall zum Opfer gefallen war, war dies ebenso zu klären wie das düstere Gegenteil davon.
Kevin Wiesinger war nicht untätig gewesen. Hilde Attensam hatte ihm vom Tatort aus schon eine Textnachricht mit dem Namen der Toten zukommen lassen. Der Endzwanziger mit den wilden schwarzen Locken und der Vorliebe für schwarze Kleidung war in seinem Element, wenn er recherchieren konnte. Die Arbeit als Polizist hatte ihn nie wirklich gefordert. Zu einfach war es in der heutigen Zeit, alles über jeden innerhalb kürzester Zeit in Erfahrung zu bringen. Sogar auf halbwegs legalem Weg. Seine Ortskenntnis, was die weniger legalen Wege betraf, hatten sich im Revier schon herumgesprochen. Er weigerte sich standhaft, die vielen Anfragen, die auf dem kleinen Dienstweg an ihn herangetragen wurden, zu beantworten. Einige der jungen Kolleginnen scheuten sich nicht einmal davor, ihn um Backgroundchecks ihrer jüngsten Eroberungen zu bitten. Wo kämen wir denn da hin, für solchen Unfug Steuergelder zu verschleudern? Kevin zeigte ihnen lieber, wie sie das selbst bewerkstelligen konnten. Das Internet war wie das Schaufenster der Welt. Alle Menschen stellten ihr Leben darin aus. Man musste nur hinsehen und das Bild auf sich wirken lassen. Es war schon fast erschütternd, wie leichtfertig die Leute mit ihren Daten und mit ihrem Privatleben umgingen. Doch ihm konnte das nur recht sein. Seine Arbeit ging schneller von der Hand, je durchsichtiger die digitalen Menschen sich Tag für Tag präsentierten. Er begann wieder mit dem Aufbau der Tafeln. Die Übersicht konnte nicht schaden, egal ob dieser Fall sich zu einem entwickelte oder nicht. Spannend würden die Recherchen allemal werden. Die Familie Ledec war ein gut gehütetes Geheimnis inmitten der illustren und mediengeilen Schickeria von Wien. Kaum jemals drang irgendetwas an die Öffentlichkeit. Hier wurde nicht nur die Schmutzwäsche hinter verschlossenen Türen gewaschen, sondern alles im Komplettpaket. Mehr als der alljährlich fällige Bericht für die Aktionär*innen kam niemals in die Zeitung, vom Netz ganz zu schweigen. Kevin nahm das zwischen den Zeilen solcher digitalen Verschwiegenheitserklärungen stehende Motto ›Message Control‹ sehr persönlich. Eine bessere Motivation gab es für jemanden wie ihn gar nicht. Es wirkte viel mehr wie ein Fehdehandschuh, den man ihm vor die Füße warf. Und er verfehlte seine Wirkung nicht. Niemand konnte sich seiner digitalen Spürnase entziehen. Niemand.
Kapitel 3: Tafelrunde
Im Salon der Villa Ledec war es ruhig geworden, nachdem Major Metz und seine Kollegenschaft von Spurensicherung und Gerichtsmedizin abgezogen war. Die Frau Gräfin zog sich auf ihr Zimmer zurück, Martin in sein Büro. Amon Junior und seine Ehefrau Chantal saßen in ihrem privaten Wohnzimmer in einem der oberen Stockwerke. Eines der Turmzimmer war das Schlafzimmer des jungvermählten Paares. Viel Glück hatte ihnen dieses märchenhafte Ambiente bislang aber nicht beschert. Bis jetzt. Chantal hatte den Kopf an die Schulter ihres Mannes gelehnt. Ihre rot umrandeten Augen starrten in die Ferne, während er mechanisch ihren goldblonden Lockenkopf streichelte. Die Geste wirkte hilflos, und vermutlich war er es auch. »Es wird alles gut werden, du wirst sehen«, sagte er irgendwann. Sie schloss die Augen. Für einen kurzen Moment konnte sie durchatmen und die Zukunft vor sich liegen sehen. »Wo ist eigentlich dein Ring?«, fragte Amon Ledec seine Frau und griff nach ihrer linken Hand. Sie zuckte zusammen und entriss sie ihm, als ob sie sich verbrannt hätte. »Beim Juwelier. Ich lasse ihn enger machen«, antwortete sie. Amon Ledec seufzte vernehmlich. »Hast du schon wieder abgenommen? Warum, Chantal? Warum tust du dir das wieder an?« Er sah sie kummervoll an, sie drehte sich zu ihm. So fröhlich und locker, wie es ihr möglich war, antwortete sie: »Es ist alles gut, versprochen. Ich hatte nur Angst, ihn zu verlieren. Du weißt doch, dass er immer locker gesessen hat.« Nun musste er lächeln. Der Kauf des Verlobungsringes und sein stümperhafter Antrag waren wie ein festes Band zwischen ihnen. Eine Art romantischer Running Gag, der immer funktionierte, um sie aufzuheitern. Er hatte sie ausgerechnet im Außenbereich einer luxuriösen Therme um ihre Hand gebeten, dort wo sie sich zwei Jahre zuvor kennengelernt hatten. Er fand die Idee romantisch. Gemeinsam hatten sie im wohltemperierten Becken spätabends unbeschwerte Stunden verbracht. Als sie endlich allein waren, stellte er die bewusste Frage. Statt einer Antwort seiner Geliebten ertönte im selben Moment aus den Lautsprechern: »Sehr geehrte Badegäste, wir schließen in 20 Minuten.« Auch diesen Wink des Schicksals nahm keiner von ihnen ernst. Wieso auch? Alles war rosarot und perfekt. Sie gehörten zusammen, und diese Geschichte war ein Teil von ihnen. Es war ihre Lovestory, die konnte ihnen niemand nehmen. Dass der Ring der zarten Braut fast vom Finger gefallen war, werteten sie ebenfalls nicht als schlechtes Zeichen. Chantal attestierte ihrem Bräutigam damals höchstens ein bescheidenes räumliches Vorstellungsvermögen. Damals sah die Zukunft noch golden aus. Das änderte sich Wochen später schlagartig mit einem Anruf von zu Hause.
Martin Ledec saß allein in seinem Arbeitszimmer am anderen Ende der Villa. Er verfügte – im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern – nur über ein Schlafzimmer und dieses Büro, mehr brauchte ein Junggeselle nicht, pflegte seine Mutter zu sagen. Er war allein. Würde er jemals seine Autobiografie veröffentlichen, würde sie diesen Titel tragen: »Allein«. Er hatte telefonisch in der Firma Bescheid gegeben, dass heute niemand von der Familie dort sein würde. Die tragischen Umstände geboten so viel demonstrativ zur Schau getragene Trauer. Seine persönliche Assistentin Margot, die treue Seele, hatte angemessen pietätvoll reagiert. Genauso mochte Martin die Menschen: angemessen, aber nicht emotional. Margot war seit 1985 im Unternehmen. ›Inventar‹ hatte sein Vater seine Privatsekretärin immer leicht abschätzig genannt. ›Stütze‹ nannte Martin sie. Nach dem plötzlichen Ableben seines Vaters war sie es gewesen, die den Laden im Grunde genommen am Laufen hielt. Er war damals gerade Mitte 30 gewesen und hatte weder von der Welt noch vom Leben oder der Wirtschaft viel Ahnung gehabt. Natürlich war er mit dem Unternehmen groß geworden. Kein Ledec kam auf den Chefsessel, ohne nicht vorher alle Bereiche kennenzulernen. Dazu zählten auch die Lieferanten, die Mitarbeiter*innen erst recht und jeder nützliche politische Kontakt in Wien und Umgebung, der das Schokoladenimperium stützen oder stürzen konnte. Zwischen diesen beiden Worten unterschied nur ein einzelner Buchstabe über Sein oder Nichtsein, im echten Leben war die Luft in der Todeszone noch sehr viel dünner. Gewinnzone hieß sie dann allerdings korrekt. Erfolg. Umsatz. Zufriedene Aktionär*innen und ein Business, das unter Martins Führung zu ungeahnten Höhenflügen aufstieg. Amon zeigte außerordentliches Geschick für das Marketing. Sein Babyface mit der leichten Schieflage machte ihn zum geborenen Medienstrategen und Verhandlungspartner mit gierigen Werbeagenturen. Schneller, als die es sich versahen, zog sie der hilflos wirkende Jungspund über den Verhandlungstisch. Er handelte Konditionen aus, die kleinere PR-Firmen über Jahre an den Rand des Ruins bringen konnten. Doch das Gegengeschenk war einfach zu verlockend: ›La Warenne Schokoladen – Chocolatiers du Monde‹ als Referenz im Portfolio zu haben, war praktisch nämlich unbezahlbar. Und genau dort setzte Amon Junior die Daumenschrauben an. Ihre Werbekampagnen waren legendär. Martin, der die Finanzen im Auge behielt, hatte oft gezögert, solche Summen in schnöde Werbung zu pumpen. Doch bald schon entstand so nicht nur Schokolade, die das Superior-Segment auf dem Weltmarkt dominierte, sondern eine Marke mit einem Image und einem Wiedererkennungswert, der es in sich hatte. Der wohl größte Coup des jüngsten Sprosses der Süßwarendynastie waren die legendären ›Cœrs d’Amour‹. Martin hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Herzpralinen auf den Markt zu bringen, die in einer pinkfarbenen, herzförmigen Schachtel mit echten Rosenblättern als Füllmaterial bei den Beschenkten ankamen. Den hochprozentigen und hochpreisigen Inhalt aus bestem französischen Cognac hätte er Amon ja noch durchgehen lassen. Aber die Aufmachung erschien dem kühlen Strategen wie ein schlechter amerikanischer Valentinsscherz. Er gab der Sache eine Chance als Limited Edition. Sie wählten das Weihnachtsgeschäft dafür aus – das Fest der Liebe konnte bekanntlich gar nicht genug Herzlichkeit aufs Auge gedrückt bekommen. Der Erfolg war durchschlagend gewesen. Damit hatte der ›Kleine‹ sich seinen Platz an der Tafelrunde der Ledecs verdient. Ob er ihn auf Dauer würde halten können, stand auf einem anderen Blatt geschrieben. Ihr Vater hatte an Härte nichts vermissen lassen, als sie Kinder waren. Seine ›Fußsoldaten‹ hatte er sie immer genannt. Er, Martin, hatte alle Erwartungen erfüllen können. Menschliche Gefühle waren ihm fremd, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, machte ihm nichts aus und die Firma kam stets an erster Stelle. Stefan, die arme Haut, war da schon ein anderer Fall. Es tat Martin leid, dass dieser sich nun, garantiert unter der Fuchtel der strengen Frau Mama, um Dinge wie Beerdigung und das familiäre Drama kümmern musste. Das Business war nie Stefans Welt gewesen. In einer anderen hätte man ihn Arzt werden lassen, und alles wäre anders gekommen. Doch ein großes Erbe brachte nun einmal große Verantwortung mit sich. Und selbst Stefan, das gute Herz, hatte erkannt, dass Martin jede Hilfe brauchen konnte, die es gab auf dieser Welt. Er war ihm zeitlebens überaus dankbar dafür gewesen, dass er ihn nicht mit allem allein gelassen hatte. Sie drei waren ein ungewöhnliches Brüder-Trio und gaben für Außenstehende eine noch viel ungewöhnlichere Führungsriege eines Unternehmens ab. Doch das Ergebnis sprach für sich. Um sich selbst machte Martin Ledec sich die wenigsten Sorgen. Er hatte die harten Gene gleich aus zwei Richtungen mitbekommen. Doch Familie war schließlich dazu da, um auf die Schwächeren achtzugeben. Der sensible Stefan würde nicht allein im Regen stehen, so viel stand fest. Allzu schwach sollte man sich in einer Familie wie jener der Ledecs allerdings auch nicht erweisen. Seine Schwägerin Chantal wäre fast unter die Räder der eisernen Familienmitglieder gekommen, die gemeinsam unter diesem Dach wohnten. Doch nun war alles zu einem guten Ende gekommen. Man musste dem Schicksal manchmal einfach nur dankbar sein für die charmanten Lösungen, die es aus dem Ärmel zauberte. »Was schadete es da schon, wenn man noch ein wenig Feenstaub hinzufügt?«, dachte Martin. Jeder anständige Zauberer tat das, um vom eigentlichen Trick abzulenken. Und wie jeder andere Magier auch würde Martin Ledec sich hüten, seine Zaubertricks zu verraten.
Hofrat Leo Katzinger war ›not amused‹. Metz stand nun schon eine gefühlte Ewigkeit in seinem protzigen Büro, ein Stuhl war ihm heute nicht angeboten worden. »Das Kind war böse«, dachte Metz. »Jetzt darf es in der Ecke stehen.« Das Gesicht des Polizeichefs war dunkelrot angelaufen. Die Rothaarigen mit der hellen, papierdünnen Haut profitierten nicht unbedingt davon, wenn ihre Gefühle sie übermannten. »Irgendwann platzt ihm tatsächlich der Kragen«, sinnierte Metz weiter. Doch Leo Katzinger beschränkte sich auf heftiges Atmen, während er versuchte, Metz den Ernst seiner Lage zu verdeutlichen. »Diese Familie ist sakrosankt, haben Sie mich verstanden?«, keuchte er irgendwann. Bis zu dieser Wortmeldung hatte Metz auf Durchzug geschaltet. Das autogene Training, das seine Therapeutin ihm seit zwei Jahren vergeblich versucht hatte, ans Herz zu legen, war nun doch für etwas gut. Er nickte verständnisvoll. Im Geiste dachte er an den Friedhof. Ob er es wohl heute schaffen würde? »Sie können gehen!« Fast hätte er den Abschiedsappell überhört. »Und denken Sie daran, mein lieber Metz: kein Mordfall, keine Ermittlungen! Haben Sie mich verstanden?« Metz nickte und wollte sich schon zum Gehen umdrehen, als Leo Katzinger ihn noch ein letztes Mal zurückbeorderte. »Gratulation zur Schießprüfung übrigens. Ein sauberes Ergebnis, nach all der langen Zeit.« Täuschte sich Metz, oder hörte er Zwischentöne? Doch Leo Katzinger war nicht der Typ für Understatement oder Ironie. Vermutlich nagte nur das schlechte Gewissen an ihm, und seine Wahrnehmung diesbezüglich war selektiv. »Das ist wie Fahrradfahren«, antwortete Metz daher und ging.
Die Kinder waren erstaunlich gefasst. Unglaublich, wie erwachsen die beiden Kleinen in ihren weißen Pyjamas wirkten, als Stefan Ledec zu ihnen ins Zimmer kam. »Schläft Mami noch?«, fragte Louisa, seine achtjährige Tochter. »Mama schläft nicht, du dummes Mädchen«, konterte ihr zehnjähriger Bruder Paul. »Wir wollen jetzt nicht böse miteinander sein, in Ordnung?«, versuchte Stefan die Wogen im Kinderzimmer zu glätten. »Eure Mama hat einen schlimmen Unfall gehabt. Sie ist von der Treppe gefallen und hat sich sehr wehgetan.« »Sie ist tot, oder?«, fragte Paul. Er besaß bereits jetzt die nötige Härte, die die Ledecs ihren Sprösslingen abverlangten. Sein Weg im Leben war vorgezeichnet und würde ihm nicht besonders schwerfallen. »Ja, Paul, sie ist jetzt im Himmel.« »Es gibt keinen Himmel, sagt die Oma«, meldete sich jetzt Louisa zu Wort. »Nur eine Hölle. Die ist dafür überall.« Stefan seufzte lautstark. Dass dieses Gespräch nicht einfach werden würde, war ihm klar gewesen. Doch eigentlich fassten die Kinder das Ableben ihrer Mutter ganz gut auf. Erstaunlich gut, um genau zu sein. Andererseits: Wie viel hatten sie von ihr schon gehabt? Eine ganze Armada an Au-pairs und Nannys hatte sich um sie gekümmert, seit sie auf der Welt waren. Er selbst hatte wahrscheinlich mehr Zeit mit ihnen verbracht als Linda zu Lebzeiten. »Bekommen wir jetzt eine neue Mama?«, fragte Paul ernst. »Wie kommst du darauf?«, entgegnete Stefan. »Jetzt sind wir erst einmal zu dritt hier mit Oma und allen anderen. Wie die drei Musketiere. Wie findet ihr das?« Pauls Gesicht erhellte sich schlagartig. Die Geschichte von den drei Musketieren gefiel ihm ganz besonders. Nur Louisa war nicht einverstanden. »Ich möchte eine Prinzessin sein. In der Geschichte gibt es aber keine.« Stefan war einmal mehr erstaunt darüber, wie Kindergehirne arbeiteten. »Wir schreiben eine Prinzessin in die Geschichte hinein, Louisa, extra für dich, in Ordnung?« Das schien sie milde zu stimmen. »Vielleicht hat Mama ja von einem giftigen Apfel gegessen?«, mutmaßte Louisa, die Märchenexpertin nun mit ernster Miene. »Das glaube ich eher nicht«, antwortete ihr Vater und umarmte beide Kinder so kräftig, wie seine stämmige Fülle und ihre zarten Körper es zuließen. »Das hätte der giftige Apfel nicht überlebt«, dachte er bei sich.
Kevin Wiesinger blickte erwartungsvoll von seinem Bildschirm auf wie ein Hund, der ein Geschenk für Herrchen in petto hatte. »Fehlt nur noch, dass er sabbert«, dachte Hilde mürrisch. Ihr Verhältnis zu Kevin – so man ihre gegenseitige Zwangsbeglückung als Kollegen so nennen konnte – hatte sich von spontaner Abneigung zu einer Art notgedrungenem Burgfrieden weiterentwickelt. Sie traute dem schleimigen kleinen Mistkerl kein Stück weit über den Weg. Viel zu verlockend war die unendliche Flut an Informationen, zu denen Menschen mit seinen Fähigkeiten Zugriff hatten. Mit Schaudern dachte sie daran, was Kevin vor einem halben Jahr noch über sie in Erfahrung hätte bringen können. Dabei war sie ohnehin ein sehr vorsichtiger Mensch. Über 30 Jahre im aktiven Polizeidienst hinterließen Spuren, machten etwas mit einem. Hildes Instinkte arbeiteten auf Hochtouren, aber eben auch, was den lieben Kevin betraf. Cornelius Metz hatte sich mit seinem Team wider Willen arrangiert. Ihren ersten gemeinsamen Fall hatten sie gelöst, und das unter widrigsten Umständen. Dass es zu keiner Anklage gekommen war – jedenfalls nicht für den eigentlichen Mord –, war nicht ihrer mangelhaften Arbeit geschuldet gewesen. Manchmal war der Mangel an Beweisen einfach nicht zu leugnen. Metz bemerkte Kevins Gier nach Aufmerksamkeit natürlich, brühte sich zuvor aber noch einen Espresso. Die Maschine hatte sich zu einem echten Segen für ihn entpuppt. Er hauste immer noch unter höchst fragwürdigen Bedingungen in seiner Gartenlaube, die seine hochwohlgeborene Mutter wahrscheinlich eher als Geräteschuppen tituliert hätte. Sein Paralleluniversum, welches er sich nach dem Tod seiner Frau erschaffen hatte, funktionierte aber. Und solange es das tat, gab es weder Frühstück noch Dusche zu Hause, sondern das Leben wurde ausgelagert. Eine Etappe davon spielte sich hier in seinem Büro ab. »Was gibt es, Kevin?«, erlöste er diesen schließlich von seinem Mitteilungsdrang. »Haben wir nun einen Fall oder haben wir keinen?«, fragte dieser als Einstieg. Metz witterte Unheil, denn Kevin war – einmal auf den Datenautobahnen des World Wide Web unterwegs – wie eine entfesselte Naturgewalt. Diese Frage bezog sich eher darauf, ob er ALLE ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Wege ausreizen durfte, um an Informationen zu gelangen, oder nur diejenigen, die der Staatsanwalt vor Gericht verwenden konnte, sollte es zu einer Anklage und Verhandlung kommen. Doch dafür bräuchte man zuerst einen Fall. »Wir haben einen Maulkorb von ganz oben bekommen. Die ehrwürdige Familie Ledec ist tiefrotes Sperrgebiet, solange Professor Hagedorn nichts findet, das die Unfalltheorie entkräftet.« Hilde hob eine Augenbraue. Kevin war sichtlich enttäuscht. Doch ganz am ausgestreckten Arm verhungern lassen wollte Metz sein jüngstes Teammitglied doch nicht. »Warum fragen Sie, Kevin?« Dieser schien zu überlegen. Doch er war viel zu gerne als Rechercheur tätig, um mit seinem Fund hinterm Berg zu halten. »Es hat nicht konkret mit unserem Fall oder Nichtfall zu tun. Aber die Familie Ledec ist aus polizeilicher Sicht ziemlich interessant, würde ich meinen.« Metz musste schmunzeln. Keine Ahnung, wann Hilde Attensam ihm die Namen zugespielt hatte, die es zu überprüfen galt, aber er war echt von der schnellen Truppe. »Sagen Sie mir erst, ob es Informationen sind, die wir auch haben und verwenden DÜRFEN. Sonst interessiert mich bis auf Weiteres nichts, in Ordnung?« Metz wusste, dass es schlimmere Aufgaben für einen Vorgesetzten gab, als den Enthusiasmus seiner Mitarbeiter*innen zu bremsen. Doch leere Kilometer würden ihnen nichts bringen. Und Spuren, denen sie nicht folgen durften, waren doppelte Nieten. »Alles legal, alles aktenkundig aus dem digitalisierten Polizeiarchiv und diversen Zeitungen, die inzwischen ebenfalls online abrufbar sind.« Kevin bekam fast rote Wangen, was angesichts seiner wächsernen Blässe, die den langen Nächten vor dem PC und seinem Hauptnahrungsmittel, den Energydrinks, zu gleichen Teilen geschuldet war, schon bemerkenswert erschien. Seine Vorliebe für schwarze Kleidung machte in dieser Hinsicht die Lage nicht besser für ihn. Metz blickte zu Hilde. »Noch einmal in aller Deutlichkeit: Wir haben keinen Fall, verstanden? Unter diesem Aspekt und weil wir um diese Uhrzeit noch nicht nach Hause gehen dürfen (›oder wollen‹, dachte er): Schießen Sie los, Kevin!«
Kapitel 4: Stille Post
Konstantin Schöpf blickte aus dem Fenster seines Arbeitszimmers. Für ein Büro in der City reichte das Geld nicht. Doch Geld war ihm egal. Er hatte sich irgendwann einmal im Leben dazu entschlossen, der Wahrheitsfindung zu dienen und die Aufdeckung von Unwahrheiten und vor allem Unrecht jeglicher Art zu seiner Berufung zu machen. Für einen Beruf hatte es nicht gereicht. Hauptsächlich deswegen, weil die Zeitschriften allesamt am Gängelband der Politik und ihrer einflussreichen Geldgeber*innen hingen. Da konnte eine Pressemeldung oder ein allzu kritischer Bericht schnell das Aus für eine Karriere bedeuten, bevor diese begonnen hatte. Er betrachtete sich im Spiegelbild seines Bildschirms. Er war alt geworden, nicht nur älter. Seine Geheimratsecken reichten inzwischen fast bis zum Scheitel. Die einstmals dunklen Haare waren ergraut, ebenso sein Gesicht. Über 30 Jahre als Enthüllungsjournalist und ›Aufdecker der Nation‹, wie gnädige linksgerichtete Medien in gelegentlich genannt hatten, hinterließen Spuren. Eine zerbrochene Ehe, komplette Kontaktsperre zu seinen beiden Kindern und ein Leben, das mehr einem Existieren glich, waren der Preis dafür gewesen. Doch es hatte sich alles gelohnt. Einige Coups waren ihm durchaus gelungen im Laufe der Jahre. Er hatte bei gar nicht so wenigen politischen Erdbeben seine Finger im Spiel gehabt und so manche hoffnungsvolle Jungkarriere auf dem glatten politischen Parkett Österreichs beendet, bevor sie begonnen hatte. Seine Entdeckungen waren grundsätzlich immer wasserdicht, bevor er mit ihnen an die Öffentlichkeit ging. Die gute alte Journalistenregel ›Check, Re-Check, Double-Check‹ war stets sein oberstes Credo gewesen. Inzwischen war es einfacher geworden, Dreck am Stecken der Menschen zu lokalisieren. Die ganze Welt war mittlerweile digital. Die Menschen verfrachteten freiwillig ihr halbes Leben ins Internet und hielten ihren Kopf noch viel bereitwilliger in jede Kamera, die irgendwo auf sie gerichtet wurde. Die politisch eingefärbten Medien des Landes straften ihn, so gut es eben ging, mit Ignoranz. Wenn sie gar nicht umhinkamen, eine Meldung über ihn oder eine seiner Enthüllungsstorys zu bringen, verschwiegen sie seinen Namen tunlichst. Maximal der ›Blogger‹ wurde er genannt. Jeder in Österreich wusste, wer gemeint war, und diese Tatsache allein genügte schon, um ihm ein Lächeln abzuringen. Die Lügenpresse war noch nie besonders kreativ gewesen. Und er war nicht nur der Stachel im Fleisch all jener, die ihre Macht und ihr Geld benutzten, um noch mehr davon anzuhäufen. Er legte vor allem den Finger in die Wunde der medialen Landschaft der Republik. Diese hing zu einem besorgniserregenden Gutteil an der kurzen Leine der Politik und ihrer Lobbyist*innen. Die Zeiten waren vorbei, wo die besten Deals abends im Wirtshaus verhandelt wurden oder am Wochenende in irgendwelchen schicken Villen im In- und Ausland. Seit jeder Mensch mit einem Handy und somit einer Kamera und einem Aufnahmegerät ausgestattet war, wehte ein rauer Wind, was heimliche Treffen und noch viel heimlichere Absprachen und Gegengeschäfte betraf. Konstantin Schöpf konnte sich glücklich schätzen. Sein Ruf war tadellos geblieben in all den Jahren, obwohl sämtliche große Zeitungen des Landes ihr Möglichstes versucht hatten, ihn in den Schmutz zu ziehen. Sein Geheimrezept war neben penibelster Recherche mit einem Wort zu umschreiben: Diskretion. Nie war es vorgekommen, dass Informant*innen und Quellen um ihre Sicherheit oder ihr Image fürchten mussten. Wenn es zu Gerichtsverhandlungen kam – und zu denen war es häufig gekommen in den letzten Jahren –, fanden sich dennoch genügend Zeug*innen, die bereit waren, zu ihrer Geschichte zu stehen. Das hatte Neid geweckt im Land. Was Medienvertreter, Politiker und Wirtschaftsbosse jedoch am allermeisten auf die Palme brachte, wenn sein Name fiel, war eine ganz andere Tatsache. Konstantin Schöpf war Publizist und Enthüllungsjournalist aus Leidenschaft und Überzeugung. Seine Geschichten hätten Bücher und Talkshows über Jahre hindurch mit Stoff versorgen können. Er hätte Millionär werden können. Allein: Er tat es nicht. Keinen einzigen Cent hatte er verdient mit seiner Arbeit im Namen der Gerechtigkeit. Das machte ihn nicht nur unbestechlich, was an sich schon eine ungünstige Eigenschaft an jemandem wie ihm war. Es machte ihn quasi zum Heiligen und Märtyrer und in der öffentlichen Meinung überdies über jeden Zweifel erhaben. Dass er viele Feinde hatte, störte ihn nicht. »Neid muss man sich verdienen«, hatte seine Mutter immer gesagt. Mitleid hingegen bekam man geschenkt. Er konnte mit beiden Gefühlen nichts anfangen. Sein Fokus war auf Fakten gerichtet. Die menschlichen Tragödien dahinter ließen ihn zwar nicht unberührt, doch was für seine Mission zählte, waren nur Tatsachen. Diese Einstellung hatte ihn von den unzähligen Gerichtsverfahren, denen er sich im Laufe seines Lebens schon hatte stellen müssen, auch so gut wie alle gewinnen lassen. Mit seinem Anwalt war er inzwischen befreundet. Wenn Menschen also Geschichten und potenzielle Skandale an ihn herantrugen, war die erste Frage, die er sich stellte, nicht jene nach der Publikumswirkung. Mediengeil durften andere sein. Nein, seine primäre Überlegung war stets: Welches Unrecht muss hier korrigiert werden? Gibt es überhaupt eines? Erst dann folgten seine üblichen Basisrecherchen zur Quelle und zu ihrer Vertrauenswürdigkeit. Sobald sich der Verdacht erhärtete, dass es die vermeintlichen Opfer nur auf Geld abgesehen hatten, war er raus aus der Sache. Entgegen der landläufigen Meinung mancher Medien und Politiker*innen ging es ihm auch nicht darum, Menschen an den Pranger zu stellen oder Karrieren zu zerstören. Diese Kollateralschäden musste man billigend in Kauf nehmen, aber sie waren nicht das primäre Ziel seiner Nachforschungen. Ihm ging es um Gerechtigkeit und darum, dass Machtmenschen und Meinungsmacher sich nicht alles erlauben durften. Davonkamen sie ohnehin noch zur Genüge, trotz seiner Bemühungen. Er blickte auf den braunen Umschlag, der ihn heute ganz altmodisch per Briefpost erreicht hatte. Kein Absender, der Poststempel von Bratislava war jedoch deutlich zu erkennen. Solche Dinge waren nichts Ungewöhnliches. Die halbe Welt, jedenfalls die halbe von Österreich, suchte Rat und Hilfe bei ihm oder hatte die noch nie da gewesene Story für ihn auf Lager. Das kleine Büchlein, das nun vor ihm lag und mit dieser Sendung den Weg zu ihm gefunden hatte, könnte tatsächlich so ein Fall werden. Er blätterte vorsichtig darin. Das Papier war vergilbt und fleckig, das Foto der jungen Frau darin aber noch gut zu erkennen. Die Eintragungen, die die akribischen Aufzählungen dokumentierten, waren gut leserlich, sehr gut sogar. Die Echtheit würde er überprüfen lassen müssen. Das Fälschen von Dokumenten aus der NS-Zeit hatte schon so einige Blüten getrieben. Er musste auf Nummer sicher gehen, wenn er sich dieser Sache annehmen wollte. Dass er wollte, hatte der Fährtensucher in ihm schon beschlossen, als er den letzten Eintrag in dem Arbeitsbuch der jungen Polin sah. ›Chocolatiers du Monde‹ bekam da plötzlich eine ganz neue Bedeutung.
Im Büro war es still geworden. Cornelius Metz und Hilde Attensam hatten Kevins Ausführungen gelauscht bis zum Schluss. Er würde es wahrscheinlich nie lernen, sich kurzzufassen, doch seine Talente lagen definitiv ohnehin woanders. »Respekt«, quittierte Metz den kurzen Vortrag zur Familie Ledec. Hilde Attensam nickte anerkennend. Doch Kevin war noch nicht am Ende angelangt. »All diese Informationen stammen nur aus den Medien. Die Familie ist zwar extrem bedacht darauf, sich jegliche Presse zu ersparen, aber manchmal war es eben doch nicht möglich. Wenn wir nun einen Fall hätten, was wir ja nicht haben, könnte ich eine