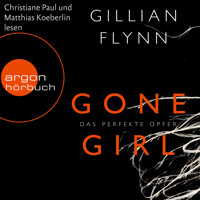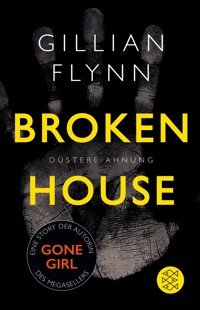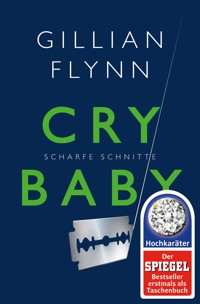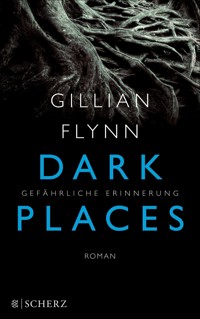
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DER ZWEITE ROMAN VON GILLIAN FLYNN - AUTORIN DES MEGA-BESTSELLERS »Gone Girl« Sie war sieben, als die Schüsse fielen. Als sie in die kalte Nacht hinauslief und sich versteckte. Als ihre Mutter und ihre beiden Schwestern umgebracht wurden. Als ihre Zeugenaussage ihren Bruder hinter Gitter brachte. Jetzt, 25 Jahre später, ist aus Libby Day eine verbitterte, einsame Frau geworden, deren Leben eigentlich keines mehr ist. Doch inzwischen gibt es Leute, die an der Schuld ihres Bruders zweifeln. Libby muss noch einmal ihre Vergangenheit aufrollen: Was hat sie in jener verhängnisvollen Nacht wirklich gesehen? Ihre Erinnerungen bringen sie in Lebensgefahr – so wie damals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gillian Flynn
Dark Places - Gefährliche Erinnerung
Roman
Über dieses Buch
Sie war sieben, als die Schüsse fielen. Als sie in die kalte Nacht hinauslief und sich versteckte. Als ihre Mutter und ihre beiden Schwestern umgebracht wurden. Als ihre Zeugenaussage ihren Bruder für immer hinter Gitter brachte. Jetzt, 25 Jahre später, gibt es Leute, die an der Schuld ihres Bruders zweifeln. Libby muss noch einmal ihre Vergangenheit aufrollen: Was hat sie in jener verhängnisvollen Nacht wirklich gesehen? Ihre Erinnerungen bringen sie in Lebensgefahr – so wie damals.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gillian Flynnwuchs in Kansas City, Missouri, auf. Nach College und Universitäts-Studium in Kansas und Chicago zog es sie nach Kalifornien, anschließend nach New York. Sie war zehn Jahre lang die leitende TV-Kritikerin von Entertainment Weekly. Im Jahre 2006 erschien ihr erster Roman ›Cry Baby‹, mit dem sie großes Aufsehen erregte. Das Buch erhielt gleich zwei >British Dagger Awards‹. Ihr zweiter Roman ›Finstere Orte‹ erschien 2009 und wurde in den USA ein riesiger Erfolg. Im Juli 2012 erschien ihr dritter Roman ›Gone Girl‹ und löste ein riesiges Medienspektakel aus. Das Buch stand monatelang auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste und wurde mehr als 3 Millionen mal verkauft. Alle drei Bücher werden verfilmt und demnächst im Kino zu sehen sein. Die Autorin lebt heute mit ihrer Familie in Chicago.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel ›Dark Places‹ bei Shaye Areheart Books, an imprint of the Crown Publishing Group, div.of Random House, New York.
© 2009 by Gillian Flynn
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: Hafen Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402785-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[WIDMUNG]
[MOTTO]
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Patty Day
Libby Day
Ben Day
Libby Day
Calvin Diehl
Libby Day
Ben Day
Libby Day
[DANK]
Für meinen hinreißenden Ehemann Brett Nolan
Die Days führten ein ziemlich normales Leben
Nur Ben Day, der war total daneben
Der Kerl war ganz scharf auf Teufelsmacht
Und hat seine Familie umgebracht.
Die kleine Michelle erwürgte er in der Nacht
Anschließend hat er Debby kaltgemacht
Mutter Patty hat er aufgespart bis zuletzt
Und ihr dann den Kopf mit der Knarre zerfetzt.
Wie durch ein Wunder kam Klein-Libby davon
Aber was für ein Leben hat sie jetzt schon?
Schulhof-Reim, circa 1985
Libby Day
In meinem Innern haust eine Fiesheit, so real wie ein Organ. Würde man mir den Bauch aufschlitzen, käme sie wahrscheinlich auf der Stelle rausgeflutscht, fiele fleischig dunkel zu Boden, und man könnte auf ihr herumtrampeln. Es ist das Day-Blut. Irgendwas stimmt nicht damit. Ich war nie ein braves kleines Mädchen, und nach den Morden wurde es nur noch schlimmer mit mir. Mürrisch und labil wuchs die kleine Waise Libby heran, weitergereicht von einem weitläufigen Verwandten zum anderen – Cousins zweiten Grades, Großtanten oder auch Freunde von Freunden, quer durch Kansas, in Wohnwagen oder verrotteten Ranchhäusern. In der Schule trug ich die Sachen, die ich von meiner toten Schwester geerbt hatte: Shirts mit schweißgelben Achseln, Hosen mit herunterhängendem Gesäß, zusammengehalten von einem schäbigen, bis ins letzte Loch gezurrten Gürtel. Auf Klassenfotos war ich grundsätzlich ungekämmt – Haarspangen hingen windschief an einzelnen Strähnen, als wären es Flugobjekte, die sich darin verfangen hatten – und hatte immer dicke Tränensäcke unter den Augen, wie eine versoffene alte Gastwirtin. Vielleicht brachte ich widerwillig eine leichte Krümmung der Lippen zustande, wo bei anderen ein Lächeln war. Aber nur vielleicht.
Ich war kein liebenswertes Kind, und ich entwickelte mich auch zu keiner liebenswerten Erwachsenen. Wenn man meine Seele zeichnen könnte, wäre es irgendein wildes Gekritzel mit deutlich sichtbaren Reißzähnen.
Es war März, scheußlich und nass wie immer. Ich lag im Bett und ging einem meiner Hobbys nach – ich malte mir aus, mich umzubringen. In solchen Tagträumen schwelgte ich gern: Ein Gewehr, mein Mund, ein Knall, mein Kopf ruckt einmal, ruckt zweimal, Blut spritzt an die Wand. Splatter, splatter. »Wollte sie begraben oder eingeäschert werden?«, fragen die Leute. »Wer kommt zur Beerdigung?« Aber niemand weiß eine Antwort. Die Leute glotzen einander auf die Schuhe oder Schultern, bis die Stille sich eingenistet hat, und dann setzt einer Kaffee auf, energisch und mit viel Geklapper. Kaffee und plötzliche Todesfälle passen immer gut zusammen.
Ich streckte einen Fuß unter der Decke heraus, brachte es aber nicht über mich, ihn auf den Boden zu setzen. Vermutlich war ich mal wieder deprimiert. Vermutlich war ich die ganzen letzten vierundzwanzig Jahre deprimiert. Irgendwo in mir spüre ich gelegentlich eine bessere Version meiner selbst – versteckt hinter der Leber oder als eine Art Anhang an der Milz, tief im Innern meines unterentwickelten, kindlichen Körpers –, eine Libby, die mir sagt, ich soll aufstehen, erwachsen werden, die Vergangenheit hinter mir lassen. Aber für gewöhnlich gewinnt die Fiesheit rasch wieder die Oberhand. Mein Bruder hat meine Familie abgeschlachtet, als ich sieben Jahre alt war. Meine Mom, meine zwei Schwestern, alle tot: Peng peng, hack hack, würg würg. Danach brauchte ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Keiner erwartete etwas von mir.
Als ich achtzehn wurde, erbte ich 321373 Dollar, gestiftet im Laufe der Jahre von all den wohlmeinenden Menschen, die von meiner traurigen Geschichte gelesen hatten, Gutmenschen, deren Herz von meinem Schicksal zutiefst gerührt war. Sooft ich diesen Satz höre – und ich höre ihn oft – stelle ich mir automatisch kitschige Herzen mit Flügelchen vor, die zu einer meiner heruntergekommenen Kindheitsbehausungen flattern. Dort stehe ich am Fenster, ein kleines Mädchen, winke und greife nach den schimmernden Kitschherzen, während von oben grüne Dollarscheine auf mich herabregnen. Danke, vielen, vielen Dank! Solange ich noch klein war, wurden die Spenden auf ein konservativ verwaltetes Bankkonto eingezahlt, dessen Stand alle drei bis vier Jahre, wenn wieder einmal eine Zeitschrift oder eine Nachrichtensendung einen Beitrag über mich brachte, sprunghaft anstieg. Ein großer Tag für die kleine Libby Day: Die Überlebende des Prärie-Massakers wird bittersüße zehn Jahre alt. (Ich mit zerzausten Rattenschwänzchen auf dem von Opossum-Pisse getränkten Rasen vor dem Trailer meiner Tante Diane. Hinter mir, unter dem für sie ganz untypischen Rock, Dianes baumstammdicke Waden.) Unsere tapfere Libby Day ist süße sechzehn! (Ich, immer noch viel zu klein, das Gesicht im Schein der Geburtstagskerzen, das Shirt viel zu eng über meinen Brüsten, die sich in diesem Jahr zu Körbchengröße D entwickelt hatten und an meinem zierlichen Körper wie eine Karikatur wirkten, lächerlich, seltsam pornographisch.)
Von dem Spendengeld lebte ich seit über dreizehn Jahren, aber nun näherte es sich dem Ende. An diesem Nachmittag hatte ich einen Termin, bei dem festgestellt werden sollte, wie viel genau noch da war. Einmal im Jahr bestand der Mann, der das Geld verwaltete – ein unerschrockener, rotwangiger Banker namens Jim Jeffreys –, darauf, mich zum Lunch auszuführen, zu einem »Check-up«, wie er es nannte. Dann aßen wir etwas aus der Preisklasse um die zwanzig Dollar und unterhielten uns über mein Leben – schließlich kannte er mich schon, seit ich sooo klein war, hehe. Ich meinerseits wusste so gut wie nichts über Jim Jeffreys und fragte auch nie, sondern sah diese Verabredungen strikt aus der immer gleichen Kinderperspektive: Einigermaßen höflich sein und daran denken, dass es bald vorbei ist. Einsilbige Antworten, müde Seufzer. Meine einzige Vermutung über Jim Jeffreys war, dass er religiös orientiert sein musste, christlich, kirchlich, denn er besaß die hartnäckige Geduld und den Optimismus von jemandem, der glaubt, dass Jesus ihm ständig über die Schulter schaut. Eigentlich wäre der nächste Check-up erst in acht oder neun Monaten fällig gewesen, aber Jim Jeffreys hatte mich genervt und mit ernster, gedämpfter Stimme Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen, in denen er mir mitteilte, er hätte alles getan, um »das Leben des Fonds« zu verlängern, aber es wäre Zeit, über die »nächsten Schritte« nachzudenken.
Und wieder zeigte sich meine innere Fiesheit: Sofort fiel mir das andere kleine Mädchen aus der Klatschpresse ein, Jamie Soundso, die im gleichen Jahr, also auch 1985, ihre Familie verloren hatte. Ihr Gesicht war teilweise in dem Feuer verbrannt, das ihr Vater gelegt und damit den Rest ihrer Familie getötet hatte. Jedes Mal, wenn ich am Geldautomaten die Knöpfe drücke, muss ich an diese Jamie denken, und daran, dass ich wahrscheinlich doppelt so viel Kohle hätte, wenn diese Göre mir nicht die Show gestohlen hätte. Dass Jamie Sowieso irgendwo in einem popligen Einkaufszentrum mein Geld ausgab, schicke Handtaschen und Schmuck und affiges teures Make-up kaufte, das sie auf ihr fettglänzendes Narbengesicht schmieren konnte. Total gemein, so was zu denken. Das wenigstens war mir klar.
Mit einem bühnenreifen Ächzen quälte ich mich endlich aus dem Bett und ging nach vorn. Ich wohne zur Miete in einem kleinen Backsteinbungalow in einer Ringstraße mit lauter kleinen Backsteinbungalows, auf einer Anhöhe, von der man auf den ehemaligen Viehhof von Kansas City blickt. Kansas City, Missouri, nicht Kansas City, Kansas. Das ist ein großer Unterschied.
Mein Viertel hat nicht mal einen Namen, es ist völlig in Vergessenheit geraten. Man nennt es ›Da Drüben‹. Oder ›Hier Entlang‹. Eine seltsame, zweitklassige Gegend, voller Sackgassen und Hundekacke. In den anderen Bungalows wohnen meist ältere Leute, die hier schon seit dem Bau der Häuschen leben. Mit grauen Puddinggesichtern sitzen sie hinter den Fliegengitterfenstern und starren hinaus, von früh bis spät. Manchmal gehen sie zu ihren Autos, vorsichtig, auf gebrechlichen Zehenspitzen, und wenn ich sie sehe, kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich sollte ihnen vielleicht helfen. Aber das würde ihnen wahrscheinlich nicht gefallen. Es sind keine freundlichen alten Leute, sondern wortkarge, verbitterte Senioren, denen es überhaupt nicht gefällt, dass ich hier eingezogen bin, ich, die Neue. Man spürt ihre Missbilligung im ganzen Viertel, es liegt in der Luft wie ein leises Summen. Dazu kommt noch der magere rote Hund zwei Häuser weiter, der tagsüber ständig bellt und nachts andauernd jault, ein Hintergrundlärm, von dem man nicht merkt, dass er einen wahnsinnig macht, bis er für ein paar glückliche Augenblicke aussetzt und dann sofort wieder anfängt. Das einzig fröhliche Geräusch in der Nachbarschaft verschlafe ich normalerweise: das Plappern und Lachen der Kinder, die jeden Morgen – pausbäckig und nach dem Zwiebelprinzip eingemummelt – zu einer Kindertagesstätte marschieren, die noch weiter in dem Rattennest von Straßen hinter mir versteckt liegt. Die erwachsene Begleitperson hält eine Schnur in einer Hand, an der die Knirpse sich festhalten, und so watscheln sie Morgen für Morgen im Gänsemarsch an meinem Haus vorbei. Aber ich habe sie noch kein einziges Mal zurückkommen sehen. Was mich anbelangt, könnten sie die ganze Welt umrunden, Hauptsache sie würden rechtzeitig zurückkehren, um am nächsten Morgen wieder unter meinem Fenster vorbeizutrotten. Wie auch immer – irgendwie hänge ich an ihnen. Es sind drei Mädchen und ein Junge, alle mit einer Vorliebe für leuchtend rote Jacken. Wenn ich sie nicht sehe, wenn ich verschlafe, bin ich tatsächlich geknickt. Noch geknickter als sonst. Dieses Wort würde meine Mom benutzen, nicht so etwas Dramatisches wie deprimiert. Ich bin seit vierundzwanzig Jahren geknickt.
Für das Treffen mit Jim Jeffreys zog ich Rock und Bluse an und fühlte mich dabei wie ein Zwerg, der in die Erwachsenenklamotten, das Zeug für große Mädchen, einfach nicht passte. Ich bin knapp eins fünfzig, eins siebenundvierzigeinhalb, um genau zu sein, aber ich runde lieber auf. Was dagegen? Ich bin einunddreißig, aber meine Mitmenschen neigen dazu, in einem kindischen Singsangton mit mir zu sprechen, als wollten sie mich fragen, ob ich gern mit Fingerfarben male.
Langsam schlenderte ich über den abschüssigen Unkrautrasen vor meinem Haus, und wie auf Kommando begann der rote Nachbarshund zu bellen. Auf dem Gehweg bei meinem Auto lagen die zermalmten Skelette zweier Vogelbabys, die mich mit ihren flachgedrückten Schnäbeln und Flügeln an kleine Reptilien erinnerten. Sie waren schon seit einem Jahr da. Aber ich konnte nicht anders, ich musste sie jedes Mal wieder anstarren, wenn ich ins Auto stieg. Eine Überschwemmung wäre nötig, um sie endlich wegzuwaschen.
Zwei ältere Frauen unterhielten sich vor einem Haus auf der anderen Straßenseite, und ich spürte, wie sie sich anstrengten, mich nicht zu sehen. Ich kenne hier niemanden mit Namen. Wenn eine dieser Frauen sterben würde, könnte ich nicht mal sagen: »Die arme alte Mrs Zalinsky ist tot.« Ich würde eher etwas wie: »Die fiese alte Zicke von gegenüber hat ins Gras gebissen« sagen.
Ich fühlte mich wie ein Kindergespenst, als ich in mein Allerwelts-Mittelklasse-Auto stieg, das mir vorkommt, als wäre es aus Plastik. Jeden Tag warte ich darauf, dass jemand vom Autohaus auftaucht und mir das Offensichtliche mitteilt: »Das Ding ist ein Witz. Damit kann man gar nicht fahren. Wir haben nur Spaß gemacht.« Wie in Trance fuhr ich die zehn Minuten zur Innenstadt, um Jim Jeffreys zu treffen, erreichte zwanzig Minuten zu spät den Parkplatz neben dem Steakhaus, wusste aber, dass er freundlich lächeln und kein Wort über meine Verspätung verlieren würde.
Er wollte immer, dass ich ihn auf dem Handy anrief, wenn ich da war, damit er mich abholen und zum Restaurant eskortieren konnte. Um das Restaurant herum – ein großes, altmodisches KC-Steakhaus – stehen nämlich lauter leerstehende Gebäude, und die machten ihm Sorgen. Als würde in den verlassenen Gemäuern eine Truppe von Vergewaltigern lauern und auf meine Ankunft warten. Jim Jeffreys will um keinen Preis derjenige sein, der zugelassen hat, dass jemand Libby Day etwas Böses antut. Nichts Böses darf unserem TAPFEREN BABY DAY, unserem LITTLE GIRL LOST, passieren, der armen rothaarigen Siebenjährigen mit den großen blauen Augen, die als Einzige das PRÄRIE-MASSAKER, das TEUFELSOPFER IM FARMHAUS, überlebt hat. Meine Mom, meine beiden großen Schwestern, alle von meinem Bruder Ben abgeschlachtet. Ich war als Einzige übrig geblieben und hatte ihn als den Mörder identifiziert. Ich war die kleine Süße, die diesen Teufelsanbeter, meinen Bruder, seiner gerechten Strafe zugeführt hatte. Ich war die Nachrichtensensation. Der »Enquirer« brachte mein tränenüberströmtes Foto auf der Titelseite mit der Schlagzeile EIN ENGELCHEN.
Ich schaute in den Rückspiegel und konnte das Babygesicht auch heute noch sehen. Die Sommersprossen waren etwas verblasst, die Zähne gerichtet, aber es war immer noch die gleiche Stupsnase, die gleichen kätzchenrunden Augen. Vor einiger Zeit hatte ich angefangen, mir die Haare weißblond zu färben, aber der rote Ansatz war schon wieder deutlich zu erkennen. Es sah aus, als würde meine Kopfhaut bluten, vor allem in der Spätnachmittagssonne. Irgendwie eklig. Ich zündete mir eine Zigarette an. Oft rauche ich monatelang überhaupt nicht, und dann fällt mir plötzlich ein, dass ich dringend eine Zigarette brauche. So bin ich eben. Labil.
»Na, dann mal los, Baby Day«, sagte ich laut. So nenne ich mich gern, wenn mir gerade alles verhasst ist.
Ich stieg aus und schlenderte rauchend auf das Restaurant zu. Die Zigarette hielt ich in der rechten Hand, damit ich die linke, die kaputte, nicht ansehen musste. Es war schon fast Abend: Wolken trieben wie Büffel in Rudeln über den Himmel, die Sonne stand tief und überschüttete alles mit ihrem rosa Licht. Richtung Fluss, zwischen den Auf- und Abfahrtschleifen des Highways, standen leere, seit langem unbenutzte Getreidesilos, schwarz und sinnlos.
Ganz allein überquerte ich den Parkplatz. Überall Glasscherben, aber niemand versuchte, mich zu überfallen. Schließlich war es gerade mal fünf Uhr nachmittags. Jim Jeffreys aß gern früh und war stolz darauf.
Als ich hereinkam, saß er an der Bar, schlürfte eine Limo und riss, genau wie ich es erwartet hatte, als Erstes sein Handy aus der Jackentasche und starrte es an, als hätte es ihn verraten.
»Hast du angerufen?«, fragte er.
»Nein, ich hab’s vergessen.«
Er lächelte. »Hmm, na ja. Aber ich bin froh, dass du da bist, Schätzchen. Was dagegen, wenn wir gleich Tacheles reden?«
Nachdem er zwei Dollarscheine auf den Tresen geklatscht hatte, manövrierte er uns zu einem Tisch mit einer roten Lederbank, aus deren Ritzen gelbes Polstermaterial hervorquoll. Der kaputte Bezug kratzte hinten an meinen Beinen, als ich mich setzte. Das Polster rülpste, und ein Schwall Zigarettengestank entwich in die Luft.
In meiner Anwesenheit trank Jim Jeffreys niemals Alkohol und fragte mich auch nie, ob ich welchen wollte, aber als der Kellner kam, bestellte ich ein Glas Rotwein und beobachtete ihn, wie er versuchte, nicht überrascht oder enttäuscht oder sonst wie nicht Jim-Jeffreys-gemäß auszusehen. Welchen Rotwein hätten Sie denn gerne?, wollte der Kellner wissen, aber ich hatte keine Ahnung – Weinnamen kann ich mir einfach nicht merken, egal ob rot oder weiß, und auch nicht, welchen Teil des Namens man laut aussprechen muss, deshalb antwortete ich einfach: Ihren Hauswein. Jim Jeffreys bestellte ein Steak, ich eine Backkartoffel mit doppelter Füllung. Sobald der Kellner verschwunden war, stieß Jim Jeffreys einen zahnarztartigen Seufzer aus und sagte: »Nun, Libby, für uns beginnt nun also eine ganz neue Phase.«
»Wie viel ist denn noch übrig?«, fragte ich und dachte sagzehntausendsagzehntausend.
»Liest du eigentlich die Belege, die ich dir zuschicke?«
»Manchmal schon«, log ich wieder. Ich bekam gern Post, hasste es aber, sie zu lesen; die Belege lagen wahrscheinlich auf einem Haufen irgendwo bei mir zu Hause.
»Hast du meine Nachrichten abgehört?«
»Ich glaube, dein Handy ist irgendwie kaputt. Es verschluckt dauernd was.« Ich hatte mir seine Botschaften lange genug angehört, um zu wissen, dass ich in Schwierigkeiten war. Normalerweise stellte ich nach Jeffreys’ erstem Satz den Anrufbeantworter ab. Hier ist dein Freund Jim Jeffreys, Libby …, lautete seine Standardeinleitung.
Jetzt legte er die Fingerspitzen aneinander und streckte die Unterlippe vor. »Es sind noch 982 Dollar und 12 Cent in deinem Fonds. Wie gesagt, wir hätten ihn erhalten können, wenn du regelmäßig gearbeitet und ihn immer wieder aufgefüllt hättest, aber …« Er warf die Hände in die Luft und verzog das Gesicht. »So ist es nun mal leider nicht.«
»Was ist mit dem Buch, hat das Buch nicht …?«
»Tut mir leid, Libby, aber nein, das Buch hat nicht funktioniert. Das sage ich dir jedes Jahr. Natürlich ist das nicht deine Schuld, aber das Buch … nein. Es hat nichts gebracht.«
Vor Jahren hatte ein Verlag, der Ratgeber veröffentlichte, mich gebeten, darüber zu schreiben, wie ich »die Geister meiner Vergangenheit« überwunden hätte. Zwar hatte ich eigentlich so gut wie gar nichts überwunden, aber ich erklärte mich trotzdem bereit, eine Frau in New Jersey anzurufen, die das eigentliche Schreiben erledigte. Zu Weihnachten 2002 erschien das Buch mit einem Coverfoto, das mich mit einem extrem unvorteilhaften zotteligen Haarschnitt zeigte. Es hatte den Titel Ein neuer Tag! Wie man ein Kindheitstrauma nicht nur überlebt, sondern über sich hinauswächst und enthielt einige Fotos aus meiner Kindheit, von mir und meiner toten Familie, eingebettet in zweihundert Seiten populärpsychologisches Gelaber. Ich bekam achttausend Dollar dafür, und ein paar Selbsthilfegruppen luden mich zu einem Vortrag ein. Ich flog nach Toledo zu einem Treffen mit einem Mann, der sehr jung Waise geworden war, ich flog nach Tulsa zu einer Versammlung von Teenagern, deren Mütter vom jeweiligen Vater ermordet worden waren. Ich signierte das Buch für Kids, die vor Aufregung kaum Luft bekamen und mir verstörende Fragen stellten, zum Beispiel, ob meine Mutter manchmal Kuchen gebacken hätte. Ich signierte das Buch für graue, bedürftige alte Männer, die mich durch ihre Bifokalbrillen anstarrten und aus dem Mund nach Kaffee und Magensäure stanken. »Jeder Tag ist ein guter Tag!« schrieb ich, oder: »Ein neuer Tag erwartet dich!« Und ich freute mich, dass mein Nachname »Tag« bedeutete. Die Menschen, die mich treffen wollten, sahen immer erschöpft und verzweifelt aus, standen unsicher in losen Trauben in meiner Nähe herum. Es kamen immer nur wenige. Als mir klarwurde, dass ich für diese Unternehmungen nicht einmal bezahlt wurde, weigerte ich mich, weiter mitzumachen. Das Buch hatte sich inzwischen ohnehin als Reinfall entpuppt.
»Ich finde, es hätte mehr Geld bringen müssen«, murmelte ich. Auf eine zwanghaft kindliche Art wünschte ich mir den Erfolg des Buches herbei – wenn ich es nur richtig wollte, musste es doch klappen. Es musste einfach!
»Ich weiß«, sagte Jim Jeffreys. Mehr fiel ihm nach sechs Jahren zu diesem Thema nicht mehr ein. Er sah zu, wie ich schweigend meinen Wein trank. »Aber in gewisser Weise beginnt für dich dadurch eine wirklich interessante Phase in deinem Leben. Ich meine, was möchtest du werden, wenn du groß bist?«
Mir war klar, dass seine Bemerkung charmant klingen sollte, aber mich machte sie nur wütend. Ich wollte nichts werden, das war ja gerade das Problem.
»Es ist also kein Geld mehr da?«
Jim Jeffreys schüttelte traurig den Kopf und begann, Salz auf sein soeben eingetroffenes Steak zu streuen, das in einer grellroten Blutpfütze lag.
»Wie wäre es mit einer neuen Spendenaktion? Bald ist der fünfundzwanzigste Jahrestag.« Wieder durchfuhr mich die Wut, darüber, dass er mich das laut aussprechen ließ. Ben hatte ungefähr um zwei Uhr morgens am 3. Januar 1985 mit dem Gemetzel begonnen, und hier saß ich nun und sehnte die Wiederkehr des Datums herbei. Wie konnte man so was nur sagen? Warum waren denn nicht wenigstens fünftausend Dollar übrig?
Doch Jim Jeffreys schüttelte wieder den Kopf. »Es ist nichts mehr zu machen, Libby. Wie alt bist du jetzt – dreißig? Eine erwachsene Frau. Für die Leute gehört das, was du erlebt hast, der Vergangenheit an, die Sache ist abgehakt. Jetzt wollen sie anderen kleinen Mädchen helfen, nicht …«
»Nicht mir.«
»Ja, ich fürchte, genauso ist es.«
»Die Leute haben die Vergangenheit abgehakt? Wirklich?« Auf einmal fühlte ich mich schrecklich allein, im Stich gelassen, so, wie ich mich als Kind immer gefühlt hatte, wenn wieder mal eine Tante oder ein Cousin mich bei einer anderen Tante oder einem anderen Cousin abgesetzt hatte: Ich bin fertig, jetzt bist du dran. Eine Woche lang war die neue Tante oder der neue Cousin dann meistens richtig nett, bemühte sich um mich kleines verbittertes Wesen, und dann … Na ja, gewöhnlich war es meine Schuld. Wirklich, das ist kein Opfergeschwätz. Beispielsweise versprühte ich im Wohnzimmer eines Cousins eine Dose Haarspray und setzte es dann in Brand. Meine Tante Diane, mein Vormund, die Schwester meiner Mutter, meine heißgeliebte Tante, nahm mich ein halbes Dutzend Mal auf, ehe sie die Tür endgültig zumachte. Ich habe dieser Frau ziemlich übel mitgespielt.
»Ich fürchte, es gibt immer wieder neue Morde, Libby«, dröhnte Jim Jeffreys weiter. »Die Menschen haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich meine, denk doch bloß mal daran, wie sie wegen Lisette Stephens durchdrehen.«
Lisette Stephens war eine hübsche brünette Zwanzigjährige, die auf dem Heimweg vom Thanksgiving-Dinner bei ihrer Familie einfach verschwand. Ganz Kansas City machte sich auf die Suche nach ihr – man konnte die Nachrichten nicht anstellen, ohne von ihrem Foto angelächelt zu werden. Anfang Februar, nachdem sich einen Monat lang in dem Fall nichts getan hatte, wurde ihr Verschwinden dann überregional bekannt gemacht. Lisette Stephens war tot, das war inzwischen allen klar, aber niemand wollte der Erste sein, der das Handtuch warf.
»Aber«, fuhr Jim Jeffreys fort, »ich glaube, alle würden sich freuen zu hören, dass es dir gutgeht.«
»Na toll.«
»Wie wäre es denn mit dem College?«, erkundigte er sich, während er einen Bissen Fleisch zermalmte.
»Nein.«
»Wie wäre es, wenn wir versuchen, einen Bürojob für dich zu finden, Aktensortieren und so weiter?«
»Nein.« Ich zog mich in mein Schneckenhaus zurück. Ignorierte mein Essen und verbreitete Trübsinn. Das war auch ein Wort, das meine Mutter gern benutzte: trübsinnig. Es bedeutete, dass man auf eine Art geknickt war, die andere Leute nervte. Ein aggressives Geknicktsein.
»Tja, warum nimmst du dir nicht einfach eine Woche Zeit und denkst mal drüber nach?« Jim Jeffreys verschlang den Rest seines Steaks mit energischen Gabelbewegungen. Jim Jeffreys wollte gehen. Jim Jeffreys war hier fertig.
Er verließ mich mit drei Briefen und einem Grinsen, das wohl aufmunternd wirken sollte. Drei Briefe, vermutlich alles Müll. Früher hatte Jim Jeffreys mir schuhkartonweise Post gebracht, und in den meisten Briefen waren Schecks. Die überschrieb ich ihm, und der edle Spender bekam einen Formbrief in meiner eckigen Handschrift. »Danke sehr für Ihre freundliche Spende. Menschen wie Sie helfen mir, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Mit freundliche Grüße, Libby Day.« Der grammatikalische Fehler war beabsichtigt, denn Jim Jeffreys glaubte, dass die Leute so etwas ergreifend fanden.
Aber die Zeiten der lukrativen Schuhkartons waren vorbei, ich hatte nur diese drei Briefe und den Rest des Abends totzuschlagen. Also machte ich mich auf den Heimweg, und mehrere Autos blendeten mich mit ihren Scheinwerfern, bis ich merkte, dass ich ohne Licht fuhr. Im Osten schimmerte die Skyline von Kansas City, eine bescheidene, mittelgroße Monopoly-Silhouette mit hier und dort einem spitzen Funkturm. Ich musste mir etwas einfallen lassen, womit ich Geld verdienen konnte. Etwas, was normale Erwachsene taten. Ich stellte mir mich mit Schwesternhäubchen und Thermometer vor. In einer schmucken Polizeiuniform, wie ich einem Kind über die Straße half. Mit Perlen und geblümter Schürze, wie ich für meinen Mann das Essen zubereitete. So verkorkst bist du, dachte ich. Deine Vorstellung vom Erwachsensein stammt immer noch aus Bilderbüchern. Und im gleichen Moment, als ich das dachte, sah ich vor mir, wie ich vor einer Horde Erstklässler mit Strahleaugen das Alphabet auf eine Tafel schrieb.
Ich versuchte, mir etwas Realistisches auszudenken – vielleicht etwas mit Computern? Dateneingabe – gab es nicht irgend so etwas als Job? Oder Kundenbetreuung. Ich hatte einen Film gesehen, in dem eine Frau ihren Lebensunterhalt damit verdiente, dass sie Hunde ausführte. Sie trug immer eine Latzhose und Twinsets, hatte Blumen in der Hand und wurde von den Hunden besabbert und geliebt. Allerdings mochte ich keine Hunde, sie machten mir Angst. Natürlich dachte ich schließlich auch an eine Farm. Schon über ein Jahrhundert waren meine Vorfahren Bauern gewesen, und auch meine Mom war Farmerin, bis Ben sie umbrachte. Nach ihrem Tod wurde die Farm verkauft.
Aber ich wüsste sowieso nicht, wie man eine Farm bewirtschaftete. Sicher, ich erinnerte mich noch an das Leben dort: Wie Ben durch den kalten Frühjahrsschlamm watete und Kälber scheuchte; wie meine Mom mit ihren rauen Händen in den Haufen kirschroter Körner griff, aus denen einmal Hirse werden würde; wie Michelle und Debby kreischten, wenn sie in der Scheune auf den Heuballen herumhüpften. »Das juckt!«, beklagte Debby sich immer und sprang dann gleich noch mal. Ich kann mich nie lange bei diesen Gedanken aufhalten, denn sie tragen ein besonderes Etikett, weil sie aus einer ganz gefährlichen Region stammen: Darkplace. Wenn ich mich zu lange bei dem Bild meiner Mutter aufhalte, wie sie versucht, die Kaffeemaschine wieder zusammenzubasteln, oder bei dem von Michelle, wie sie, die Socken bis zu den Knien hochgezogen, in ihrem Jerseynachthemd herumtanzt, dann bin ich mit einem Schlag in Darkplace. Grausig grellrote Geräuschfetzen in der Nacht. Das unerbittliche, rhythmische Schlagen der Axt, mechanisch, als würde sie Holz hacken. Gewehrschüsse in einem schmalen Korridor. Das panische Vogelgekreisch meiner Mutter, die versuchte, ihre Kinder zu retten, obwohl ihr Kopf nur noch zur Hälfte da war.
Was macht eine Verwaltungsangestellte?, fragte ich mich.
Ich hielt vor meinem Haus, stieg aus und trat auf ein Stück Gehweg, auf das jemand vor Urzeiten »Jimmy liebt Tina« in den Beton gekritzelt hatte. Manchmal stiegen Phantasiebilder in mir auf, was aus dem Paar geworden war: Er war Baseballspieler in der Minor League, sie kämpfte als Hausfrau in Pittsburgh gegen ihre Krebserkrankung. Er war ein geschiedener Feuerwehrmann, sie Anwältin und voriges Jahr vor der Golfküste ertrunken. Sie war Lehrerin, er war mit zwanzig durch ein Aneurysma tot umgefallen. Es war ein gutes, wenn auch grausames Gedankenspiel. Inzwischen hatte ich mir angewöhnt, mindestens einen der beiden sterben zu lassen.
Ich schaute zu meinem gemieteten Häuschen hinauf und überlegte, ob das Dach tatsächlich schief hing. Wenn das Ding einstürzte, würde ich nicht viel verlieren. Ich besaß nichts Wertvolles außer einem sehr alten Kater namens Buck, der mich tolerierte. Als ich die glitschigen, durchgebogenen Stufen betrat, hörte ich sein grollendes Maunzen aus dem Innern des Hauses, und mir wurde schlagartig klar, dass ich ihn heute noch nicht gefüttert hatte. Ich öffnete die Tür, und das greise Tier kam langsam und krumm auf mich zu, wie ein rostiges Auto mit einem kaputten Rad. Ich hatte kein Katzenfutter mehr – seit einer Woche stand es schon auf meiner Einkaufsliste –, deshalb holte ich ein paar Scheiben vertrockneten Schweizerkäse aus dem Kühlschrank und gab sie ihm. Dann setzte ich mich an den Tisch und öffnete die drei Briefe. Meine Finger rochen nach verdorbener Milch.
Gleich beim ersten Brief blieb ich hängen.
Liebe Ms Day,
ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie, denn anscheinend haben Sie keine Website. Ich habe viel über Sie gelesen und Ihre Geschichte in den letzten Jahren genau verfolgt. Nun interessiert es mich sehr, wie es Ihnen heute geht und was Sie machen. Treten Sie gelegentlich in der Öffentlichkeit auf? Ich bin Mitglied einer Gruppe, die Ihnen 500 Dollar bezahlen würde, wenn Sie einmal zu uns kommen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf, ich würde mich freuen, Ihnen nähere Informationen zu geben.
Mit freundlichen Grüßen
Lyle Wirth
PS: Es handelt sich um ein seriöses Angebot.
Strippen? Porno? Als damals das Buch herauskam, gab es auch einen Teil »Erwachsenenfotos von Baby Day«. Das denkwürdigste davon zeigt mich im Alter von siebzehn Jahren, mit wogendem, aus einem knappen billigen Haltertop hervorquellendem Busen. Daraufhin erhielt ich mehrere Angebote von zwielichtigen Nacktmagazinen, von denen mir aber keines so viel Geld anbot, dass ich in Versuchung geraten wäre, auch nur ernsthaft darüber nachzudenken. Fürs Ausziehen würden mir die in dem Brief angebotenen fünfhundert Dollar auch jetzt nicht reichen. Aber vielleicht – denk positiv, Baby Day!, – vielleicht war es ja tatsächlich ein seriöses Angebot, wieder so eine Trauergruppe, die meine Gegenwart als Vorwand brauchte, um über sich selbst zu reden. Fünfhundert für ein paar Stunden Sympathie waren ein erwägenswerter Tauschhandel.
Der Brief war getippt bis auf die Telefonnummer, die in einer markanten Handschrift mit Tinte unten auf der Seite vermerkt war. In der Hoffnung, einen Anrufbeantworter dranzukriegen, wählte ich die Nummer. Doch statt einer Maschine hörte ich zunächst nur grottentiefes Schweigen in der Leitung, dann wurde das Telefon abgehoben, aber niemand sagte etwas. Ich war ein bisschen verlegen, als hätte ich jemanden mitten in einer Party angerufen, von der ich nichts erfahren durfte.
Drei Sekunden verstrichen, dann ertönte eine Männerstimme: »Hallo?«
»Hi, spreche ich mit Lyle Wirth?« Buck strich um meine Beine und verlangte mehr Futter.
»Mit wem habe ich das Vergnügen?« Im Hintergrund immer noch ein großes lautes Nichts. Als wäre er auf dem Grund eines tiefen Lochs.
»Hier ist Libby Day. Sie haben mir geschrieben.«
»Ohhhh, na so was. Echt? Libby Day! Äh, wo sind Sie denn? In der Stadt?«
»In welcher Stadt?«
Der Mann – der Stimme nach könnte es auch ein Junge sein – rief jemandem hinter ihm etwas zu, aber ich verstand nur: »Die hab ich doch schon erledigt!«, und stöhnte mir dann ins Ohr.
»Sind Sie in Kansas City? Sie wohnen doch in Kansas City, oder nicht, Libby?«
Ich wollte schon auflegen, aber der Typ fing an, Hallooo? Hallooo? in den Hörer zu brüllen, als wäre ich ein verträumter Schüler. Also sagte ich ihm, dass ich tatsächlich in Kansas City wohnte, und fragte ihn, was er von mir wollte. Er antwortete mit einem Hehehe-Lachen, das wohl seine Begeisterung ausdrücken sollte.
»Tja, wie gesagt, ich wollte mit Ihnen über einen Auftritt sprechen.«
»Was soll ich denn dabei tun?«
»Na ja, ich bin in so einem speziellen Club … und nächste Woche haben wir ein spezielles Clubtreffen hier, und …«
»Was ist das für ein Club?«
»Na ja, er ist jedenfalls nicht nullachtfünfzehn. So ein bisschen eine Untergrund-Geschichte …«
Ich antwortete nicht und ließ ihn stottern. Nach dem großkotzigen Getue vom Anfang spürte ich jetzt, dass er sich unwohl fühlte. Gut.
»Ach Mist, ich kann das nicht am Telefon erklären. Kann ich Sie, äh, kann ich Sie vielleicht zum Kaffee einladen?«
»Es ist zu spät für einen Kaffee«, sagte ich, ehe mir klarwurde, dass er wahrscheinlich nicht heute meinte, sondern irgendwann in dieser Woche, und dann fragte ich mich wieder, wie ich die nächsten vier, fünf Stunden totschlagen sollte.
»Dann vielleicht ein Bier? Oder Wein?«, fragte er.
»Wann?«
Pause. »Heute Abend?«
Pause. »Na schön.«
Lyle Wirth sah aus wie ein Serienkiller. Was wahrscheinlich hieß, dass er keiner war. Wenn man Nutten zerhackte oder Ausreißer verspeiste, versuchte man ja eher normal auszusehen. Er saß an einem schmierigen Kartentisch mitten im Tim-Clark’s Grille, einer schwülen Spelunke direkt neben einem Flohmarkt. Tim-Clark’s war berühmt wegen seinem Barbecue, und wurde jetzt allmählich von der Schickeria vereinnahmt, so dass sich die Klientel aus einer unbehaglichen Mischung von angegrauten Stammkunden und schlapphaarigen Typen in Röhrenjeans zusammensetzte. Lyle passte zu keiner der beiden Gruppen: Er war Anfang zwanzig, mit welligen, mausbraunen Haaren, die er mit zu viel Gel an genau den falschen Stellen zu stylen versucht hatte. Er trug eine randlose Brille, einen engen Anorak von »Members Only« und Jeans, die zwar Röhrenjeans waren, aber nicht cool, sondern einfach nur eng. Seine Gesichtszüge waren zu fein, um bei einem Mann attraktiv zu wirken. Meiner Meinung nach sollten Männer keine Rosenlippen haben.
Unsere Blicke trafen sich gleich, als ich hereinkam. Zuerst erkannte er mich nicht, sondern taxierte mich nur. Doch kurz bevor ich seinen Tisch erreichte, fiel bei ihm der Groschen: die Sommersprossen, der Vögelchen-Körperbau, die Stupsnase, die umso stupsiger wurde, je länger man sie anstarrte.
»Libby!«, begann er, merkte, dass das zu vertraulich klang, und fügte schnell hinzu: »Day!« Dann stand er auf, zog einen der Klappstühle heraus, machte ein Gesicht, als bereute er seine Ritterlichkeit, und setzte sich wieder. »Sie sind ja blond.«
»Japp«, sagte ich. Mir sind Leute, die ein Gespräch mit Tatsachen beginnen, auf Anhieb unsympathisch – was soll man denn antworten? Heiß heute. Ja. Ich sah mich um, weil ich etwas bestellen wollte. Eine miniberockte Kellnerin mit einer üppigen schwarzen Haarmähne wandte uns ihre hübsche Rückseite zu. Ich trommelte mit den Fingern auf den Tisch, bis sie sich umdrehte und ich ihr Gesicht sah, das mindestens siebzig Jahre alt war, dick mit Make-up zugekleistert, das sich in ihren Falten staute, die Hände von lila Adern durchzogen. Irgendein Teil von ihr knarrte, als sie sich zu mir herunterbeugte, um meine Bestellung aufzunehmen, und sie schnaufte entrüstet, weil ich nur ein Bier wollte.
»Die Rinderbrust ist echt lecker hier«, sagte Lyle, obwohl auch er nur an den Überresten von etwas Milchigem nippte.
Ich esse kein Fleisch, seit ich mit angesehen habe, wie meine Familie abgeschlachtet wurde. Ich hatte noch genug damit zu tun, Jim Jeffreys und sein sehniges Steak aus dem Kopf zu kriegen. Also zuckte ich stumm die Achseln, wartete auf mein Bier und schaute mich in dem Laden um wie ein Tourist. Als Erstes fiel mir auf, dass Lyle schmutzige Fingernägel hatte. Dann entdeckte ich, dass die Perücke der alten Kellnerin schief saß: Strähnen ihrer verschwitzten weißen Naturhaare klebten ihr im Nacken. Während sie mit der einen Hand nach einer Ladung Pommes griff, die unter der Wärmelampe brutzelten, versuchte sie die verräterischen Haare mit der anderen zurückzustopfen. Am Nebentisch saß ein dicker Mann allein, futterte Rippchen und untersuchte sein Flohmarktschnäppchen, eine kitschige alte Vase mit einer Meerjungfrau. Seine Finger hinterließen Fettspuren auf den Brüsten der Meerjungfrau.
Wortlos stellte die Kellnerin mein Bier vor mir auf den Tisch und wandte sich dann dem Fetten zu, den sie mit »Schätzchen« anredete und dabei schnurrte wie eine Katze.
»Also, was ist das nun für ein Club?«, drängelte ich.
Lyle lief rosa an, und unter dem Tisch zitterten seine Knie.
»Na ja, manche Jungs spielen Phantasie-Football oder sammeln Baseball-Karten, richtig?« Ich nickte. Er stieß ein sonderbares Lachen aus und fuhr fort: »Frauen lesen Klatschmagazine und wissen alles über einen Schauspieler, wie sein Baby heißt oder die Stadt, in der er aufgewachsen ist, stimmt’s?«
Ich senkte leicht den Kopf, ein vorsichtiges Nicken.
»Na ja, und bei uns ist es so ähnlich, aber es ist … na ja, wir nennen es den Kill Club.«
Ich trank einen Schluck Bier und merkte, wie sich Schweißperlen auf meiner Nase bildeten.
»Es ist aber gar nicht so abgefahren, wie das jetzt vielleicht klingt.«
»Hört sich aber echt verdammt abgefahren an.«
»Manche Leute mögen Krimis, oder nicht? Oder finden True-crime-blogs toll. Na ja, aus solchen Leuten besteht der Club. Jeder interessiert sich für ein bestimmtes Verbrechen: Laci Peterson, Jeffrey MacDonald, Lizzie Borden … Sie und Ihre Familie. Ich meine, Sie und Ihre Familie stehen im Club total hoch im Kurs. Total. Mehr als JonBenét Ramsey.« Als er sah, dass ich das Gesicht verzog, fügte er schnell hinzu: »Eine echte Tragödie, was bei Ihnen passiert ist. Und Ihr Bruder sitzt im Gefängnis, wie lange schon? Bald fünfundzwanzig Jahre, nicht wahr?«
»Ben muss Ihnen nicht leidtun. Er hat meine Familie umgebracht.«
»Hmm, ja, richtig.« Er lutschte an einem Stück milchigen Eis herum. »Haben Sie jemals mit ihm darüber gesprochen?«
Ich merkte, wie meine Abwehrmechanismen aktiv wurden. Es gibt nämlich Leute, die behaupten, dass Ben unschuldig sei. Sie schicken mir Zeitungsartikel über Ben, die ich nie lese, sondern wegwerfe, sobald ich sein Foto sehe – mit seinen schulterlangen roten Haaren und dem strahlend friedvollen Gesicht die reinste Jesuskopie. Er geht jetzt auf die vierzig zu. In den ganzen Jahren habe ich meinen Bruder nie im Gefängnis besucht. Praktischerweise liegt das derzeitige am Rand unserer Heimatstadt – Kinnakee, Kansas –, dort, wo er die Morde begangen hat. Aber ich empfinde keine Nostalgie.
Die meisten Anhänger von Ben sind Frauen, mit großen Ohren und langen Zähnen, Hosenanzugliebhaberinnen, dauergewellt, wortkarg und mit Kruzifixen behangen. Gelegentlich stehen sie vor meiner Tür, starren mich aus unnatürlich glänzenden, beseelten Augen an und erzählen mir, dass meine Aussage falsch gewesen sei. Sie meinen, dass ich damals, als ich mit meinen sieben Jahren geschworen habe, dass mein Bruder meine Familie getötet hat, verwirrt gewesen sei, dass ich unter Druck gesetzt worden sei oder schlicht gelogen hätte. Oft schreien sie mich an, und sie sind entsetzlich hartnäckig. Ein paar haben mich sogar geohrfeigt. Wodurch sie noch weniger überzeugend wirkten: Eine rotgesichtige, hysterische Frau kann man leicht ignorieren, und ich suche immer nach einem guten Grund, jemanden nicht zu beachten.
Wenn sie netter zu mir gewesen wären, hätten sie mich vielleicht inzwischen überzeugt.
»Nein, ich spreche nicht mit Ben. Wenn es darum geht, bin ich nicht interessiert.«
»Nein, nein, nein, Sie brauchen einfach nur zu kommen, es ist so eine Art Kongress. Und wir löchern Sie mit unseren Fragen. Denken Sie wirklich nie an die Mordnacht?«
Darkplace.
»Nein, nie.«
»Vielleicht erfahren Sie ja etwas Interessantes. Es gibt da ein paar Fans … Experten, die über den Fall besser Bescheid wissen als die Polizei. Nicht dass das so schwierig wäre.«
»Dann sind es also Leute, die mich davon überzeugen wollen, dass Ben unschuldig ist.«
»Na ja … vielleicht. Aber vielleicht überzeugen Sie diese Leute auch vom Gegenteil.« In seiner Stimme glaubte ich einen Hauch Herablassung zu hören, und er beugte sich aufgeregt, mit angespannten Schultern zu mir über den Tisch.
»Ich verlange tausend Dollar für so einen Auftritt.«
»Ich könnte Ihnen siebenhundert geben.«
Ich schaute mich wieder im Raum um, ganz unverbindlich. Natürlich würde ich nehmen, was immer Lyle Wirth mir anbot, denn die Alternative war bekanntlich, dass ich mir einen richtigen Job suchen musste. Und dazu fühlte ich mich überhaupt nicht in der Lage. Ich bin nicht die Art Mensch, auf den man sich fünf Tage die Woche verlassen kann. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag? Manchmal schaffe ich es nicht, fünf Tage hintereinander aus dem Bett zu kommen. Ich denke ja nicht mal jeden Tag daran zu essen. Pünktlich bei einer Arbeitsstelle aufzutauchen, wo ich acht Stunden bleiben müsste – acht lange Stunden weg von zu Hause –, das war schlicht unvorstellbar.
»Na gut, dann eben siebenhundert«, sagte ich schließlich.
»Wunderbar. Es werden eine Menge Sammler da sein. Also bringen Sie alle Souvenirs mit, äh, Sachen aus Ihrer Kindheit, die Sie verkaufen möchten. Ich denke, Sie könnten ohne weiteres mit zweitausend Dollar rausmarschieren. Vor allem, wenn Sie Briefe haben. Je persönlicher, desto besser, klar. Alles möglichst nah am Datum der Morde, 3. Januar 1985.« Er betete das herunter, als hätte er das Gleiche schon oft gesagt. »Die Leute sind echt … echt fasziniert von Ihrer Mom.«
Das war schon immer so. Alle wollten eine Antwort auf die Frage: Was für eine Frau muss das sein, die von ihrem eigenen Sohn abgeschlachtet wird?
Patty Day
Er telefonierte wieder, sie konnte das Gemurmel seiner Stimme hinter der verschlossenen Tür hören. MuaMUAua, Geräusche wie aus einem Zeichentrickfilm. Er hatte einen eigenen Anschluss gewollt – die Hälfte seiner Mitschüler hätte einen eigenen Eintrag im Telefonbuch, behauptete er. Man nannte sie Kinderleitungen. Sie hatte gelacht und war dann sauer geworden, weil ihn ihr Lachen wütend gemacht hatte. (Also ernsthaft – eine Telefonleitung für Kinder? Wie verwöhnt waren die Kids denn heutzutage?) Sie hatten es beide nicht mehr erwähnt – ihnen wurde beiden schnell ein Thema unangenehm –, und dann war er ein paar Wochen später nach Hause gekommen, einfach so, und hatte ihr mit gesenktem Kopf eine Einkaufstüte präsentiert: Darin war ein Splitter, durch den man zwei Apparate an die gleiche Leitung anschließen konnte, und ein erstaunlich leichtes Plastiktelefon, das nicht viel anders aussah als das rosarote Ding, mit dem die Mädchen manchmal Sekretärin spielten. »Büro von Mr Benjamin Day«, meldeten sie sich immer und wollten den großen Bruder in ihr Spiel mit einbeziehen. Dann grinste Ben und sagte ihnen, sie sollten eine Nachricht für ihn aufnehmen. In letzter Zeit hatte er sie allerdings meistens ignoriert.
Seit Ben diesen Luxus eingeführt hatte, war der Ausruf »diese verdammte Telefonschnur« im Haus der Days zum geflügelten Wort geworden. Das Kabel wand sich vom Küchenanschluss über die Anrichte, den Flur hinunter und quetschte sich dann unter der stets geschlossenen Tür seines Zimmers durch. Mindestens einmal pro Tag stolperte jemand über die Schnur, gefolgt von einem Aufschrei (wenn es eins der Mädchen gewesen war) oder lautem Fluchen (bei Patty oder Ben). Schon mehrfach hatte sie ihn gebeten, das Kabel an der Wand zu befestigen, aber er machte es einfach nicht. Sie versuchte sich einzureden, dass das ganz normale Teenager-Sturheit war, aber bei Ben wirkte es irgendwie aggressiv, und sie machte sich Sorgen, dass er wütend oder faul oder noch etwas Schlimmeres war, was ihr noch nicht mal in den Sinn kam. Und mit wem redete er da eigentlich dauernd? Bevor der zweite Telefonanschluss so klammheimlich eingerichtet worden war, hatte Ben kaum je einen Anruf bekommen. Er hatte zwei gute Freunde, die Muehler-Brüder – angehende Farmer im Overall, Mitglieder der Bauernorganisation Future Farmers of America, die so schüchtern waren, dass sie manchmal wortlos auflegten, wenn Patty ans Telefon ging. Dann sagte sie Ben Bescheid, dass Jim oder Ed gerade angerufen hätte. Aber diese langen Gespräche hinter verschlossener Tür hatte es bislang nie gegeben.
Patty vermutete, dass ihr Sohn endlich eine Freundin gefunden hatte, aber wenn sie etwas in dieser Richtung andeutete, war das Ben offensichtlich extrem unangenehm – seine blasse Haut wurde weißblau, und seine bernsteinfarbenen Sommersprossen begannen geradezu zu glühen. Es wirkte fast wie eine Warnung, deshalb mied sie das Thema inzwischen. Sie war nicht die Art Mutter, die ihre Nase allzu tief in das Leben ihrer Kinder steckte – es war schwer genug für einen fünfzehnjährigen Jungen, in einem Haus voller Frauen die eigene Privatsphäre aufrechtzuerhalten. Als er eines Tages von der Schule heimgekommen war und Michelle dabei erwischt hatte, wie sie seine Schreibtischschubladen durchwühlte, hatte er ein Vorhängeschloss an seiner Tür angebracht. Auch bei der Installation des Schlosses hatte er den Rest der Familie vor vollendete Tatsachen gestellt: Ein paar Hammerschläge, und plötzlich war es da. Die Jungsdomäne, abgegrenzt und gut gesichert. Patty konnte ihm keinen Vorwurf daraus machen. Seit Runner sie verlassen hatte, war das Farmhaus sehr mädchenhaft geworden, Vorhänge, Sofas, sogar die Kerzen waren apricotfarben. Überall Spitze. Kleine rosa Schuhe, geblümte Unterwäsche und Haarspangen in Schubladen und Schränken. Bens seltene Behauptungsversuche – die ineinander verdrehte Telefonschnur und das metallische, männliche Vorhängeschloss – waren da doch mehr als verständlich.
Auf einmal hörte sie lautes Lachen aus seinem Zimmer, was ihr noch mehr auf die Nerven ging als das Gemurmel. Ben hatte nie viel gelacht, nicht mal als Kind. Mit acht hatte er seine Schwester kühl gemustert und verkündet: »Michelle hat einen Lachanfall«, als diagnostizierte er eine Krankheit, die dringend behandelt werden musste. Er war immer still gewesen, zurückhaltend, sogar verschlossen. Sein Vater wusste mit ihm nichts anzufangen; mal versuchte er mit ihm zu toben (wenn Runner mit ihm auf dem Boden herumrollte, machte Ben sich ganz steif und reagierte kaum), mal beschimpfte er ihn (wobei der Hauptvorwurf war, dass der Junge keinen Spaß verstand und sich sonderbar und zickig aufführte). Patty war nicht viel besser mit ihrem Sohn zurechtgekommen. Vor kurzem hatte sie sich ein Buch über die Erziehung von Teenagern gekauft, das sie unter ihrem Bett versteckte, als wäre es Pornographie. Der Autor riet den Eltern, mutig zu sein, Fragen zu stellen und Antworten von den Pubertierenden zu verlangen, aber Patty brachte das einfach nicht fertig. Zurzeit konnte man Ben manchmal schon mit einer Andeutung zum Explodieren bringen oder ein unerträglich lautes Schweigen provozieren. Je mehr sie ihn zu verstehen versuchte, desto mehr versteckte er sich. In seinem Zimmer. Wo er mit Menschen redete, die sie nicht kannte.
Auch ihre drei Töchter waren wach, schon seit Stunden. Eine Farm – selbst ihre jämmerliche, überschuldete, unterbewertete – verlangte, dass man früh aufstand, und die Routine hielt sich den ganzen Winter über. Jetzt spielten die Mädchen draußen im Schnee. Patty hatte sie hinausgescheucht wie ein Rudel Welpen, damit sie Ben nicht weckten, und sich geärgert, als sie seine Stimme am Telefon hörte und merkte, dass er längst auf war. Sie wusste, dass sie deshalb jetzt Pfannkuchen machte, das Lieblingsfrühstück der Mädchen. Gerechtigkeit. Ben und die Mädchen warfen ihr ständig vor, sie würde jemanden bevorzugen – entweder kam der Vorwurf von Ben, der dauernd Geduld mit den kleinen, herausgeputzten Kreaturen haben musste, oder von den Mädchen, die dauernd leise sein sollten, um ihren Bruder nicht zu stören. Mit ihren zehn Jahren war Michelle die älteste Tochter, Debby war neun und Libby sieben. (»Herrgott, Mom, du bist doch kein Kaninchen«, hörte sie Bens mahnende Stimme.) Sie spähte durch die dünne Gardine nach draußen, um die Mädchen unbemerkt zu beobachten: Michelle und Debby, Chefin und Assistentin, bauten eine Schneeburg, in deren Planung sie Libby wohlweislich erst gar nicht einbezogen hatten. Libby versuchte, sich einzubringen, doch die Schneebälle, Steine und Stöcke, die sie anschleppte, wurden kaum eines Blickes gewürdigt und sofort zurückgewiesen. Schließlich ging Libby in die Knie und heulte eine Weile, dann trat sie das Bauwerk kurzerhand kaputt. Patty wandte sich ab, denn sie wusste, dass als Nächstes Fäuste und Tränen kämen, und dafür war sie nicht in Stimmung.
Mit einem leisen Knarren öffnete sich Bens Tür, und an den schweren Schritten am anderen Ende des Flurs hörte sie, dass er mal wieder die schweren schwarzen Stiefel trug, die sie so leidenschaftlich hasste. Ignorier sie einfach, sagte sie sich. So redete sie sich auch immer gut zu, wenn er seine Tarnhose trug. (»Dad hat die auch immer angehabt«, hatte er geschmollt, als sie sich über seinen Aufzug beklagt hatte. »Zum Jagen, ja. Nur zum Jagen«, hatte sie gekontert.) Sie vermisste den Jungen, der früher am liebsten möglichst schlichte Klamotten getragen hatte, hauptsächlich Jeans und karierte Buttondown-Hemden. Den Jungen mit den dunkelroten Locken, der eine leidenschaftliche Begeisterung für Flugzeuge an den Tag legte. Und jetzt erschien er in der Küche mit einer schwarzen Jeansjacke, schwarzen Jeans und einer dicken Mütze, die er sich weit in die Stirn gezogen hatte. Er murmelte etwas und machte sich dann gleich auf den Weg zur Tür.
»Nicht vor dem Frühstück«, rief sie. Er hielt inne und wandte ihr lediglich das Profil zu.
»Ich hab ein paar Dinge zu erledigen.«
»In Ordnung, aber frühstücke doch erst mal mit uns.«
»Ich hasse Pfannkuchen. Das weißt du eigentlich.« Verdammt.
»Ich kann dir gern was anderes machen. Setz dich doch.« Gegen einen direkten Befehl würde er sich nicht auflehnen, oder? Sie starrten einander an, und Patty war kurz davor, klein beizugeben, als Ben einen tiefen Seufzer ausstieß und sich auf den nächstbesten Stuhl fallen ließ. Er begann mit dem Salzstreuer zu spielen, schüttete Salz auf den Tisch und fegte die Körnchen zu einem Häufchen zusammen. Um ein Haar hätte sie ihm gesagt, er sollte das lassen, aber sie biss sich in letzter Sekunde auf die Lippen. Für den Moment war sie froh, dass er am Tisch saß.
»Mit wem hast du denn telefoniert?«, fragte sie und goss ihm ein Glas Orangensaft ein, obwohl sie wusste, dass er es nicht anrühren würde, nur um sie zu ärgern.
»Mit ein paar Leuten.«
»Mit Leuten? Mehreren?«
Er zog die Augenbrauen hoch.
Die Fliegengittertür quietschte, kurz darauf knallte die Haustür gegen die Wand, und man hörte mehrere Stiefel auf die Fußmatte poltern – guterzogene Töchter, die keinen Schmutz ins Haus schleppten. Anscheinend hatte sich der Streit leicht schlichten lassen. Michelle und Debby kicherten schon wieder über irgendeinen Comic im Fernsehen. Libby marschierte herein, setzte sich auf einen Stuhl neben Ben und schüttelte sich die Schneereste aus den Haaren. Von den drei Mädchen beherrschte nur Libby die Kunst, Ben zu entwaffnen: Sie lächelte ihn von unten herauf an und winkte ihm kurz und freundlich zu.
»Hey, Libby«, sagte er, noch immer mit dem Salz beschäftigt.
»Hey, Ben. Ich mag deinen Salzberg.«
»Danke.«
Als dann jedoch die anderen beiden Mädchen die Küche betraten und mit ihren hellen, harten Stimmen auch die letzte Ecke ausfüllten, konnte Patty sehen, wie Ben sich wieder in sein Schneckenhaus zurückzog.
»Mom, Ben macht eine Sauerei«, rief Michelle denn auch sofort.
»Schon in Ordnung, Schätzchen. Die Pfannkuchen sind fast fertig. Eier, Ben?«
»Warum kriegt Ben Eier?«, heulte Michelle.
»Eier, Ben?«
»Ja.«
»Ich will auch Eier«, sagte Debby.
»Du magst doch überhaupt keine Eier«, fauchte Libby. Man konnte sich darauf verlassen, dass sie die Partei ihres Bruders ergriff. »Ben braucht Eier, weil er ein Junge ist. Ein Mann.«
Bei dieser Erklärung erschien der Hauch eines Lächelns auf Bens Gesicht, was wiederum Patty veranlasste, für Libby den schönsten, rundesten Pfannkuchen zu reservieren. Während die Eier in der Pfanne zischten, häufte sie die Pfannkuchen auf die Teller der Mädchen. Die Logistik des Frühstückzubereitens für fünf lief erstaunlich gut. Es waren die letzten Reste ordentliches Essen, noch übrig von Weihnachten, aber sie wollte sich deswegen jetzt keine Sorgen machen. Dafür war nach dem Frühstück noch genug Zeit.
»Mom, Debby hat die Ellbogen auf dem Tisch«, verkündete Michelle, immer noch in Herrscherlaune.
»Mom, Libby hat sich nicht die Hände gewaschen«, wieder Michelle.
»Hat keiner«, lachte Libby.
»Dreckspatz«, sagte Ben und knuffte sie spielerisch in die Seite. Aus irgendeinem Grund war das ein Witz zwischen ihnen. Patty wusste nicht, wie es angefangen hatte. Libby legte den Kopf in den Nacken und lachte lauter, ein Bühnenlachen, um Ben zu gefallen.
»Goldschatz«, kicherte sie dann – die übliche Antwort.
Patty seifte einen Lappen ein und reichte ihn herum, damit keiner aufzustehen brauchte. Dass Ben sich herabließ, eine seiner Schwestern zu necken, war eine Seltenheit, und sie hoffte die gute Laune erhalten zu können, wenn alle blieben, wo sie waren. Sie brauchte die entspannte Stimmung, wie man nach einer durchwachten Nacht den Schlaf braucht und den ganzen Tag davon träumt, sich endlich ins Bett legen zu können. Jeden Morgen wachte sie auf und gelobte hoch und heilig, sich von der Farm nicht so runterziehen zu lassen, sich vom Ruin des Hofs (sie war drei Jahre mit dem Kredit in Verzug, drei Jahre, ohne einen Silberstreif am Horizont) nicht in die Art Frau verwandeln zu lassen, die sie hasste: freudlos, verkniffen, unfähig, irgendetwas zu genießen. Jeden Morgen kniete sie sich auf den abgewetzten Teppich neben ihrem Bett und betete – genau genommen war es ein Schwur: Heute werde ich nicht rumbrüllen, heute werde ich nicht weinen, heute werde ich mich nicht ducken, als wartete ich auf einen Schlag, der mich endgültig zerstört. Ich werde mich an dem Tag heute freuen. Manchmal hielt sie durch bis zum Lunch. Jetzt waren alle sauber, alles war in Ordnung – bis Michelle wieder loslegte.
»Ben muss seine Mütze abnehmen.«
In der Familie hatte es immer die Regel gegeben, dass am Esstisch keine Kopfbedeckungen getragen wurden, eine so feste Regel, dass Patty überrascht war, sie überhaupt ansprechen zu müssen.
»Ja, Ben muss die Mütze abnehmen«, bestätigte Patty, ein sanftes Drängen in der Stimme.
Ben neigte den Kopf in ihre Richtung, und sofort wurde sie unruhig. Irgendetwas stimmte nicht. Seine Augenbrauen, normalerweise eine dünne rötliche Linie, waren schwarz, die Haut darunter dunkellila.
»Ben?«
Er nahm die Mütze ab, und darunter kam eine pechschwarze Haarkrone zum Vorschein, struppig wie ein alter Labrador. Es war ein Schock, als würde man Eiswasser zu schnell trinken – ihr rothaariger Junge war verschwunden, Ben hatte sein charakteristischstes Merkmal zerstört. Er sah älter aus. Fies. Als hätte der Typ, der hier vor ihr saß, den Ben, den Patty kannte, terrorisiert, bis er die Flucht ergriffen hatte.
Michelle schrie, Debby brach in Tränen aus.
»Ben, Schatz, warum hast du das gemacht?«, fragte Patty. Sie bemühte sich, nicht überzureagieren, tat aber genau das. Dieser dumme Teenagerstreich – denn genau das war es – löste bei ihr das Gefühl aus, dass es für ihre Beziehung zu ihrem Sohn keine Hoffnung mehr gab. Während Ben feixend vor sich auf den Tisch starrte und so der ganzen weiblichen Hysterie Kontra bot, suchte Patty nach einer Erklärung. Als Kind hatte Ben seine roten Haare gehasst und war deswegen oft gehänselt worden. Vielleicht war es also ein Akt der Selbstbehauptung. Etwas Positives. Andererseits hatte er die roten Haare von Patty geerbt – und sie soeben ausgelöscht. Wie konnte man das interpretieren, wenn nicht als Ablehnung? Libby, der einzige andere Rotschopf unter ihren Kindern, verstand es eindeutig so, denn sie zwirbelte eine Strähne ihrer roten Haare zwischen den Fingern und starrte sie traurig an.
»Na schön«, sagte Ben, schlürfte sein Ei und stand auf. »Genug Drama. Es sind ja nur Haare.«
»Aber deine Haare waren so hübsch.«
Er hielt inne, als würde er tatsächlich über ihre Bemerkung nachdenken. Dann aber schüttelte er den Kopf – ob über das, was sie gesagt hatte oder über den ganzen Morgen, wusste sie nicht – und marschierte zur Tür.
»Kriegt euch wieder ein«, rief er, ohne sich umzudrehen. »Bis später dann.«
Sie rechnete fest damit, dass er die Tür zuknallen würde, aber er schloss sie leise, was ihr irgendwie noch schlimmer vorkam. Patty blies sich den Pony aus der Stirn und sah sich am Tisch um, sah in all die weitaufgerissenen blauen Augen, die sie anstarrten und sich fragten, wie sie reagieren würde. Patty lächelte und stieß ein mattes Lachen aus.
»Tja, das war seltsam«, sagte sie. Das munterte die Mädchen ein wenig auf, und sie saßen schon etwas aufrechter auf ihren Stühlen.
»Er ist total seltsam«, fügte Michelle hinzu.
»Jetzt passen seine Haare zu seinen Klamotten«, meinte Debby und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen ab, während sie sich mit der Gabel einen Bissen Pfannkuchen in den Mund stopfte.
Libby starrte auf ihren Teller und ließ die Schultern zum Tisch sinken. Nur ein Kind schaffte es, so niedergeschlagen auszusehen.
»Ist schon gut, Libby«, sagte Patty und versuchte, ganz zwanglos ihren Arm zu tätscheln, ohne dass die anderen Mädchen gleich wieder zu zetern anfingen.
»Nein, es ist überhaupt nicht gut«, sagte sie. »Er hasst uns.«
Libby Day
Fünf Tage nach meinem Bier mit Lyle fuhr ich abends von meinem Haus die steile Straße hinunter, und immer weiter, bis ich in der Talsohle von Kansas Citys West Bottoms landete. In den Zeiten der großen Viehhöfe hatte das Viertel floriert und dann einige Jahrzehnte das Gegenteil durchgemacht. Jetzt bestimmten große, stille Backsteingebäude das Bild, auf denen noch die Namen der ehemaligen Firmen prangten: Raftery Cold Storage, London Beef, Dannhauser Cattle Trust. Einige wenige Gebäude waren zu professionellen Spukhäusern umfunktioniert worden, die in der Halloween-Saison in neuem Glanz erstrahlten: viergeschossige Rutschen, Vampirschlösser und besoffene Teenager, die in ihren Lederjacken Bierflaschen versteckten.
Doch jetzt, Anfang März, war es einfach nur einsam hier. Als ich durch die verlassenen Straßen fuhr, sah ich hier und dort jemanden ein Gebäude betreten oder verlassen, aber ich hatte keine Ahnung, zu welchem Zweck. In der Nähe des Missouri River wirkte die Gegend nicht mehr nur halbleer, sondern gespenstisch leer – eine guterhaltene Ruine.
Ich hatte einen unbehaglichen Kloß im Hals, als ich vor dem dreistöckigen Gebäude mit dem Schild »Tallman Corporation« parkte. Es war einer jener Momente, in denen ich mir wünschte, ich hätte mehr Freunde. Oder überhaupt Freunde. Ich hätte jemanden bei mir haben sollen. Oder wenn nicht, wenigstens jemanden, der darauf wartete, dass ich mich meldete. Aber ich hatte nur einen Zettel auf die Treppe in meinem Haus gelegt, auf dem stand, wo ich war, und Lyles Brief daran geheftet. Für den Fall, dass ich verschwand, hatten die Cops wenigstens einen Ansatzpunkt für ihre Suche. Wenn ich eine Freundin hätte, hätte sie vielleicht gesagt: Ich lass dich auf gar keinen Fall allein da hingehen, Süße – in diesem fürsorglichen Ton, den Frauen oft an sich haben.
Vielleicht aber auch nicht. Seit den Morden war ich permanent unsicher bei solchen Entscheidungen. Ich machte mich immer erst mal auf das Schlimmste gefasst, denn schließlich hatte ich das Schlimmste erlebt. Andererseits sagte ich mir, dass es doch äußerst unwahrscheinlich war, dass mir, der kleinen Libby Day, zu allem, was ich schon durchgemacht hatte, noch etwas Schreckliches zustoßen würde. War ich nicht schon genug gestraft? Eine glänzende, unanfechtbare statistische Erkenntnis, oder etwa nicht? Weil ich mich nicht entscheiden kann, schwanke ich zwischen drastischer Übervorsicht (ich lasse nachts immer das Licht an, und auf meinem Nachttisch liegt griffbereit der Colt Peacemaker meiner Mom) und lächerlicher Unvorsicht (ich gehe allein zu einem Kill Club in einem unbewohnten Gebäude).
Um ein paar Zentimeter größer zu wirken, hatte ich Stiefel mit Absätzen angezogen, von denen der rechte wesentlich lockerer saß als der linke, wo der Fuß kaputt ist. Am liebsten hätte ich mir alle Knochen gebrochen, nur um ein bisschen lockerer zu werden. Ich war dermaßen angespannt. So wütend, dass ich mit den Zähnen knirschte. Es war einfach nicht richtig, dass jemand so dringend Geld brauchte wie ich. Im Lauf des Tages hatte ich mir einzureden versucht, dass das, was ich tat, vollkommen unverfänglich und harmlos wäre, und hatte kurzfristig sogar an meine noblen Beweggründe geglaubt. Die Leute, mit denen ich mich traf, interessierten sich für meine Familie, ich war stolz auf meine Familie, und ich gewährte diesen Menschen Einblicke, die sie sonst von niemandem bekommen konnten. Und wenn sie mir dafür Geld anboten, würde ich es annehmen, dafür war ich mir nicht zu schade.